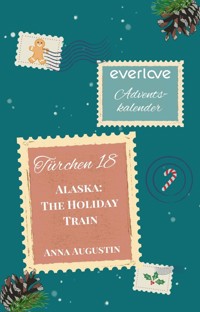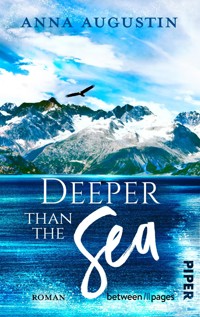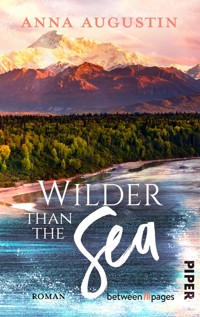
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Familie ist dort, wo dein Herz zuhause ist – eine berührende Enemies-to-Lovers Romance im wilden Alaska für Fans von Carina Schnell und Miriam Covi »Wenn Robin mich so ansah, wollte ich sie in meine Arme ziehen und in dem Gefühl von Wärme und Geborgenheit versinken. Dann wollte ich vergessen, dass ich eigentlich ganz allein war.« Nach ihrer Strafversetzung in das entlegene Alaska will die junge Coast Guard-Pilotin Robin so schnell wie möglich zurück zu ihrer kleinen Tochter. Doch der arrogante Rettungsschwimmer Kyle, mit dem sie seit der Schulzeit eine tiefe Feindschaft verbindet, verhagelt ihr jede Chance auf eine Strafverkürzung. Als Robins Tochter in den tiefen Wäldern Alaskas vermisst wird, müssen beide dennoch zusammenarbeiten, um sie zu retten. In der rauen Wildnis kochen alte Gefühle hoch – aber auch Ängste, die alles zerstören können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Wilder than the Sea« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Julia Feldbaum
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Info
Content Note
Widmung
Prolog – Kyle
1. Robin
2. Kyle
3. Robin
4. Kyle
5. Kyle
6. Robin
7. Robin
8. Kyle
9. Robin
10. Robin
11. Kyle
12. Robin
13. Kyle
14. Robin
15. Kyle
16. Robin
17. Robin
18. Kyle
19. Robin
20. Robin
21. Robin
22. Robin
23. Kyle
24. Kyle
25. Robin
26. Kyle
27. Kyle
28. Robin
29. Kyle
30. Robin
31. Kyle
32. Kyle
33. Kyle
34. Robin
35. Kyle
36. Robin
37. Robin
Epilog – Kyle
Danksagung
Triggerwarnung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Info
Für ein spoilerfreies Leseerlebnis empfehlen wir, die Reihe Alaskan Coast Guards in der richtigen Reihenfolge zu lesen:
Band 1: Stronger than the Sea
Band 2: Deeper than the Sea
Band 3: Wilder than the Sea
Content Note
In diesem Buch sind Themen enthalten, die triggernd wirken können. Am Ende des Buches findet sich eine Aufzählung, die jedoch den Verlauf der Geschichte spoilern kann.
Wir wünschen ein bestmögliches Leseerlebnis.
Widmung
Für alle Mütter, die viel zu oft an sich zweifeln.Eure Liebe ist genug.
Prolog – Kyle
Sechs Jahre zuvor
Die erste Seite aus meinem Tagebuch herauszureißen, kostete mich Überwindung. Es war wie mit dem Abziehen eines Pflasters. Man zögerte, betastete die ausgefransten Kanten, zupfte daran herum und verlor kurz den Mut, weil man wusste, dass es wehtun würde. Aber dieser Schmerz war notwendig, wenn man heilen oder einfach nur vergessen wollte – so wie ich.
Meine Hand zitterte, als ich das eng beschriebene Papier mit einem Ruck aus dem Einband heraustrennte. Ich knüllte es zusammen und warf mit ihm all die unsinnigen Worte ins Feuer. Flammendes Orange loderte auf und fraß sich durch Selbstmitleid und Schwäche, verkohlte Gedanken und eingeschlossene Tränen zu Asche und zehrte Erinnerungen auf, die ich nicht mehr haben wollte.
Mein Atem ging stoßweise, und der Rauch stach in meinen Augen, aber ich machte weiter, riss Seite um Seite aus diesem verfluchten Buch und verbrannte mit ihnen diesen jämmerlichen, naiven Teil von mir, der viel zu schnell und viel zu tief vertraut hatte. Ich ließ ihn in Flammen aufgehen, bis nur noch die Wut übrig blieb.
Wut auf mich und Wut auf sie. Wut auf mein verdammtes Herz, das immer noch stach und zog, wann immer ihr Gesicht vor meinem geistigen Auge auftauchte. Doch dann rief ich mir all die Lügen ins Gedächtnis, die unechten Glücksmomente, die falschen Worte.
Hast du wirklich geglaubt, irgendetwas davon wäre echt gewesen, Bradshaw?
Ich ballte die Faust, zerrte gleich mehrere Seiten auf einmal aus dem Einband und schmiss sie mit einem unterdrückten Schrei in die Feuerschale.
»Was machst du denn da, mein Schatz?«
Die erschrockene Stimme meiner Mom ertönte in meinem Rücken, aber ich drehte mich nicht zu ihr um. Stattdessen starrte ich weiter in die Flammen und warf immer mehr Worte und Hoffnungen in die lodernde Hitze, bis sie mir eine kühle Hand auf den Unterarm legte.
»Es tut mir so leid«, flüsterte sie, was den Rauch nur noch stärker in meinen Augen brennen ließ. Aber ich blinzelte dagegen an, weil Tränen sinnlos waren. Sie waren ein Zeichen der Schwäche, die ich in den letzten Monaten mit Mut verwechselt hatte, weil mich diese bescheuerte Verliebtheit geblendet hatte.
»Nein, mir tut es leid. Ich habe euch Kummer gemacht, weil ich vergessen habe, was wirklich wichtig ist. Aber das ist nun vorbei. Endgültig.«
Mit einem letzten Ruck riss ich das Pflaster ab und warf die Reste meines Tagebuchs ins Feuer – und mit ihm mein gebrochenes Herz.
1. Robin
Vibrierender Schmerz schoss von meinen Armen bis in meine Schulterblätter, als ich meine Fäuste hart und immer härter in das unnachgiebige Leder des Boxsacks trieb. Schweiß rann mir in Sturzbächen über Stirn und Nacken und brannte in meinen Augen, aber ich konnte jetzt keine Pause machen. Noch nicht. Vorher musste ich das brüllende Chaos in meinem Kopf mit Erschöpfung ersticken. Bleierne Müdigkeit sollte meine überlauten Gedanken überstrahlen und dafür sorgen, dass die allgegenwärtige Panik vor heute und morgen und den verdammten nächsten Monaten mir nicht länger den Brustkorb zusammenschnürte.
Mit jedem Schlag wurden meine Arme schwerer, meine Bewegungen langsamer – doch das Chaos blieb. Es hatte sich festgebissen, und daran war ich selbst schuld. Denn ich hatte es in mein Leben gelassen, weil ich immer noch nicht in der Lage war, aus meinen eigenen bescheuerten Fehlern zu lernen.
Wut auf mich und die Welt und das verdammte Schicksal jagte heiß und zerstörerisch durch meinen Körper und flutete meine Muskeln mit neuer Energie. Ich hieß sie willkommen, hüllte mich ein in ihre Kraft und legte sie an wie eine Rüstung – denn die Wut war lauter als die Erschöpfung und stärker als die Müdigkeit. Sie besaß die Macht, das Chaos in Schach zu halten.
»Meinst du nicht, dass es gerade Wichtigeres gibt als dieses sinnlose Eindreschen auf einen Boxsack?«
Die Stimme meiner Mutter ertönte in meinem Rücken, ruhig und beherrscht und doch so voller Tadel, dass ich zusammenzuckte, als hätte sie mich angeschrien. Ich wirbelte zu ihr herum und war mir im nächsten Moment mehr als bewusst, was für einen jämmerlichen Anblick ich bieten musste. Ich hatte mir nach dem Aufstehen nicht die Mühe gemacht zu duschen, sondern war nur mit einem ausgeleierten Schlafshirt und Shorts bekleidet in den Keller meines Elternhauses geflüchtet. Dort hatte mein Vater vor Jahren einen Fitnessraum ausgebaut, der schnell mein liebster Ort im ganzen Haus geworden war. Denn hier hatte ich meine Ruhe. Hier konnte ich durchatmen und für einen Moment vergessen, welches Horrorszenario in ein paar Stunden über mich hereinbrechen würde. Ein Horrorszenario, in das ich mich selbst hineinmanövriert hatte.
»Nyla hat dich beim Frühstück vermisst.« Meine Mutter machte einen Schritt in den Fitnessraum und hätte in ihren schwarzen Lackmokassins, dem zeitlosen Hosenanzug und der eleganten Hochsteckfrisur keinen schärferen Kontrast zu mir bilden können. »Ich bin davon ausgegangen, dass wir wenigstens an deinem letzten Tag zusammen am Tisch sitzen würden.«
»Ich wäre noch zu euch gestoßen. Vorher habe ich nur einen kurzen Augenblick für mich gebraucht«, erwiderte ich, zog mir die Boxhandschuhe von den Händen und schob mir hastig ein paar blonde Strähnen hinter die Ohren, damit ich nicht vollkommen derangiert aussah.
Meine Mom schnaubte, doch selbst dieses wenig damenhafte Geräusch tat ihrer ätherischen Erscheinung keinen Abbruch. »Dein ganzes Leben ist eine endlose Aneinanderreihung von Momenten, die du für dich allein hast. Doch wenigstens heute solltest du ein wenig Zeit für deine Tochter erübrigen, meinst du nicht? Sie sieht dich sowieso kaum, und jetzt hast du mit deinem Hitzkopf auch noch dafür gesorgt, dass du auf diese gottverlassene Insel versetzt wirst. Schieb endlich deinen Egoismus beiseite und verhalte dich wie eine erwachsene Frau, Robin. Und wie eine verantwortungsbewusste Mutter.«
Ihre Worte trafen mich härter, als ein Boxhieb es jemals gekonnt hätte. Zielsicher prasselten sie auf meine Schwachstellen, auf die wunden Punkte und kaum verheilten Narben ein. Sie schnürten mir die Kehle zu, den Brustkorb, das Herz, bis ich keine Luft mehr bekam. Denn sie hatte recht. Ich war eine miserable Mutter. Eine Mutter, die sich lieber in einen Helikopter setzte und raus in den Sturm flog, weil sie sich dort mutiger und sicherer fühlte als im Kinderzimmer ihrer eigenen Tochter.
Trotzdem würde ich mir den offensichtlichen Treffer nicht anmerken lassen. Lieber atmete ich tief in den Bauch und reckte das Kinn vor – denn Schwäche fühlen und Schwäche zeigen waren zwei Dinge, die ich strikt voneinander trennte. Schon immer und vor allem in Gegenwart meiner Mutter.
»Du weißt genau, dass ich, so oft es geht, versuche, von Astoria hierher zu euch zu kommen. Aber ich bin nun mal Pilotin bei der Coast Guard, Mom. Ich fliege Einsätze und habe Bereitschaftsdienste, damit ich Menschen in Not helfen kann. Gerade von dir hätte ich mehr Verständnis dafür erwartet. Schließlich warst du während meiner Kindheit auch mehr im OP-Saal als zu Hause bei Andrew und mir.«
Tiefes Rot durchbrach die vornehme Blässe ihrer Wangen. »Das kannst du nicht vergleichen. Deinem Bruder und dir hat es an nichts gefehlt. Es war immer mindestens ein Elternteil für euch da.«
»Und ihr seid für Nyla da, und dafür bin ich euch über alle Maßen dankbar«, erwiderte ich gepresst, während alles in mir schrie. Weil meine Mutter es schon wieder so klingen ließ, als wäre es ein Makel, ein Unglück, dass ich alleinerziehend war. Dabei wusste sie doch genau, dass wir nie eine vernünftigere Entscheidung getroffen hatten, als den Erzeuger meiner Tochter aus ihrem und meinem Leben rauszuhalten. Denn nur so hatte ich eine Chance gehabt, zu vergessen, zu heilen und zu lernen, dass ich keine Schuld daran trug, was mir zugestoßen war.
»Aber wir können ihr nicht die Mutter ersetzen, Robin.«
»Und das sollt ihr auch nicht. Wenn die Mindestdauer der Strafversetzung abgelaufen ist, dann …«
Ich stockte, denn meine Mutter stieß ein höhnisches Lachen aus.
»Dann wirst du einen neuen Grund finden, warum sie nicht bei dir wohnen kann. Du machst Nyla Hoffnungen – immer und immer wieder –, nur um dann doch zu kneifen, weil dir deine Freiheiten wichtiger sind. So bist du schon immer gewesen. Hauptsache, du kannst dich in irgendein Cockpit setzen und in der Weite des Himmels verschwinden.«
»Wie kannst du so etwas sagen?« Ein Zittern fuhr durch meinen Körper und fachte die Wut von Neuem an. Heiß und vertraut legte sie sich um mein schmerzendes Herz und ließ all die ungewollten Gefühle in einer Stichflamme aufgehen. »Denkst du wirklich, ich habe mir das ausgesucht? Denkst du, ich lasse meine Tochter freiwillig im Stich? Ausgerechnet für diese verfluchte Insel, auf der …«
Meine Stimme erstarb, als ein Name durch meine lodernde Rüstung aus Wut und Ohnmacht brach. Ein Name, den ich aus meinen Gedanken und meinen Erinnerungen gestrichen hatte, weil er sie mit Schmerz und unendlicher Enttäuschung vergiftete. Ein Name, der mich immer noch mit einer irrationalen Sehnsucht quälte, die toxisch und dumm und unerträglich war und sich trotzdem nicht aus meinem Herzen schneiden ließ.
Ich bekam keine Luft mehr, und mein Magen drehte sich um. Sterne explodierten vor meinen Augen. Keine Sekunde länger hielt ich es in diesem Raum aus.
»Jetzt werd’ doch nicht wieder melodramatisch«, hörte ich meine Mom noch rufen, doch da stürmte ich schon an ihr vorbei die Treppe nach oben und weiter den Flur mit der dunkelgrünen Seidentapete entlang. Meine nackten Füße flogen über den sündhaft teuren Parkettboden, während mein keuchender Atem zwischen den hohen Korridorwänden widerhallte. Wie spöttisches Gelächter drängte er sich zurück an mein Ohr, mischte sich mit den schneidenden Worten meiner Mutter und ließ meine Augen brennen.
Nicht heulen, Robin. Bloß nicht jetzt. Bloß nicht hier.
Ich lief auf die halb gewundene Treppe am Ende des Gangs zu, die in mein altes Jugendzimmer hochführte, lief vorbei am Esszimmer und den beiden Behandlungsräumen meines Dads. Die hatte er in einem Anflug von Nächstenliebe für Patienten eingerichtet, die sich einen Besuch in seiner Chefarzt-Sprechstunde am Seattle Medical Center nicht leisten konnten. Junge Familien. Senioren. Personen ohne Job oder festen Wohnsitz. Mein Vater wollte allen zeigen, dass er aus Überzeugung Arzt geworden war und nicht des Geldes wegen. Auch wenn Letzteres bei seinem Renommee nun mal nicht ausgeblieben war.
Ich stieß einen erstickten Laut aus, als die Tür zu Moms Bibliothek aufgezogen wurde und jemand direkt vor mir auf den Hausflur trat.
Andrew packte mich instinktiv bei den Schultern, bevor ich ihn über den Haufen rennen konnte.
»Langsam, Schwesterchen! Schon vergessen, auf dem Flur wird nicht gerannt. Auch dann nicht, wenn du mal wieder versuchst, vor deinem eigenen Leben davonzulaufen.« Mein Bruder stieß ein Lachen aus, das trotz der unverhohlenen Schadenfreude eine Spur besorgt klang.
Ich laufe nicht davon, wollte ich empört erwidern, doch da lenkte mich sein Blick ab, mit dem er an mir vorbei den Flur hinunterschaute.
»Warum siehst du aus, als wärst du auf der Flucht?«, wollte ich wissen.
»Weil ich mal wieder deinen Job übernehme, Robsie. Ich habe eben nicht nur mit deiner Tochter gefrühstückt, sondern spiele jetzt auch mit ihr Verstecken, weil ihre Mutter wie immer Besseres zu tun hat. Dabei habe ich eine Nachtschicht in der Klinik hinter mir und möchte eigentlich nur noch ins Bett. Aber im Gegensatz zu dir fällt es mir nicht so leicht, Nyla zu enttäuschen.«
Wie so oft trafen Andrews Spitzen mitten ins Schwarze, und die kaum verrauchte Wut in meiner Brust wollte mich zu einer hitzigen Antwort verführen. Sie wollte, dass ich meinen Zwillingsbruder als Ventil nutzte, um die verdammte Anspannung zu lindern – aber darauf wartete Andrew nur.
»Ich habe dich nicht darum gebeten, dich um Nyla zu kümmern«, sagte ich und reckte das Kinn vor.
»Natürlich hast du das nicht, weil du viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt warst. Du musst doch wahrscheinlich immer noch deine Wunden lecken, weil du es nicht verkraftest, dass die große Robin Sterling, die gefeierte Pilotin, einfach so auf eine kleine Insel im Nordpazifik abgeschoben wird, nicht wahr? Und das alles nur, weil deine Fliegerkollegen nicht damit klargekommen sind, dass du Brüste hast.« Er runzelte die Stirn, als würde er angestrengt nachdenken. »Oder warte, ich glaube, es lag doch eher daran, dass du deinem Copiloten in einem Anfall von Hysterie die Nase blutig geschlagen hast.«
Und noch ein zielsicherer Treffer. »Du hast ja keine Ahnung!«
»Wirklich nicht? Ich finde, das klingt schon sehr nach meinem hitzköpfigen Schwesterchen.«
Er besaß die Dreistigkeit, mir eine Hand auf die Schulter zu legen.
»Vielleicht kühlt dein neuerlicher Aufenthalt in Alaska dein Gemüt ja ein wenig ab und hilft dir dabei zu erkennen, was und vor allem wer in deinem Leben wirklich wichtig ist. In Fairbanks war es im Herbst ja immer schon recht frostig. Mit etwas Glück gibt es auch auf Kodiak bald Schnee und …«
»Spar dir deine geheuchelten Lebensweisheiten. Ich muss jetzt duschen«, zischte ich, bevor Andrew noch mehr sagen konnte, was ich nicht hören wollte, und schob mich an ihm vorbei in Richtung Treppe.
»Ach, Robsie? Eins noch«, rief er mir hinterher, als ich die Treppe schon halb nach oben gelaufen war. »Grüß mir doch unseren lieben Freund Kyle Bradshaw, wenn du auf Kodiak ankommst, ja? Ich bin mir sicher, er wird sich über alle Maßen freuen, dich wiederzusehen.«
Der Sarkasmus in seiner Stimme war zu viel. Dieser Name war zu viel. Er brachte das Brennen mit aller Macht zurück in meine Augen, in meine Brust und meinen ganzen Körper.
Scheiße!
Mit bebenden Knien stolperte ich die letzten Meter bis in mein Zimmer, rasend vor Wut auf meinen Bruder und blind vor Panik angesichts dessen, was mich auf Kodiak Island erwartete. Die gepackten Koffer neben meinem Bett nahm ich kaum wahr, als ich die Tür zum angrenzenden Badezimmer aufstieß, mir die Klamotten vom Leib riss und unter die Dusche sprang.
Ein gequälter Laut entfuhr meiner Kehle, als endlich heißes Wasser auf meinen Körper prasselte und diesen verfluchten Namen aus meinem System spülte. Ein erprobter Bewältigungsmechanismus, der jedes Mal funktionierte, wenn mich mein Gehirn mit unerwünschten Erinnerungen überrollte. Nur würde der mir auf Kodiak überhaupt nichts nützen. Ich konnte schließlich nicht jedes Mal unter die kochend heiße Dusche hechten, wenn jemand seinen Namen erwähnte – ganz zu schweigen davon, wenn ich ihm über den Weg lief. Was vermutlich ständig passieren würde …
Scheiße, Scheiße, Scheiße!
Ein eisiger Schauer jagte mir die Wirbelsäule hinunter. Hastig drehte ich den Wasserstrahl weiter auf, schrubbte über meine Haut, bis sie feuerrot war und verfluchte mich zum millionsten Mal für meine eigene Dummheit.
Warum hatte ich nicht einfach mal die Klappe halten können? Warum hatte ich die anzüglichen Kommentare meiner sogenannten Kollegen nicht einfach an mir abprallen lassen? Wann, verdammt noch mal, kapierte ich endlich, dass es am Ende sowieso immer auf mich zurückfiel? Und zwar mit voller Wucht und allen Konsequenzen.
Ich blieb unter der Dusche stehen, bis meine Hände schrumpelig waren und in meinem Kopf neue Gedanken Platz fanden, die kaum weniger angsteinflößend waren als die vorherigen. Denn wie ich es auch drehte und wendete, den Abschied von Nyla konnte ich nicht länger aufschieben. Zwar ging mein Flieger in Richtung Kodiak erst morgen früh, doch die letzte Nacht würde ich in einem Hotelzimmer am Flughafen verbringen. Auch wenn meine Mutter darin einen weiteren Beweis für meinen Egoismus sah, brauchte ich diese wenigen Stunden vor dem Abflug für mich allein, um mein Herz nach der Verabschiedung wieder zusammenzusetzen und für das zu wappnen, was auf der Insel auf mich wartete.
Als ich wieder nach unten kam, erfuhr ich von unserer Haushälterin, dass Nyla mittlerweile draußen im Garten spielte. Dort fand ich sie sonst eigentlich immer zwischen den orangen und pinken Chrysanthemen, die das weitläufige Grün hinter dem Haus mit bunten Farbtupfern durchbrachen, doch dieses Mal fehlte jede Spur von ihr. Auch auf der Schaukel war sie nicht, die mein Dad für sie am Ast eines kräftigen Ahornbaums hatte befestigen lassen, kaum dass sie sitzen konnte.
Ich schlang die Arme um meinen Oberkörper und unterdrückte ein Frösteln, als ich dem schmalen gepflasterten Weg durch die akribisch gepflegten Hochbeete meiner Mutter folgte, um in den hinteren Teil des Gartens zu gelangen. Dort ragten gleich mehrere üppige Sträucher und Laubbäume in die Höhe und bildeten nicht nur einen natürlichen Sichtschutz zum Nachbargrundstück, sondern waren auch der perfekte Ort, um weiterhin Verstecken zu spielen.
»Nyla?«, rief ich und blieb unschlüssig stehen. »Bist du hier irgendwo?« Meine Frage verhallte unbeantwortet zwischen den Baumkronen, wo bereits einzelne Blätter in einem satten Gelbton leuchteten. »Nyla?« Ich lief ein paar Schritte tiefer in das kleine Wäldchen hinein, bevor mir eine Idee kam. Ich stieß einen Pfiff aus – ein Trillern, das an das Gezwitscher eines Vogels erinnerte und das meine Tochter bei den Pfadfindern gelernt und mir beigebracht hatte. Sie hatte es »unseren Ruf« genannt, aber wir hatten ihn bisher noch nie ausprobiert, weil ich die letzten Wochen zu selten hier gewesen war.
Auf mein Pfeifen folgte rauschende Stille, und ich wollte schon wieder umkehren, als ein weiteres Trillern ertönte.
»Überraschung!« Ein vergnügtes Kinderlachen ertönte über mir.
Als ich den Blick hob, sah ich meinen Wirbelwind von Tochter mit wilden Locken und einem breiten Zahnlückengrinsen in einer Astgabel hocken.
»Wie findest du meinen neuen Lieblingsplatz?« Nyla umfasste zwei Äste mit ihren kleinen Händen und ließ ihren Oberkörper vor- und zurückschaukeln, dass die Blätter um sie herum nur so raschelten.
Mein Herz rutschte mir in die Kniekehlen. »Pass auf, dass du nicht fällst.« Ich eilte näher an den Baumstamm, tastete nach der Rinde, meine Hände mit einem Mal klatschnass und die Knie butterweich. Das Echo einer alten Angst hallte durch meinen Kopf.
Was, wenn sie stürzt? Was, wenn ich sie nicht fangen … nicht beschützen kann? Was, wenn ich schuld bin, dass ihr etwas zustößt?
»Ach, Mommy, du weißt doch, dass ich ein Profi bin.« Mit stolzgeschwellter Brust deutete Nyla auf ihr Pfadfinder-Outfit – ein beiges Hemd und khakifarbene Shorts – und die zahlreichen Abzeichen, die dicht an dicht auf eine Schärpe genäht worden waren. Wahrscheinlich von meiner Mutter. »Schau mal, ich hab letzte Woche sogar ein neues bekommen. Ich weiß jetzt, wie man Feuer macht.« Sie zeigte auf ein rundes Abzeichen mit einer stilisierten Flamme, und das glückliche Leuchten in ihren Augen war beinahe zu viel für mich.
»Das ist ja großartig. Da kannst du stolz auf dich sein, und ich bin es sowieso«, erwiderte ich und zwang mich, ihr Lächeln zu erwidern, obwohl mir zum Heulen zumute war. Dabei sollte ich eigentlich froh sein. Nyla war ein aufgewecktes Kind. Ein glückliches Mädchen, das ein Zuhause hatte – auch wenn dieses Zuhause bei seinen Großeltern war und nicht bei seiner Mom. Sie hatte sich mit der Situation arrangiert und überhäufte mich mit ihrer Liebe, obwohl ich sie so oft allein ließ.
»Du musst unbedingt raufkommen und dir meinen Lieblingsplatz anschauen!«
»Klettern ist nicht gerade meine Stärke, kleine Motte«, antwortete ich.
»Dann hab ich das vielleicht von meinem Daddy geerbt. Konnte er gut klettern?«
Nylas Frage wischte mir das Lächeln aus dem Gesicht. Seit gut zwei Jahren fing sie immer wieder von diesem Thema an. Vielleicht weil all ihre Freundinnen einen Daddy hatten – nur sie nicht. Vielleicht weil es sie beschäftigte, woher sie kam und was hätte sein können, wenn sie neben mir noch jemanden gehabt hätte, auf den sie sich mehr verlassen konnte.
Immer wieder wollte sie etwas über ihren Erzeuger wissen, und ich hatte mir nicht anders zu helfen gewusst, als sie anzulügen. In Nylas Vorstellungen waren Väter fürsorgliche Menschen, die mit ihren Kindern spielten und Quatsch machten und die dazugehörigen Mütter auf Händen trugen, und diese Illusion hatte ich ihr nicht nehmen wollen. Also hatte ich ihr erzählt, dass ihr Vater kurz nach ihrer Geburt gestorben war, weil diese Lüge weniger schmerzhaft war als die Wahrheit. Wie hätte ich meinem süßen Mädchen auch erklären sollen, dass sie das Ergebnis eines der schlimmsten Momente meines Lebens war.
»Das kann gut sein«, erwiderte ich ausweichend und streckte eine Hand nach meiner Tochter aus. »Sei so lieb und komm runter zu mir. Hier können wir besser miteinander sprechen und uns noch …« Ich stockte, und Nylas Gesichtsausdruck wurde mit einem Schlag ernst und viel zu erwachsen.
Eine Minute später stand sie endlich auf sicherem Boden und verschränkte die Arme hinter ihrem Rücken.
»Musst du schon los?«, fragte sie mit verräterisch bebender Unterlippe. Trotzdem rollten keine Tränen. Die behielt sie für sich. In dieser Hinsicht war Nyla mir erschreckend ähnlich.
Ich machte einen Schritt auf sie zu, wollte ihr eine Hand auf die Schulter legen oder ihr den Kopf tätscheln und tat es dann doch nicht. Weil ich nicht wusste, wie – so lächerlich sich das auch anhörte. Ich wusste nicht, wie ich meine eigene Tochter trösten sollte, und fühlte mich dabei wie eine absolute Versagerin.
»Ich fahre erst heute Abend. Aber ich dachte, bis dahin könnten wir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen.«
Ihre Miene erhellte sich, und im nächsten Moment taumelte ich rückwärts, als Nyla sich in meine Arme warf und ihr Gesicht gegen meinen Bauch drückte. Sie vergrub ihre Hände in meinem Pulli und hielt sich an mir fest, als wollte sie mich nie wieder loslassen.
»Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben?«, fragte sie in den weichen Stoff hinein. »Nur ein paar Tage?«
Mit einem Stein im Magen schloss ich die Arme um ihren zarten Körper und atmete gegen die Emotionen an, die mich in Stücke reißen wollten. »Wir sehen uns doch schon bald wieder. In zwei Wochen komme ich dich besuchen, und ich verspreche dir, dann feiern wir den besten Geburtstag, den du jemals hattest.«
»Okay«, erwiderte sie leise und atmete tief ein, genau so, wie ich es oft tat, wenn ich die aufsteigenden Tränen zurückkämpfte. »Ich werd’ dich trotzdem vermissen, Mommy. Jeden Tag und jede Minute.«
»Ich dich auch, kleine Motte.« Ich presste die Lippen auf ihre Stirn, sog ihren süßen Duft nach Erdbeershampoo und Blumen und Wald in meine Lunge und schloss ihn tief in meinem Herzen ein. »Aber wir werden das schaffen, hörst du? Ich werde alles daran setzen, so schnell wie möglich zurückzukommen, und dann hol ich dich zu mir. Dann kann uns nichts mehr trennen. Das verspreche ich dir.«
Die Worte hinterließen einen bitteren Nachgeschmack auf meiner Zunge, aber den vergaß ich sofort wieder, als Nyla den Kopf hob und mich mit glasigen Augen anstrahlte. Sie löste sich aus unserer Umarmung und zog einen schwarzen Filzstift aus der Brusttasche ihres Hemdes.
»Und bis es so weit ist, haben wir das hier.« Sie zog die Kappe des Stiftes ab und griff nach meiner Hand.
Mit zugeschnürter Kehle beobachtete ich, wie mein kleines Mädchen erst mir und dann sich selbst ein Herz auf die Innenseite des Handgelenks malte.
»Wofür ist das?«, fragte ich mit belegter Stimme.
»Die Mommy von Lisa macht das jeden Morgen, bevor sie Lisa zur Vorschule bringt.« Nyla schob den Stift zurück in ihre Brusttasche und hielt die perfekte kleine Zeichnung auf ihrem Handgelenk gegen meine. »Ihre Mommy sagt immer: Wenn wir uns vermissen, schauen wir einfach auf das Herz und denken ganz fest aneinander. Und schon sind wir nicht mehr allein. Das finde ich schön. Du auch?«
Ich konnte nichts sagen, konnte nicht atmen, konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Dieses Mal zog ich Nyla, ohne zu zögern, in meine Arme und erlaubte mir, die Schwäche, die ich fühlte, auch zu zeigen.
»Ja, ich auch.«
2. Kyle
Normalerweise wusste ich die Stille zu schätzen, doch heute dröhnte sie so laut in meinen Ohren, dass selbst das kreischende Mahlen der Kaffeemaschine sie nicht übertönen konnte. Seit dem Aufwachen brüllte sie mir ins Gesicht, weil all die typischen Geräusche fehlten, die zu diesem einen Tag im Jahr gehörten wie das Wellenrauschen zum Ozean.
Aufgeregte Schritte auf der Treppe. Geschirrgeklapper und das Piepen des Backofens. Joeys euphorisches Klopfen an meiner Zimmertür, gefolgt von den melodischen Klängen seiner Gitarre und dem verzückten Seufzen unserer Mutter, sobald meine Brüder und ich ein mehr oder weniger schiefes Happy Birthday für sie anstimmten.
Halbbrüder, berichtigte ich mich in Gedanken, und schon nahm die Stille einen versöhnlicheren Ton an. Schließlich war sie das beste Zeichen dafür, dass ich das Lügengeflecht, das sich meine Familie nannte, aus meinem Leben geschnitten hatte – und mit ihm den Mann, der mich dreiundzwanzig Jahre in dem Glauben gelassen hatte, ich sei sein Sohn. Den Mann, der mich dazu getrieben hatte, mein Leben danach auszurichten, ihn stolz zu machen. Medaillen, Urkunden, der Chief-Posten bei der Coast Guard – für all das hatte ich gekämpft, um einen Namen ins beste Licht zu rücken, der zwar ihm, aber nicht mir gehörte.
Doch damit war jetzt ein für alle Mal Schluss. Ich hatte mich von der ganzen Familienscheiße losgesagt und genoss es in vollen Zügen. Die Stille, den Frieden und die Freiheit, das zu tun, was ich tun wollte. Ohne Rücksicht auf irgendjemanden.
Heftiger als nötig zog ich die Tür des Kühlschranks auf, goss einen ordentlichen Schuss Hafermilch in meinen gerade durchgelaufenen Kaffee und warf einen Blick auf die digitale Zeitanzeige des Backofens. Zwanzig Minuten nach neun. Der Vater meiner Halbbrüder war sicherlich längst vom Geburtstagsfrühstück aufgestanden. Als Commander der Coast Guard hatte man schließlich seine Pflichten – und die konnten nicht warten. Doch Patrick und Joey würden noch ein Weilchen am Tisch sitzen bleiben, um mit einer weiteren Tasse Kaffee und Kakao auf den Ehrentag unserer Mutter anzustoßen.
Ich fragte mich, ob ihnen mein Fehlen in der Runde überhaupt noch auffiel. Schließlich entzog ich mich seit über einem Jahr jeglicher Familientreffen. Nur Joey war hin und wieder nach der Schule vorbeigekommen, um mich zu besuchen. Und Patrick lief ich wohl oder übel auf der Arbeit über den Weg. Schließlich war ich als Chief der Kodiak Coast Guard der direkte Vorgesetzte der Rettungsschwimmerstaffel, zu der auch er gehörte.
Mit meiner Mutter hatte ich hingegen kaum mehr als fünf Sätze gewechselt, seit herausgekommen war, dass sie mich mein Leben lang angelogen hatte. Mir fehlten einfach die Nerven für ihre Ausreden und Entschuldigungen, und ich wollte nicht, dass sie wieder von ihm anfing …
Ich spülte die aufkommenden Gedanken an meinen Erzeuger mit einem großen Schluck Kaffee hinunter, als das schrille Läuten der Türklingel durch das Haus echote.
Na endlich!
Ich stellte meine Tasse zurück auf die Arbeitsplatte, fuhr mir einmal durch das gescheitelte Haar und meißelte mir ein Lächeln auf die Lippen, das sich eher wie ein Zähnefletschen anfühlte.
Auf der Veranda stand eine hochgewachsene Frau um die fünfzig. Sie trug einen eleganten Wollmantel und strich sich immer wieder durch das silbergraue Haar, das wahrscheinlich einmal in sanften Wellen über ihre Schultern gefallen war. Doch die Nebelschwaden, die im September tief über Kodiak hingen, hatten ihre Frisur in ein kräuselndes Durcheinander verwandelt. Zu ihren Füßen standen zwei beachtliche Koffer, in denen sie mit Sicherheit ihr Fotoequipment aufbewahrte.
»Mr. Bradshaw, wie schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen«, sagte sie mit rauchiger Stimme und hielt mir ihre perfekt manikürten Finger entgegen.
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Mrs. Dearing.« Ich drückte ihre Hand kurz und fest, bevor ich einen Schritt zurückmachte, damit sie eintreten konnte. »Ich hoffe, Sie hatten trotz des bescheidenen Wetters einen guten Flug von Anchorage hierher.«
»Tatsächlich musste ich dem Piloten des Flugtaxis mehrmals gut zureden, damit er bei der eingeschränkten Sicht überhaupt abhebt. Aber ich wollte unser Treffen auf keinen Fall verschieben.« Ein Leuchten trat in ihre von einem dezenten Lidstrich betonten Augen. »Schließlich freue ich mich schon seit unserem ersten Telefonat darauf, Ihr Prachtstück von einem Haus in Augenschein zu nehmen. Die Fotos waren ja bereits sehr vielversprechend.«
Die offene Bewunderung in ihrer Stimme entfachte einen leisen Funken Stolz in meiner Brust. Vor über einem Jahr hatte ich den baufälligen Bungalow am Stadtrand von Kodiak gekauft und seitdem jede freie Minute in dessen Renovierung gesteckt, bis ich mit dem Ausbau so weit zufrieden gewesen war, dass ich Mrs. Dearings Maklerbüro kontaktiert hatte. Ihr Portfolio war mir sofort ins Auge gestochen, weil es genau in die Richtung ging, die ich beim Ausbau des alten Bungalows im Sinn gehabt hatte – und die hoffentlich auch ihre Kunden zu schätzen wussten. Rustikal, gemütlich, stilvoll. Viel Holz. Warme Töne. Lichtdurchflutete Räume.
»Dann will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen.« Mit einer knappen Geste bedeutete ich ihr, mir ins Wohnzimmer zu folgen.
Der Maklerin entfuhr ein verzücktes Seufzen, als sie den Blick durch den offenen Raum, über den abgeschliffenen Parkettboden und den gemauerten Kamin wandern ließ. Sie bestaunte die bodentiefen Fenster, den flauschigen Teppich und die ausladende Sofalandschaft mit den übertrieben vielen Kissen.
Mein Geschmack war das nicht. Aber das musste es auch nicht sein. Schließlich sollte sich hier einer von Mrs. Dearings Kunden zu Hause fühlen. Und nicht ich.
»Haben Sie das Haus wirklich ganz allein ausgebaut?«, wollte die Maklerin wissen und trat näher an die Wände heran, um den fachgerechten Auftrag der beigen Wandfarbe zu überprüfen.
»Es hat ein paar Monate in Anspruch genommen, aber ja, das meiste habe ich mit eigenen Händen renoviert und saniert.«
»Und Sie sind sich nach wie vor sicher, dass Sie verkaufen wollen? Bei all der Arbeit, die Sie in dieses Haus investiert haben?«
»Es war ein Projekt für mich. Nichts weiter«, erwiderte ich. »Und da ich das Projekt nun abgeschlossen habe, ist es an der Zeit, es für einen guten Preis zu verkaufen.«
Dass der Bungalow für mich mehr als nur ein Projekt gewesen war, behielt ich für mich. Was hatte es schon eine Maklerin zu interessieren, dass mich die Renovierungsarbeiten nach dem Bruch mit meiner sogenannten Familie vor dem Durchdrehen bewahrt hatten. Das Streichen und Tapezieren, das Abschleifen und Einrichten hatte mich beschäftigt gehalten – an dunklen Abenden, freien Wochenenden und endlos langen Urlaubstagen.
Mrs. Dearing sah mich einen Moment lang prüfend an, und ich setzte mein charmantestes Lächeln auf, damit sie sich mit meiner Erklärung zufriedengab.
»Wenn das so ist, würde ich gern direkt damit beginnen, Fotos für das Exposé zu schießen. In der Zwischenzeit …«, sie tastete nach ihrer Aktentasche und zog einen ledergebundenen Hefter hervor, »… machen Sie sich doch schon einmal mit meinen Preiskalkulationen vertraut. Natürlich beruhen diese vorerst nur auf den Eckdaten, die Sie mir im Vorfeld zur Verfügung gestellt haben. Aber das ist schon mal eine gute Diskussionsgrundlage.«
Sie reichte mir den Hefter, und ich zögerte, weil mich ein seltsam bohrendes Gefühl von Endgültigkeit durchzuckte. Dabei war der Verkauf des Bungalows bei Weitem nicht der letzte Schritt auf meiner Endlich weg aus Kodiak-Liste. Mir fehlte schließlich immer noch der unterschriebene Versetzungsantrag von Captain Reynolds. Aber auch das war hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit.
»Haben Sie denn schon ein neues Objekt im Blick, dem Sie sich als Nächstes widmen wollen? Wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen bestimmt etwas Passendes vermitteln«, bot Mrs. Dearing an, während sie mir in die Küche folgte.
»Nein, das hier war eine einmalige Sache.« Ein Mittel zum Zweck, eine Ablenkung und eine Möglichkeit, gutes Geld für einen Neuanfang zu verdienen. Weit weg von Kodiak und von allem, was mir Tag für Tag mehr die Luft abschnürte.
»Dann kann ich ja von Glück sprechen, dass Sie mich mit dem Verkauf dieses Schmuckstücks betraut haben und keinen Makler hier von der Insel.«
Ich zog einen Stuhl zurück und setzte mich an den Esstisch. Den Hefter legte ich vor mich hin, ohne ihn aufzuschlagen. »Ich wollte den Verkauf nicht an die große Glocke hängen.«
Hätte ich jemanden von der Insel beauftragt, hätte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet und jeglichen Spekulationen über meine Beweggründe Tür und Tor geöffnet. Es hätte keine Stunde gedauert, und ganz Kodiak wäre bis ins kleinste Detail informiert gewesen. So lief das in Kleinstädten nun einmal ab. Entdeckten die Einwohner etwas, was sie auch nur ansatzweise von ihrem eigenen bedauernswerten Leben ablenkte, verbissen sie sich darin wie Hyänen in einem Stück Aas. Und dieses Stück Aas trug seit Monaten meinen Namen: Kyle Bradshaw – das Produkt eines dummen Fehlers. Der lebende Beweis dafür, dass die sonst so rechtschaffene Madeleine Bradshaw ihrem Ehemann Hörner aufgesetzt hatte. Und nicht nur das. Ich war auch noch der unerwünschte Makel auf dem sonst so blütenweißen Andenken von Thomas Chadwick, dem mutigen Rettungsschwimmer, den jeder seit seinem heldenhaften Tod schmerzlich vermisste. Jeder außer mir.
Ich hatte die Schnauze voll davon, das Thema Nummer eins der abendlichen Stammtischrunden oder der kurzen Schwätzchen im Supermarkt zu sein. Ich ertrug das Getuschel hinter vorgehaltener Hand nicht länger, ebenso wenig wie die neugierigen Blicke und aufdringlichen Fragen. Doch am allermeisten kotzte mich das Mitleid an, das betroffene Kopfschütteln, das übergriffige Schulterklopfen. Ich wollte nicht mehr, dass die Leute sich auf der Straße nach mir umdrehten und jeder – wirklich jeder! – Dinge über mich wusste, die ich selbst nur noch vergessen wollte.
Das Klicken von Mrs. Dearings Kamera durchbrach meine düsteren Gedanken, und ich zwang mich dazu, endlich den Hefter vor mir aufzuschlagen. Dearing Immobilien stand in geschwungenen Buchstaben ganz oben auf dem Briefbogen, umrahmt von der stilisierten Silhouette einer Skyline, doch mich interessierte nur die Zahl, die ganz unten auf der Seite zu lesen war. Erleichtert stellte ich fest, dass sie meine Erwartungen sogar noch übertraf. Damit ließ sich ohne Probleme ein neues Leben fern dieses verdammten Trümmerhaufens beginnen.
»Mr. Bradshaw?«, rief Mrs. Dearing aus dem Flur. »Eine der Zimmertüren ist abgeschlossen. Wären Sie so gut, sie für mich zu öffnen?«
Die Erleichterung erlosch wie die Flamme eines Streichholzes inmitten eines aufziehenden Orkans. Hastig schob ich den Stuhl nach hinten und eilte zu Mrs. Dearing, deren Hand immer noch auf der Türklinke zu dem Raum ruhte, den ich nicht ohne Grund verschlossen hielt.
Ich räusperte mich, um den Knoten in meiner Kehle zu lösen. »Dieses Zimmer ist noch nicht vollständig renoviert«, erklärte ich und war mir des panischen Untertons in meiner Stimme nur allzu bewusst. Beim Anblick der Eichenholztür schoben sich ungefragt Bilder vor mein geistiges Auge. Ein umgekipptes Bücherregal, Urkunden hinter zersplittertem Glas, vergilbte Umzugskartons, vollgestopft mit verhassten Erinnerungen. Und dazwischen lagen sie verstreut: einundzwanzig Briefe, die ich vor einem Jahr in blinder Wut auf den Boden geschleudert hatte, weil sie der hässlichen Wahrheit über meine Existenz die Krone aufgesetzt hatten. Seitdem hatte ich mehr als einmal den Entschluss gefasst, sie wegzuwerfen, zu zerreißen und zu verbrennen, doch ich hatte es nicht über mich gebracht. Weil mir die Courage fehlte, die Briefumschläge in die Hand zu nehmen und auf jedem einzelnen von ihnen diesen verfluchten Schriftzug zu lesen: In Liebe für K.
In Liebe – was für eine Heuchelei!
»Gar kein Problem«, erwiderte Mrs. Dearing und sah mich weiterhin auffordernd an. »Ich werfe nur einen kurzen Blick hinein und …«
»Nein!«, rief ich mit Nachdruck und schob schnell ein Lächeln hinterher, das hoffentlich nicht so gequält aussah, wie es sich anfühlte. »Ich meine, wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich die Arbeiten dort drin erst zu Ende führen und Ihnen dann die Fotos nachliefern.«
Mrs. Dearing runzelte die Stirn, nickte dann aber doch. Sie trat einen Schritt von der Tür zurück, und ich musste mich sehr beherrschen, nicht erleichtert auszuatmen.
Die Maklerin blieb zwei weitere Stunden, bis sie alle Fotos und ein Video mit einer Roomtour im Kasten hatte und wir uns über den Verkaufspreis einig geworden waren, den sie ihren Kunden vorschlagen würde. Den Termin konnte man als vollen Erfolg verbuchen, denn er brachte mich meinem Ziel ein großes Stück näher – auch wenn sich diese Tatsache nicht ganz so befreiend anfühlte, wie ich gehofft hatte.
»Ich melde mich dann zeitnah mit dem fertigen Exposé für die Verkaufsanzeige. Und vergessen Sie nicht, mir die fehlenden Bilder nachzusenden, damit ich mit der Bewerbung Ihres Hauses beginnen kann«, sagte Mrs. Dearing, als wir uns zum Abschied im Flur die Hände schüttelten.
Dann war ich wieder allein mit der Stille, die geduldig in den dunklen Ecken auf mich gewartet hatte. Sie brachte mich dazu, den Blick erneut auf die Tür zu richten, die ich wohl oder übel würde öffnen müssen. Bald schon. Aber nicht heute. Auf gar keinen Fall heute.
Das Klingeln meines Handys schallte aus der Küche in den Flur und verwies die Stille zumindest kurz auf ihren Platz.
Der Anruf kam von der Air Station, dem Stützpunkt der Kodiak Coast Guard, was mich einen Moment irritiert innehalten ließ. Schließlich begann meine Schicht sowieso in etwas mehr als einer Stunde. Was also war so dringend, dass es nicht bis Dienstantritt warten konnte, aber wiederum nicht dringend genug, um mich über meinen Pager anzupiepsen?
Ich hob das Handy an mein Ohr. »Bradshaw?«
»Chief Bradshaw, hier spricht Petty Officer West«, ertönte eine tiefe, ruhige Stimme am anderen Ende. »Schön, dass ich Sie direkt erreiche.«
»Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Officer?«
»Es geht um Ihren Versetzungsantrag.«
Mein Herz sprang mir von der Brust bis in den Hals.
»Hat der Captain ihm stattgegeben?«, wollte ich wissen, während das Blut so laut in meinen Ohren rauschte, dass ich befürchtete, das erlösende Ja zu verpassen.
»Der Captain möchte Sie diesbezüglich noch vor Dienstbeginn sprechen. Können Sie bis dreizehn Uhr da sein?«
3. Robin
Mein Nacken fühlte sich an, als steckte er in einem Schraubstock, als ich mich bepackt mit meinem Reiserucksack und zwei Rollkoffern von der Gepäckausgabe in Richtung Ankunftshalle schleppte.
Auf dem dreieinhalbstündigen Flug von Seattle nach Anchorage war ich nach einer schlaflosen Nacht im Hotel immer wieder in den unbequemsten Positionen eingenickt, was sich nun mit Verspannungen und hämmernden Kopfschmerzen rächte. Kopfschmerzen, die sich nur mit einer ordentlichen Mütze Schlaf bekämpfen lassen würden. Doch die lag in genauso unerreichbarer Ferne wie das Ende der Milchstraße. Also würde ich mich die nächsten Monate wohl oder übel an das dumpfe Pochen hinter meiner Stirn gewöhnen müssen, denn in Kodiak konnte ich wohl kaum mit viel Ruhe rechnen. Dafür surrte die Anspannung viel zu laut durch meinen Körper, und ich wusste, dass dieses Gefühl erst nachlassen würde, wenn ich wieder mindestens tausend Meilen zwischen mich und diese Insel gebracht hatte.
Zusammen mit zahlreichen anderen Reisenden erreichte ich die Ankunftshalle, wo uns eine kleine Menschentraube empfing. Einige Wartende stießen freudige Rufe raus und drängten sich den Ankommenden mit ausgebreiteten Armen entgegen. Andere riefen laut irgendwelche Namen und winkten wie verrückt. Ein Reisender ließ seinen Kofferwagen direkt vor meinen Füßen stehen, um einer Frau mit roten Locken entgegenzulaufen und sie unter übertriebenem Jauchzen durch die Luft zu wirbeln.
Meine Güte!
Ich unterdrückte ein genervtes Schnauben, lief um den Wagen herum und hielt Ausschau nach dem Piloten des Flugtaxis, das die Coast Guard für mich organisiert hatte. In all der Aufregung hatte ich vergessen zu fragen, woran ich ihn erkennen würde. Doch da stach mir der Schriftzug schon ins Auge: Lt. Robin Sterling.
Soweit es der Reiserucksack zuließ, zog ich die Schultern zurück und drückte den Rücken durch. Ich hoffte, dass meine Uniform durch den Flug nicht zu viele Knitterfalten davongetragen hatte, und stülpte die stoische Maske meines Piloten-Ichs über die wachsende Panik in meinem Inneren.
Mit ausgreifenden Schritten hielt ich auf das Schild zu und stutzte, als mein Blick auf die junge Frau fiel, die es in der Hand hielt.
Schwarze Locken umrahmten ihr freundliches Gesicht. Sie trug Jeans und eine verwaschene Lederjacke – und sie war nicht allein. Neben ihr standen zwei Coast Guards in dunkelblauen Overalls, groß und mit muskulösen Armen, die sie wie Bodyguards vor der Brust verschränkt hatten. Einer der beiden hatte immerhin ein verschmitztes Grinsen auf den Lippen, doch der andere ließ den Blick fast schon grimmig über die Gesichter der Ankommenden schweifen.
Glaubte die Coast Guard etwa, ich würde mich dagegen sträuben, in das Flugtaxi zu steigen, und schickte deswegen gleich zwei ihrer breitschultrigen Supermänner? Damit ich auch ja keinen Widerstand leistete?
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, traf mich der Blick der schwarzhaarigen Frau, und ihre Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln.
»Lieutenant Sterling?«, fragte sie, doch ich kam gar nicht dazu zu antworten, denn da nahmen die Frau und ihre beiden Kollegen bereits Haltung an.
Sofort richteten sich mehrere Augenpaare auf uns, und die überschwänglichen Willkommensrufe wichen neugierigem Getuschel. Peinlich berührt bedeutete ich den dreien, bequem zu stehen, bevor noch einer der Umstehenden auf die Idee kam, sein Handy zu zücken und mein verdattertes Gesicht für die Ewigkeit festzuhalten.
»Wow, mit einem Empfangskomitee habe ich gar nicht gerechnet«, sagte ich und hätte mir am liebsten auf die Zunge gebissen, weil meine Stimme auf einmal erschreckende Ähnlichkeit mit der von Micky Maus hatte.
»Daran werden Sie sich gewöhnen müssen, Lieutenant, denn die beste Crew von Kodiak gibt es nur im Komplettpaket.« Das Lachen der schwarzhaarigen Frau klang rau, echt und ansteckend. Sie streckte mir ihre Hand entgegen. »Hi, ich bin Lieutenant Taya Williams, und wir zwei teilen uns ab sofort ein Cockpit.«
»Wirklich?«, entgegnete ich voller freudiger Überraschung, denn eine Copilotin hatte ich in meiner neuen Crew nicht erwartet. Am Stützpunkt Astoria war ich stets Einzelkämpferin in einem Minenfeld aus fragilen Männeregos gewesen. Schnell hatte man mir das Image des bockigen Mädchens aufgedrückt, das nicht einsehen wollte, dass es viel zu schwach, zu emotional und zu hysterisch war, um bei den großen Jungs mitzuspielen. Die ehrgeizige Frau, die verdammt viel geopfert hatte, um Pilotin bei der U. S. Coast Guard zu werden, hatte keiner von ihnen sehen wollen. Trotz meines hart erkämpften Ranges war ich immer nur »das Mädchen« geblieben – egal, wie sehr ich auch versucht hatte, sie vom Gegenteil zu überzeugen.
Ich schob die bitteren Gedanken beiseite und erwiderte den festen Händedruck meiner zukünftigen Copilotin. »Freut mich sehr, Taya. Ich bin Robin. Gern ohne das sperrige Lieutenant, wenn das für euch in Ordnung ist.«
»Ist gebongt, Boss.« Der Bodyguard mit dem verschmitzten Grinsen trat neben Taya und hielt mir ebenfalls die Hand hin. »Hi, ich bin Scott und ab sofort dein Bordmechaniker und Ansprechpartner für alles rund um die Jayhawk-Helikopter.«
»Hi, Scott.«
Ich erwiderte sein Grinsen, bevor mein Blick zu dem letzten Crewmitglied wanderte – dem Rettungsschwimmer, wie ich annahm. Sein vorhin noch grimmiger Gesichtsausdruck war einem überraschend warmen Lächeln gewichen, und ich wollte ihn ebenfalls begrüßen, als mir der aufgestickte Namenszug auf seiner rechten Brust auffiel: Bradshaw.
Ein Beben fuhr durch meinen Körper, erschütterte meine Beine, meinen Bauch und mein verdammtes Herz. Es rüttelte an jedem Zentimeter, jeder Zelle und legte Worte frei. Worte auf welligem Papier, die so lange in meinem Gedächtnis verschüttet gewesen waren, dass ich dachte, sie längst vergessen zu haben. Doch sie waren noch da und stachen und brannten auf meiner Haut und in meiner Kehle: Ich sollte mich längst daran gewöhnt haben, in seinem Schatten zu stehen, sollte aufhören, nach jedem gewonnenen Wettkampf und jeder weiteren Medaille zu glauben, etwas würde sich ändern. Es brachte überhaupt nichts, wenn ich mich abstrampelte und das letzte bisschen aus mir herausholte, wenn Dad am Ende doch immer nur von ihm sprach. Immer nur von Patrick. Patrick. Patrick. Und nie von mir.
»Ist alles in Ordnung?«
Ich zuckte zusammen, als sich eine Hand auf meinen Arm legte und ein wachsamer Blick mit meinem kollidierte. Panik schoss durch meine Adern, und einen entsetzlichen Moment lang befürchtete ich, ich könnte den Namen laut ausgesprochen und damit Fragen aufgeworfen haben, die ich unter keinen Umständen beantworten wollte. Dabei sollte mir doch spätestens jetzt klar sein, dass ich sie nicht auf ewig würde umgehen können. Nicht, wenn ausgerechnet sein Bruder Teil meiner neuen Crew war.
»Ja, alles gut«, presste ich hervor und hoffte, dass das Lächeln in meinem Gesicht den Aufruhr in meinem Inneren blickdicht übermalte.
Patrick musterte mich weiterhin mit undurchdringlichen grauen Augen, als ahnte er, dass ich ihn anlog. »Du bist auf einmal ganz blass geworden. Ist dir schlecht?«
Und wie.
»Nein, ich … ich bin nur etwas müde. Die letzte Nacht war ziemlich kurz.« Ich zögerte einen Moment, als ich die ehrliche Sorge in den Augen dieser drei mir völlig fremden Menschen erkannte, und beschloss, wenigstens einen Teil von dem preiszugeben, was in mir vorging. »Und ich bin ein bisschen nervös. Ich hab bisher keine so guten Erfahrungen damit gemacht, irgendwo die Neue zu sein.«
Die Mienen der drei erhellten sich.
»Das musst du nicht sein. Du bist jetzt unsere neue Kommandantin. Wer dir blöd kommen will, muss erst mal an uns vorbei«, erklärte Scott im Brustton der Überzeugung, und als Taya und Patrick einvernehmlich nickten, hatte ich auf einmal einen viel zu dicken Kloß im Hals.
Seit ich von meiner Strafversetzung nach Kodiak erfahren hatte, hatte ich mir nicht einmal Gedanken um meine neuen Crewmitglieder gemacht. Warum hätte ich das auch tun sollen – schließlich gab es meiner Erfahrung nach nur zwei Möglichkeiten, wie sie sich mir gegenüber verhalten würden. Entweder sie traten mir mit offener Ablehnung entgegen, weil ich neu war und jung und zudem auch noch eine Frau. Oder aber sie versteckten ihre Skepsis hinter professioneller Distanz und einem höflichen Lächeln und ließen sich nur dann über mich aus, wenn sie glaubten, ich bekäme es nicht mit.
Für beide Möglichkeiten war ich gewappnet gewesen und fest entschlossen, dieses Mal souverän damit umzugehen. Ich hatte mir geschworen, meiner Crew keine Angriffsfläche zu bieten, Anzüglichkeiten an mir abprallen und mich nicht von bissigen Kommentaren und abschätzigen Bemerkungen aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich würde mit vorbildlichem Verhalten glänzen und damit hoffentlich die verdammte Strafversetzung auf ein Minimum der Zeit verkürzen.
Eine dritte Möglichkeit hatte ich nicht in Betracht gezogen, und so traf es mich völlig unvorbereitet, dass meine neuen Crewmitglieder einfach nur nett waren. Sie waren sogar mehr als das. Sie waren offen, herzlich und in Scotts Fall noch dazu verdammt witzig. Auf dem einstündigen Flug nach Kodiak hatte ich schon zweimal so herzhaft gelacht, dass ich mich bei dem Gedanken ertappte, der Aufenthalt auf der Insel könnte vielleicht doch nicht so furchtbar werden wie erwartet.
»Wenn du Lust hast, können wir nach der Landung noch eine gemeinsame Runde durch die Stadt drehen. Wir könnten dir alles Wichtige zeigen und dann zum Mittagessen ins Henrys fahren«, schlug Taya vor, deren Stimme blechern aus den Kopfhörern meines Headsets drang.
Vollkommen entspannt bediente sie die Steuerelemente ihrer Cessna, obwohl die Wetterbedingungen alles andere als ideal für einen Flug über den Ozean waren. Die Wolken hingen tief, und noch dazu raubten uns dichte Nebelschwaden jede Sicht. Ob wir immer noch über Land flogen oder uns schon über dem Nordpazifik befanden, konnte ich ohne Kenntnisse über unsere Flugroute beim besten Willen nicht sagen.
»Das klingt verlockend«, antwortete ich. »Allerdings sollte ich mich wohl zuerst bei Captain Reynolds melden. In den nächsten Wochen soll in Kodiak ein neues Trainingsprogramm für Helikopter-Crews entstehen, und dazu wollte er sich direkt nach meiner Ankunft mit mir austauschen.«
»Weil du schon Erfahrungen mit diesem Programm gesammelt hast, richtig?« Scott beugte sich auf seinem Sitz nach vorn und stützte sich mit den Unterarmen auf der Rückenlehne von Tayas und meinem Sitz ab.
Ich nickte. »In Astoria bieten wir dieses spezielle Bootcamp schon seit einigen Jahren an. Ich bin … ich meine … ich war eine der Ausbilderinnen.«
Beinahe zwei Jahre hatte ich viel zu viel Zeit und noch mehr Herzblut in die USCG Advanced Helicopter Rescue School gesteckt – ein Trainingsprogramm, das selbst erfahrene Helikopter-Crews an ihre Grenzen brachte. Ein Ausbilderteam aus erprobten Piloten, Bordmechanikern und Rettungsschwimmern trainierte im Frühling und Herbst Coast Guards aus dem ganzen Land, die für diese Extremerfahrung extra zu uns nach Astoria in Oregon reisten. Denn dort war das Wetter ganzjährig extrem wechselhaft, inklusive unberechenbarer Luftströmungen und meterhoher Wellen, die so manche Piloten und Rettungsschwimmer aus der Fassung brachten. Nach dem fünftägigen Bootcamp hatten die Teilnehmer der Rescue School nicht nur körperlich die härtesten Herausforderungen überstanden, die gemeinsame Bewältigung der schier unlösbaren Aufgaben inmitten meterhoher Wellenberge schweißte die Crewmitglieder zusammen. Es verbesserte ihre Kommunikation und stärkte ihr Vertrauen zueinander. Und genau das konnte den entscheidenden Unterschied machen, wenn man sich als Lebensretter den Extremen des unberechenbaren Pazifiks stellen musste. Die Crews, die wir trainiert hatten, hatten das spätestens am dritten Tag des Bootcamps verstanden. Leider hatte dasselbe nicht für die Ausbilderteams gegolten. Zumindest nicht für meins.
»Ich habe übrigens gestern erst vom Captain erfahren, dass ich auch Teil des Ausbilderteams sein werde, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was wir von dir über das Trainingsprogramm lernen können.« Scotts breites Grinsen brach sich in der Frontscheibe der Propellermaschine, und Hoffnung verpasste der lästigen Anspannung in meiner Brust einen beruhigenden Dämpfer. Vielleicht hatte mich das Glück ja doch nicht gänzlich verlassen. Vielleicht bekam ich dieses Mal die Chance, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mich respektierten, die mit mir an einem Strang zogen und es mir leicht machen würden, der Coast Guard zu beweisen, dass ich eben doch teamfähig war. Und vielleicht konnte ich damit sogar meine Vorgesetzten überzeugen, meine Strafversetzung kürzer ausfallen zu lassen als vorgesehen – damit ich wieder zurück nach Hause konnte, um Nyla endlich die Mom zu sein, die sie verdiente.
»Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen«, erwiderte ich, drehte mich im Sitz zu Scott um und sah gerade noch, wie dieser einen fast schon besorgten Blick mit Patrick austauschte, das Grinsen nicht einmal mehr halb so breit wie noch eine Minute davor.
Ich wollte ihn schon fragen, was denn los sei, da tippte Taya mir gegen die Schulter und deutete zum Horizont. Die Wolkendecke war aufgebrochen und gab den Blick auf eine Küstenlinie frei, die so verwunschen aussah, als wäre sie einem Fantasyroman entsprungen. Hügel aus sattem Grün erhoben sich wie eine Oase aus den tosenden Wellen des Ozeans. An ihren Hängen thronten unzählige Nadelbäume, ihre dunkelgrünen Wipfel umsponnen von Nebelschwaden, und direkt darunter brachen sich majestätische Schaumkronen an schroffen Felsen.
Der Anblick verschlug mir den Atem, während Taya mit einem wissenden Grinsen alles bereit zur Landung machte.
»Herzlich willkommen auf Kodiak, Boss.«
»Du hast vorhin merkwürdig reagiert.« In meinen Ohren klang ich viel zu atemlos, als ich etwa eine Stunde später mit Scott zum Büro von Captain Reynolds lief. Seit wir die Schranken der Kodiak Air Station passiert hatten, war die Anspannung mit solch einer Heftigkeit zurückgekehrt, dass ich kaum noch Luft bekam. Meine Muskeln waren zum Zerreißen gespannt, und ich zuckte jedes Mal innerlich zusammen, wenn uns einer von Scotts Kollegen entgegenkam. Dabei war ich mir noch nicht einmal sicher, ob er überhaupt für die Coast Guard arbeitete. Es war nur eine Vermutung, weil er damals jede freie Minute für die Aufnahme in die Rettungsschwimmerstaffel trainiert hatte. Natürlich hätte ich ihn einfach googeln können, aber feige, wie ich war, hatte ich es nicht über mich gebracht, seinen Namen in das Suchfeld zu tippen.
»Vorhin?« Scott sah mich fragend von der Seite an.
»Als ich meinte, es könne nichts mehr schiefgehen mit uns beiden im Ausbilderteam.« Mein Magen knotete sich zusammen, als ich an den Blick dachte, den er mit Patrick ausgetauscht hatte. Ein Blick, der bei meinen Kollegen in Astoria an der Tagesordnung gewesen war, wann immer ich auch nur falsch Luft geholt hatte. »Falls es für dich ein Problem ist, dass mir als neue Kollegin sofort die Verantwortung einer Ausbilderrolle übertragen wird, sollten wir direkt darüber reden. Denn …«
Ich stockte, als Scott stehen blieb und mich entgeistert ansah. »Warum sollte das ein Problem für mich sein? Du hast bereits zwei Jahre Erfahrung mit diesem Programm gesammelt. Wer, wenn nicht du, sollte Teil des Ausbilderteams sein?«
Die ehrliche Entrüstung in seiner Stimme ließ ein ganzes Gebirge von meinen Schultern fallen, und ich musste mich zusammenreißen, um nicht vor Erleichterung laut aufzulachen. »Dann habe ich da wohl etwas missverstanden.«
»Zumindest missinterpretiert. Falls du auf den Blick anspielst, den ich Pat zugeworfen habe – der hatte nichts mit dir zu tun.«
»Sondern?«
Scott zog die Schultern hoch. »Wir werden uns nicht allein um das Trainingsprogramm kümmern. Unser Chief wird das Ausbilderteam komplettieren, und er und ich … na ja … wir kommen nicht sonderlich gut miteinander aus. Ist eine lange und komplizierte Geschichte. Jedenfalls wird das Ganze wahrscheinlich nicht so entspannt über die Bühne gehen, wie du es dir wünschst.«
»Klingt nach einem sympathischen Zeitgenossen.«
Ein Laut, halb Lachen, halb Schnauben, entfuhr Scotts Mund. »Er ist ein Kotzbrocken. Aber lass dich von seiner ätzenden Art nicht irritieren. Irgendwo, ganz tief unter der harten Schale, hat er einen weichen Kern. Er will es nur nicht zugeben.« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf eine Tür am Ende des Gangs. »Dort ist übrigens das Büro des Captains. Melde dich, wenn du noch etwas brauchst, okay? Wir sehen uns dann später.«
»Danke, bis dann.«
Scott hob die Hand zum Gruß, und ich fühlte mich auf einmal seltsam allein, als seine Schritte hinter der nächsten Ecke verhallten. Meine Güte, der Schlafmangel und diese furchtbare Anspannung machten mich viel zu gefühlsduselig.
Entschlossen straffte ich die Schultern und marschierte vor bis zu der Tür mit dem schwarzen Namensschild. Ich hatte kaum geklopft, da ertönte von drinnen schon ein dumpfes »Herein« – also atmete ich ein letztes Mal tief in den Bauch und drückte die Klinke herunter.
Captain Reynolds saß hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus glänzendem Holz. Er war ein Mann um die fünfzig, mit dunklem Haar und grauen Schläfen, breiten Schultern und einem strengen Zug um den Mund. Als er den Blick von seinem Berg aus Papieren hob, schossen seine Brauen fragend in die Höhe.
»Guten Tag, Sir. Lieutenant Robin Sterling meldet sich zum Dienst«, beeilte ich mich zu sagen und nahm Haltung an.
»Lieutenant Sterling.« Captain Reynolds stützte sich auf der Tischplatte ab, als er sich von seinem Bürostuhl erhob, sein Mund nun zu einem milden Lächeln verzogen. Er kam um den Schreibtisch herum.
Sein Händedruck war rau und schwielig und nicht so kraftvoll, wie ich es erwartet hatte.