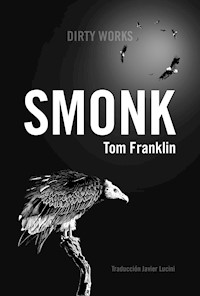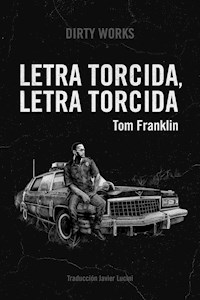Einleitung
Jagdzeit
Ich stehe auf einer Bockbrücke im Süden von Alabama und schaue hinab in das kaffeebraune Wasser des Blowout, eines Angelplatzes, den ich als Kind geliebt habe. Es ist Ende Dezember,
kalt. Ein steifer Wind furcht das Wasser, wirbelt totes Laub auf und biegt die
hohen braunen Rohrkolben entlang des Ufers. Weiter hinten im Wald ist es ganz
still, Sumpfzypressen und Baumknie, dicke Ranken, ein verlassener Biberbau. Am
Himmel schweben Truthahngeier, schwarze Flecken vor den grauen Wolken. Einmal haben mein Bruder Jeff und ich, nur mit Angelruten bewaffnet,
auf dieser Brücke den Schrei eines Pumas gehört. Es ist ein Laut, den ich niemals vergessen habe, wie das Gekreisch einer
Wahnsinnigen. Danach nahmen wir Gewehre mit, wenn wir angeln gingen. Heute
jedoch bin ich unbewaffnet, und die einzigen Geräusche sind das Ächzen und Zischen von Bulldozern und Lastwagen auf einer neu angelegten
Holzabfuhrstraße knapp fünfhundert Meter entfernt.
Vor vier Jahren, mit dreißig, bin ich aus dem Süden weggegangen, zu einem weiterführenden Studium in Fayetteville, Arkansas, wo mir unter den dorthin verpflanzten
Yankees und Weststaatlern klar wurde, welches Glück ich hatte, hier in diesen Wäldern aufgewachsen zu sein, unter Wilderern und Geschichtenerzählern. Ich weiß natürlich, dass Arkansas für die meisten Leute zum Süden zählt, aber es ist nicht mein Süden. Mein Süden – der mir bis heute im Blut liegt und meine Vorstellungswelt bestimmt, der Süden, in dem diese Geschichten spielen – ist das südliche Alabama, üppig, grün und voller Tod, die waldreichen Countys zwischen dem Alabama und dem Tombigbee
River.
Gestern Morgen um fünf bin ich in Fayetteville aufgebrochen und über eintausend Kilometer gefahren, zum neuen Haus meiner Eltern in Mobile, und
heute Morgen bin ich früh aufgewacht und noch einmal zwei Stunden gefahren, vorbei an dem Kieswerk und
den Chemiefabriken, wo ich mit Mitte zwanzig gearbeitet habe, nach Dickinson,
der Gemeinde, in der wir bis zu meinem achtzehnten Lebensjahr wohnten. Es ist
ein winziges Kaff, ein einziger Laden (inzwischen geschlossen), im selben Gebäude ein Postamt, der Friedhof von Kudzu überwuchert, Eisenbahngleise. Ich stehe kurz vor dem Abschluss einer Novelle, die
in diesen Wäldern spielt – in der Erzählung wird genau unterhalb der Stelle, wo ich stehe, ein Mann umgebracht –, und ich bin hier, um mich nach Einzelheiten der Landschaft umzusehen, nach
Dingen, die ich vielleicht vergessen habe.
Um zum Blowout zu kommen, habe ich mir einen Weg durch sechshundert Meter
Kiefernwald gesucht, der noch bis vor zwölf Jahren eines der Maisfelder meiner Familie gewesen ist. Ich erkenne die
Gegend kaum wieder. Ich gehe einen knappen Kilometer an der neuen
Holzabfuhrstraße entlang, dann steige ich auf das Eisenbahngleis, zu beiden Seiten dichter
Wald, hohe Patchwork-Wände aus Gestrüpp und Bäumen, Rote Spottdrosseln hüpfen unsichtbar neben mir her, als gäben sie mir das Tempo vor. Früher gehörte dieses Land meinem Vater, meinen Tanten und Onkeln. Es war unser Land. Kurz
vor seinem Tod teilte mein Großvater fast sechshundert Morgen unter seinen fünf Kindern auf. Er erwartete, dass der Besitz in der Familie blieb, aber sie verkauften ihn nach und
nach an die Holzwirtschaft oder an Jagdclubs. Heute gehört uns nichts mehr davon.
Ich will gerade wieder gehen, als ich bemerke, dass sich fünfzig Meter weiter etwas Großes zwischen den Bäumen herauslöst. Für einen Moment erlebe ich den jähen Schreck wieder, der mich jedes Mal ergriff, wenn ich ein Stück Wild sah, doch das hier ist nur ein Jäger. Ich sehe, dass er mich erspäht hat, auf das Gleis steigt und mir entgegenkommt. Weil ich achtzehn Jahre lang
in dieser Gegend gelebt habe, rechne ich damit, ihn zu kennen, und komme mir
einen Moment lang lächerlich vor. Was mache ich hier während der Jagdzeit am Blowout, ohne Gewehr?
Es ist eine vertraute Empfindung, dieses leise Schuldgefühl, denn in meiner Jugend wurde ein Junge, der nicht auf die Jagd ging, als
Schlappschwanz abgestempelt. Aus irgendeinem Grund hatte ich nie das Verlangen,
etwas zu töten, aber ich war nicht mutig genug, das auch zu sagen. Stattdessen tat ich, was
man von mir erwartete: Ging sonntags und mittwochabends zur Kirche, sagte »Ja, Ma’am« und »Nein, Sir« zu meinen Eltern. Und ging auf die Jagd.
Obwohl ich es hasste (und immer noch hasse), früh aufzustehen, kroch ich um vier Uhr morgens aus dem Bett. Obwohl ich die Kälte hasste, suchte ich mir einen Weg durch den eisigen Wald, kletterte auf einen
der Hochstände meiner Familie oder ließ mich am Fuß einer dicken Lebenseiche nieder um anzusitzen, was schlicht bedeutet, darauf zu
warten, dass ein Bock vorbeikommt, damit man ihn schießen kann. Und weil ich aus den falschen Gründen auf die Jagd ging und weil ich mir Sorgen machte, dass mein Vater, mein
Bruder und meine Onkel meinen Schwindel vielleicht durchschauten, wurde ich der eifrigste Jäger von uns allen.
Ich war derjenige, der morgens als Erster aufwachte und Jeff wachrüttelte. Der Erste im Pick-up. Der Erste auf dem Gleis, wo wir den felsigen Hügel hinaufstiegen und in Richtung des Blowout schlichen, der Stelle, wo wir uns
trennten. An solchen Morgen, an denen die Sterne noch am Himmel standen, war es
zu dunkel, als dass wir unseren Atem hätten sehen können, die Schwellen knarrten unter unseren Stiefeln, und ich ging am leisesten,
hielt meine doppelläufige Flinte vom Kaliber 16 quer vor der Brust, den bloßen Daumen an der Sicherung, den linken Zeigefinger am vorderen der beiden Abzüge. Beim Blowout angekommen, ging ich wortlos nach links und Jeff nach rechts.
In der Morgenstille, die jedes Geräusch verstärkte, schlich ich über das lose Gestein abwärts und trat unten leise über die gefrorenen Pfützen und zwischen die dunklen Bäume.
Im Wald verschwanden die Sterne oben wie weggewischt, und ich schob mich vorwärts, die Hand vor dem Gesicht, um es gegen Dornen zu schützen, mit vor Kälte tränenden Augen. Wenn ich weit genug gekommen war, suchte ich mir einen Baum, unter
dem ich sitzen konnte, dachte zitternd und unglücklich an die Geschichten, die ich schreiben wollte, und hoffte auf etwas,
worauf ich schießen konnte. Denn mit sechzehn hatte ich noch immer kein Stück Rotwild erlegt, und das hieß, ich war streng genommen noch immer ein Schlappschwanz.
Natürlich gab es in meiner Familie viele echte Jäger, darunter auch mein Vater. Obwohl Gerald Franklin nicht mehr jagte, nötigte er auch dem erfahrensten Waidmann Respekt ab, weil er als junger Mann ein
legendärer Truthahntöter gewesen war (und wir wissen alle, dass Truthahnjäger sich für die einzigen ernsthaften Jäger halten und Rotwild- oder sonstige Jäger auf ganz ähnliche Weise geringschätzen, wie Fliegenfischer auf andere Angler herabsehen.) Dad prahlte nie mit den
Truthähnen, die er geschossen hatte, aber wir erfuhren alles von unseren Onkeln. Laut
ihnen war mein Vater der Wildeste von uns allen gewesen, war früher aufgestanden und länger im Wald geblieben als jeder andere im County.
Eine Geschichte, die er erzählt, handelt davon, wie er eines Sonntags im Frühjahr aufwachte, um jagen zu gehen – er benutzte nie eine Uhr, sondern verließ sich stattdessen auf seinen »eingebauten« Wecker. Voller Begeisterung, weil er wusste, auf welchem Baum sich am Vorabend
ein Truthahn zum Schlafen niedergelassen hatte, zog er sich im Dunkeln an, um
meine damals mit mir schwangere Mutter nicht zu wecken. Als er im Wald ankam,
war es immer noch stockdunkel, und so machte er es sich bequem, um den
Tagesanbruch abzuwarten. Eine Stunde verging, und keine Spur von Licht. Anstatt
wieder nach Hause zu gehen, legte er sein Gewehr beiseite, zündete sich eine Zigarette an und wartete weiter auf eine Morgendämmerung, die erst drei Stunden später kam. Später erzählte er meinen Onkeln lachend, dass er um ein Uhr morgens in den Wald gegangen
war.
Aber irgendwann, bevor ich in die erste Klasse kam, gab er die Jagd auf. Ich
vermutete immer, es lag daran, dass er zur Religion gefunden hatte. Ich wurde
damit groß, dass ich jeden Sonntag zur Baptistenkirche ging, mit einem Vater, der Diakon
und kein Jäger war. Mein Elternhaus war fromm – bis zum heutigen Tag habe ich Dad niemals fluchen hören –, wir sprachen bei jeder Mahlzeit (auch wenn wir auswärts aßen) ein Tischgebet und beteten jeden Abend gemeinsam als Familie, wobei wir uns
an den Händen hielten. Sonntagvormittags nach dem Gottesdienst saß Dad, der den ganzen Tag seine Krawatte anbehielt, in unserem Wohnzimmer und las
in seiner Bibel, und abends verfrachtete er uns abermals in den großen weißen Chrysler und fuhr erneut zur Kirche.
Wenn wir dabei an den drei Wiggins-Brüdern vorbeikamen, die alte Klamotten trugen und selbstgeschnitzte Angelruten bei
sich hatten, schüttelte Dad den Kopf und hielt uns eine kleine Predigt über die Gefahren des Angelns am Tag des Herrn. Obwohl weder er noch sonst wer es
je bestätigt hat, habe ich mir immer gedacht, dass er mit seinem Verzicht auf die Jagd eine Art selbst auferlegter Buße tat für die Samstagabende in seiner Jugend, die er in Billardsalons verbrachte, und für die Sonntage, an denen er den Gottesdienst geschwänzt hatte, um Truthähne zu jagen.
Manchmal, wenn ich während meiner eigenen Jagdzeit an einem Amberbaum kauerte und auf den Mittag oder
die Abenddämmerung wartete, damit ich den Wald endlich verlassen durfte, stellte ich mir
meinen Vater als jüngeren Mann vor, wie er, immer noch in seinem blauen Mechanikerhemd mit dem in
die Brusttasche eingestickten Namen, zwischen den Bäumen hindurchschlich, Schmierfett von seiner Werkstatt unter den Fingernägeln und in den schwieligen Händen dieselbe Flinte vom Kaliber 16, die er später mir schenkte. Er steuerte die Stelle an, wo er am Morgen vor der Arbeit
einen Truthahn gehört hatte.
Dort angekommen, kniete er sich hin, legte sich die Flinte in die Armbeuge und
zog aus der Tasche seiner alten Feldjacke den kleinen Truthahn-Locker, den er
Jahre später meinem Bruder schenkte. Dieser bestand aus Holz und war hohl wie ein
winziger Gitarrenkorpus. Man bewegte so sanft wie möglich, als wollte man einen Apfel schälen, ohne die Schale zu beschädigen, einen Stift über die grüne Oberfläche. Wenn man sich auskannte, produzierte man auf diese Weise das leise, perfekte Glucken einer Henne, ein Geräusch, das ein Mensch kaum hören konnte, das jedoch noch in knapp tausend Metern Entfernung den Kopf eines
Truthahns herumfahren ließ. Nachdem Dad ein-, zweimal gegluckt hatte, wartete er, und wenn er die ferne
Antwort – jenen geheimnisvollen, herrlichen Schrei, ein Mittelding aus Hahnenkrähen und Pferdewiehern – hörte, bewegte er den Kiefer wie ein Mann, der seinen Priem von einer Seite zur
anderen schiebt, und beförderte seinen »Yepper« unter der Zunge hervor nach oben an den Gaumen.
Jahr für Jahr bekamen Jeff und ich in unseren Weihnachtsstrümpfen unsere eigenen »Yepper« von ihm geschenkt, winzige Truthahn-Locker aus Plastik, etwa so groß wie der Daumennagel eines ausgewachsenen Mannes, und er versuchte, uns
beizubringen, wie Truthähne zu »yeppen«. Jeff hatte den Dreh schnell heraus, aber ich musste davon würgen.
Mit dieser Art von Geschenk vermittelte mir mein Vater nicht nur, dass er einen Jäger aus mir machen wollte – ohne dass er je Druck ausübte —, sondern auch sein Unbehagen darüber, dass ich bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr mit Puppen spielte. Nicht mit Mädchenpuppen, sondern mit »Actionfiguren«. Den original G.I. Joe mit seinem krausen Bürstenschnitt und der Narbe am Kinn, Johnny West mit seiner aufgemalten Kleidung, Big Jim mit seinem
patentierten Karateschlag: Ich hatte sie alle. Ich spielte schrecklich gern mit
ihnen, und weil Jeff zwei Jahre jünger war als ich, tat er alles, was ich tat. Doch während er G.I. Joe Kopf und Hände abdrehte, um dahinterzukommen, wie die Puppe zusammengesetzt war, stellte
ich mir vor, mein G.I. Joe wäre Tarzan, der Herr der Affen. Eine der Barbiepuppen meiner Schwester wurde, bis
auf einen knappen Dschungel-Bikini entkleidet, zu Jane. Ein dreißig Zentimeter hoher Chew-bacca war Kerchak, ein Affe. An den üppig grünen Sommernachmittagen bauten Jeff und ich aus Stöcken und Ranken afrikanische Dörfer. Wir hoben quer durch unseren Garten einen breiten Graben aus und machten
mit dem Gartenschlauch einen schlammigen braunen Fluss voller Gummischlangen
und Plastikkrokodile.
Wenn die Wiggings-Brüder auf ihren rostigen Fahrrädern angestrampelt kamen – sie waren sehnige Jungs mit von der Sonne gebleichtem Haar, die nach Schweiß und Fisch rochen, im Sommer niemals Hemden oder Schuhe trugen und anderthalb
Kilometer entfernt an einer unbefestigten Straße im Wald wohnten –, warfen Jeff und ich unsere Puppen ins Gebüsch und taten so, als räumten wir irgendein Durcheinander im Garten auf.
»Kommt ihr mit angeln?«, fragte Kent Wiggings und stopfte sich Skoal hinter die Unterlippe.
Sein Vater arbeitete im Sägewerk, und auch Kent würde dort einen Job bekommen, wenn er achtzehn wurde. Ich beneidete sie um die
Lockerheit, mit der sie ihr Leben akzeptierten und bewältigten, um die Art, wie sie zwischen den Zähnen hindurch ausspuckten, eine Angelschnur auswarfen, ein Gewehr abfeuerten.
Jeff und ich gingen überallhin mit, wann immer sie uns dazu aufforderten — ich hatte Angst, ausgelacht und Muttersöhnchen genannt zu werden, wenn ich nein sagte, und Jeff angelte gern. Und während ich auf der Bockbrücke über dem Blowout saß und zusah, wie die Wiggins’ und mein kleiner Bruder einen Katzenwels nach dem anderen herausholten, sehnte
ich mich nach meinem G.I. Joe und hasste die Sehnsucht.
Einmal, ich war gerade fünfzehn geworden und stand mit zehn Geburtstags-Dollar in der Tasche zum
Verjubeln im K-Mart, stellte sich mein Vater neben mich.
»Du könntest dir ein Jagdmesser kaufen«, flüsterte er.
»Gerald ...«, mahnte meine Mutter.
Er ließ meine Schultern los, schob die Hände in die Taschen.
»Er will sich ein neues Outfit für seinen G.I. Joe kaufen«, sagte Mom zu Dad.
Niemals kam ich mir so sehr wie ein Schlappschwanz vor.
Ach, was soll’s, dachte ich und steuerte die Enden der Angelruten an, die ich hinter dem Gang
mit den Spielsachen aufragen sehen konnte. Dad ging neben mir her. Auf der
Suche nach dem schärfsten Messer ließ er mich die borstigen Haare an seinem Handgelenk abschaben, während Mom mit verschränkten Armen beim Stinkköder stand und finster ins Leere starrte. An der Kasse sah ich zu, wie Dad für das Old Timer Sharpfinger, das ich mir ausgesucht hatte, fünf Dollar auf meine zehn drauflegte. Als wir das Geschäft verließen, lag sein Arm um meine Schultern.
Während er uns nach Hause fuhr, fragte ich ihn, ob es ihm lieber wäre, wenn ich nicht mit G.I. Joes spielte. Mom saß am anderen Ende der langen Sitzbank und schaute zum Beifahrerfenster hinaus.
Auf meine Frage hin fuhr ihr Kopf zu Dad herum, der zu pfeifen aufhörte. Er sah sie kurz an, ehe er im Rückspiegel meinen Blick auffing.
»Nein«, sagte er. »Ich bin wirklich stolz auf dich, mein Junge. Es freut mich, dass du ...
Phantasie hast.«
Als Jeff seinen ersten Bock, einen Spießbock, schoss, war ich dabei.
Obschon der Jüngere, ist Jeff schon immer ein viel besserer Schütze gewesen als ich. Ich hatte zu Weihnachten Dads Kaliber-16-Flinte bekommen,
doch Jeff hatte eine Büchse, einen Marlin Unterhebelrepetierer 30-30, ausgepackt. Der Umstand, dass ich
achtzehn war und immer noch eine Flinte benutzte, blieb nicht unbemerkt – der Junge, der am schlechtesten trifft, bekommt stets die Schrotflinte, weil
deren Garbe größere Chancen auf einen Treffer bietet als ein einzelnes Geschoss. Es tat nichts
zur Sache, dass meine Flinte eine Antiquität war, die meinem Großvater gehört hatte, eine seltene, aus gebläutem Sterlingworth-Stahl gefertigte Foxboro, das Modell mit
nebeneinanderliegenden Läufen, die sich hinter dem Vorderschaft aus Walnussholz abklappen ließen. Die Patronen werden eingeschoben, und der Verschluss klappt mit einem gedämpften Schnappen zu, einem Geräusch, das eher nach Tuch als nach Metall klingt. Es ist ein Gewehr, das ich – Läufe, Vorderschaft, Schaft – in dreißig Sekunden auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kann. Ein Gewehr, das über zweitausend Dollar wert ist. Doch im Wald schämte ich mich dafür.
Die Highschool schloss am ersten Tag der Rotwildsaison, und an jenem ersten
Morgen im Jahr neunzehnhundertachtzig saßen Jeff und ich auf einander gegenüberliegenden Hochsitzen – kleine Sitze, die so gebaut waren, dass man ein weites Feld überblickte, wohin Wild zum Äsen kam —, und von meinem aus sah ich zu, wie mein Bruder mich durch das Zielfernrohr
seiner Büchse anvisierte. Ich saß stocksteif und schweigend da, bereit für ein Stück Wild, während Jeff mir aus hundert Meter Entfernung zuwinkte. Mir den Stinkefinger
zeigte. Er pinkelte von seinem Hochsitz, und zwar zweimal. Er gähnte. Schlief. Doch während aus einer Stunde zwei wurden, verharrte ich stockstill – mir fehlte Jeffs Instinkt dafür, wann man bereit sein musste und wann man sich entspannen konnte, bis es Zeit
war, anzulegen und zu zielen. Meine Gliedmaßen begannen zu kribbeln, der Blutfluss in meinen Adern verlangsamte sich wie ein
zufrierender Bach. Ich blinzelte so lange nicht, dass der Wald verschwamm und
ich mir vorkam wie ein Teil davon: Die Bäume und Blätter nahmen etwas durchdringend Summendes an und büßten ihre scharfen Konturen ein, das Summen schwoll an, als flöge in meinem Kopf eine Hornisse herum, und einen Augenblick lang schwebte ich
dort als Mittelpunkt von etwas, sah mit meinen Ohren, hörte mit meinen Augen, die Welt um mich herum ein greifbarer Schimmer von scheckigem Geräusch. Dann blinzelte ich.
Und von der anderen Seite des Feldes aus ertönte Jeffs Schuss.
Von da an bestand ich darauf, auf Jeffs Glück bringendem Hochsitz zu sitzen. Ein Jahr später, zu Beginn der Jagdsaison 1981, war ich ebenfalls dort und wartete, die
Flinte im Schoß. Angespannt. Der Abend dämmerte und ich war abermals dabei, die Hoffnung zu verlieren. Ich hatte gejagt
wie ein Fanatiker – ein-, zweimal am Tag. Ich hatte aufgehört, Bücher mitzunehmen. Ich hatte Wild gesehen, einmal sogar eine Hirschkuh verfehlt,
und das legendäre Jagdfieber schüttelte mich in heftigen Schüben, sodass mir der Gewehrlauf zitterte und die Zähne klapperten.
Jetzt, auf dem Glück bringenden Hochsitz, sah ich das Stück Wild nicht, als es aufs Feld trat. Das tut man selten. Sie erscheinen
einfach. Und wenn es, so wie dieses, ein Bock ist, bemerkt man als Erstes das
Geweih, die schlankesten, spitzesten Stangen der Welt, kein Knochen, sondern
vertrocknete und steinhart gewordene Blutgefäße. Auf dem Hochsitz hob ich langsam die bebende Flinte und entsicherte, der Bock
keine zwanzig Meter von der Stelle entfernt, wo ich zitternd saß.
Während mir das Blut in den Ohren rauschte, zielte ich und schoss, ohne den Rückstoß zu spüren.
Immer noch kauend, hob der Bock den Kopf. Sein Geweih schien sich zu entwirren,
während er sich umblickte, sich fragte, woher dieser Knall gekommen war. Irgendwann fiel mir ein,
dass ich einen zweiten Lauf hatte, und ich betätigte erneut den Abzug, ehe mir schließlich klar wurde, dass ich den zweiten Abzug betätigen musste. Als ich schoss, knickte das Tier ein, fing sich wieder und
verschwand dann, abgelöst von dem Lärm, mit dem etwas durch das tote Laub hinter mir fetzte, ein schmerzhaftes, in
die Senke hinunterkrachendes Geräusch.
Von der anderen Seite des Feldes aus Jeffs Stimme: »Was geschossen?«
Mit zitternden Händen stieg ich die Leiter hinunter. Unten angelangt, mühte ich mich damit ab, die Flinte aufzuklappen, und aus meiner Tasche fielen
Patronen auf den Boden. Ich lud nach und ließ mich fast weinend auf den Grund der Senke hinuntergleiten.
Der Bock war – Gott sei Dank – dort. Noch am Leben, aber zu Boden gebracht. Seine Flanke hob und senkte sich,
ein Hinterlauf zitterte. Während ich mich ihm näherte, zählte ich seine Geweihenden – sechs, sieben, acht – ein Achtender! Was ich jetzt eigentlich hätte tun sollen – was mein Dad und meine Onkel mir eingetrichtert hatten —, war, mich dem Bock vorsichtig zu nähern, mein Messer zu ziehen, ihm die Kehle durchzuschneiden und zuzusehen, wie
er verblutete. Doch in meiner Aufregung vergaß ich das. Stattdessen trat ich bis auf einen Meter an die erlahmende Flanke des
Tiers heran und entsicherte die Flinte. Ich hielt sie im Hüftanschlag, legte einen Finger um jeden der beiden Abzüge und betätigte sie beide gleichzeitig.
An jenem Abend bewunderte meine gesamte Familie den Bock, der mit sich trübenden schwarzen Augen auf der Ladefläche von Dads Pick-up lag. Es ist Tradition, einem Jungen Blut ins Gesicht zu
schmieren, wenn er seinen ersten Bock geschossen hat, aber Dad hatte eine
Lektion zu erteilen. Ich hatte den Rumpf des Bocks so übel zerschossen, dass das Fleisch großenteils nicht mehr zu verwenden war. Das Loch, das ich ihm in die Flanke
geschossen hatte, war so groß, dass ich meinen Kopf hätte hineinstecken können, und Dad trat hinter mich und tat genau das. Als er mich am Kragen wieder
herauszog, hätte ich mich fast übergeben, aber ich schaffte es, mich zusammenzureißen wie ein Mann. Das war der Moment, in dem mich alle umringten, meine Onkel und
Jeff mir auf den Rücken klopften und Mom und meine Tanten mich umarmten, bemüht, kein Blut auf ihre Blusen zu bekommen.
Wenn ich diese Geschichte erzähle, beende ich sie mit dem Satz, dass das Gefühl, das ich an jenem Abend hatte, nur einmal übertroffen wurde, nämlich als Beth Ann an einem warmen Wein-und-Käse-Nachmittag in Paris meinen Heiratsantrag annahm. Während ich das Stück unter Dads Anleitung aufbrach, aus der Decke schlug und die kleinen weißen Fettpolster wegschnitt, näherte sich uns mein achtjähriger Cousin. Als der Junge die blutige, leere Leibeshöhle des Bocks sah, wankte er würgend davon. Dad sah mich an und verdrehte die Augen. Dann begannen wir das rote
Fleisch zu zerwirken, mein Gesicht und mein Hals immer noch blutverschmiert,
meine Haare von Blut verkrustet.
Gegen Ende derselben Jagdsaison saß ich auf einem bewaldeten Hügel auf einem Stück Land, für das mein Vater, als er es verkaufte, klugerweise die Schürf- und Jagdrechte behalten hatte. Es war nur zwei Monate, nachdem ich meinen
Achtender geschossen hatte, doch nun war alles anders, denn Jeff hatte in der
Schule mit dem Bock angegeben. Wenn ich die Geschichte erzählte, stellte ich mich jedes Mal als Dummkopf hin, weil ich dem Tier aus nächster Nähe beide Läufe verpasst hatte. Den Leuten schien das zu gefallen. Ich war dabei, die Macht
der Selbstironie zu entdecken, und es machte mir nichts aus, dass über mich gelacht wurde, solange nur alle wussten, dass ich den Hirsch geschossen
hatte. Und so war es auch. Trainer Horn hatte mich in sein Büro hinter der Sporthalle geführt und mir die Geweihe an der Wand gezeigt. Zum ersten Mal in meinem Leben war
ich kein Schlappschwanz mehr. Nein. Als ich an jenem Abend auf dem Hang saß, war ich ein Mann, der zum ersten Mal Blut geschmeckt hatte und nach mehr
verlangte.
Es war ein milder Januartag, das Laub spröde und vom Wind zu einem fast ständigen Rascheln bewegt. Plötzlich war auf dem Grund der Schlucht ein noch größerer Achtender erschienen und stahl sich zwischen den Lebenseichen hindurch.
Zuerst sah ich sein Geweih, während er am Boden entlangschnoberte und Eicheln fraß. Dann seinen Widerrist. Seinen Stummelschwanz. Dank der Farbe des toten Laubs
hob er sich so wenig vom Hang ab, dass ich ihn nur sah, wenn er sich bewegte.
Mein Herz begann zu hämmern, und als ob der Bock es hörte, hob er den Kopf und sah mich direkt an. Er hielt die Nase in die Luft und
schnaubte, seine Nüstern schimmerten. Einen Moment lang schien er zu verschwinden, gar nicht
dagewesen zu sein, doch ehe ich in Panik geraten konnte, sah ich ihn wieder,
als er sich einen Schritt von mir entfernte.
Irgendwie machte ich alles richtig – zielte, als er den Kopf senkte, drückte den Abzug, anstatt daran zu reißen – und hätte trotzdem fast vorbeigeschossen. Die Schrotgarbe traf ihn an Hals, Gesicht und Geweih, von
dem sie kleine Stückchen absplitterte, tüpfelte seine Backen mit blutigen Perlen, kostete ihn ein Auge und verletzte ihn – wie wir später sahen – an der Wirbelsäule, sodass die Hinterläufe gelähmt waren und er nur noch die Vorderläufe benutzen konnte. Ich stand auf und sah zu, wie er sich durchs Laub
schleppte, zu entkommen versuchte, wühlend den Hang der Senke hinunterstolperte.
Von der nächsten Senke aus rief Jeff: »Was geschossen?«
Ich stürzte halb auf den Grund der Schlucht. Der Bock lag still, die großen, ledrigen Flanken hoben und senkten sich nur ganz leicht, auf seiner
schwarzen Nase schimmerte Blut. Während ich, die Flinte im Anschlag, um ihn herum ging, beobachtete er mich, sein
erhobener Kopf drehte sich, um mich im Blick zu behalten. Ein Auge war rot und
blutete, doch das andere war nach wie vor hell und klar. Auf der anderen Seite
des Hügels hörte ich Jeff durchs Laub krachen. Ich wusste, er hatte meinen Schuss – meinen einen Schuss – gehört, und ich wollte nicht, dass er noch einen hörte.
Warum schnitt ich dem Bock nicht die Kehle durch? Das war keine Schande und außerdem die sicherste Methode, sich vor seinem tödlichen Geweih zu schützen. Doch stattdessen tat ich etwas, was mich bis auf den heutigen Tag
entsetzt. Ich legte die Flinte auf den Boden und zog mein Sharpfinger. Ich näherte mich dem Bock und sah zu, wie er mir mit seinem gesunden Auge folgte.
Vorsichtig, so wie man mit dem Fuß eine Schlange festnagelt, streckte ich das Bein aus, stellte dem Bock den
Stiefel in den Nacken und drückte ihm den Kopf nach unten. Ich kniete mich rittlings auf seinen Rücken. Jetzt hörte ich sein abgerissenes Atmen, spürte seine Wärme an meinen Oberschenkeln. Mit der rechten Hand packte ich eine dicke Stange
seines Geweihs und drehte sein gesundes Auge zur Seite, damit er nichts sah. Er
leistete keinen Widerstand. Ich hob das Messer und begann ihn ins Blatt zu
stechen, wo sich, wie ich wusste, sein Herz befand. Der Bock bewegte sich kaum
unter mir, und das Messer drang mühelos ein, als stäche ich in weiche Erde. Ich stach zwölfmal zu, und zwar so, wie es nach meiner Vorstellung dem Streuungsmuster eines
Schrotschusses entsprach. Dann legte ich die Hand auf das noch warme Blatt des
Tiers, auf die Wunden, die ich ihm beigebracht hatte, und spürte, dass sein Herz aufgehört hatte zu schlagen.
Als Jeff den Hang heruntergerannt kam, hatte ich schon mit meinem ersten feldmäßigen Aufbrechen begonnen. Es war – und ist nach wie vor – der größte Bock, den jemals irgendwer aus meiner Familie geschossen hat; er wog über 220 Pfund, siebzig Pfund mehr, als ich damals wog.
Später, als wir den Bock an dem Baum hochzogen, den wir zum Aus-der-Decke-Schlagen
benutzten, bemerkte Dad die Löcher in der Seite des Tiers. »Respekt, Jungs«, sagte er, »das war ein guter Schuss.« Mit meinem Messer hatte ich eine Reihe von Einschnitten an den Hinterläufen des Stücks vorgenommen, und Jeff und Dad halfen mir, dem Bock das Fell abzuziehen – ein Geräusch wie von einem Klettverschluss —, sodass der fast lilafarbene Körper darunter zum Vorschein kam.
Die Nacht war hereingebrochen, und Dad betrachtete mit einer Taschenlampe den
Rumpf des Bocks. Er bückte sich, untersuchte ihn eingehender, fuhr mit dem Finger in einen der
Messerschlitze. Dann starrte er mich an, bis ich den Blick abwandte.
»Junge«, sagte er, »ist es das, was ich glaube?«
Ich gab keine Antwort.
Er griff nach dem Kopf des Tiers und hob ihn an dem riesigen, beschädigten Geweih mit den acht Enden an, einem Geweih, das so groß war, dass ich zwischen den Stangen mühelos Platz gehabt hätte. Er packte mich im Kreuz und stieß mich gegen meinen toten Bock. Er richtete das Geweih auf meinen Bauch und drückte die Spitzen so kräftig dagegen, dass es wehtat.
»Weißt du, was ›ausweiden‹ heißt?«, fragte er mich.
Jetzt, am Blowout, nähert sich mir der Jäger auf der Bockbrücke. Ich rechne damit, dass es einer der Wiggins-Brüder ist, und wieder stehe ich ohne Gewehr da, voller Schuldgefühle und lächerlich, als hielte ich eine Puppe in der Hand. Doch während der Mann, eine Büchse mit Zielfernrohr in der Armbeuge, näher kommt, erkenne ich an seinem teuren Tarnanzug, seinem leuchtend
orangefarbenen Hut und seiner Tarnschminke, dass er nicht von hier ist. Die Männer, die in dieser Gegend leben, jagen in Arbeitskleidung, alten Stiefeln und
ausgeblichenen Feldjacken, die von ihren Vätern oder Großvätern auf sie übergegangen sind. Als ich noch jagte, hatte ich immer eine solche Kopfbedeckung
in der Tasche, falls ich einem Wildhüter über den Weg liefe, doch die meisten Jäger, die ich in meiner Kindheit und Jugend bewunderte, liefen schlichtweg
niemals einem Wildhüter über den Weg. Diese Männer züchten ihre Hunde für die Waschbär- und Eichhörnchenjagd selbst. Die Schäfte ihrer Gewehre sind mit Isolierband umwickelt. Obwohl sie oft außerhalb der Saison oder nachts jagen, essen sie normalerweise, was sie schießen. Ich bewundere sie und verspüre deshalb eine leichte Abneigung gegen diesen Außenseiter.
»Hallo«, sage ich zu dem Mann, wahrscheinlich einem Anwalt aus Mobile. »Was geschossen?«
»Verschwinden Sie von hier«, sagt er.
Ich lege den Kopf schräg. »Wie bitte?«
»Sie haben mich schon verstanden. Das hier ist Privatbesitz. Sie betreten
unbefugt das Gelände unseres Jagdclubs.« Er schwenkt den Gewehrlauf nach rechts in Richtung Wald, als deutete er auf
seine Freunde, die mit grün und schwarz bemalten Gesichtern und Zweigen im Haar im Schatten lauern und mit
teuren Gewehren auf meinen Kopf zielen.
Ich spucke aus. Ich sage ihm nicht, dass dieses Land einmal meiner Familie gehört hat, dass ich Rotwild über eben dieses Gleis gezerrt und Stunden auf dieser gottverdammten Brücke zugebracht habe. Stattdessen sage ich: »Die Eisenbahn ist kein Privatgelände.«
»Von wegen«, sagt er. Und hebt das Gewehr, richtet es auf mich.
Wir fixieren einander. Bald wird es dunkel, und von der linken Seite des Gleises
ertönt das ferne Knurren einer Holzfällersäge. Ich versuche, mich mit den Augen des Jägers zu sehen: meine abgerissenen Jeans, meine Lederjacke und meine
Wanderstiefel. Für ihn sehe ich wahrscheinlich wie ein Hippie aus, das Letzte, worauf man hier
draußen zu stoßen erwartet.
Unterdessen wird der Jäger nervös, blickt sich nach dem Wald um. »Ich sage es Ihnen nicht nochmal«, sagt er.
Die Säge verstummt rasselnd, dann dreht sie wieder hoch.
»Hören Sie das?«, frage ich. »Das ruiniert Ihnen gründlicher die Jagd als ich.«
Ich weiß, ich sollte gehen, doch stattdessen setze ich mich auf das kalte Gleis, wende
den Blick von dem Jäger ab und richte ihn auf den Wald. Ich entsinne mich einer Geschichte, die mir
mein Vater einmal erzählt hat. Eines Sonntagmorgens war er hier in aller Frühe auf Truthahnjagd. Während er dahinschlich, hörte er eine bebende Stimme, die ihm unheimlich war. Er folgte ihr zwischen den Bäumen hindurch, bis er in der Ferne einen alten schwarzen Prediger sah, der auf
einem Baumstumpf stand und seine Predigt probte. In der einen Hand hatte er
eine riesige weiße Bibel und in der anderen ein rotes Taschentuch zum Gesichtabwischen. Trotz der
nur knapp über null liegenden Temperatur hatte er die Hemdsärmel hochgekrempelt. Dad blieb stehen, und während er der zitternden Stimme des Mannes lauschte, war ihm klar, dass jeder
Truthahn im Umkreis von Kilometern fort, dass ihm die Jagd verdorben war. Er
konnte genauso gut nach Hause gehen. Als ich ihn fragte, ob er wütend gewesen sei, sagte er, nein, bloß unheimlich sei ihm zumute gewesen.
Ich drehe mich um und schaue dem Jäger in das bemalte Gesicht. »Haben Sie schon mal Truthähne gejagt?«
»Scheren Sie sich zum Teufel«, sagt er und geht weg. Er blickt sich nicht um, sondern stiefelt einfach in den
Wald hinein. Als er verschwunden ist, stehe ich auf und mache meine Jacke zu.
Werfe einen langen letzten Blick auf den Blowout und steige dann vorsichtig die
Böschung neben dem Gleis hinunter. Ich ducke mich unter den dunkler werdenden
Magnolienästen auf der anderen Seite hindurch und mache mich auf den Rückweg zur Holzabfuhrstraße.