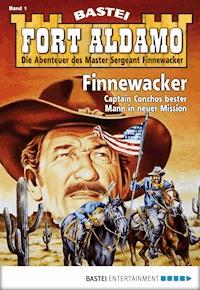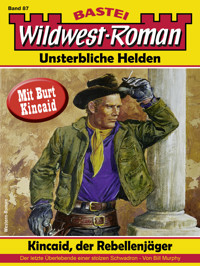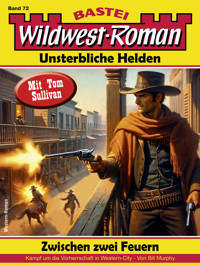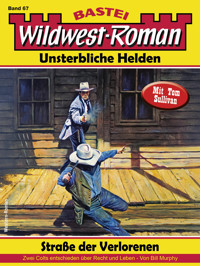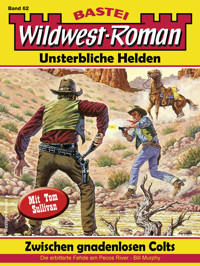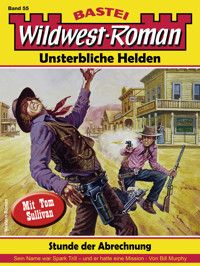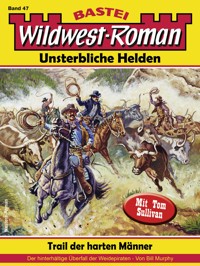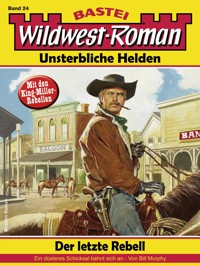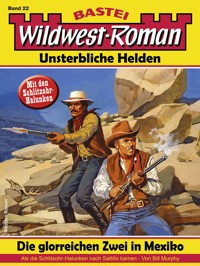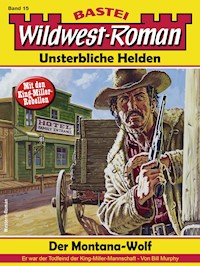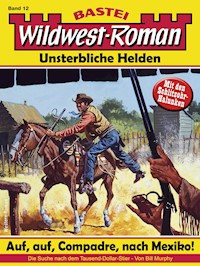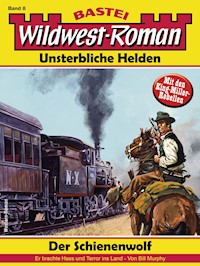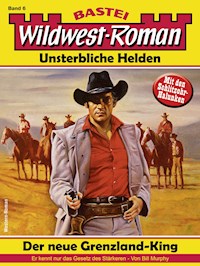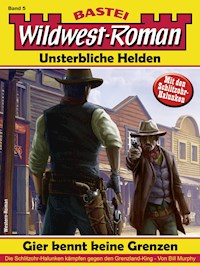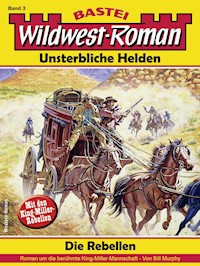1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Durango ist ein heißes Pflaster. Eine berüchtigte Falschmünzerbande hat hier ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Tom Sullivan wird durch den Mord an einem Goldgräber auf sie aufmerksam. Der Mann wurde erschossen und ausgeplündert. Doch die Täter ahnen nicht, dass die gebündelten Scheine, die sie an sich nahmen, gefälscht sind. Der Ermordete hatte sie kurz zuvor für echten Goldstaub ausgezahlt bekommen. Sein Tod ist insofern ein tragischer Irrtum und beweist Sullivan, dass er es mit zwei Banden zu tun hat: mit den Falschmünzern und den Mördern. Nun beginnt ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit, um die Desperados zur Strecke zu bringen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Handgeld des Teufels
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Handgeld des Teufels
Von Bill Murphy
Durango ist ein heißes Pflaster. Eine berüchtigte Falschmünzerbande hat hier ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Tom Sullivan wird durch den Mord an einem Goldgräber auf sie aufmerksam. Der Mann wurde erschossen und ausgeplündert. Doch die Täter ahnen nicht, dass die gebündelten Scheine, die sie an sich nahmen, gefälscht sind. Der Ermordete hatte sie kurz zuvor für echten Goldstaub ausgezahlt bekommen. Sein Tod ist insofern ein tragischer Irrtum und beweist Sullivan, dass er es mit zwei Banden zu tun hat: mit den Falschmünzern und den Mördern. Nun beginnt ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit, um die Desperados zur Strecke zu bringen ...
Orson Benton packte wilde Verzweiflung. Die Verfolger holten auf. Er schlug erbarmungslos auf den Falben ein. Der Hochwald drüben über dem Tal war seine Chance. Doch sein Ziel war noch weit entfernt.
Die beiden Wegelagerer schienen Rennpferde zu reiten. Yard um Yard schoben sie sich heran. Seine Absicht durchschauend, jagten sie ihn schräg durchs Tal. Mit heiseren Schreien und Rufen, die Orson Benton immer deutlicher vernehmen konnte, trieben sie ihre schwarzen Renner vorwärts.
Orson Benton feuerte den Falben mit Flüchen und Kosewörtern an. Die Winchester vor sich über dem Sattel, lag er weit über dem Hals des Pferdes.
Noch einmal gab der Falbe alles, jagte trommelnden Hufes dahin, übersprang einen Creek, als wäre er eben erst losgaloppiert, und hetzte dann den Hügel empor.
Drei, vier Pferdelängen jagte er im unverminderten Tempo hinauf.
Orson Benton schöpfte neue Hoffnung.
Doch dann ließ der Falbe nach.
Der Hang war zu steil, und das Tier war über drei Meilen hinweg scharf geritten worden. Das hügelige Gelände und diese drei Meilen steckten ihm plötzlich wie Blei in den Läufen.
Es stakte nach oben, stolperte, schnaufte und machte sich krumm, sodass Orson Benton einige Mühe aufbringen musste, um im Sattel zu bleiben. Er verwünschte das Land in die Hölle und verfluchte den Gedanken, der ihn gerade diesen Weg nehmen ließ.
Die Wegelagerer verkürzten unaufhaltsam die Distanz. Sie waren längst auf eine Weite herangekommen, die einen sicheren Schuss aus der Winchester eines halbwegs guten Schützen zuließ. Doch sie schossen nicht. Sie schienen sich ihrer Beute sicher zu sein.
Orson Benton sah sich häufiger um. Nur selten schätzte er die Entfernung zum Wald, die sich wesentlich langsamer verringerte als der Abstand zu seinen Verfolgern.
So sah er dann den Mann ohnehin zu spät, der am Waldrand entlangritt und genau auf die Stelle zuhielt, die er mit dem abgekämpften Falben doch noch zu erreichen hoffte.
Orson Benton stieß einen wilden, verzweifelten Schrei aus und ließ sich aus dem Sattel fallen. Der Falbe blieb sofort stehen.
Der stürzende Reiter presste die Winchester an sich, kam hart auf, überschlug sich und rollte ein Stück den Hang hinab, seinen Verfolgern genau entgegen.
Nun schnellte er hoch, sprang auf ein Gebüsch zu und ließ sich keuchend und schnaufend hineinfallen. Die Winchester bekam er schnell hoch. Doch die nach Atem ringenden Lungen hielten seinen ganzen Körper in Bewegung. So verschoss er seine Kugeln und seine letzte Chance.
Die drei Wegelagerer ritten auf den Busch zu. Der Mann, der so unvermittelt aus dem Wald gekommen war, hielt neben dem Falben an und nahm dessen Zügel auf, während seine Kumpane schon in das Gebüsch hineinschossen.
Orson Benton riss die Waffe herum und legte auf den Banditen neben seinem Falben an.
Ringsherum fetzten die Kugeln der Wegelagerer Zweige und Blätter auseinander.
Als Orson abdrücken wollte, traf ihn die erste Kugel. Der Schmerz fuhr ihm stechend durch die Hüfte. In ihm krampfte sich alles zusammen. Er konnte nicht einmal mehr atmen, ließ die Winchester fallen und sank vornüber. Irgendetwas schlug ihm den rechten Arm und Sekunden später das linke Bein weg. Er fiel in bodenlose Tiefen. Dann war es Nacht um ihn.
Die drei Wegelagerer hockten abwartend in den Sätteln. Dabei sahen sie sich lauernd um, blickten über das weite Tal hinweg und spähten zum Waldrand empor.
Der Mann, der Orson Bentons Falben am Zügel hielt und einen Rotfuchs ritt, grinste breit und zufrieden, zeigte dabei zwei Reihen großer und starker Zähne, dem Gebiss eines Wolfes ähnelnd, und sagte brummig: »Sieh nach, Bratt! Er wird erledigt sein.«
Bratt hob die Winchester, ließ sie um die Hand kreiseln und steckte sie flink in den Scabbard. Nun stieg er aus dem Sattel. Dann zog er den Colt und schritt auf den Busch zu.
Vor dem Dickicht blieb er stehen. Er ließ die Colthand sinken, gab seinen Partnern ein Zeichen und steckte die Waffe weg.
Sie stiegen sogleich von den Pferden und kamen ihm zu Hilfe. Gemeinsam zogen sie Orson Benton aus den Büschen. Dann legten sie ihn auf den Rücken und knöpften ihm die blutverschmierte Jacke auf.
Bratts Finger glitten sicher und schnell zwischen Jacke und Hemd hin und her. Nun knöpfte er etwas auf, dann riss er die Hand empor und hielt triumphierend einen Leinenbeutel hoch.
Der Mann, der den Rotfuchs ritt, der Anführer und Leitwolf des rauen Rudels, zeigte wieder die Zähne. Womit er weniger Gefährlichkeit, sondern vielmehr Zufriedenheit ausdrückte.
»Sieh nach, Bratt!«, raunte er scharf und noch vom Jagdfieber gepackt. »Das ist bestimmt nicht alles. Er müsste zehntausend Dollar bei sich haben. Lewis, such die Satteltaschen des Falben durch!«
Lewis nickte und ging zu den Pferden. Bratt hatte unterdessen den Leinenbeutel geöffnet. Er zog Packen auf Packen daraus hervor. Es waren viertausend Dollar in schönen, grünen Zwanzig-Dollar-Noten.
Lewis kam vom Falben zurück.
Der Mann mit den Wolfszähnen und Bratt schmunzelten. Sie richteten sich auf und nahmen ihm die Zwanzig-Dollar-Noten-Pakete ab.
Bratt bog jedes Päckchen durch, schlug mit der Hand klatschend darauf und addierte laut.
»Achttausend!«, sagte der Leitwolf dann und stemmte die Fäuste in die Hüften. Er warf einen kurzen spähenden Blick zum Waldrand und über das Tal hinweg. Danach wandte er sich um und ging zu Orson Bentons Falben. Er leerte die Satteltaschen. Tabak, Seife, Brot und ähnliche Dinge warf er achtlos auf die Erde. »Nichts mehr!«, raunte er und war ein wenig enttäuscht.
Seine Kumpane zuckten mit den Schultern. »Mehr als genug, Lai«, sagte Bratt tröstend, erhob sich, raffte mehrere der Päckchen zusammen, klemmte sie sich unter den Arm und ging zu seinem Rappen. Mit einem Griff hielt er so an die zweitausend Dollar im Arm.
»Halt! Warten!«, sagte Lai scharf.
Bratt blieb stehen und grinste unsicher.
Misstrauen stand in aller Augen.
»Aufteilen können wir doch später, Lai«, sagte Bratt fast entschuldigend. »Sehen wir zu, dass wir hier erst einmal wegkommen.«
Lewis lächelte mager. »Ich bin dafür, dass sofort jeder seinen Teil übernimmt und ihn selbst aus dem Land trägt.«
Lai nickte, zeigte seine Wolfszähne und sagte brummig: »Das tun wir auch!«
Bratt zuckte mit den Schultern. Er ging zurück und ließ die grünen Dollar-Packen neben Orson Benton ins Gras fallen.
Sie teilten nach einer genau festgelegten Vorgehensweise.
Bratt konnte alles wieder aufheben, was er zuvor fallen lassen musste. Das besänftigte ihn und drängte seinen Groll gegen die Kumpane zurück.
Als sie ihre Satteltaschen zuzurrten, stöhnte Orson Benton.
Sie sahen sofort zu ihm hin.
Lewis zog seinen Colt.
Lai winkte ab. »Lass das, Lewis!« Während er so sprach, schaute er zum Himmel empor. »Die Geier werden den Rest besorgen.«
»Ich bin dafür, dass wir ihn fragen, wo er das Gold fand, das er in Durango gegen diese herrlichen grünen Scheine eintauschte«, warf nun Bratt ein und ging auf Orson Benton zu.
Lai zog sich in den Sattel. Auch Lewis stieg auf seinen Rappen.
»Lass uns reiten, Bratt!«, mahnte Lai. »Ich verspüre nicht die mindeste Lust, Hacke, Schaufel und Waschsieb in die Hand zu nehmen. Das ist kein Geschäft. Seinen Claim hat er sicherlich schon genutzt oder verkauft. Da holen wir nichts mehr.«
Bratt machte kehrt und stieg auf. »Wie du meinst, Lai.«
Lai zeigte seine Zähne. »Nicht wie ich meine, Bratt. Wie ich befehle.« Er klopfte selbstgefällig auf die Satteltasche. »Meine Befehle zu befolgen, bringt viel ein. Vergiss das nicht.«
Bratt grinste unsicher. »In Ordnung, Lai!«
»Auf nach Norden! Reiten wir noch ein Stück, bevor es richtig warm geworden ist«, sagte Lai und spähte zum Himmel empor. »Es wird sicher ein heißer Tag. Vorwärts!«
Black bellte, als er die Geier sah.
Tom hielt Red King an und schaute zum Waldrand hinauf.
Einer dieser grässlichen Vögel hob sich träge über die Wipfel der Bäume empor. Er stieg eine Weile, zog einen Kreis und glitt, die Flügel schwach schlagend, wieder auf die Bäume zu. Zwei andere stiegen auf und kreisten dann einige Zeit.
Tom ritt weiter. In diesem wilden Land sah er oft Geier über zu erwartender Beute kreisen. Doch dann erblickte er das Pferd. Er ritt etwas schneller und trieb Red den Hang hinauf. Jetzt konnte er auch erkennen, dass dieses Pferd ein Falbe war und einen Sattel trug.
Kurz darauf stieg er an einem Busch ab. Der Mann im Gras schien tot. Tom nahm zuerst an, dass er auf diesem Hang aus dem Sattel stürzte und sich dabei das Genick gebrochen hatte. Doch dann sah er die Wunde an der Hüfte und die Einschüsse an Arm und Bein.
Tom kniete nieder. Der Mann lebte noch. Er war jedoch ohnmächtig. Sicher hatte er viel Blut verloren. Tom wusste nicht, wie lange der Verwundete schon an dieser Stelle lag. Bis nach Durango waren es ungefähr sieben Meilen. Der Verwundete musste schnell zu einem Doc. Tom erhob sich und sah sich um. Dieser Mann war überfallen und ausgeraubt worden. Tom suchte nach Spuren. Doch in der vergangenen Nacht hatte es geregnet. Im Gras war nichts zu erkennen. Er hob die im Gras liegenden Gegenstände auf und verstaute sie in der Satteltasche des Falben.
Als er zurücktrat, krachte ein Schuss. Die Kugel war ziemlich gezielt abgefeuert worden. Tom konnte sie pfeifen hören. Er richtete sich wenig später auf und blickte zum Waldrand empor.
Eine Weile geschah nichts. Dann aber tauchte oben ein Mann auf. Er trat hinter einem Gebüsch am Waldrand hervor und kam den Hang herunter, in den Händen hielt er eine Winchester, deren Mündung auf Tom gerichtet war.
Blacks Fell sträubte sich im Nacken. Er knurrte und duckte sich.
Tom lächelte und beruhigte den Hund, als er einen langen Blondzopf auf den Schultern der Gestalt tanzen sah.
Es war ein Mädchen. Die junge Frau war nicht sehr groß. Sie trug Hosen, Texasstiefel und ein buntes Baumwollhemd, so, wie die Cowboys unten in Texas.
Tom nahm die Arme herunter und wartete, bis sie heran war.
»Was wollen Sie hier?«, fragte sie böse und hielt die Winchester nach wie vor auf ihn gerichtet.
»Ich sah die Geier«, sagte Tom. »Erst als ich näher herankam, konnte ich das Pferd und den Mann erkennen.« Er blickte auf ihre Waffe. »Haben Sie Anrechte auf diesen Mann? Ich überlasse es gern Ihnen, ihn in die Stadt zu bringen. Das muss nur schnell gehen, Madam.«
»Wer sind Sie? Woher kommen Sie?«
Tom zog lächelnd den Stetson. »Mein Name ist Sullivan, Tom Sullivan. Dieser Hund heißt Black. Wir kommen aus Weston. Das Ziel ist Durango.« Er schwieg und sah sie erwartungsvoll an.
Sie blickte auf Black.
Für Tom war klar, dass sie allein war. Wäre nämlich ein Mann in der Nähe gewesen, wäre sicher der heruntergekommen. Er griff deshalb zu, riss das Gewehr zur Seite und zog gleichzeitig seinen Colt.
Die junge Frau war viel zu überrascht, um an Gegenwehr zu denken. Sie stieß nur einen spitzen Schrei aus.
Tom steckte den Colt zurück. Er gab ihr das Gewehr wieder. »Sie sollten etwas vorsichtiger sein, Madam«, sagte er. Dann zeigte er auf den verwundeten Mann. »Er ist wohl der beste Beweis. Kennen Sie ihn?«
Sie war noch ein wenig durcheinander. Aus erschreckten Augen blickte sie auf ihre Waffe und konnte es wohl noch gar nicht fassen, dass sie eben überrumpelt worden war.
Tom sah das und lächelte. »Vielleicht zeigen Sie mir den kürzesten Weg zur Stadt, Madam. Wir können nicht viel Zeit verlieren, nur weil Sie mir nicht trauen.« Nun ging er zu dem Verwundeten hin, hob ihn hoch und trug ihn zu dem Falben.
Als er dort angelangt war und ihn auf das Pferd heben wollte, kam Bewegung in sie. »Warten Sie, Mr. Sullivan! Nicht mit dem Pferd. Dort unten bei den Fichten steht mein Wagen. Wir bringen ihn zur Ranch. Mein Vater ist Doc. Bis zur Stadt ist das viel zu weit. Er würde es sicher nicht überleben. Können Sie ihn hinuntertragen?«
Tom schritt sofort los und stieg, den Verwundeten auf den Armen, den Hang hinab.
Die Frau fasste wortlos mit an. Während des Weges vermied sie es, Tom anzusehen.
Als sie unten im Tal waren und den Verwundeten ins Gras legten, konnte Tom den Wagen sehen. Hätte er seinen Weg fortgesetzt, wäre er daran vorübergekommen.
Black und die beiden Pferde waren gefolgt. Black hatte die Pferde vor sich hergetrieben.
Der Verwundete lag im Fieber.
Tom ging deshalb zu dessen Falben, schnallte die Decke ab. Als er sie ihm überwarf, fiel ein länglicher Leinenbeutel heraus.
Der Scout kniete sich nun nieder und knöpfte ihn auf. Ein Packen von Zwanzig-Dollar-Noten rutschte heraus, glitt ihm durch die Finger und fiel zur Erde. Er musste fest zugreifen, um zu verhindern, dass die anderen Päckchen nachrutschten. Währenddessen bückte er sich.
Als er mit dem Geld in der Hand dastand, kam sie heran und hielt direkt neben ihm. Sie sah ihn finster an.
Tom lächelte. Er leerte den Beutel. »Ich bin kein Fledderer, Madam. Dieser Beutel war in der Decke eingewickelt. Es sind zweitausend Dollar. Die Männer, die ihn überfielen, haben dieses Geld sicher übersehen.«
Sie stieg ab und kam heran. Dann nahm sie ihm einen Packen aus der Hand. »Es ist ganz neues Geld.«
Tom hob einen Schein ab und zog ihn aus der Banderole heraus. Nun hielt er ihn gegen das Licht und stutzte. Es waren grüne Zwanzig-Dollar-Noten. Dass sie einen gelben Schimmer hatten, einen leichten Stich ins Gelbe, das sah er erst in diesem Augenblick.
»Was ist?«, fragte sie.
»Kennen Sie diesen Mann, Madam?«, fragte Tom.
Sie schüttelte den Kopf und lächelte voller Ironie. »Sie sind sicher sein Bruder, Mr. Sullivan. Wenigstens jetzt. Wenn er stirbt, werden Sie bestimmt Anspruch auf dieses viele Geld erheben, nicht wahr?«
Er gab ihr den Beutel. »Sie werden das Geld dem Sheriff übergeben«, sagte er.
»Dem Sheriff? Dieser Mann ist noch nicht tot.«
Tom hob den Verwundeten hoch und legte ihn auf den Wagen. Dann nahm er die Decke und breitete sie über ihm aus. »Der Sheriff wird das Geld trotzdem bekommen müssen. Es ist falsches Geld.«
Sie lachte herb. »Worauf wollen Sie hinaus? Hoffen Sie, dass ich Sie mit diesen Scheinen reiten lasse?«
»Ich bin am Ziel, Madam. Ich habe in Durango einige Dinge zu erledigen. Fahren wir nun, damit sich Ihr Vater dieses Mannes annehmen kann?« Er wandte sich ab und ging zu Red.
Mochte der Teufel wissen, warum sie auf einmal wütend wurde. »Hier haben Sie das Geld, wenn Sie es nur auf solche Dinge absehen!«, rief sie und warf ihm den Beutel zu.
Der Beutel traf ihn am Rücken, öffnete sich und ein Päckchen grüner Zwanzig-Dollar-Noten mit einem verräterischen Stich ins Gelbe fiel heraus. Die Banderole riss kaputt, und die Scheine flatterten ins Gras.
Tom bückte sich und sammelte die Scheine wortlos ein. Er steckte sie in den Beutel. Nur einen behielt er in der Hand.
Sie saß schon auf dem Wagen und wollte anfahren.
Er ging sogleich zu ihr und hielt ihr den Schein hin. Den Beutel warf er in den Wagen. Dann holte er einen Zwanzig-Dollar-Schein aus seiner Jacke.
»Sehen Sie den Unterschied in der Farbe?«, fragte er sie.
Erst als er diese Frage stellte, besah sie sich die beiden Scheine. Nun zuckte sie mit den Schultern. »Einer ist neu. Einer ist alt und abgegriffen. Beide Scheine sind gutes Geld.«
Tom hegte einen Augenblick lang den Verdacht, dass sie den Unterschied nicht sehen wollte. Er hob deshalb seinen Schein hoch. »Grün. Aber dieser hier ist gelbgrün. Sonst ist an ihm alles in Ordnung. Vielleicht stimmt auch die Nummer nicht. Aber sonst ist alles okay. Nur die Farbe, Madam, die Farbe haben die Leute nicht richtig hinbekommen.«
Sie sah ihn misstrauisch an. »Wer sind Sie?«
Tom lächelte. »Ich hatte mich vorgestellt. Nur Sie haben das noch nicht getan.«
»Dunja«, sagte sie schroff. »Dunja Freeman.«
Tom steckte sein Geld ein. Die falsche Note verstaute er im Beutel. »Fahren Sie nun, Miss Freeman.«
»Kommen Sie mit?«, fragte sie.
»Well, wenn ich darf, begleite ich Sie, Miss Freeman. Ich möchte gern wissen, wer dieser Mann ist. Es würde mich auch interessieren ...«
»Woher er das Geld hat?«
Tom lächelte mager. »Ich möchte gern wissen, wer ihn so zusammengeschossen hat. Was suchten die Leute bei ihm? Das Geld oder war es etwas anderes?«
Sie fuhr wortlos an.
Tom stieg auf Red King, nahm den Falben am Zügel und folgte ihr.
Panse Movar und Jeff Tesman trieben ihre Pferde aus dem Dickicht heraus.
»Der Tote war Orson Benton, der Goldgräber«, sagte Panse Movar. »Ich habe ihn erkannt. Ich kenne auch den Falben. Ich täusche mich bestimmt nicht.«
Jeff Tesman schaute hinter dem Wagen und dem Reiter her. »Warten wir auf Whit«, sagte er ruhig. »Der wird es von seinem Platz aus besser beobachtet haben.«
Sie ritten zum Weg hinunter.
Whit Strong trieb seinen Grauen aus den Fichten. Er kam schnell herangeritten.
»Wer war der Tote?«, fragte Panse Movar aufgeregt.
Whit Strong fluchte. »Der Goldgräber! Dieser verrückte Narr, der im Hotel sein ganzes Gold eintauschte. Er muss hier überfallen worden sein.«
Sie sahen sich alle drei verstehend an. Jeder begriff sofort, was das bedeutete.
»Dann ist er ausgeraubt worden«, schnappte Panse Movar. »Genau wie ich eben sagte, Jeff. Der Boss wird verrückt.«
Jeff Tesman zuckte mit den Schultern. »Wozu? Was ist der Grund? Sie bringen Benton sicher zur Freeman Ranch. Wichtiger ist die Antwort auf die Frage, wer den Goldgräber ausraubte. Waren es Fremde oder gar irgendwelche Haie aus Durango?«
»Reiten wir hinüber«, erwiderte Panse Movar. »Vielleicht finden wir Spuren.«
Whit Strong machte eine wegwerfende Bewegung. »Wir hätten zu Dunja hinaufreiten sollen, bevor der Fremde kam. Deine Einwände waren fehl am Platz, Jeff. Sie hat ihn gefunden, weil sie hier vorüberfuhr. Wir sind vorübergeritten. Der Gaul da oben war weithin zu sehen. Also hätten wir ihn ebenfalls rein zufällig ...«
»Du redest zu viel, Whit«, sagte Jeff Tesman grob. »Wir müssen herausfinden, wer dem Goldgräber das Geld stahl. Los! Das ist wichtig. Wenn es ein Mann oder Männer aus der Stadt waren, ist es eine verteufelte Geschichte. Die Blüten sind zu schlecht. Wenn sie hier in unserer Gegend in Umlauf kommen, werden wir bald zupacken müssen. Mir gefällt es hier und dem Boss auch. Schließlich ist er hier zu Hause. Reiten wir hinauf. Irgendwelche Spuren werden sicher zu lesen sein.«
Panse Movar und Jeff Tesman zogen die Pferde herum.
Nur Whit Strong bewegte seinen Grauen nicht.
»Das Geld ist da«, sagte er gedehnt.
Sie hielten sofort an und fragten wie aus einem Munde: »Wo?«
Whit Strong zeigte zum Ende des Tales, wo der Wagen und der fremde Reiter gerade noch zu erkennen waren.
»Der Fremde fand es, als er Orson Benton auf den Wagen legte. Der Goldgräber hatte den Zaster in der Decke versteckt. Ich habe genau gesehen, wie es herausfiel.«
»Wer war dieser Fremde?«, fragte Jeff Tesman raunend. »Hast du deine Augen richtig aufgemacht, Whit?«
Whit Strong nickte. »Habe ich. Doch es war ein Gesicht, das ich noch nie gesehen habe. Ich hörte, wie er zu Dunja sagte, dass er in Durango etwas zu erledigen habe. Also werden wir Gelegenheit bekommen, uns den Burschen richtig anzusehen.«
Jeff Tesman kratzte sich den Schädel. Dann nickte er. »Ich bin dafür, dass wir uns den Gent genauer ansehen.«
Sie ritten auf den Weg und wenig später galoppierten sie Bügel an Bügel nach Durango.
Bob Freeman war ein Mann über fünfzig. Er stellte zunächst kaum Fragen. Er ließ den Verwundeten ins Zimmer tragen, holte seine Instrumententasche und machte sich dann an die Arbeit.
Dunja Freeman ging ihm dabei zur Hand.
Tom und einige Cowboys der Freeman Ranch standen um den Tisch herum und sahen Bob Freeman – mehr oder weniger mit verzogenem Gesicht – bei der Arbeit zu.
Erst als er den letzten Verband anlegte, sah er Tom an und fragte: »Wer ist dieser Mann? Kennen Sie ihn, Mr. Sullivan?«
Tom schüttelte den Kopf.