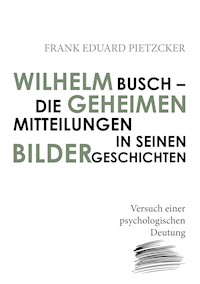
Wilhelm Busch – Die geheimen Mitteilungen in seinen Bildergeschichten E-Book
Frank Eduard Pietzcker
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Busch, schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit mit allen Möglichkeiten, einen gesellschaftlich bevorzugten Platz einzunehmen, trat schon früh einen unerklärlichen Rückzug aus der Öffentlichkeit an. Sein Leben in der dörflichen niedersächsischen Heimat glich einem 'sich vergraben'. Was mögen die Gründe für dieses Verhalten gewesen sein? Untersuchungen tiefenpsychologischer Art können hier neue Einsichten zu Tage fördern, die auf starke familiäre Bindungen und daher rührende Schuldgefühle hinweisen, die eine lebenslange Belastung dargestellt haben dürften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das doppelte Selbstverständnis
Sinnbilder
Pflanzen und Tiere
Gegenstände
Vorgänge
Gesten
Verlockungen
Drohungen
Das Trauma Prügel
Scham und Verhüllung
Beobachtung
Sadismus oder Masochismus
Katastrophen
Die Welt der Objekte
Sexualität
Die Eltern
Die Schwester Fanny
Die Unerreichbare
“Fremdes Glück ist ihm zu schwer“
Zwischen den Stühlen
Verzicht als Lebenshaltung
Schopenhauer und der Pessimismus
Der Glaube an die Wiedergeburt
Sehnsucht nach dem Nichts
Die Malerei
Fließende Grenzen
Das Haus in der Bockenheimer Landstraße
Schlussbetrachtung
Fußnoten
Nachweis der zitierten Texte und Abbildungen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Das doppelte Selbstverständnis
Zu einer Zeit, als Wilhelm Busch seinem Verleger ungeniert die Honorare für seine Bildergeschichten vorschreiben konnte, – Werke, die sich längst großer Beliebtheit in der Leserschaft erfreuten –, berichtet sein Malerfreund Friedrich Kaulbach, Busch habe einem Bekannten mit finsterer Miene die Lektüre eben dieser Sachen abempfohlen und ihm die Beschäftigung mit seiner Gedankenlyrik nahe gelegt: „Lesen Sie meine ´Kritik des Herzens`. Darin lernen Sie mich kennen, nicht in den anderen Sachen.“1)
Die „Kritik des Herzens“: Eine Sammlung von meist ernsten Gedichten, die man in die Spezies „Gedankenlyrik“ einzuordnen hat. Das 1874 erschienene Bändchen verkaufte sich schlecht, wie Busch in einem Brief mitzuteilen wusste, (Briefe II, Anh. 4, S. 314), und so könnte man annehmen, Busch habe mit seiner Mindereinschätzung der Bildergeschichten um seine Glaubwürdigkeit als ernsthafter Dichter fürchten müssen.
Nun liest man in einem Brief an seinen Freund Erich Bachmann (331), was er während einer Bahnfahrt in seinem Abteil erlebte: „… in Kreiensen zog ein Herr meine Abenteuer eines Junggesellen aus der Tasche und las sie laut der Reisegesellschaft vor, bis Nordstemmen. Es war mir sehr peinlich und ekelhaft; ich tat, als wenn ich schliefe.“ Diese Reaktion legt eine andere Deutung nah: Den Fall persönlicher Betroffenheit.
Tatsächlich äußerte sich Busch später mehrfach zum Charakter seiner Bildergeschichten. In seiner 1886 verfassten autobiographischen Schrift „Was mich betrifft“ bekannte er: „So nahmen denn bald die Bildergeschichten ihren Anfang, welche … mehr Beifall gefunden, als der Verfasser erwarten durfte … Fast sämtlich sind sie in Wiedensahl gemacht, ohne wen zu fragen und zum Selbstpläsier.“ (GA IV, S. 151). Ähnlich äußerte er sich in einem Brief an Kaulbach: „Dass ich meine Sachen … lediglich und vor allen Dingen zu meinem rücksichtslosen Pläsier zurechtgeschustert, das ist eben manchen Leuten nicht begreiflich zu machen.“ (656)
Warum aber immer wieder die Veröffentlichungen? Sind es am Ende geheime Bekenntnisse, die der Autor vor sich selbst ablegt? Es ist in der Literatur mehrfach unterstellt worden, dass sich der Autor sogar in der einen oder anderen, von ihm selbst erdachten, Person versteckte.2) Dagegen hatte sich Busch allerdings gewehrt. Dass die Bildergeschichten ein Stück von ihm selbst unter die Leute getragen hätten, leugnete er energisch: „Von mir selbst? Das will ich nicht glauben. Ich bin ganz anders. Meinetwegen ganz anders geworden.“3)
Dennoch: Derartige Bemerkungen verraten starkes Abwehrverhalten. So hat man dann auch in seinem Werk gelegentlich eine „grandiose Ersatzleistung“ entdecken wollen, bzw. Vorgänge, die unzweifelhaft auf den Autor selbst übertragen werden könnten.4) So oder so wäre es möglich, dass die „zum Selbstpläsier“ geschaffenen Werke Versuche darstellen, um eigene Konflikte darzustellen und damit aufzuarbeiten.
Sein Neffe Hermann Nöldeke erzählte: „Was er veröffentlicht hatte, war für ihn erledigt, wie wenn die Schlange sich gehäutet hat. Den Vergleich gebrauchte er selbst.“5) Das klingt ganz stark nach einem Vorgang des Aufarbeitens, den man allerdings erst einmal nur für die Bildergeschichten gelten lassen sollte. Hier halten die Versuche der Selbstbefreiung und Ablösung von quälenden Innenzuständen an. So schreibt er einmal an seinen Verleger Bassermann, der ihn um einen Kommentar zu einer seiner Neuerscheinungen gebeten hatte:
“In Betreff der ´Deutung` möchte ich ja gewiss gern Deine Wünsche befriedigen; aber es geht nicht, es geht mir durchaus wider die Haare… Ich denke meine Geschichte ehrlich durch und durch, so weit meine Fähigkeit dazu ausreicht. Damit habe ich meine Schuldigkeit gethan und will nun ´mein Ruh` haben. Wenn dann dieser oder Jener dieses oder Jenes sagt, so mag er recht haben; aber ich muss ihn notgedrungen ablehnen, denn er kann mir nichts helfen. Ich weiß selber zu gut, welche Mängel in meiner individuellen Art der Anschauung, welche Hindernisse in der Schrift durch Bilder überhaupt liegen, und mit dieser Selbsterkenntnis muss ich mich beruhigen, so gut es geht, und mit Geduld mein Päckchen weiter tragen.“ (155)
An diesen Aussagen wird offenbar, mit welchen inneren Schwierigkeiten der Autor zu kämpfen hatte, wenn er preisgeben sollte, was ihn eigentlich bewegte. Die Art der Abwehr verrät starke Ängste vor Bloßstellung, – vor Offenlegung dessen, was eben geheim bleiben sollte. Kein Zweifel: Die Bildergeschichten sind nicht in erster Linie auf „Außenwirkung“ gedacht. Die Kommunikation mit dem Leser findet allenfalls im Sinne einer „Beobachtung durchs Schlüsselloch“ statt. Die dargestellten Figuren agieren auf einer Ebene, die keinesfalls Mitleidsgefühle o.ä. erzeugen sollen. In seiner autobiografischen Schrift „Von mir über mich“ schreibt er: „So ein Konturwesen macht sich leicht frei von dem Gesetz der Schwere und kann, besonders wenn es nicht schön ist, viel aushalten, eh´ es uns weh tut.“ (GA IV, S. 210)
Finden sich aber möglicherweise erzieherische Absichten hinter seinen Bildergeschichten? Dieser Verdacht ist im Lauf der Zeit gelegentlich geäußert worden. Er dürfte sich aber wohl verbieten. Zu deutlich ist die Ironie, die uns aus den Geschichten von „Max und Moritz“, von Plisch und Plum“, aber auch aus den „Abenteuern eines Junggesellen“ anlacht.
Von der Psychoanalyse ist neuerdings nahe gelegt worden, wie sehr sich literarische oder auch zeichnerische Formen für den Autor eignen, sich bestimmte Phantasien oder gar Ängste bewusst zu machen und deutlicher mit ihnen umzugehen.6) Die Verwandlung eines persönlichen Konfliktes in ein literarisches Thema oder auch nur in eine literarische Figur, das „Umgießen“ in eine neue Form, gestattet u.U. die Beschwichtigung solcher Ängste, die sonst der Verdrängung anheim fallen würden. So heißt es in einer Untersuchung eines bekannten Romans: Die literarische Form „filtert und verändert, kanalisiert und sozialisiert, versteckt und maskiert nicht zugelassene, aber mächtig ins Bewusstsein drängende Phantasien des Autors so, dass sie für ihn und den Leser bewusstseinsfähig, akzeptabel und kommunikabel werden.“7)
Danach wäre der oben zitierte Verdacht, Busch verstecke sich hinter seinen eigenen Figuren, zwar nicht ganz falsch, geht aber an der Sache vorbei. Natürlich ist das dramatische Geschehen der Bildergeschichten im Ganzen wie im Detail ohne die Lebenserfahrungen des Autors nicht denkbar, Sie erlauben aber nicht ohne Weiteres direkte Bezüge zu seiner Vita. All´ das ist, wie Hans Ries formulierte, „eben doch mit einer ganz anderen Regie gemacht und nach Bedarf gestaltet, als der Autor sein Leben lebt.“8)
Wenn überhaupt, wird man die Person des Wilhelm Busch nur bruchstückhaft in seinen Geschichten wieder erkennen können. Seine Akteure treten in veränderter Gestalt und in anderen Sinnzusammenhängen auf, die zunächst einmal keinerlei Rückschlüsse auf das Leben seines Autors gestatten. Nun lassen sich aber immer wieder gemeinsame Elemente der Darstellung oder auch der inneren Einstellung sowohl in den Bildergeschichten, wie auch in bestimmten Gedichten seiner Gedankenlyrik festmachen. Derartige Analogien könnten doch die oben zitierten Vermutungen bestätigen.
Gewiss finden die in den Gedichten der „Kritik des Herzens“, der Sammlungen „Schein und Sein“ und „Zu guter Letzt“ gemachten Weisheiten auf ganz anderer Ebene statt, als es in den Bildergeschichten der Fall ist. Mit der Gedankenlyrik hat der Autor eine Form gefunden, die über Persönliches hinausgeht und stärkere Allgemeingültigkeit besitzt. Sie hat „den Menschen schlechthin im Visier“.9) Dennoch gibt es zuweilen Sinnentsprechungen, ja auffallende Übereinstimmungen in den letztlich gemachten Aussagen, die nicht zufällig sein können. Sie bieten u.U. eine Handhabe zur weiteren Erschließung eventuell verborgener oder sonst wie rätselhafter Aussagen. Sie gilt es „dingfest“ zu machen.
Es findet sich in Buschs Gesamtwerk eine Fülle von Zeichenhaften, von Symbolen und Gesten, die, wo sie nicht aus sich selbst heraus verständlich sind, in bestimmte Lebenszusammenhänge des Autors gestellt werden müssen, um sie angemessen deuten zu können. Einige charakteristische Beispiele seien im Folgenden angeboten.
Sinnbilder
Pflanzen und Tiere
1: Aus: „Schnurrdiburr, oder die Bienen“. (GA II, S. 32)
“Meine Welt ist die Welt der Phantasie. Darin will ich nicht gestört sein“ ließ Busch einmal seinen Neffen wissen.10) Dieser grundsätzlichen Einstellung hat er selbst bildhaft Ausdruck verliehen, als er „Schnurrdiburr oder die Bienen“ schuf. Der in dieser Geschichte beschriebene Bienenstock ist ein Gleichnis, für dessen Deutung der Meister schon selbst einen Hinweis gab: Der Bienenkorb „kommt mir immer vor, wie ein altes, würdiges Menschenhaupt, wo die Gedanken ein- und ausfliegen. Bald spielen sie gemütlich vor …; bald sitzen sie behaglich brummend an der Stirn in traulicher Dämmerstunde; bald fliegen sie emsig ab und zu im Sonnenglanze.“ (GA IV, S.499) Und in der Schrift „Kennen die Bienen ihren Herren?“ heißt es 1867. „Der wahre Imker ist der ´platonische Philosoph auf dem Thron´“ (GA IV, S.496)
Sieht man sich in der Bildergeschichte die Szene mit dem Virgil an: „Friedlich lächelt Virgil, umsäuselt von sumsenden Bienen“ (5. Kap.), gewinnt man den Eindruck einer Metapher für gewisse Gedankenspiele, für phantastische Schwärmereien, vielleicht sogar Wunschvorstellungen. Die Anspielungen schon im ersten Kapitel werden bereits konkreter: Der Bienenbäcker Krokus verschickt einen Brief an die Kellnerin Aurikel. Es gibt eine Blumensprache, aber die Blume selbst ist schon Symbol genug: So steht die Aurikel für vergebliche Liebe, für die Alleingelassene, der Enzian aber für tatkräftige Sexualität.
2: Aurikel und Enzian. Aus: „Schnurrdiburr…“. (GA II, S. 19)
Ganz gleich welche Vorstellungen, vielleicht allzu private, Busch mit diesen Anspielungen verband, – seine Ausdrucksmittel, hier also Bild und Symbol, treten stets so fließend und ungekünstelt auf, dass man diese Art der Mitteilung fast als seine normale Sprache einschätzen kann. Mitunter weiß man dann auch nicht sicher, ob und was sie verheimlicht.
Bilder und Symbole können ihre jeweiligen Bedeutungen auf verschiedenen Ebenen entfalten. Busch benutzte auch im Alltag eine Bildersprache. Als ihm Friedrich Theodor von Vischer im „Heiligen Antonius von Padua“ einen „pornographischen Strich“ attestieren wollte, reagierte Busch verständnislos: „… dem [ist] bei Bestellung des eigenen Ackers ein Stück Guano ins Auge geflogen.“ (GA IV, S. 151)
Es finden sich in Buschs Werken zahlreich gebräuchliche Bilder und Symbole, die keiner weiteren Erklärung bedürfen. So ist der Affe seit dem Mittelalter Symbol alles Untermenschlichen im Menschen und „steht für Lüsternheit, Geiz und übel wollende List...“11) Busch benutzt es in seiner Geschichte „Fipps, der Affe“, um bestimmte negative Eigenschaften zu demonstrieren, die ein Wesen schließlich schuldig werden lassen können.
3: Kaspar Schlichs Ende. Aus „Plisch und Plum“. (GA III, S. 514)
Es finden sich auch selbst erdachte Symbole in seinen Werken: Die immerfort qualmende Pfeife des Kaspar Schlich in „Plisch und Plum“ ist ganz sicher nicht nur ein Attribut des alten Miesmachers. Als er stirbt, heißt es von ihr: „Einst belebt von seinem Hauche; / Jetzt mit spärlich mattem Rauche / Glimmt die Pfeife noch so weiter/ Und verzehrt die letzten Kräuter./ Noch ein Wölkchen blau und kraus. –/ Phütt! – ist die Geschichte aus.“ Der Tabak wird hier zum Lebenselixier eines Menschen, das Rauchen zum Symbol seines Lebens überhaupt.
Es taucht noch ein anderes, nicht gleich erkennbares, „Markenzeichen“ für den alten Schlich auf: Am Teich, in den er am Anfang der Geschichte seine beiden Welpen wirft, zeigen sich drei herzförmige Blätter, die in der letzten Szene, in der der Alte sein Leben beschließt, unübersehbar wieder erscheinen. Sie sind nicht zufällig da. Es handelt sich um die „Calla paludis“, die in Fachbüchern als „giftiges Teichrandgewächs“ bezeichnet wird. Zweifellos eine passende Wappenpflanze für den alten Zyniker, – für das giftige Randgewächs einer menschlichen Gesellschaft!
Mehrfach fällt in den Geschichten Buschs ein Hase auf, der den jeweiligen Bildinhalt begleitet. In der kleinen Sammlung „Hernach“ findet sich eine Zeichnung, die das Motiv „Rast im Walde“ darstellt. Hier ist wohl die Heilige Familie dargestellt, – ein für Busch ganz ungewöhnliches Thema. Im Text dazu heißt es: „Es hielten mal Wandrer/ Im Walde Ruh, / Da kamen zwei Häslein/ Und schauten zu.“ (GA IV, S. 339)
Ruhe und Frieden herrscht auch in der Idylle, in der Knopp in den „Abenteuern eines Junggesellen“ seine zerrissene Hose flickt: „Hier auf dieser Blumenwiese, / Denn geeignet scheinet diese, / Kann er sich gemütlich setzen, / Um die Scharte auszuwetzen…/ Hier ist alles Fried und Ruh, / Nur ein Häslein schauet zu.“ („Die stille Wiese“) Der Hase deutet hier nun gewisslich mehr als nur Frieden und Ruhe an. Das Abenteuer, das Knopp vorher durchstehen musste, war für ihn mit Peinlichkeit und auch mit Schuld verbunden, die Busch mit diesem Vorfall verband. Nur so ist die Formulierung „Scharte auswetzen“ zu verstehen. Ein Riss in der Hose ist keine Scharte, die es auszuwetzen gilt. Es muss sich vorher um eine höchst persönliche Niederlage gehandelt haben. Was ist passiert?
Knopp zeigt sich auf einer dörflichen Kirmes als gewandter Tänzer, engagiert eine Dame und glänzt zum Schluss sogar im Solotanz. Nur ein Missgeschick, nicht eigene Schuld, ist Ursache des Defektes an seiner Garderobe. Keine Frage, dass hier die Eitelkeit eines Menschen, seine Selbstdarstellung angesprochen und gegeißelt werden soll. Knopps Größenphantasie wird auf durchschnittliche Maße zurückgeholt, sein Ausflug in unangemessene Sphären als Schuld angesehen. Der Hase, der die „Reparatur“ beobachtet, bildet eine Art Gegenstück, – ein Symbol für die Unschuld.
Der Verdacht, zu viel in dieses Motiv hineingedeutet zu haben, verringert sich, wenn man die Erzählung „Hänsel und Gretel“ aus den „Bilderpossen“ studiert. Man muss auch hier wieder einen Hasen bemerken, der fast alle Szenen dieser Geschichte als Beobachter begleitet und eigentlich mit der Fabel gar nichts zu tun hat. Sie wird eingeleitet vom Verbot der Mutter an die Kinder, ja nicht in den Wald zu gehen. Dieses Verbot wird natürlich überschritten. Was folgt, ist lebensgefährlicher Strafvollzug. Die schadenfrohe Miene des Hasen zeigt, dass er diese Konsequenz offensichtlich billigt. Auch hier wieder der Kontrapost zur Schuld der Kinder: Das Unschuldssymbol!
4: Aus den „Bilderpossen“: „Hänsel und Gretel“. (GA I, S. 331)
Gegenstände
Zurück zum Abenteuer des Tobias Knopp: Nach Reparatur seines Beinkleids sieht man Knopp entschlossenen Schrittes über eine Brücke nach links aus dem Bild gehen. Dies ist allerdings ein eindeutiges und früher geläufiges Symbol für „Wiedergutmachung“, das sich z.B. bei Hieronymus Bosch auf einem seiner Altarbilder findet und das in seiner Bedeutung geklärt ist.12) Aber sind das innere Schwierigkeiten, mit denen der Autor selber umgehen musste? Ganz gewiss waren ihm die Probleme eitler Selbstdarstellung oder gar der Zur-Schau-Stellung nicht unbekannt. Er wird immer wieder dagegen angekämpft haben. Er hatte die Erfahrung mit dem Ruhm gemacht, als sein „Max und Moritz“ großes Aufsehen erregte. Aber er hat dann auch das Gedicht gemacht: „Der Ruhm, wie alle Schwindelware, / Hält selten über tausend Jahre…“ (GA IV, S. 301f.)
5: „ Abenteuer eines Junggesellen.“ (GA III, S. 42)
Vorgänge
Der Gang nach links über die Brücke: ein Rückzug, – die Korrektur eines Abwegs. Andere Abwege vermeidet Knopp von vornherein. Auf seinem Weg zum Förster Knarrtje geht vor ihm eine „schwärzliche Gestalt“, ein Geistlicher, der dann rechts einen kürzeren Seitenweg zur Försterei einschlägt, um dort in Abwesenheit des Hausherrn ein Techtelmechtel mit der Försterin zu beginnen. Der heimkehrende Ehemann entdeckt die Affäre, und es kommt zur Katastrophe, bei der alle Beteiligten, auch Knopp, zu Schaden kommen. Der ramponierte Liebhaber verlässt die Szene wiederum auf einem Seitenweg, diesmal folgerichtig links. Knopp enteilt mit energischem Schritt geradeaus marschierend, als wolle er sagen: „Deinen Weg gehe ich nicht!“ Ausdruck eines geraden Weges!“
Zu seinen sonstigen Begegnungen in dieser Bildergeschichte scheint Knopp auch keine sehr positive Einstellung gehabt zu haben. Der stereotype Refrain am Ende jeden Kapitels: „Knopp vermeidet diesen Ort und begibt sich weiter fort …“ spielt revueartig alle möglichen Arten der Lebensgestaltung durch, für die sich eigentlich niemand recht erwärmen möchte. Knopps Empfindungen sind dementsprechend: Ablehnung, Peinlichkeit, ja Ekel. Sie enden schließlich in vitalen Ängsten:
Sein Besuch bei einem fröhlichen Zeitgenossen, dem gerade seine Frau gestorben ist, wird je unterbrochen, als die vermeintlich Tote plötzlich wieder erscheint und sich in einer Art Epiphanie präsentiert. Knopp muss so etwas geahnt haben; warum sieht er während der ganzen Unterhaltung fortgesetzt zur Tür, hinter der die Verstorbene aufgebahrt ist? Während der Ehemann tot umfällt, wird Knopp von panischer Angst überfallen und ergreift überstürzt die Flucht.
Es wird deutlich, dass diese ganze Begebenheit nicht in den Bereich des Wirklichen gehört. Die Ängste, die hier sichtbar werden, können durchaus die Ängste des Autors sein, der sich ein Leben lang mit der Wiedergeburtslehre auseinander gesetzt hatte, was ihn nachweislich nicht wenig belastete, – eine Folge seiner Beschäftigung mit der Philosophie Schopenhauers.
6: Aus: „Abenteuer eines Junggesellen“. (GA III, S. 64)
Das Thema „Flucht“ hat Busch noch mehrfach beschäftigt. Wenn „Fipps der Affe“ im 8. Kapitel sein gut situiertes Zuhause unter Hinterlassung von Chaos und Zerstörung verlässt und die Flucht durchs Fenster ergreift, ist das mehr als bloße Abenteuerlust. Hier kommt die tiefe Überzeugung des Autors vom Bösen in allen Lebewesen zum Ausdruck, die sich nun einmal nicht „domestizieren“ lassen. So heißt es in einem späteren „Kommentar“ zu dieser Geschichte:
“Und der Fipps verlässt im Saus / Dieses ehrenwerte Haus, / Um sich ferner zu zerstreun / Und ein rechter Lump zu sein.“ (GA III, S. 528) Die Natur bricht sich Bahn durch alle Formen und Konventionen. Auch diese Einstellung geht auf seine Auseinandersetzung mit der Lehre Schopenhauers zurück.
Weniger „philosophisch“, vielmehr eigene „Untaten“ widerspiegelnd, ist das, was Busch in seinem „Maler Klecksel“ schildert. Kuno, die Hauptperson dieser Bildergeschichte, ist als Lehrling bei einem Maler und Anstreicher angestellt, treibt seine unpassenden Späße, weil er sich in diesem Beruf nicht wohl fühlt. Schließlich verlässt er die Stätte seiner unerwünschten Ausbildung, nachdem er dort ein unbeschreibliches Chaos angerichtet hat. „Froh schlägt das Herz im Reisekittel … / Vorausgesetzt man hat die Mittel.“
7: Aus: „Maler Klecksel“. (GA IV, S. 106)
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Busch hier eigenes Erleben in die Geschichte einfließen lässt und dass das alles von starken Schuldgefühlen begleitet wird. Bekanntlich ist er als junger Mann von seinem Vater auf die Polytechnische Schule nach Hannover geschickt worden, um Maschinenbau zu studieren.
Der Sohn fühlte sich zu anderem berufen, verließ die Hochschule in eigener Initiative und begann in Düsseldorf, später in Antwerpen, ein Studium der Malerei. Die Kühnheit des jungen Mannes einem sicherlich strengem Vater gegenüber ist später dauerhaftem und belastendem Schuldgefühl gewichen. Es wird darüber noch zu berichten sein.
Gesten
Im gesamten Schaffen Wilhelm Buschs spielen Bilder und Symbole eine nicht zu übersehende Rolle. Symbole sind bekanntlich Zeichen für Sachen oder Vorgänge, denen alles Nebensächliche oder Zufällige fehlt und wo die jeweiligen Inhalte in Bereichen leben, denen allgemeine Bedeutung und dauerhafter Wert zugeschrieben werden kann. Die in den Bildergeschichten Buschs so zahlreich verwendeten Gesten, insbesondere die Hand- und Fingerzeichen, legen sehr bald die Frage nahe, ob es sich hier nicht auch um deutungsbedürftige Zeichen handeln könnte.
Handgesten haben kommunikative Funktion und darüber hinaus oft Symbolwert.13) In den Bildergeschichten Wilhelm Buschs werden sie geradezu als dramaturgisches Mittel eingesetzt. So treten sie dort entweder in abwehrender, bzw. mahnender Gestalt auf, oder sie locken und sind Zeichen der Verheißung. Die ganze Palette ihrer Möglichkeiten zeigt z.B. Hieronymus Jobs während seiner Predigt auf der Kanzel. (GA II, S. 317ff.)
Die hier mehr spielerisch eingesetzten Mittel zur Unterstützung des Gesprochenen erhalten in der Sammlung „Die Haarbeutel“ ernsthafteren Charakter. So wehrt die Wirtin Pauline mit energischer Handgeste den Heiratsantrag ihres Mieters Döppe ab. – Ähnlich theatralisch entsagt im Alter die „Fromme Helene“ dem Alkohol, wie auch der „Heilige Antonius“ als Beichtvater die Annäherungsversuche der schönen Monika zurückweist. (GA II, S. 114))
Mahnend wird der Zeigefinger erhoben, wenn der Ladenbesitzer Kunze seinen Gehilfen auffordert, „keine dummen Streiche“ zu machen, solange er nicht da ist. (Die Haarbeutel. Fritze) – Onkel Nolte hält im 2. Kapitel seine Nichte Helene so zu tugendhaftem Verhalten an. – In der kleinen Bildergeschichte „Die Verwandlung“ versucht die Schwester Anna ihren Bruder vom Naschen abzuhalten. (GA I, S. 528ff.) – Schließlich erscheint der Tod mit erhobenen Zeigefinger, um das nahende Ende des Hieronymus Jobs anzukündigen.
Gesten „werden an Werte gebunden, die universelle Geltung beanspruchen.“ Und sie haben oft eine „moralische Dimension“ 14) In allen diesen Fällen, (die sich beliebig vermehren ließen), liegt der moralische Gehalt klar zu Tage, ganz gleich, ob vom Autor sachlich oder ironisch gemeint.
Verlockungen
Nicht immer sind die von Busch verwendeten Gesten und ihre Aussagen offen und eindeutig. Gelegentlich verwendet er vertraute Zeichen, deren Moral sich mehr oder weniger versteckt hält. Im „Heiligen Antonius“ (2. Kap.) winkt die verheiratete Julia dem jungen Mann vor dem Fenster und lädt ihn zu einem Schäferstündchen ein. – In derselben Geschichte verleitet die Nonne Laurentia mit lockendem Zeigefinger den inzwischen Mönch gewordenen Antonius dazu, gleich ihr das Kloster zu verlassen. (GA II, S. 89)
In der Prosaerzählung „Der Schmetterling“ winkt eine hübsche junge Hexe dem Ich-Erzähler mit dem Finger, der dieser Aufforderung natürlich Folge leistet. (GA IV, S. 236) – Auch „Balduin Bählamm“ auf dem Land lässt sich des Nachts von einer jungen Bäuerin zu einem vermeintlichen Abenteuer verleiten. (GA IV, S. 54)) In allen diesen Fällen aber endet das sich ankündigende Liebesabenteuer in einer Katastrophe:
Antonius wird bei der Julia vom überraschend heimkehrenden Ehemann entdeckt und landet im Abtritt. – Bählamm tappt in eine Falle, die die Bäuerin ihm gestellt hat und wird schrecklich misshandelt. – Im „Schmetterling“ wird der Ich-Erzähler von der Hexe in peinlicher Weise gequält. – Die Geste, die Lustvolles verspricht, erweist sich als trügerisch.





























