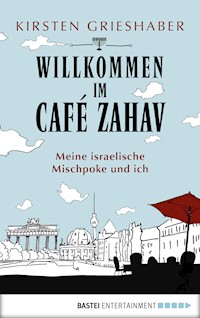
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im kleinen israelischen Restaurant von Kirstens Mann ist das Tohuwabohu programmiert. Während die Gäste ihren Hummus mit Pinienkernen löffeln, wächst der Familie schon wieder der Alltag über den Kopf: Mal will ein wildfremder Geistlicher Kirsten ungefragt zum Judentum konvertieren, dann wünscht sich Töchterchen Miri nach dem Kindergarten eine neue Hautfarbe, und im wenig mediterranen Berliner Winter nimmt auch noch der Gatte Reißaus. WILLKOMMEN IM CAFÉ ZAHAV erzählt die oft komischen, manchmal schockierenden und immer überraschenden Geschichten aus dem Leben einer ganz normalen deutsch-israelischen Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmung1. Der konvertierungstolle Rabbiner2. Familienbesuch im Heiligen Land3. Eran unterm Weihnachtsbaum4. Aris Vorhaut5. Miris braune Haut6. Vertreibung aus dem Paradies7. Reise nach Jerusalem8. Jesus, Moses und Allah9. Zwischen allen Stühlen10. Mixer in der Mikwe11. Zahav12. Bist du Jude?13. Der koschere Stammbaum14. »Ich bin eine Berlinerin«Über dieses Buch
Im kleinen israelischen Restaurant von Kirstens Mann ist das Tohuwabohu programmiert. Während die Gäste ihren Hummus mit Pinienkernen löffeln, wächst der Familie schon wieder der Alltag über den Kopf: Mal will ein wildfremder Geistlicher Kirsten ungefragt zum Judentum konvertieren, dann wünscht sich Töchterchen Miri nach dem Kindergarten eine neue Hautfarbe, und im wenig mediterranen Berliner Winter nimmt auch noch der Gatte Reißaus. WILLKOMMEN IM CAFÉ ZAHAV erzählt die oft komischen, manchmal schockierenden und immer überraschenden Geschichten aus dem Leben einer ganz normalen deutsch-israelischen Familie.
Über die Autorin
Kirsten Grieshaber, Jahrgang 1972, studierte Amerikanistik, Anglistik und Geschichte in Köln, Washington, D. C., und Oxford, Mississippi. Anschließend absolvierte sie im Jahr 2001 die Journalistenschule der Columbia Universität in New York. Sie arbeitete mehrere Jahre als freie Journalistin in New York und Berlin für New York Times, Zeit und Taz. Seit 2007 ist sie Deutschlandkorrespondentin für die Nachrichtenagentur Associated Press in Berlin, zuständig für Reportagen über Flüchtlingsthemen, Einwanderung und Religion. Kirsten Grieshaber ist mit einem Israeli verheiratet und Mutter zweier Kinder.
KIRSTEN GRIESHABER
WILLKOMMEN
IM
CAFÉ ZAHAV
Meine israelischeMischpoke und ich
BASTEI ENTERTAINMENT
Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Artur Senger, Köln
Titelillustration: © getty-images/Eastnine Inc. | © FinePic/shutterstock (4)
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6072-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Familie
1. Der konvertierungstolle Rabbiner
Es ist ein früher Herbstabend im Zahav, dem israelischen Restaurant meines Mannes in Berlin-Mitte. Draußen rattert eine Straßenbahn vorbei, es dämmert schon. Drinnen strahlt das Licht der bunten Kerzen, die auf den weißen Holztischen stehen. Der Ansturm der Abendgäste hat noch nicht begonnen. Ein junges Paar sitzt auf einer Bank am Fenster und unterhält sich leise. Die beiden haben frischen Minztee bestellt und löffeln gemeinsam ein Eis mit Dattelhonig und gehackten Pistazien. Die Wände des Ladenlokals sind dicht behängt mit Bildern aus Israel. Betende Männer an der Klagemauer. Marktschreier hinter Fässern voll bunter Oliven. Badende Touristen im Toten Meer. In der rechten hinteren Ecke des Restaurants hängt ein langes Holzregal mit hebräischen Büchern. Neben einer Schwingtür, die den Gastbereich vom Vorratsraum abtrennt, stapeln sich Kisten mit dunkelroten Granatäpfeln, rechts davon geht es in die Küche. Es duftet nach gerösteten Auberginen und frisch gekochten Kichererbsen.
Mein Mann Eran und ich teilen uns gerade einen Teller warmen Hummus mit Pinienkernen, als die Tür aufgeht und ein alter Mann eintritt. Er sieht aus wie ein Rabbiner aus einem Märchen. Sein gebeugter Körper ist in einen schwarzen Mantel gehüllt, eine dunkelblaue, goldbestickte Samtkippa lugt seitlich unter einem Hut mit breiter Krempe hervor. Ein langer, weißer Bart umrahmt das hagere Gesicht, die grauen Schläfenlocken hat er hinters Ohr geklemmt. Der Mann schüttelt laut eine blecherne Sammelbüchse, als versuche er, mit dem Münzgerassel die hymnischen Rhythmen der israelischen Rock-Songs zu übertönen, die aus einem CD-Player hinten in der Küche erklingen. Offensichtlich will er Spenden sammeln für einen guten, jüdischen Zweck. Doch dann bleibt sein Blick an Eran hängen. Misstrauisch mustert er meinen Mann mit seinem kahlrasierten Kopf, der braunen Haut und den warmen, honigfarbenen Augen. Obwohl es draußen schon unangenehm kühl ist, trägt er nur ein T-Shirt, beige Cargo-Shorts und Sandalen, als ob er mit diesem trotzigen Aufzug die Ankunft des Winters verhindern könne.
Auf Erans Schoß wippt unser kleiner Sohn Ari und nuckelt zufrieden an seinem blauen Lieblingsschnuller. Unsere vierjährige Tochter Miri sitzt daneben und malt. Ihre dunkelbraunen, seidigen Haare sind zu zwei Zöpfchen geflochten, sie summt selbstvergessen Kindergartenlieder vor sich hin. Den mysteriösen Mann in seinem mittelalterlich wirkenden Gewand hat sie überhaupt nicht bemerkt.
Der forschende Blick des alten Mannes gleitet von Eran und Ari mit seinen blonden Babylöckchen weiter hinüber zu Miri und mir. Auf Hebräisch, vermengt mit ein paar Brocken Deutsch, fragt er Eran, ob Ari sein Sohn sei. Dann weist er mit einer Kopfbewegung zu mir, typisch deutsch mit blonden Haaren und blauen Augen, und will wissen, ob ich die dazugehörige Frau und Mutter sei. Eran bejaht.
»Ist sie Jüdin?«, fragt der Alte.
»Lo«, verneint Eran knapp auf Hebräisch.
Der Alte runzelt die Stirn und betrachtet unsere Familie mit unverhohlenem Widerwillen. Es gefällt ihm ganz offensichtlich nicht, dass Eran mit einer Schickse, so die abwertende Bezeichnung einer Nichtjüdin, verheiratet ist. Er überlegt einen Moment und dreht dabei seine linke Schläfenlocke um den Zeigefinger. Dann erklärt er, dass er Rabbiner sei, und macht meinem Mann ein »unkoscheres« Angebot: In unserem Fall könne er eine Ausnahme machen, die sonst so strengen Übertrittsregeln zum Judentum ignorieren und mich auf der Stelle mit ein paar ausgewählten Segenssprüchen konvertieren.
Ich bin sprachlos. Hier wird über meine Religionszugehörigkeit verhandelt, und keiner fragt, was ich von einem Spontanübertritt zum Judentum halte.
Eran guckt den Rabbi konsterniert an und lehnt dankend ab. So leicht gibt sich dieser aber nicht geschlagen. Im Gegenteil, er fängt an, so schnell auf Eran in Hebräisch einzureden, dass ich kein Wort mehr verstehe. Eindringlich schwingt er seinen Zeigefinger erst in meine Richtung und deutet dann aufgeregt auf unsere Kinder, als sei drohendes Unheil im Verzug. Immer näher rückt er an Eran heran und scheppert dabei so laut mit seiner Blechdose, dass sogar das Pärchen am Fenster verstummt, die Teegläser abstellt und zu uns hinüberstarrt. Solch ein Spektakel bekommt man in Berlin nicht alle Tage geboten.
Selbst Miri guckt erstaunt hoch von ihren Malereien und wundert sich über den Schlamassel. Dem Rabbiner ist das egal. Eran aber nicht. Er ist eigentlich ein sehr geduldiger Mensch und hat zunächst versucht, die Heilsreden des alten Mannes zu ignorieren. Doch als er merkt, dass sogar seine Kunden anfangen, über uns zu tuscheln, wird es ihm zu viel. Abrupt drückt er mir Ari in die Arme, steht auf und bemüht sich nicht länger, seine Fassung zu bewahren.
»Maspiek. Achschav«, herrscht er den Rabbi an, Schluss damit. Und zwar sofort. Eran ist mindestens einen Kopf größer als der Rabbiner, und seine Schultern sind bestimmt doppelt so breit. Er baut sich vor dem Rabbi auf, verschränkt ärgerlich die Arme vor seinem Bauch und guckt den alten Mann wütend an. Normalerweise kann er mit dieser Drohgebärde sein Gegenüber schnell zum Verstummen bringen. Doch dem Rabbiner geht es offensichtlich darum, unsere Seelen zu retten – streng genommen ein urchristliches Gebaren, denn Juden missionieren nicht. Eigentlich.
Der Rabbi kann einfach nicht akzeptieren, dass wir keine »rein jüdische« Familie sind, und will Ordnung schaffen in unserer kleinen, bunten Welt. Ordnung in seinem Sinne. Und er ist verdammt hartnäckig. Er drängt sich an Eran vorbei, stellt sich vor mich und beginnt mit monotoner Stimme auf Hebräisch zu singen. Dabei scheppert er aggressiv seine Sammelbüchse. Aufgebracht beschimpft Eran den Rabbiner im übelsten israelischen Gossen-Slang, während dieser unbeirrt weitersingt. Eran schimpft und der Rabbi singt, immer lauter und immer fanatischer. Inzischen hat er sich wieder meinem Mann zugewandt. Wütend stehen sich nun die beiden Männer gegenüber und werden immer lauter.
Erst als Eran die Tür weit öffnet, den immer noch gestikulierenden Mann am Mantelkragen packt und Richtung Ausgang zieht, gibt der Rabbi endlich klein bei. Er murmelt noch einen letzten Segensspruch, verlässt widerwillig unser Restaurant und verschwindet mit wehendem Gewand in der Dunkelheit.
Das Judentum ist, wie schon erwähnt, eigentlich eine nicht-missionarische Religion und macht es Konversionswilligen äußerst schwer, zum jüdischen Glauben überzutreten. Mit einer Ausnahme: Nichtjüdische Frauen werden von der Familie des jüdischen Mannes oft zum Übertritt gedrängt, wenn sich abzeichnet, dass die Beziehung ernsthafter ist. Denn nur wenn die Frau jüdisch ist, sind auch die gemeinsamen Kinder jüdisch. Der Vater allein kann seine Jüdischkeit nicht an die Kinder vererben. Zwar sprechen manche progressiven Juden von den sogenannten »Vaterjuden«, aber wirklich anerkannt sind diese Kinder innerhalb der jüdischen Community nicht. Die fehlende Jüdischkeit der Mutter ist ein immenses Manko, das nur überwunden werden kann, indem die Vaterjudenkinder selbst konvertieren. Nur dann werden sie von der Mehrheit der Juden vollwertig als ihresgleichen angenommen.
Im normalen Fall dauert die Konversion zum Judentum mehrere Jahre. Übertrittswillige werden vom Rabbiner mehr als einmal nach Hause geschickt, um zu sehen, ob ihnen der Übertritt tatsächlich so wichtig ist, dass sie auch nach wiederholten Ablehnungen nicht aufgeben. Sie müssen Hebräisch lernen, die Thora studieren, die Mitzwot, also die jüdischen Vorschriften, auswendig lernen und die strengen Speisegesetze, die Kaschrut, einhalten.
Vielen nichtjüdischen Ehefrauen und Kindern von jüdischen Männern wird der Übertritt allerdings etwas leichter als anderen gemacht, denn nebst angestrebtem monoreligiösem Familienfrieden, spielen auch simple demografische Erwägungen eine Rolle. Christlich-jüdische Mischehen in den USA, die seit Jahrtausenden andauernde Verfolgung und der Holocaust haben die Zahl der Juden so dezimiert, dass sich die Gemeinden über jeden zusätzlichen Juden freuen.
Für mich war der Übertritt zum Judentum eigentlich nie ein Thema. Ich hatte, bis ich Eran kennenlernte, ein erfülltes Leben als ungetauftes Heidenkind katholischer Eltern im Rheinland gelebt und konnte mir gut vorstellen, dies auch weiterhin so zu tun. Wir feierten bei uns zu Hause zwar Weihnachten und Ostern mit allem Brimborium, aber ansonsten spielte der Glaube in unserer Familie keine große Rolle. Mein Vater war als Nachkriegskind in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen. Sonntags war die Gemeinde geschlossen zur katholischen Messe in die Kirche gegangen. Im barocken Hauptschiff liegt ein über und über mit Diamanten und Gold behängtes Skelett von einem mir unbekannten Märtyrer, das ich bei unseren seltenen Besuchen dort immer mit angenehmem Grusel betrachte. Mein Vater und seine Eltern zogen, als er sechs Jahre alt war, nach Heidelberg um, aber er verbrachte weiterhin alle Schulferien in Bayern bei seiner Großmutter. In Heidelberg bekam er während seiner Schulzeit viel Unterstützung von katholischen Priestern, die seinen Wissendurst mit Erklärungen und Büchern stillten, die es zu Hause nicht gab. Als Meeresbiologe hatte er während seiner Arbeit nicht viel mit Religion zu tun, aber er war der Kirche gegenüber immer wohlwollend eingestellt und dankbar für die Hilfe, die er in seiner Jugend bekommen hatte. Darüber hinaus betrachtete mein Vater Religion als seine Privatangelegenheit.
Meine Mutter war das Kind einer »Mischehe«. Ihre Mutter war evangelisch, ihr Vater katholisch. Als die beiden 1938 heirateten, war das ein solcher Skandal, dass die Mutter meines Großvaters der Hochzeit fernblieb. Außerdem musste meine Oma schwören, dass sie ihre Kinder im katholischen Glauben erziehen würde. Das hatte zur Folge, dass meine Mutter ein von katholischen Nonnen geführtes Gymnasium in Hessen besuchen musste und über die Jahre einen regelrechten Widerwillen gegen die Kirche entwickelte. Regelmäßig fiel sie beim Schulgottesdienst wegen des beißenden Weihrauchgeruchs in Ohnmacht, aber trotzdem wurde sie jede Woche aufs Neue genötigt, an der Messe teilzunehmen. Wenn sie meine jüngere Schwester Friederike und mich als Kinder zum Lachen bringen wollte, erzählte sie uns Geschichten über ihre Klassenlehrerin, eine alte Nonne, die so schamhaft war, dass sie beim Umziehen sogar den Vogelkäfig ihres Papageis verhängte, damit der keinen Blick auf ihren jungfräulichen Körper erhaschen konnte.
In der Grundschule hänselten mich die anderen Kinder manchmal, weil meine Eltern, die beide Naturwissenschaftler sind, nur standesamtlich geheiratet hatten. Wir besaßen noch nicht einmal eine Bibel im Haus, und ich war stets das einzig ungetaufte Kind in der Klasse.
»Wir können uns jeden Namen für dich aussuchen, den wir wollen. Du bist nicht getauft und hast deswegen nie einen richtigen Vornamen bekommen«, ärgerten mich die anderen Schüler mit kindlicher Fiesheit und jagten mich über den Pausenhof. Als ich meiner Mutter davon zu Hause erzählte, ging sie am nächsten Tag zu meiner Klassenlehrerin und beschwerte sich. Von da an hatten die Hänseleien ein Ende.
Als Jugendliche rebellierte ich gegen das vermeintliche Establishment, und Religion war für mich nichts weiter als Opium fürs Volk und Kriegsrechtfertigung seit Ewigkeiten. Meine ablehnende Einstellung gegenüber Gottesgläubigkeit und Frömmigkeit änderte sich erst, als ich während meines Journalistikstudiums an der Columbia University ein Seminar über »religious reporting« belegte. Monatelang begleitete ich die unterschiedlichsten religiösen Gruppierungen in der Einwanderermetropole. Ich befragte die Menschen zu ihrem Glauben, schrieb über hinduistische Diwali-Feiern, beobachtete Mormonen beim Tür-zu-Tür-Missionieren und wurde zum muslimischen Zuckerfest eingeladen. Die verschiedenen Rituale und Glaubensrichtungen faszinierten mich, wenngleich auch eher aus journalistischer Neugierde als aus religiöser Überzeugung.
Eran war als Kind in Israel traditionell, aber nicht überaus religiös aufgewachsen. Die Eltern luden jeden Freitagabend Verwandte und Freunde zu einem großen Schabbat-Essen ein, bei dem gebetet und gesungen wurde. Sie gingen regelmäßig in die Synagoge und aßen weder Schweinefleisch noch andere unkoschere Lebensmittel, aber mit dem Fahrverbot am Schabbat nahmen sie es nicht so genau und unternahmen am Samstag gerne Ausflüge mit Kind und Kegel nach Jerusalem. Es war ihnen wichtig, dass Eran und seine vier Schwestern alle Regeln des Judentums kannten, aber sie übten keinen Druck auf sie aus, diese auch immer einzuhalten.
Eran selbst ist ein gläubiger Mensch, aber gleichzeitig sehr tolerant gegenüber anderen. So deutete er zwar am Anfang unserer Beziehung ein paarmal an, dass er sich freuen würde, wenn ich übertreten würde, akzeptierte aber, dass ich das nicht wollte. Mit der Zeit gewöhnte er sich daran, dass seine Freundin eine Schickse oder Goya, also eine Nichtjüdin war.
Erans Mutter Dana war zunächst nicht begeistert, als ihr Sohn erzählte, dass seine neue Freundin keine Jüdin sei. Vermutlich hoffte sie, dass ich mich irgendwann in die lange Reihe seiner Exfreundinnen einreihen würde. Als dies nicht geschah, war es schließlich Erans jüngste Schwester Lior, die Dana den Kopf wusch.
»Siehst du denn nicht, wie glücklich Eran mit Kirsten ist?«, fragte sie ihre Mutter. »Was ist dir wichtiger, ein glücklicher Sohn mit einer guten Frau, die nicht jüdisch ist, oder ein unglücklicher Sohn mit einer schlechten Frau, die jüdisch ist?«
»Ein glücklicher Sohn mit einer guten, jüdischen Frau wäre mir am liebsten«, antwortete Dana. Aber nachdem sie sich erst einmal an den Gedanken einer Schickse als Schwiegertochter gewöhnt hatte, warf sie ihre Vorurteile über Bord und liebte mich so sehr wie ihre eigenen Töchter.
Nicht so allerdings Erans Schwester Yael. Sie war nach der Geburt ihrer zweiten Tochter länger krank gewesen und hatte nach ihrer Genesung zu Gott gefunden. Zusammen mit ihrem Mann und den Kindern zog sie in die Nähe eines fundamentalistischen Rabbiners ins nordisraelische Safed. Dort lebt die Familie ein strikt religiöses Leben. Ihre fünf Kinder gehen auf religiöse Schulen, keusch getrennt nach Geschlechtern. Die Jungen tragen immer Kippa, die Mädchen stets weite Röcke und langärmlige Blusen. Es wird ständig gebetet, gibt nur koscheres Essen, und am Schabbat wird weder gearbeitet noch Auto gefahren. Man bleibt unter sich. Freundschaften zu Menschen außerhalb der orthodoxen Community gibt es nur selten und schon gar nicht zu Goyim, wie die Nichtjuden abwertend genannt werden.
Ich habe Erans Schwester Yael nur ein einziges Mal getroffen. Bei unserer ersten gemeinsamen Reise nach Israel fuhren wir als Überraschungsbesuch bei ihr vorbei. Hätten wir uns vorher angemeldet, wären wir wahrscheinlich gar nicht erst empfangen worden. Zum kleinen Haus von Yael und ihrem Mann Yehuda gehörte eine Autowerkstatt und ein großer Hof, auf dem ein paar Hühner herumspazierten und alte Dreiräder im Gras herumlagen. Yehuda, der als Kind aus Argentinien eingewandert war, hatte eigentlich Maschinenbau studiert. Aber nachdem erst seine Frau und dann er religiös geworden waren, hat er seinen Ingenieursjob aufgegeben und seither nur noch als Mechaniker gearbeitet. Die meiste Zeit war er mit religiösen Studien beschäftigt.
Yael, eine hagere Frau mit einem turbanähnlichen Kopftuch und knöchellangen, weiten Gewändern in gedeckten Farben, wirkte streng und lachte selten. Dafür ermahnte sie ständig ihre beiden kleinen Söhne, die Kippot wieder aufzusetzen, wenn sie ihnen beim Spielen vom Kopf fielen.
Wir bekamen Tee und ein paar Nüsse vorgesetzt, die Kinder schauten mich scheu an, als käme ich von einem anderen Stern. Eine Frau mit Tanktop und kurzen Hosen, die noch dazu kein Hebräisch sprach, hatten sie noch nie gesehen. Bei jeder Nuss, die die Kinder aßen, mussten sie ein kurzes Dankesgebet murmeln. Yael hielt uns zwei Stunden lang religiöse Vorträge mit einem fanatischen Glühen in den Augen. Ich verstand kaum etwas von dem, was sie sagte, denn Eran machte sich nicht die Mühe, mir ihre Monologe zu übersetzen. Und Yael weigerte sich, auf Englisch mit mir zu sprechen, obwohl sie der Sprache mächtig war.
Ein Jahr nach unserem Treffen mit Yael machten Eran, seine Schwester Lior, Mutter Dana und ich zusammen eine Woche Urlaub in Eilat, einem Badeort am Roten Meer im Süden Israels. Als wir abends gemeinsam auf der Hotelterrasse saßen und die Palmensilhouetten in der Dämmerung bewunderten, berichtete uns Dana von ihrem letzten Gespräch mit Yael. Diese hatte die Mutter beauftragt, uns auszurichten, dass sie jeglichen Kontakt mit Eran abbrechen würde, wenn er »seine Schickse« heiraten würde.
»Yael sagt, dass sie Kirsten nicht mal dann akzeptieren würde, wenn sie nur wegen dir, Eran, zum Judentum überträte«, teilte uns Dana sichtlich bedrückt mit. »Sie will in Zukunft nur dann etwas mit euch zu tun haben, wenn Kirsten aus purer Liebe zu Gott zum Judentum konvertiert.«
Ich war schockiert, und auch Eran wirkte betroffen, sagte aber nichts. Er musste die Nachricht erst einmal verdauen. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben so zurückgestoßen gefühlt. Dass man mich wegen meiner Herkunft und Andersartigkeit diskriminierte, war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich hatte ein Würgen im Hals und fühlte mich ungerecht behandelt. Ich hatte doch nichts gemacht. Warum konnte mich Erans Schwester nicht einfach so akzeptieren, wie auch ich sie akzeptierte mit ihrer ganzen, mir fremden Religiosität? Erschüttert fing ich an zu weinen, während Eran und seine Mutter stumm neben mir saßen. Lior tröstete mich. Sie war Atheistin und fand die religiösen Ansichten ihrer älteren Schwester unerträglich. Yael hatte Lior bei einem ihrer letzten Treffen ins Gesicht gesagt, dass sie noch keinen Mann gefunden habe, sei eine Strafe Gottes dafür, dass sie sich vom Judentum abgewandt habe. Und der Mutter hatte sie vorgehalten, sie würde nicht genug für das Seelenheil ihrer jüngsten Tochter beten. Lior war seitdem stinksauer auf ihre große Schwester, und die beiden sprachen kaum noch miteinander. Wenn doch, gab jedes Mal nur Streit und Tränen.
Mit ihrem Erpressungsversuch bewirkte Erans Schwester das genaue Gegenteil bei mir. Wütend über diese Diskriminierung, wurde mir mein Säkularismus wichtiger als je zuvor. Hätte ich jemals einen Übertritt in Erwägung gezogen, dann hatte Yael nun dafür gesorgt, dass dieser garantiert nicht stattfinden würde.
Mutter Dana war niedergeschmettert, denn wegen Yaels Fanatismus zog sich fortan ein Riss durch die Familie. Es war ihr nicht mehr möglich, die ganze Familie am Schabbat-Abend zu Hause um den Tisch zu versammeln. Wenn Eran und ich bei ihr waren, weigerte sich Yael mit ihrer Familie zu kommen.
Irgendwann war die Mutter so verzweifelt, dass sie nach Safed fuhr, um persönlich mit Yaels Rabbi zu sprechen. Er hatte Yael schließlich gesagt, dass sie den Kontakt zu uns abbrechen müsse. Dana, Eran und Lior waren davon überzeugt, dass er Yael und Yehuda einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen hatte, nachdem sie sich seiner Gemeinde in Safed angeschlossen hatten. Der Rabbiner empfing Dana zwar, aber er war unerbittlich. Dana flehte ihn an, warf ihm vor, dass er ihre Familie zerstöre, und wurde schließlich so wütend, dass sie sogar anfing, ihm zu drohen.
»Wenn du Yael nicht dazu bringst, meinen Sohn und seine Freundin zu akzeptieren, dann werde ich zum Islam übertreten«, schrie sie ihn an.
Das war die schlimmste Androhung, die Dana sich ausdenken konnte, denn ihre Beziehung zu Muslimen war mehr als kompliziert. Als Kind war sie im Iran aufgewachsen und immer von den Lehrern geschlagen worden, wenn sie die Suren des Koran im Unterricht nicht auswendig rezitieren konnte. Wenn sie als kleines Mädchen über den Markt ging und, wie es Kinder eben gerne tun, die saftigen Früchte anfasste, schrien die Verkäufer sie an: »Du dreckiges Judenkind, lass die Finger von unserem Obst.« Diese Erfahrung hatte bei ihr unheilbare Narben hinterlassen. Alles, was mit dem Islam zu tun hatte, betrachtete sie mit größtem Argwohn.
Doch der Rabbi ließ sich auch von Danas Androhung nicht beeindrucken, und so musste sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren.
Eran war erschüttert von den Forderungen seiner Schwester Yael und unendlich traurig. Er war durch und durch ein Familienmensch, und der Gedanke, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Schwester, ihrem Mann Yehuda und seinen fünf geliebten Neffen und Nichten haben durfte, schmerzte ihn gewaltig. Andererseits hatte er nicht die Absicht, sich von Yael erpressen zu lassen. Er rief noch einmal bei ihr an und versuchte, sie zur Vernunft zu bringen, aber Yael legte auf, sobald sie seine Stimme hörte. So heiratete er mich trotz aller Drohungen seiner Schwester, und seitdem haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen.
Als Eran und ich uns kennenlernten, hatten wir keine Ahnung davon, was da einmal alles auf uns zukommen würde. Wir hatten beide gerade unser Journalistikstudium an der Columbia University in New York begonnen. Es war ein schwüler, heißer Tag, und wir waren auf einer von der Uni organisierten Busfahrt durch Brooklyn unterwegs. Bei einer kurzen Mittagspause in einem jamaikanischen Schnellimbiss unterhielten wir uns ein paar Minuten über die Vergangenheit, wie es Israelis und Deutsche eben tun, wenn sie sich zum ersten Mal begegnen.
»Ihr Deutschen habt uns nicht gerade nett behandelt im letzten Jahrhundert«, sagte Eran zu mir, nachdem er sich vorgestellt hatte. Dabei war er mir natürlich schon längst auf dem Campus aufgefallen mit seinem Seeräubergesicht und der wilden schwarzen Lockenpracht, die er damals noch hatte.
Während ich noch überlegte, ob ich auf seinen Spruch reflexhaft deutsch und entschuldigend reagieren sollte, merkte ich, dass er mit mir flirtete. Der Holocaust als Pick-Up-Line, das war mir bislang auch noch nicht passiert.
»Und du mit deinen blauen Kulleraugen und blonden Locken bist auch nicht der unschuldige arische Engel, für den dich alle halten«, fügte er grinsend hinzu.
Eran gefiel mir. Erleichtert warf ich die mir von meinen Alt-Achtundsechziger-Lehrern indoktrinierten Schuldgefühle über Bord und entspannte mich.
Wir waren uns schnell einig, dass wir den Holocaust und die deutsche Schuld nicht länger diskutieren müssten. Es gab wirklich nichts Neues mehr zur Shoah zu sagen. Dachten wir damals. Und verstanden uns von nun an bestens. Wir halfen uns gegenseitig beim Studium, gingen manchmal abends zusammen mit anderen Kommilitonen feiern und schäkerten miteinander, aber unsere Beziehung blieb platonisch, auch wenn es immer knisterte zwischen uns. Mit Vergnügen erzählten wir uns von unseren seltsamen Erfahrungen, die wir beide beim Dating mit Amerikanern (erstes Treffen Kino, zweites Treffen Restaurant, drittes Treffen Sex) machten. Je besser wir die Amis kennenlernten, desto fremder wurden sie uns und desto ähnlicher erschien uns die deutsche und israelische Kultur im Vergleich.
Zwei Jahre nach unserem Uniabschluss verließen wir New York. Unabhängig voneinander zogen wir beide nach Berlin. Eran wollte ein Buch schreiben. Die Kombination von Prostituierten und Panzern, die nach dem 11. September vor der Neuen Synagoge auf der Oranienburger Straße auf und ab patrouillierten, fand er so faszinierend, dass ihn hier die Muse küsste.
Das behauptete er zumindest, in Wirklichkeit war er natürlich mir hinterhergezogen, das wollte er nur nicht zugeben! Ich arbeitete in Berlin als freie Journalistin für deutsche und amerikanische Zeitungen. Manchmal schrieben wir auch gemeinsam Reportagen.
Bei der Recherche zu einer Story über Lebensborn-Kinder für die israelische Zeitung »Ha’aretz« kamen wir uns näher. Im Wonnemonat Mai fuhren wir gemeinsam nach Wernigerode, um Menschen zu interviewen, die in den von Heinrich Himmler gegründeten SS-Heimen zur Welt gekommen waren. Viele von ihnen waren uneheliche Kinder, deren Mütter davon abgehalten werden sollten, Abtreibungen vorzunehmen. Wer hier sein Kind zur Welt brachte, musste einen Ariernachweis über viele Generationen hinweg erbringen. Oft, aber nicht immer, waren die Väter auch Mitglieder der SS. Die Kinder kamen meist zu Adoptiveltern und leiden bis heute unter ihren Lebensgeschichten. Bei der Besichtigung eines ehemaligen Lebensborn-Heims in Wernigerode trafen wir gebrochene ältere Menschen, die keinen Frieden schließen konnten mit sich selbst, weil sie gleichzeitig die Nachkommen der Täter, aber auch deren Opfer waren.
Auf dem Rückweg nach Berlin fuhren wir über gewundene Landstraßen durch den Harz. Am Straßenrand blühte zitronengelb der Raps, die Amseln tirilierten in der Abenddämmerung, und bei einer Pause küssten wir uns zum ersten Mal im blauen Licht einer Aral-Tankstelle.
Manchmal bin ich versucht, einen Psychiater zu bitten, mir diesen folgenreichen Tag samt Lebensborn-Impulsen zu analysieren. Aber dann denke ich doch wieder, dass es gesünder ist, manche Begebenheiten einfach nur für sich sprechen zu lassen.
Ein Jahr später zogen wir wieder zurück nach New York, weil ich dort einen festen Job bei einer Nachrichtenagentur angeboten bekommen hatte. Dieses Mal überquerten wir gemeinsam den Atlantik. Eran schrieb weiterhin an seinem Buch und eröffnete nebenbei eine Umzugsfirma, wie Israelis es oft und gerne in den USA machen. Jede Einwanderergruppe hat hier ihre Nische: Die Chinesinnen betreiben Schönheitssalons, die Iren arbeiten im Baugewerbe, die Mexikaner verdingen sich als Tagelöhner, und die Israelis haben das Umzugswesen fest in ihrer Hand.
In New York fühlte sich Eran wie ein Fisch im Wasser. Er kannte jede Straßenecke, jeden Shop, jede Bar. Schließlich hatte er seit seiner Entlassung aus der Armee fast durchgehend dort gelebt. Als Jude gehörte er hier voll dazu, denn die Mehrheit aller weißen New Yorker sind Juden. Wenn wir abends mit jüdisch-amerikanischen Freunden ausgingen, konnten sie gar nicht genug kriegen von ihm, dem ehemaligen israelischen Elitesoldaten. Sie erzählten Eran von romantischen Jugendaustauschen im Kibbuz in Israel und radebrechten mit ihrem dicken Ami-Akzent ein paar Wörter auf Hebräisch zusammen.
Amerikanische Juden neigen Israelis gegenüber oftmals zu Schuldkomplexen, weil sie ein komfortables Leben in Sicherheit führen und den Staat Israel nur mit Geldspenden unterstützen, während die Israelis ihr Land als Soldaten mit dem eigenen Leben verteidigen.
Mich ließen die New Yorker Juden links liegen. Mit hochgezogener Augenbraue erwähnten sie mir gegenüber höchstens entfernte Onkel und Tanten, die Überlebende der Shoah seien. Oder sie erzählten, dass sie bei ihren Reisen immer die jeweiligen Holocaust-Museen vor Ort besuchten, sei es in Jerusalem, Berlin oder Houston, Texas.
Während Erans Umzugsunternehmen in der Bronx immer weiter expandierte und er sich auf den Umzug von Büros mithilfe ehemaliger Sträflinge spezialisierte, saß ich im Schichtbetrieb rund um die Uhr am Newsdesk und schrieb US-Nachrichten für den internationalen Dienst um. Wenn wir nicht arbeiteten, genossen wir New York und entdeckten die vielen verschiedenen Nachbarschaften der Millionenstadt. Fast jeder hier, so schien es zumindest, war ein Einwanderer. Wir alle waren Fremde, und deswegen wurde keiner ausgegrenzt. Aus allen Ländern der Erde waren die Menschen nach New York gekommen, um ihren Traum von einem besseren Leben in Amerika zu erfüllen.
Wir wohnten in einem Hochhaus ein paar Straßenblöcke westlich vom Times Square auf der 43. Straße. Wenn wir von dort ein paar Stationen mit der U-Bahn fuhren, konnten wir nach kürzester Zeit in die unterschiedlichsten fremden Welten der Einwanderermetropole eintauchen. Eine vietnamesische Freundin nahm uns mit zu den Merengue-Partys ihrer dominikanischen Nachbarn in Washington Heights, in Flatbush gingen wir nachts zum karibischen Karnevalsumzug, in Flushing gab’s chinesisches Dim Sum samt Hühnerfüßen zum Frühstück, und mit einer indischen Freundin entdeckten wir die All-You-Can-Eat-Büfetts und Sari-Shops von Jackson Heights. Wenn einer von uns beiden Heimweh hatte, besuchten wir die israelischen und deutschen Stadtviertel von New York. Tausende Israelis leben in Fresh Meadows in Queens. Auf den Straßen wird Hebräisch gesprochen, es gibt Läden nur mit importierten Waren aus Israel, und an den Häusern hängen die blau-weißen israelischen Fahnen mit dem Davidstern neben dem amerikanischen Sternenbanner. Wenn man ein paar Blöcke weitergeht, fühlt man sich wie in einem mittelalterlichen jüdischen Schtetl. Die Männer tragen seidig glänzende, schwarze Kaftane und große, runde, tablettähnliche Hüte aus Bärenfell, die sie bei Regen mit speziell angefertigten Plastiküberzügen schützen. Die Mütter haben stets einen Tross von unzähligen Kindern hinter sich, und alle sprechen sie Jiddisch.
Wenn ich auf der Suche nach Heimatgefühlen war, fuhren wir mit dem Crosstown-Bus nach Yorkville an der Upper East Side von Manhattan. Hier wurde früher auf den Straßen fast nur Deutsch gesprochen, aber inzwischen waren die meisten deutschen Einwanderer verstorben. Einen deutschen Fleischer gab es noch und eine alte Bäckerei. Es fühlte sich surreal an, mitten in Manhattan auf Deutsch Leberwurst und Pumpernickel zu bestellen. Die Verkäuferinnen wirkten wie aus der Zeit gefallen mit ihren geblümten Kittelschürzen und den gewickelten Locken. Auch ihre Sprache war im Deutschland der Fünfzigerjahre stehen geblieben. Mit meiner modernen deutschen Heimat hatten sie nicht viel zu tun.
So sehr wir unsere Zeit in New York auch genossen, nach mehreren Jahren in Amerika entschieden wir uns, nach Europa zurückzukehren. Ich vermisste meine Eltern und meine Schwester und hatte das Gefühl, dass, wenn wir jetzt nicht wieder zurückgehen würden, wir den Absprung nicht mehr kriegen und wahrscheinlich für immer in den USA bleiben würden. Deutschland war meine Heimat, und bei aller Liebe zu New York wollten wir hier nicht unsere Kinder großziehen. Außerdem hätten wir uns in Amerika niemals die gleiche gute Schulausbildung wie in Deutschland für unsere (noch ungeborenen) Kinder leisten können. Einen Umzug nach Israel konnte ich mir nicht vorstellen, mein Horror vor Selbstmordattentätern, explodierenden Bussen und Raketenangriffen aus Gaza und dem Libanon war zu groß.
Nachdem wir uns für Berlin als unseren zukünftigen Wohnort entschieden hatten, fragte mich Eran, wie er dort aufenthaltstechnisch leben solle. Bei seinem ersten längeren Aufenthalt in Berlin war er alle drei Monate für ein Wochenende nach Prag gefahren, um durch die Wiedereinreise nach Deutschland sein Bleiberecht zu erneuern. Manchmal passte er nicht ganz so penibel mit den Daten auf, was dazu führte, dass wir einmal beim Abflug von Berlin-Tegel kurzzeitig von der Bundespolizei festgesetzt wurden, weil seine Aufenthaltserlaubnis abgelaufen war. Das wollten wir nicht unbedingt noch einmal wiederholen.
Wir saßen im kleinen Wohnzimmer unseres Apartments im dreißigsten Stock in Hell’s Kitchen mit Blick auf den Hudson River. Im Süden konnte man schemenhaft die Umrisse der Freiheitsstatue erkennen. Von unten drang der Lärm der niemals enden wollenden Autolawine hoch, die von New Jersey durch den Lincoln Tunnel nach Manhattan hineinrollte. Sachlich zählte ich Eran die verschiedenen Optionen auf, mit denen er eine langfristige Aufenthaltsgestattung für Deutschland erhalten würde.
»Du kannst ein Journalistenvisum beantragen, dich als Student an einer Berliner Uni einschreiben oder eine Aufenthaltsgenehmigung durch Heirat mit einem deutschen Staatsbürger bekommen«, erklärte ich.
Kaum hatte ich den Satz beendet, sah ich zu meiner großen Verwunderung, wie Eran zum Telefon griff und seine Mutter in Israel anrief. Viel verstand ich nicht. Nur das Wort »Chatuna«, das er ständig und euphorisch wiederholte, hatte ich gerade in meinem Hebräischkurs gelernt: Es bedeutete Hochzeit.
Misstrauisch setzte ich an, ihn zu fragen, was er denn gerade seiner Mutter erzählt habe, aber da wählte er schon die nächste Nummer. Diesmal sprach er mit seiner kleinen Schwester Lior. Anschließend strahlte er mich an, gab mir einen Kuss, und erklärte: »Ich habe meiner Familie nur berichtet, dass du mir einen Heiratsantrag gemacht hast. Und dass ich Ja gesagt habe.«
Danach verlor er keine Minute und fing sofort an, unsere Hochzeit zu organisieren, fast so, als hätte er Angst, ich könnte es mir noch mal anders überlegen, wenn ich mich von seinem Überrumpelungsmanöver wieder erholt hätte. Zwei Wochen nach meinem vermeintlichen Antrag hatte er einen Termin beim Standesamt in der City Hall von Manhattan organisiert. Unsere Eltern fühlten sich ebenfalls leicht überwältigt von der kurzfristig anberaumten Hochzeit und waren kaum nach New York zu locken. Mein Vater hatte geschäftliche Termine, die er nicht verschieben konnte, meine Schwester stand mitten im Physikum, aber wenigstens meine Mutter kam. Erans Vater war schon vor Jahren gestorben, und seine Mutter fand auch alles viel zu kurzfristig und sagte ab. Nur Erans Schwestern Lior und Efrat mit ihrem Mann Joni und den beiden kleinen Nichten würden kommen.
Zwei Tage vor der Trauung überlegte sich Mutter Dana dann wieder alles anders. Die Hochzeit ihres einzigen Sohnes konnte sie doch nicht verpassen! Sie rief beim Reisebüro an, aber alle Flüge waren ausgebucht. Kurzerhand packte sie ihren Koffer, fuhr zum Flughafen und marschierte direkt zum Schalter der größten israelischen Fluggesellschaft El Al.
»Ich muss auf den nächsten Flug nach New York mitkommen, Motek«, sagte sie zur jungen El-Al-Angestellten und nannte sie Motek oder Schätzchen, wie sie es üblicherweise mit allen jungen Frauen machte. »Mein Sohn heiratet übermorgen in Manhattan, da darf ich nicht fehlen.«
»Der Flieger ist ausgebucht und hebt in zwei Stunden ab, tut mir leid«, erwiderte die Angestellte und drehte sich dem nächsten Kunden zu. Sie hatte noch nicht verstanden, mit wem sie es zu tun hatte.
»Motek, das ist keine Option, ich muss mitfliegen«, erklärte Dana nachdrücklich. Wenn sie etwas wollte, konnte sie ein richtiger Nudik, eine echte Nervensäge sein. Genau wie ihr Sohn.





























