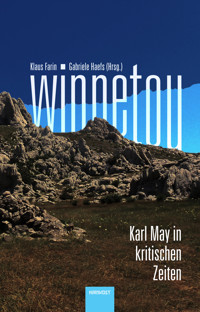
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Karl May (1842–1912) ist einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren – die Gesamtauflage seiner Bücher wird auf über 200 Millionen Exemplare geschätzt. Seine Erzählungen und deren einzigartige Rezeptionsgeschichte sind ein Zeugnis für die Macht der Literatur, kulturelle Barrieren zu überwinden und universelle Werte zu vermitteln. Einst stand Karl May für Freiheit, Pazifismus und Antikolonialismus. May erweckte in Millionen jugendlicher Leser:innen Bewunderung und Respekt für die indigenen Völker und Kulturen Nordamerikas. Winnetou, der edle Häuptling der Apachen, ist eine der positivsten Figuren der Weltliteratur. Und heute soll derselbe Winnetou die Verherrlichung kolonialistischer Fremdbestimmung und Identitätsdiebstahl symbolisieren? Im Sommer 2022 lösten zwei Kinderbücher und ein Kinofilm eine heftige Diskussion mit mehr als 100.000 Medienbeiträgen – darunter 3.200 Artikel in Tageszeitungen und Magazinen – aus. Dieser Band untersucht das literarische Werk Karl Mays und dessen Bedeutung unter der Perspektive von kultureller Aneignung, Auswanderung und europäischem Kolonialismus. Darüber hinaus enthält er Beiträge von Christian Feest über das "Indianer"-Bild in Europa, Andreas Brenne über das "Indianer"-Bild bei Karl May, Johannes Zeilinger zum historischen Hintergrund und der kolonialen Debatte seiner Afrika-Romane, Gunnar Sperveslage über Kara Ben Nemsi in Mekka. Koloniales Denken in Karl Mays Orientzyklus. Einführung und Nachwort von Klaus Farin und Gabriele Haefs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KLAUS FARINGABRIELE HAEFS(Hrsg.)
WINNETOU
KARL MAY INKRITISCHEN ZEITEN
Originalausgabe
© 2025 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;
[email protected]; http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage März 2025
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkund:innen und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Unsere Bücher kann man auch abonnieren!
Layout: Conny Agel
ISBN:
PRINT: 978-3-98857-045-1
PDF: 978-3-98857-047-5
EPUB: 978-3-98857-046-8
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos: https://www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag/
INHALT
KARL MAY
Winnetou
KLAUS FARIN
Einführung»Als Kind wäre ich gern Indianerhäuptling geworden«
CHRISTIAN FEEST
»Gibt es viele Indianer in Europa?«Anmerkungen zu einer langen Geschichte
ANDREAS BRENNE
Karl May und die IndianerEin sächsischer Utopist imaginiert Möglichkeitsräume
JOHANNES ZEILINGER
Karl May kämpft gegen die VersklavungZum historischen Hintergrund und der kolonialen Debatte seiner Afrika-Romane
GUNNAR SPERVESLAGE
Kara Ben Nemsi in MekkaEuropäische Überheblichkeit und koloniales Denken in Karl Mays Orientzyklus
GABRIELE HAEFS
Nachwort
Die Autor:innen
Anhang
Titelbildillustration zu Winnetou III von Sascha Schneider (1870–1927). Karl May lernte den homosexuellen Maler, Graphiker, Bildhauer und Professor für Aktzeichnen in Weimar 1903 kennen und beauftragte ihn mit der Illustration einer Werkausgabe seiner Reiseerzählungen im Verlag Friedrich Ernst Fehsenfeld
WINNETOU
KARL MAY
Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein; dies hat, so sonderbar es erscheinen mag, doch seine Berechtigung. Mag es zwischen beiden noch so wenig Punkte des Vergleichs geben, sie sind einander ähnlich in dem einen, dass man mit ihnen, allerdings mit dem einen weniger als mit dem andern, abgeschlossen hat: Man spricht von dem Türken kaum anders als von dem »kranken Mann«, während jeder, der die Verhältnisse kennt, den Indianer als den »sterbenden Mann« bezeichnen muss.
Ja, die rote Nation liegt im Sterben! Vom Feuerlande bis weit über die nordamerikanischen Seen hinauf liegt der riesige Patient ausgestreckt, niedergeworfen von einem unerbittlichen Schicksal, welches kein Erbarmen kennt. Er hat sich mit allen Kräften gegen dasselbe gesträubt, doch vergeblich; seine Kräfte sind mehr und mehr geschwunden; er hat nur noch wenige Atemzüge zu tun, und die Zuckungen, die von Zeit zu Zeit seinen nackten Körper bewegen, sind die Konvulsionen, welche die Nähe des Todes verkündigen.
Ist er schuld an diesem seinem frühen Ende? Hat er es verdient?
Wenn es richtig ist, dass alles, was lebt, zum Leben berechtigt ist, und dies sich ebenso auf die Gesamtheit wie auf das Einzelwesen bezieht, so besitzt der Rote das Recht zu existieren nicht weniger als der Weiße und darf wohl Anspruch erheben auf die Befugnis, sich in sozialer, in staatlicher Beziehung nach seiner Individualität zu entwickeln. Da behauptet man nun freilich, der Indianer besitze nicht die notwendigen staatenbildenden Eigenschaften. Ist das wahr? Ich sage: Nein!
Der Weiße fand Zeit, sich naturgemäß zu entwickeln; er hat sich nach und nach vom Jäger zum Hirten, von da zum Ackerbauer und Industriellen entwickelt; darüber sind viele Jahrhunderte vergangen; der Rote aber hat diese Zeit nicht gefunden, denn sie wurde ihm nicht gewährt. Er soll von der ersten und untersten Stufe, also als Jäger, einen Riesensprung nach der obersten machen, und man hat, als man dieses Verlangen an ihn stellte, nicht bedacht, dass er da zu Fall kommen und sich lebensgefährlich verletzen muss.
Es ist ein grausames Gesetz, dass der Schwächere dem Stärkeren weichen muss; aber da es durch die ganze Schöpfung geht und in der ganzen irdischen Natur Geltung hat, so müssen wir wohl annehmen, dass diese Grausamkeit entweder eine nur scheinbare oder einer christlichen Milderung fähig ist, weil die ewige Weisheit, welche dieses Gesetz gegeben hat, zugleich die ewige Liebe ist. Dürfen wir nun behaupten, dass in Beziehung auf die aussterbende indianische Rasse eine solche Milderung stattgefunden hat?
Es war nicht nur eine gastliche Aufnahme, sondern eine beinahe göttliche Verehrung, welche die ersten »Bleichgesichter« bei den Indsmen fanden. Welcher Lohn ist den Letzteren dafür geworden? Ganz unstreitig gehörte diesen das Land, welches sie bewohnten; es wurde ihnen genommen. Welche Ströme Blutes dabei geflossen und welche Grausamkeiten vorgekommen sind, das weiß jeder, der die Geschichte der »berühmten« Conquistadores gelesen hat. Nach dem Vorbild derselben ist dann später weiter verfahren worden. Der Weiße kam mit süßen Worten auf den Lippen, aber zugleich mit dem geschärften Messer im Gürtel und dem geladenen Gewehr in der Hand. Er versprach Liebe und Frieden und gab Hass und Blut. Der Rote musste weichen, Schritt um Schritt, immer weiter zurück. Von Zeit zu Zeit gewährleistete man ihm »ewige« Rechte auf »sein« Territorium, jagte ihn aber schon nach kurzer Zeit wieder aus demselben hinaus, weiter, immer weiter. Man »kaufte« ihm das Land ab, bezahlte ihn aber entweder gar nicht oder mit wertlosen Tauschwaren, welche er nicht gebrauchen konnte. Aber das schleichende Gift des »Feuerwassers« brachte man ihm desto sorgfältiger bei, dazu die Blattern und andere, noch viel schlimmere und ekelhaftere Krankheiten, welche ganze Stämme lichteten und ganze Dörfer entvölkerten. Wollte der Rote sein gutes Recht geltend machen, so antwortete man ihm mit Pulver und Blei, und er musste den überlegenen Waffen der Weißen wieder weichen. Darüber erbittert, rächte er sich nun an dem einzelnen Bleichgesicht, welches ihm begegnete, und die Folgen davon waren dann stets förmliche Massaker, welche unter den Roten angerichtet wurden. Dadurch ist er, ursprünglich ein stolzer, kühner, tapferer, wahrheitsliebender, aufrichtiger und seinen Freunden stets treuer Jägersmann, ein heimlich schleichender, misstrauischer, lügnerischer Mensch geworden, ohne dass er dafür kann, denn nicht er, sondern der Weiße ist schuld daran.
Die wilden Mustangherden, aus deren Mitte er sich einst kühn sein Reitpferd holte, wo sind sie hingekommen? Wo sieht man die Büffel, welche ihn ernährten, als sie zu Millionen die Prärien bevölkerten? Wovon lebt er heute? Von dem Mehl und dem Fleisch, welches man ihm liefert? Schau zu, wie viel Gips und andere schöne Dinge sich in diesem Mehl befinden; wer kann es genießen! Und werden einem Stamm einmal hundert »extra fette« Ochsen zugesprochen, so haben diese sich unterwegs in zwei oder drei alte, abgemagerte Kühe verwandelt, von welchen kaum ein Aasgeier einen Bissen herunterreißen kann. Oder soll der Rote vom Ackerbau leben? Kann er auf seine Ernte rechnen, er, der Rechtslose, den man immer weiter verdrängt, dem man keine bleibende Stätte lässt?
Welch eine stolze, schöne Erscheinung war er früher, als er, von der Mähne seines Mustangs umweht, über die weite Savanne flog, und wie elend und verkommen sieht er jetzt aus in den Fetzen, welche nicht seine Blöße bedecken können! Er, der in überstrotzender Kraft einst dem schrecklichen grauen Bären mit den Fäusten zu Leibe ging, schleicht jetzt wie ein räudiger Hund in den Winkeln umher, um sich, hungrig, einen Fetzen Fleisch zu betteln oder zu stehlen!
Ja, er ist ein kranker Mann geworden, ein sterbender Mann, und wir stehen mitleidig an seinem elenden Lager, um ihm die Augen zuzudrücken. An einem Sterbebett zu stehen, ist eine ernste Sache, hundertfach ernst aber, wenn dieses Sterbebett dasjenige einer ganzen Rasse ist. Da steigen viele, viele Fragen auf, vor allem die: Was hätte diese Rasse leisten können, wenn man ihr Zeit und Raum gegönnt hätte, ihre inneren und äußeren Kräfte und Begabungen zu entwickeln? Welche eigenartigen Kulturformen werden der Menschheit durch den Untergang dieser Nation verloren gehen? Dieser Sterbende ließ sich nicht assimilieren, weil er ein Charakter war; musste er deshalb getötet, kann er nicht gerettet werden? Gestattet man dem Bison, damit er nicht aussterbe, ein Asyl da oben im Nationalpark von Montana und Wyoming, warum nicht auch dem einstigen rechtmäßigen Herrn des Landes einen Platz, an dem er sicher wohnen und geistig wachsen kann?
Aber was nützen solche Fragen angesichts des Todes, der nicht abzuwenden ist! Was können Vorwürfe helfen, wo überhaupt nicht mehr zu helfen ist! Ich kann nur klagen, aber nichts ändern; ich kann nur trauern, doch keinen Toten ins Leben zurückrufen. Ich? Ja, ich! Habe ich doch die Roten kennen gelernt während einer ganzen Reihe von vielen Jahren und unter ihnen einen, der hell, hoch und herrlich in meinem Herzen, in meinen Gedanken wohnt. Er, der beste, treueste und opferwilligste aller meiner Freunde, war ein echter Typus der Rasse, welcher er entstammte, und ganz so, wie sie untergeht, ist auch er untergegangen, ausgelöscht aus dem Leben durch die mörderische Kugel eines Feindes. Ich habe ihn geliebt wie keinen zweiten Menschen und liebe noch heute die hinsterbende Nation, deren edelster Sohn er gewesen ist. Ich hätte mein Leben dahingegeben, um ihm das seinige zu erhalten, so wie er dieses hundertmal für mich wagte. Dies war mir nicht vergönnt; er ist dahingegangen, indem er, wie immer, ein Retter seiner Freunde war; aber er soll nur körperlich gestorben sein und hier in diesen Blättern fortleben, wie er in meiner Seele lebt, er,W i n n e t o u ,d e rg r o ß eH ä u p t l i n gd e rA p a c h e n .Ihm will ich hier das wohlverdiente Denkmal setzen, und wenn der Leser, welcher es mit seinem geistigen Auge schaut, dann ein gerechtes Urteil fällt über das Volk, dessen treues Einzelbild der Häuptling war, so bin ich reich belohnt.1
EINFÜHRUNG
»ALS KIND WÄRE ICH GERN INDIANERHÄUPTLING GEWORDEN«
KLAUS FARIN
Indianer, derWortart: Substantiv, maskulinGebrauch: diskriminierend
DUDEN
I.
Karl May (1842–1912) ist einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren – die Gesamtauflage seiner Bücher wird auf über 200 Millionen Exemplare geschätzt. Seine Erzählungen und deren einzigartige Rezeptionsgeschichte sind ein Zeugnis für die Macht der Literatur, kulturelle Barrieren zu überwinden und universelle Werte zu vermitteln.
Seine Erzählungen wurden vielfach verfilmt, adaptiert und als Theaterstücke aufgeführt. Das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) nennt heute – im Dezember 2024 – 663 Werke von ihm, die im Buchhandel erhältlich sind, sowie 646 weitere Titel über ihn und sein Werk. Dokumentiert sind auch über 60 Theaterstücke nach Werken von Karl May, darunter sogar zwei Ballettwerke, mit insgesamt mindestens 2.000 Aufführungen.2
Karl May hatte einen enormen Einfluss auf die deutsche Populärkultur. Auch wenn vor allem die filmischen Adaptionen oft kitschig und stereotypisiert sind, so haben sie doch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die indigenen Völker in das kulturelle Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit zu bringen und viele Menschen in Folge davon auch für echte Anliegen und Probleme der indigenen Völker zu sensibilisieren. Dass der Begriff »Indianer« im deutschsprachigen Raum anders als in den meisten anderen Regionen der Welt und als Begriffe für andere Ethnien und Gruppen (etwa »Zigeuner«) durchweg positiv und nicht rassistisch konnotiert ist, ist hauptsächlich das Verdienst von Karl May.
So gibt es auch unter Grünen zahlreiche Karl-May-Fans. Hans-Christian Ströbele bekannte im Interview mit dem Berliner Stadtmagazin tip, dass ihm Karl May schon immer näher lag als Karl Marx:
»Die ›Winnetous‹ habe ich dreimal gelesen. Bei Karl Marx habe ich nicht mal das Kapital ganz geschafft.«3
Claudia Roth bekennt sich heute noch öffentlich dazu.
»Winnetou war meine erste Liebe. Nach dem Tod von Nscho-tschi konnte ich weder essen noch schlafen.«4
Und auch Bettina Jarasch unterlag offenbar schon in ihrer Kindheit der Faszination des Popstars aus Sachsen. Auf dem Wahlparteitag der Berliner Grünen 2021 soll die Spitzenkandidatin für die Senatswahl menschlich präsentiert werden und wird von der Moderation nach ihren früheren Berufswünschen gefragt, bevor sie Berufspolitikerin wurde. Ihre Antwort:
»Als Kind wäre ich gern Indianerhäuptling geworden.«
Sofort erhebt sich jedoch in der grünen Community ein missbilligendes Raunen. Bettina Jarasch solle sich für den Gebrauch dieser »diskriminierenden kolonialistischen Fremdbezeichnung« entschuldigen, wird von diversen indigenen Deutschen gefordert. Zwei Stunden später offenbart die Spitzenpolitikerin der Grünen nicht nur ihre hohe persönliche Bereitschaft zum Opportunismus, sondern auch den autoritären Charakter großer Teile der Grünen-Mitglieder: Sie entschuldigt sich für die Träume ihrer Kindheit.
»Ich verurteile meine unreflektierte Wortwahl und meine unreflektierten Kindheitserinnerungen, die andere verletzen können.«
In der YouTube-Aufzeichnung ihres Interviews wird der inkriminierte Satz gelöscht.5
Einst stand Karl May – und vor allem Winnetou – für Freiheit und – so formulierten wir es in unserer progressiven Jugend – die Solidarität der Völker. Und heute soll derselbe Winnetou die Verherrlichung kolonialistischer Fremdbestimmung und Identitätsdiebstahl symbolisieren?
Schlagersänger Florian Silbereisen, der in einer ARD-Gala Klaus Lages Hit »1000 und 1 Nacht« wiedergeben wollte, traute sich nicht, das Wort »Indianer« auszusprechen, und aus »Erinnerst du dich, wir ham Indianer gespielt« wurde »zusammen gespielt«.6
Auf Facebook bat »ZDF heute«, das »I-Wort« nicht mehr zu verwenden:
»Hallo zusammen, wir freuen uns über eine Diskussion zum Thema. Bitte bleiben Sie dabei sachlich und vermeiden Sie pauschalisierte Äußerungen. Bitte achten Sie darauf, das I-Wort in der Kommunikation zu vermeiden, da wir rassistisch geprägten Begriffen keine Plattform geben möchten.«7
Als Alternativbegriffe schlägt der Sender »Indigene Völker« oder »Native Americans« vor.
In den Niederlanden werden Karl Mays Werke vom größten Verlag des Landes, Meulenhoff Boekerij, nicht mehr gedruckt und verkauft. In einer Erklärung des Amsterdamer Verlags heißt es:
»Bücher über die Abenteuer des Indianers Winnetou werden vom Verlag Meulenhoff Boekerij vom Markt genommen. Die Geschichten zeichnen ein unrealistisches und romantisierendes Bild der Geschichte indigener Völker und sind laut Kritikern voller falscher Klischees und Rassismus.«8
Würde dieses Kriterium der realitätsgerechten und nicht romantisierenden Darstellung der Welt in Romanen auf alle Autor:innen angewendet, müssten viele Verlage wohl große Teile ihres Programms schreddern. Denn dass die Darstellung von Prinzessinnen und Prinzen in der Kinderliteratur die gesellschaftliche Realität in Monarchien abbildet, dürfte eher die Ausnahme sein. Und entspringen die bösen Stiefmütter in unzähligen Kinderbüchern nicht einem misogynen Weltbild? Sind Internatsgeschichten nicht bloße Verharmlosungen der Realität, wie sie sich in den letzten Jahren nicht nur in kirchlichen Zusammenhängen enthüllte? Verschweigt das allseits beliebte Genre der Seeräubergeschichten nicht den oft mörderischen Charakter der Piraterie? Sind Love Stories, in denen nur heterosexuelle Paare vorkommen, noch zeitgemäß?
In Deutschland genügt schon das Wort »Indianer« auf dem Cover eines Buches, damit dieses Werk in vielen Buchhandlungen nicht mehr verkauft wird, selbst wenn es das Werk eines indigenen Autors ist,9 als wäre Indianer, ein über einhundert Jahre in Deutschland überaus positiv konnotierter Begriff, über Nacht plötzlich ein »N-Wort« geworden. The times they are a-changin’ …
Den aktuellen Anlass und vorläufigen Höhepunkt des Konflikts bzw. der Kampagne gegen Karl May und seine Werke bildete ein Instagram-Posting des Ravensburger Verlags im Sommer 2022:
»Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch Der junge Häuptling Winnetou verfolgt und wir haben heute entschieden, die Auslieferung der Titel zu stoppen und sie aus dem Programm zu nehmen.
Wir danken Euch für Eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich.
Unsere Redakteur*innen beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität oder kultureller Aneignung. Dabei ziehen sie auch externe Fachberater zu Rate oder setzen ›Sensitivity Reader‹ ein, die unsere Titel kritisch auf den richtigen Umgang mit sensiblen Themen prüfen. Leider ist uns all das bei den Winnetou-Titeln nicht gelungen. Wir haben einen Fehler gemacht und wir können euch versichern: Wir lernen daraus!«10
Bei den beiden zurückgezogenen Kinderbüchern handelte es sich um Merchandising-Produkte zum Kinofilm Der junge Häuptling Winnetou, die wenig mehr als transkribierte Texte und Bilder aus dem Film enthielten und wie der Film selbst außer den nach Karl Mays Kulturikonen benannten Helden nichts mit Karl May zu tun haben.11 (Dass eigentlich Karl May das Opfer dieser kulturellen Aneignung seines Werkes und Verunglimpfung seines Namens durch peinlich miserable Adaptionen seiner Erzählungen war und ist, wurde bisher nicht skandalisiert.)12 Das Überraschende war also zunächst weniger die Einstellung des Verkaufs als die Tatsache, dass diese Werke überhaupt veröffentlicht wurden und womöglich sogar Käufer gefunden hätten.
Die wenig spektakuläre Instagram-Mitteilung des Ravensburger Verlags vom 19. August 2022 löste in den Medien sofort eine Diskussion über »Zwang, Zensur, Gedankenkontrolle, Cancel Culture, Sprechverbote, Bücherverbrennung, Woke-Wahnsinn, linke Aktivistengruppen und eine angebliche Bedrohung der Demokratie«13 aus. Innerhalb nur einer Woche gab es weit mehr als 100.000 Beiträge, die wieder millionenfach geliked, geteilt und kommentiert wurden – darunter 8.600 redaktionelle Artikel und davon 3.200 von Tageszeitungen und Nachrichten-Magazinen, dokumentierte das Münchener Beratungsunternehmen für Kommunikation Scompler Technologies in einer Medienanalyse. »Der Tenor: Heftig laute, aber unlautere Kritik durch ›woke Gruppen‹ in den sozialen Medien hätte den Verlag in einem Shitstorm so sehr unter Druck gesetzt, dass er letztlich gar nicht anders konnte (oder das zumindest dachte), als sich einer ›radikalen Minderheit zu unterwerfen‹. Die aufgebrachte Menge sieht eine ›Tyrannei der Political Correctness‹ und wehrt sich heftig gegen jede Form von Verbot.
Datenanalysen zeigen jedoch: Diesen Shitstorm über das Buch oder den Film gab es nie, ebenso wenig wie Forderungen nach Verboten. Beide sind vielmehr eine Erfindung findiger Journalisten und Populisten, die entweder medieninkompetent sind oder aus politischem Interesse bzw. aus wirtschaftlichem Kalkül hetzen. Und viele andere Journalisten, Politiker, CEOs und Bürger sind darauf hereingefallen und haben sich instrumentalisieren lassen. Nach eigenen Aussagen hat der Ravensburger Verlag die Kritik seiner Community ernst genommen, einen Fehler eingesehen und daraufhin eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Nur passt das wohl nicht in das Weltbild (und das Geschäftsmodell) einiger Verlage. Also erfanden sie den ›woken Shitstorm‹, verbreiteten haufenweise Verzerrungen und inszenierten erst damit die Aufregung, die wir jetzt erleben: einen ›antiwoken Shitstorm‹, der seinesgleichen sucht. Und sie verhinderten dabei noch ganz nebenbei, dass wir uns inhaltlich mit der Frage auseinandersetzen, ob rassistische Stereotype auch dann problembehaftet sind, wenn sie vermeintlich positiv oder gut gemeint sind, und wie wir mit denen umgehen. Unser Mediensystem ist kaputt.«14
Auslöser und Profiteur dieses Fake-Shitstorms war laut Scompler – wer wundert sich da noch – Deutschlands professionellstes Hetzblatt, die Bildzeitung. »Unterstützt haben das bereitwillig viele Politiker, stellvertretend für sie Markus Söder15, der völlig uninformiert (und faktisch falsch) kritisiert, dass man sich ›der lauten Meinung weniger beugen sollte‹ und auch ›die ARD deswegen keinesfalls Winnetou verbannen dürfte‹. Dabei gab es weder ›laute Meinungen‹ noch hat irgendjemand, schon gar nicht die ARD, vorgehabt, wegen dieser Meinungen Winnetou zu verbannen. Söder hat sich hier schlichtweg von der BILD für ihre Woke-Hetze und ihr Geschäftsmodell instrumentalisieren lassen. Die Lüge bestand vor allem darin, zu suggerieren, dass ›Winnetou verboten‹ werden sollte. Niemals, nicht mal im Ansatz ging es um Winnetou, auch nicht um die Bücher von Karl May, erst recht nicht um die Filme aus den 60er Jahren. Gegenstand der Diskussion ist hier ausschließlich ein Merchandising-Produkt zu dem neuen Film, das selbst keinerlei eigenständigen literarischen Wert hat. Der Bevölkerung wurde – auch von Söder – weis gemacht, man wolle ihr ›Winnetou‹ insgesamt wegnehmen.
Ursache ist die Überforderung und mediale Inkompetenz von Journalisten und Meinungsführern. Hätten die Journalisten journalistische Standards eingehalten, wäre das nicht passiert. Das ist mutmaßlich aber nicht (nur) ein individuelles, sondern ein systemisches Problem: Verlage würden sich um ihren wirtschaftlichen Erfolg bringen, wenn sie nicht auf diese Erregungswellen aufspringen. Und soziale Medien belohnen eben nur Nachrichten, die Erregung triggern. Am besten Hass und Hetze. Dazu kommt, dass viele Medien unter so wirtschaftlichem Druck und gleichzeitig so sehr unter Nachrichtenstress sind, dass kaum ein Redakteur mehr die Zeit bekommt, auch nur ansatzweise verantwortlich zu recherchieren. Und Politiker ›plappern‹ völlig ungeprüft und unreflektiert Dinge nach, die sie irgendwo gelesen haben, ohne deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen – zumindest wenn die vermeintliche Botschaft in ihre Agenda passt.
Karl May hat ohne Zweifel das Bild, was Menschen von den American Natives haben, massiv mitgeprägt. Und er hat ein Bild gezeichnet, was wir als ›edel‹ und ›positiv‹ empfinden, was den Vorwurf von Rassismus absurd erscheinen lässt: Dass Kinder so gerne Indianer spielen, ist ohne Frage Karl May zu verdanken. Allerdings könnte das Bild, das Karl May und seine Werke vermitteln, nicht weiter von der Wirklichkeit entfernt sein. Nicht im Großen, weil die amerikanischen Ureinwohner nicht zuvorderst ein ›edles Volk‹ sind, sondern ein Volk, die Opfer eines Angriffskrieges waren, und an denen ein Genozid verübt wurde, der in der Auswirkung mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus vergleichbar ist: mit jeweils sechs Millionen toten Juden und sechs Millionen toten Indigenen. Und nicht im Kleinen, weil nur die Indianer im Film ständig ›How‹ und ›Hugh‹ sagen, weil ›Squaw‹ eigentlich die Bedeutung von ›Hure‹ hat, Indigene keine ›rote Haut‹ haben, nicht im Krieg ›heulen‹ und durchaus auch Schmerz kennen und so gar nichts mit der romantischen Folklore zu tun haben, die in den Werken vermittelt wird. So wie Deutsche nicht alle Lederhosen und Pickelhaube tragen und den ganzen Tag nur Bier trinken und Schweinshaxe essen.
Die Debatte wäre eine gute Gelegenheit gewesen, dass jeder in Deutschland seinen eigenen Rassismus reflektiert und in Zukunft vielleicht etwas bewusster umgeht. Und man hätte überlegen können, wie man das auch Kindern gegenüber thematisiert. Das Geschrei wegen angeblicher Verbote oder Einschränkungen ist blanker Unsinn. Er verhindert einfach nur eine entspannte Auseinandersetzung mit dem Thema. Denn was hier stattgefunden hat, ist ein sehr lauter, sehr gewalttätiger und ein sehr bedenklicher Aufschrei einer radikalen Mehrheit.
Wir leben in einem freien Land, in dem Minderheiten, die lange diskriminiert wurden, immer mehr Rechte für sich beanspruchen. Und die greifen natürlich (ur-)alte Privilegien an. Hier scheint es viele Menschen zu geben, die diese Privilegien mit allen Mitteln verteidigen wollen. Da wird verdreht, übertrieben und verzerrt, fast bis zur Lüge. Da wird beleidigt, gehetzt, diffamiert und verunglimpft. Und dabei verlieren die Kritiker jedes Maß, bis hin zum Nazi- und einem Totalitarismus-Vergleich (Bücherverbrennung oder George Orwell). Die Mittel und Methoden erinnern sehr an die von Donald Trump. Die Diskussion hat sich zu einem Gebäude aus Verdrehungen, Verzerrungen und Lügen entwickelt. Getrieben von rechten Populisten, skrupellosen Journalisten und ewig Gestrigen. Und ganz viele haben sich dafür instrumentalisieren lassen.
Und das scheint mehr zu sein als ein Einzelfall. Genau die gleiche Mechanik wird zum Beispiel auch beim Thema Gendern angewendet. Oder beim Klimawandel. Oder beim Impfen. Man muss sich ja beim Gendern nur mal vor Augen führen: Hier wird allen Ernstes ein Gender-Verbot diskutiert, um einen nichtexistierenden Gender-Zwang zu verhindern.«16
Medien können Meinungen verstärken, falsche Tatsachen, Hass und Vorurteile verbreiten – und sie tun dies auch tagtäglich. Aber Medien sind niemals Ursache für individuelle Einstellungen. Ihre Botschaften müssen bereits auf einen fruchtbaren Nährboden fallen, damit sie wirken. Rassismus – oder allgemeiner: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – ist tief in der Mitte der Gesellschaft verankert.17 Deshalb ist es auch gut, über Sprache und Inhalte – auch von literarischen Werken – immer wieder zu diskutieren. Das »N-Wort« beispielsweise wurde bis in die 1970er Jahre in deutschsprachigen Ländern vollkommen unreflektiert benutzt – selbst in progressiver, antirassistischer Literatur. Sprache wandelt sich permanent, und deshalb macht es immer Sinn, etwa bei Neuauflagen Aktualisierungen vorzunehmen und auch die eigenen Lieblingsautor:innen kritisch zu lesen.18
»Wir leben in einem freien Land, in dem Minderheiten, die lange diskriminiert wurden, immer mehr Rechte für sich beanspruchen«, stellt Mirko Lange, der Autor der Scompler-Medienanalyse in seinem Beitrag fest. Die Kehrseite dieses Emanzipationsprozesses ist allerdings, dass Trittbrettfahrer auftreten und den identitären Joker aus der Tasche ziehen, um sich selbst auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten zu performen und andere in der Hierarchie gesellschaftlichen Erfolges – und sei es nur in der eigenen Bubble – zu diskreditieren und die Leiter ein paar Stufen hinabzuwerfen, um sich selbst zu erhöhen. Mit völkischen, ageistischen oder sexistischen Argumenten wie »Du als weißer alter Mann …«, »Du als Weißer …«, »Du als cis-Mensch …«19 sollen Angehörige der Mehrheitsgesellschaft vom Diskurs ausgeschlossen und eigene Privilegien der Meinungshoheit begründet werden. Konkretisiert wird dieser Standpunkt oft in Forderungen, dass z. B. »weiße« Schauspieler:innen keine »schwarzen« Charaktere spielen, eine »weiße« Übersetzerin nicht die Lyrik einer »schwarzen« Autorin übertragen oder »Weiße« sich nicht mit Dreadlocks oder anderen Modeaccessoires »schwarzer« Kultur schmücken dürfen. Dies ist nicht nur in einer Demokratie inakzeptabel, sondern auch bequem für die Mehrheitsgesellschaft – entlässt es diese doch aus ihrer eigenen Verantwortung. Oft sind es zudem privilegierte Angehörige dieser Mehrheitsgesellschaft selbst – junge, gut ausgebildete, »weiße«, heterosexuelle cis-Menschen –, die meinen, für verfolgte Minderheiten, denen sie selbst nicht angehören – Schwarze, Trans-Menschen, indigene Völker etc. –, lautstark und öffentlich auftreten zu müssen.
Im »Fall« Karl May wird oft »Carmen Kwasny von der Native American Association of Germany, die für Abkömmlinge der amerikanischen Ureinwohner spricht«, zitiert. Allerdings: Die Native American Association of Germany spricht keineswegs für die »Abkömmlinge der amerikanischen Ureinwohner«. Der deutsche Verein mit Sitz in Kaiserslautern wurde zwar einst von Native Americans, die als Angehörige der US-Armee nach Deutschland gekommen waren, gegründet; doch längst sind die Gründungsmitglieder in die USA zurückgekehrt und indigene Deutsche haben ihr Engagement in Deutschland fortgesetzt – so auch die heutige Vorsitzende des Vereins, die Sensitivity Reader, Referentin und Eventmanagerin Carmen Kwasny. Sie selbst hat in einem ausführlichen Beitrag sowohl der mehrfach wiederholten Mediendarstellung, sie sei eine Sprecherin der Native Americans, widersprochen als auch der Behauptung, dass sie bzw. ihr Verein ein »Winnetou-Verbot« gefordert hätten.20
Die Meinungen unter den Native Americans selbst fallen sehr divers aus – zu divers, um behaupten zu können, es gebe ein eindeutiges Urteil der »Indianer« über ihr Bildnis im Werk von Karl May. Einige Native Americans kritisieren das kolportierte Bild von liebenswert-rückständigen Naturmystiker:innen und weisen auf konkrete Fehler in den Darstellungen hin. Gonzo Flores, Abkömmling des legendären Apachen-Führers Geronimo und Gesundheitsbeauftragter der US-Lipan-Apachen in Portland (Oregon), erklärt dagegen:
»Karl May zeigte uns in einem positiven Licht.«
Winnetou sei »vergleichsweise fortschrittlich« und Karl May habe durch sein Werk zu ihrer Bekanntheit beigetragen.
»Karl May hat erreicht, dass deutsche Forscher kamen, und so wurden unser Wissen, unsere Sprache, unsere Literatur bewahrt.«21
Der aus Denver stammende Cherokee-Choctaw Silkirtis Nichols, der 1942 als Angehöriger der US-Army nach Deutschland kam, leitete von 1966 bis 1971 sogar das Karl-May-Museum in Bamberg.
Der kanadische Autor und Filmemacher Drew Hayden Taylor vom Volk der Anisinhaabe, der für seinen wunderbaren Dokumentarfilm Searching for Winnetou regelmäßig Deutschland und auch das Karl-May-Museum in Radebeul besuchte, kritisiert die »Klischees« in Karl Mays Werken (»Es ist an der Zeit, dass wir die Dinge etwas anders betrachten, mit unserem Wissen von heute. Wenn ich bei Karl May lese, dass Winnetou kurz vor seinem Tod noch den rechten Weg findet und von seiner Religion zum angeblich einzig wahren Christentum wechselt – da muss ich echt die Augen verdrehen.«), entdeckt aber auch Gutes an Karl May:
»Er hatte eine großartig ausgestattete Bibliothek für einen Autor seiner Zeit. Man vermutet, dass er sogar ein Apache-Wörterbuch besaß. Er war sehr um gründliche Recherche bemüht in einer Zeit, wo das Recherchieren extrem schwierig war. Natürlich hat er viel herbeifantasiert und vor allem Märchen erzählt. Aber das würde ich ihm nicht zum Vorwurf machen, das war typisch für seine Ära. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Jules Verne nicht 20.000 Meilen unter dem Meer war. Er hat großes Interesse für die American Natives geweckt, er hat sie respektiert, sie als zivilisiert beschrieben und ihre Vernichtung beklagt. Das war nicht nur für seine Zeit sehr ungewöhnlich: Noch in den großen Hollywood-Western der Fünfziger waren die Indianer nur die bedrohlichen mörderischen Wilden.«22
Und auch über die korrekte Bezeichnung gibt es, anders als das ZDF, der Duden und zahlreiche andere indigene Deutsche verkündeten, bei den Native Americans selbst unterschiedliche Positionen. Der Wiener Ethnologe und langjährige Herausgeber des Review of Native American Studies Christian Feest summiert im Interview mit dem österreichischen Standard:
»Der Begriff war natürlich von Beginn an ein Irrtum, weil Kolumbus bekanntlich nicht in Indien landete, sondern in Amerika. Zugleich repräsentiert die Bezeichnung eine europäische Sicht auf eine unglaubliche Vielfalt von Bevölkerungen und Sprachen, die in dieser für Europa ›Neuen Welt‹ angetroffen wurde. Diese ganze Vielfalt wird mit der Bezeichnung Indianer über einen Kamm geschert, und dieser Sammelbegriff wurde dann auch zur Grundlage von Stereotypen, die man all diesen Gruppen zusprach. Insofern spreche ich lieber von den indigenen Völker Nordamerikas. Zugleich hat diese imaginäre kollektive Gruppe, die mit dem Begriff Indianer bezeichnet wird, selbst eine gewisse Wirklichkeit bekommen. Durch Jahrhunderte des Kolonialismus und des Postkolonialismus entstand so etwas wie eine ›Schicksalsgemeinschaft‹: Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Sprache, unterschiedlicher Kulturen, die sich zum Teil sogar bekriegten, wurden durch ein gemeinsames Schicksal vereint. Entsprechend gibt es in den USA und Kanada Gesetze, die in diesen beiden Ländern für all diese Gruppen gemeinsam geschaffen wurden. Wobei in den Gesetzen der USA bezeichnenderweise immer noch von ›Indians‹ die Rede ist – während man in Kanada lieber den Begriff ›First Nations‹ verwendet, obwohl es um die gleichen Gruppen diesseits und jenseits der Grenze geht. Zusätzlich sind auch die Lakota, Hopi oder Irokesen selbst pluralistischer geworden. In diesen Gruppen sind alle möglichen Meinungen darüber vertreten, wie sie sich selbst bezeichnen wollen. Diese Problematik der Repräsentation gilt im Übrigen auch für die Sammelbezeichnung der indigenen Völker in der nördlichen Polarzone: Der vermeintlich politisch korrektere Begriff der Inuit umfasst nur die östlichen Eskimo, nicht aber die westlichen etwa in Alaska – und ist also selbst problematisch.«23
Auch die Native American Association of Germany benutzt den Begriff »Indianer« auf ihrer Homepage und widerspricht der Aussage, dass die Native Americans selbst diesen pauschal ablehnen und als diskriminierend bewerten. »Grundsätzlich sagen wir Native Americans. Ein Otto Normalverbraucher in Deutschland weiß gar nicht, was ich meine, wenn ich von Native Americans spreche«, erklärte Carmen Kwasny im Interview mit der Welt. »Der Begriff ›Indianer‹ differenziert nicht. Wir reden hierbei von über 500 verschiedenen Nationen. Wir nennen ja auch nicht jeden Menschen aus Europa ›Europäer‹. Wir sagen Griechen, Deutsche, Italiener. Das Problem ist, dass wir keinen deutschen Begriff haben, der das passend übersetzt. Wir sind immer wieder gefragt worden, warum wir den Begriff ›Indianer‹ noch auf unserer Internetseite haben. Der Grund dafür ist, dass wir keine Aufklärungsarbeit leisten können, wenn man uns nicht im Internet findet.«24





























