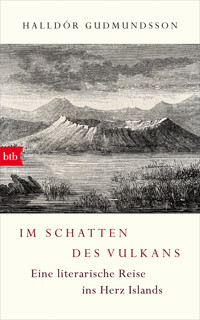Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog
Sagenhafter Reichtum einer kleinen Insel
Gott segne Island
Musste das Finanzsystem zusammenbrechen?
Die Kochtopfrevolution
Was macht die Krise mit den Menschen?
Die Krise im Kopf
Mit dem Lastwagen gegen die Wand
Warum sollen wir zusammenhalten?
Und einmal waren wir fünftausend
Unter Hausarrest
Am Fenster des Premierministers
Tränengas und Steinwürfe
Der arbeitslose Visionär
Zurück zur Natur
Zur Lage der Nation
Mein Land als Beispiel
Anmerkungen
Erläuterung, Dank und Quellen
Copyright
Redaktion und deutsche Bearbeitung von Regina Kammerer
Karikaturen von Halldór Baldursson
Fotos von Dagur Gunnarsson
Für Mamutschka, die sehr viel schlimmere Krisen erlebt hat.
Prolog
Der Krach war unglaublich laut an diesem hellen Sommerabend vor knapp zwei Jahren, vielleicht weil er wie eine Explosion in eine totale Stille hereinbrach. Wir, meine Frau Anna und ich, waren auf Flatey, der kleinen Insel im Breidafjördur, dem breiten Fjord im Westen Islands, und liefen sofort zum Fenster, um zu sehen, was eigentlich los war. Der Himmel war wolkenlos und tiefblau, nur ein leichter rötlicher Schimmer zeigte an, dass es bald Abend werden würde. Flatey ist ein ausgesprochen friedlicher Ort, das letzte Fleckchen Erde auf Island, das einem eine Ahnung davon gibt, wie ein Dorf aus dem neunzehnten Jahrhundert ausgesehen haben mag. Hier wurde immer Handel getrieben, selbst zu Zeiten der mehr oder weniger ständigen Hungersnot, die vor anderthalb Jahrhunderten viele Isländer nach Amerika trieb. Am Breidafjördur gab es immer Fisch und Fleisch, und selbst in den schlimmsten Zeiten mussten die Menschen hier nicht hungern. In den vergangenen dreißig Jahren wurden die Katen auf Flatey aufwendig renoviert und hauptsächlich als Sommerhäuser verwendet; im Winter dann wohnen nur noch zwei Bauern auf der Insel, die einander misstrauisch umkreisen, wie es sich gehört auf einer kleinen Insel. Das Dörfchen ist so pittoresk, dass es in der Vergangenheit mehrmals als Filmkulisse diente – einige deutsche Leser mögen sich vielleicht sogar noch daran erinnern, denn dort wurde seinerzeit die beliebte Fernsehserie Nonni und Manni gedreht.
In den Sommermonaten legt die Fähre aus Stykkishólmur zweimal am Tag auf ihrem Weg zu den Westfjorden an, und am Wochenende drehen manchmal Touristen ihre Runden, um sich die hübschen Häuser anzuschauen oder zu den Vogelbergen zu spazieren; inzwischen gibt es sogar ein kleines Hotel auf Flatey. Aber unter der Woche ist normalerweise nicht viel los auf der Insel, und außer dem Vogelgesang und vielleicht einem kleinen Fischerboot in der Ferne herrscht Stille. Einen solchen Lärm hatten wir bei unseren vielen Besuchen auf Flatey noch nie erlebt. Wir starrten Richtung Kirche, dem höchstgelegenen Gebäude der Insel, und da kam er dann auch plötzlich zum Vorschein, der schwarze Hubschrauber, der den Krach verursachte. Fast schien es, als landete er auf dem Friedhof, aber die fünf Kinder im Dorf, die sofort losrannten, um sich das Spektakel anzusehen, stellten schnell fest, dass er sich die Wiese gleich nebenan als Landeplatz ausgesucht hatte.
Alle Dorfbewohner hatten sich versammelt, als zwei Männer – der Pilot und der Besitzer des Hubschraubers – ausstiegen, mit Sonnenbrillen und in diesen ganz leichten, schwarzen Lederjacken, die eher teuer als nützlich sind. Der Besitzer des Prestigeobjekts war ein Isländer, Olafur Olafsson, einer aus der relativ jungen Garde heimischer Milliardäre. Ein freundlicher Mann, vielen dadurch bekannt, dass er es sich hatte leisten können, Elton John für ein Privatkonzert zu seinem fünfzigsten Geburtstag einfliegen zu lassen. Und freundlich erwies er sich auch auf Flatey: Er ließ den Piloten mit den ältesten Kindern des Dorfes eine Runde über die Insel drehen, bevor er sich für eine Nacht im Hotel einquartierte. Tags darauf flog er zum Hornbjarg, dem hohen, unzugänglichen Vogelberg an der nordwestlichen Spitze Islands, zu dem die meisten nur in ihren Träumen gelangen. Zu dieser Zeit war Olafur Olafsson einer der Hauptaktionäre der Kaupthing Bank, der größten isländischen Bank, und selbstverständlich steinreich. Kaupthing entstand nach der Privatisierung der Landwirtschaftsbank, Bunadarbankinn, die an Geschäftsleute ging, die der Progressiven Partei nahestanden – eigentlich ganz natürlich, da die Mitte-Rechts-Partei der Progressiven ursprünglich eine Bauernpartei gewesen war. In deren Firmengeflecht war Olafur Olafsson ein wichtiger »Player«, wie wir es schon damals zu nennen wussten, und so konnte er sich ein paar Jahre nach der Gründung der Kaupthing Bank einen Hubschrauber leisten, um sein Sommerhaus im Westen Islands aufzusuchen. Und Flatey, die Insel, die nur eine halbe Flugstunde davon entfernt lag.
Überhaupt scheint Olafsson eine Vorliebe für Inseln zu haben. Auf den Tortola-Inseln, einem Teil der britischen Jungfern-Inseln, gehören ihm bzw. seinen Gesellschaften wahrscheinlich mehrere Dutzend Firmen. Die Tortola-Inseln sind nicht viel größer als Flatey, aber statt zwei Bauern sind dort mehrere Hundert Firmen allein aus Island beheimatet – über die nicht viel größeren Cayman-Inseln sagte US-Präsident Obama neulich, dort müsste eigentlich das höchste Haus der Welt stehen, denn über zwölftausend amerikanische Firmen wiesen dort seltsamerweise dieselbe Adresse auf. Erst nach dem Kollaps des heimischen Finanzsystems erfuhren die Isländer, dass sage und schreibe einhundertsechsunddreißig auf den Tortola-Inseln ansässige Firmen die Erlaubnis hatten, in Island Bankgeschäfte zu betreiben. Was selbstverständlich an den dort herrschenden, ausgesprochen freizügigen Steuergesetzen lag. Man zahlte eine jährliche Gebühr für den Firmensitz, das war’s.
Es ist nicht immer leicht, etwas über die wahren Besitzer dieser Firmen herauszufinden. Meistens werden sie von Mittelsmännern oder Banken gelenkt; Kaupthing beispielsweise hat viele isländische Gesellschaften auf den Tortola-Inseln verwaltet, das heißt die Gebühren bezahlt und für eine ordnungsmäßige Gründung gesorgt. Einige davon gehörten Scheich Mohammed Bin Khalifa Al-Thani aus Katar, einem ebenfalls ausgesprochen inselfreudigen Menschen. Er ist bis heute mit Olafur Olafsson befreundet, und genau ein Jahr nach dem oben erwähnten Besuch auf Flatey, im Juli 2008, kam Olafsson wieder und brachte ein Mitglied der Al-Thani-Familie gleich mit. Ein arabischer Scheich auf Flatey: da verblasst sogar der Eisbär, den die Filmemacher von Nonni und Manni seinerzeit auf die Insel brachten. Zwei Wochen vor dem Kollaps der isländischen Banken, im September 2008, wurde bekannt gegeben, dass der Island- und Inselfreund aus Katar fünf Prozent der Kaupthing Bank gekauft habe. Stolz wiesen die Manager darauf hin, dies sei der Beweis dafür, dass ausländische Investoren den Glauben an die isländischen Banken nicht verloren hätten und von der Zukunft unseres Finanzwesens überzeugt seien.
Nach dem Sturz der Banken wurde der Glaube der Isländer an den Scheich allerdings schwer erschüttert – selbst derer, die ihn seinerzeit auf Flatey zu Gesicht bekommen hatten. Er schien nicht auffindbar. Und schlimmer noch: das Geld, mit dem er seinen angeblichen Anteil an Kaupthing erworben hatte, schien auch nirgendwo gebucht. Hingegen hatte die Bank ihm bzw. seinen Firmen in der Vergangenheit hohe Kredite gewährt, allein fünfzig Millionen Dollar noch in der Woche vor dem Zusammenbruch, glaubt man den isländischen Zeitungen. Plötzlich waren sie alle verschwunden, die isländischen Milliardäre und die ausländischen Investoren. Auch Olafur Olafsson war nicht mehr ganz so prominent. Und doch: Im Februar dieses Jahres stiftete sein Wohltätigkeitsfonds den Isländern zwanzig Millionen Kronen, um die psychologischen Folgen des Zusammenbruchs der Banken zu bekämpfen.
Wie eine Hubschrauberlandung auf Flatey: So brach der globale Finanzkapitalismus Anfang des 21. Jahrhunderts über Island herein, mit einem Riesenkrach, und wie kleine Kinder liefen wir ihm freudig entgegen, um einen Rundflug zu machen. Genauso schnell verschwand er wieder, mit all seinen Akteuren. Und jetzt müssen wir Isländer lernen, mit Lust und Frust in der Krise zu sein. Wie allmählich die ganze westliche Welt.
Sagenhafter Reichtum einer kleinen Insel
In England there are certain traditional ways of living and spending for rich people which at least give them a certain grace. In Iceland there are none.
W.H. Auden, Letters from Iceland, 1937
Am Freitag, dem 13. März 2009, fand in Reykjavík eine ungewöhnliche, aber gut besuchte Veranstaltung statt. Vertreter des kanadischen Bundesstaates Manitoba stellten Jobmöglichkeiten in ihrem Heimatland vor. In Manitoba herrsche Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften, und Isländer würden dort besonders willkommen geheißen. Zu der Zeit waren auf Island bereits siebzehntausend Arbeitslose registriert. Fünfhundert Leute kamen zu dieser Veranstaltung – die man auch live im Internet verfolgen konnte -, um sich über Arbeitsplätze in Kanada zu erkundigen. Ein paar Wochen zuvor war bereits die Bürgermeisterin der Kleinstadt Gimli am Lake Winnipeg nach Island gereist, um den Medien ganz Ähnliches zu erzählen, in wunderbarem Isländisch übrigens.
Wieso in aller Welt sollten Isländer auf den endlosen Prärien von Manitoba ihr Glück versuchen? Und wieso sind sie dort besonders willkommen? Die Antwort ist einfach: weil sie das schon einmal getan haben. Wahrscheinlich gibt es dort bis zu hunderttausend Menschen isländischer Abstammung. Wenn man so will, lernen Isländer von klein auf, auf der Hut zu sein. In den Jahrzehnten nach 1870 floh knapp ein Viertel der Bevölkerung in den Westen, der Großteil davon nach Kanada – in Folge von Vulkanausbrüchen, harten Wintern und dem daraus resultierenden Lebensmittelmangel konnte das Land einfach nicht mehr Menschen ernähren. »New Iceland« nannten die Flüchtlinge die Gegend am Winnipegsee, wo sie sich ansiedelten, und eine Zeitlang hatten sie dort sogar ihr eigenes Grundgesetz. Anfang des 20. Jahrhunderts ebbte die Siedlungswelle wieder ab. Wird sie sich jetzt, ein Jahrhundert später, wieder von neuem erheben? Und wo finden die Isländer nun das neue Island, das sie so dringend benötigen?
Die Flucht gen Westen am Ende des 19. Jahrhunderts bedeutete in den Augen mancher die endgültige Kapitulation vor den unüberwindbaren Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, auf Island zu leben. Schon seit Jahrhunderten war die Grenze der Bewohnbarkeit erreicht. Auch die so genannte Neuzeit brachte auf Island keine Fortschritte mit sich. Im Jahre 1801 lebten hier weniger Einwohner als im Jahre 1700, insgesamt 47 240 Menschen laut Volkszählung – wesentlich weniger als im 12. Jahrhundert. In Regierungskreisen der Kolonialmacht Dänemark diskutierte man im 18. Jahrhundert allen Ernstes, die wenigen Isländer auf die Heiden in Jütland umzusiedeln. Es würde sich nicht lohnen, Island bewohnt zu halten. Auch im 19. Jahrhundert war Reykjavík nur ein Dorf, »die ärmlichste Stätte, die ich je gesehen habe«, wie der amerikanische Reisende John Ross Browne in sein Tagebuch schrieb, »dessen Straßenbild von Hunden und Fliegen« dominiert werde. Urbanisierung, bürgerliche Kultur, Selbständigkeit: alles schien in weiter Ferne. Erst der Fischfang mit Trawlern ab 1906 markierte in Island die industrielle Revolution. Und erst der Zweite Weltkrieg, als die Zahl der amerikanischen Soldaten in Island ungefähr so groß war wie die Einwohnerzahl, brachte richtig Geld ins Land. In fünfzig Jahren machte Island danach die Entwicklung durch, die in anderen westlichen Ländern dreihundert Jahre dauerte. Die Isländer sind per Definition neureich.
Im Jahre 2005 waren die Isländer dann das fünftreichste Land der Welt, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen. Jetzt, vier Jahre später, planen sie wieder die Flucht nach Manitoba. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Es fing alles mit der Privatisierung der Banken Anfang des neuen Jahrhunderts an, sagt man jetzt. Vielleicht sollte man jedoch weiter zurückgehen. Die Unabhängigkeitspartei, seit dem Krieg größte Partei des Landes, stellte von 1991 bis Anfang 2009 die Regierung; stärkste politische Kraft war sie in den Nachkriegsjahren sowieso. Ihr Führer, der charismatische ehemalige Bürgermeister von Reykjavík, David Oddsson, wurde ein Jahr nach Margret Thatchers Abgang in England Premierminister in Island, und zwar mit ihrer Politik. Wie sie und seinerzeit Ronald Reagan war er ein Anhänger des wirtschaftlichen Liberalismus oder Neo-Liberalismus, wo Freiheit immer mehr Markt und weniger Staat bedeutet und die Politik sich idealerweise überflüssig macht; für Letzteres war Oddsson indes zu sehr Machtmensch. Vieles konnte auch in eine marktwirtschaftliche Richtung gelenkt werden: Der isländische Kapitalismus vor 1990 war in mancher Hinsicht ein Staatskapitalismus. Die großen Banken gehörten alle dem Staat, und um einen Kredit zu bekommen, war ein gutes Verhältnis zu einem Politiker manchmal genauso wichtig wie die eigene Solvenz. Man war lange verpflichtet, Einnahmen in ausländische Währung einzutauschen, und der Wechselkurs der Krone war staatlich festgeschrieben und wurde regelmä ßig heruntergesetzt. Bis 1986 gab es auch nur einen staatlichen Fernsehkanal, und die Printmedien waren fast allesamt Parteizeitungen. Wirtschaftlich hatten sich die Isländer längst an eine haushohe Inflation gewöhnt: Als ich Mitte der achtziger Jahre als Verleger anfing, erhöhten wir vor jeder Weihnachtssaison die Buchpreise um dreißig Prozent, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Die isländische Krone war im Ausland ein Witz, mehr Verlass war da noch auf die gute alte Briefmarkensammlung. Sparen lohnte sich auf keinen Fall, in einem Land, wo die Zinsen meistens nicht mit der Inflation Schritt hielten. Das Resultat war ein anderes Verständnis von Geld, als es zum Beispiel die vorsichtigen Nachkriegsdeutschen haben, um es einmal behutsam zu formulieren.
Das änderte sich alles in den neunziger Jahren. 1990 wurde das so genannte Quotensystem in der Fischerei eingeführt (in anderer Form gab es das schon seit 1984). Ursprünglich nicht zuletzt dazu gedacht, die Fischgründe im Meer rund um Island zu schützen und eine vernünftige Fischereipolitik zu betreiben, war die Verteilung der Quoten immer sehr umstritten. Sie wurde als nicht gerecht betrachtet: Sie bevorzuge die Wohlhabenden, führe zur Bildung weniger, großer Fischereibetriebe und gebe Neugründungen keine Chance. Inzwischen meinen manche, wie etwa der Ökonom Thorvaldur Gylfason, dass sich die Kluft zwischen Moral und Wirtschaft, in die wir jetzt alle gefallen sind, zuerst mit dem Quotensystem aufgetan hat. Als die Isländer zum ersten Mal Fisch verkaufen konnten, den sie noch nicht gefangen hatten. Aber am Anfang sahen es die wenigsten so.
Bis 1992 unterlagen alle Währungsgeschäfte strengen staatlichen Kontrollen. Wenn zum Beispiel ein Isländer für eine Auslandsreise harte Währung benötigte, musste er sein Flugticket vorzeigen. Anfang der neunziger Jahre entschloss sich Island dann, dem Europäischen Wirtschaftsraum beizutreten, der ab 1994 die EFTA-Länder – jetzt nur noch Island, Norwegen und Liechtenstein, da die Schweiz ein anderes Abkommen hat – mit der EU verband. In streng wirtschaftlicher Hinsicht kam das fast einem EU-Beitritt gleich, und damit tat auch Island große Schritte in Richtung einer westeuropäischen Marktwirtschaft. Die späten neunziger Jahre waren von einem steten Wirtschaftswachstum geprägt, die Krone wurde stärker, die Inflation schwand, die isländische Gesellschaft verlor ihre letzten, wenn man so will, »osteuropäischen« Eigenschaften. Es war eine Zeit des Optimismus und der Expansion, und dem konnte auch das Platzen der Internetblase um die Jahrtausendwende nicht Einhalt gebieten. Nach der Wahl 1999 schien für David Oddsson alles machbar, und nun galt es zu privatisieren: die Banken, die Post, die staatliche Telefongesellschaft und am liebsten auch Teile des Schul- und Gesundheitssystems. Jeder, der abwarten oder auch nur nachdenken wollte, erschien wie ein Spielverderber. Tempo war gefragt, und die Parteien wetteiferten darum, wer marktfreundlicher war als der andere.
In diesen Jahren hingen die Isländer auch einem anderen Traum nach, den der Autor Andri Snaer Magnason in seinem Buch »Traumland« beschrieben hat. Man wollte die natürliche isländische Energie, in Wasserkraftwerken und geothermischen Kraftwerken gebündelt, an die ausländische Großindustrie verkaufen, und damit neue Investoren ins Land holen. Island sollte eine der wichtigsten Bastionen der Aluminiumindustrie in der westlichen Welt werden. Im Jahr 2002 beschloss Althingi, das Parlament, mit großer Mehrheit den Bau eines Wasserkraftwerks bei den Karahnjukar-Bergen im Osten des Landes. Ein Riesendamm sollte dem Kraftwerk eine Kapazität von 690 Megawatt sichern. Diese Elektrizität wurde dann an den amerikanischen Aluminiumriesen Alcoa verkauft, der an dem nahe gelegenen Reydarfjord eine Fabrik errichtete, die im Jahr knapp dreihunderttausend Tonnen Aluminium produzieren kann. All das ist in den letzten sechs Jahren geschehen; in diesen Jahren floss eine Unmenge Geld ins Land, und man betrachtete die Naturschützer und Skeptiker wieder mal als Spielverderber. Mit dem abrupten Sturz des Aluminiumpreises in der jetzigen Krise scheint auch dieser Traum fürs Erste ausgeträumt.
Im Jahr 2002 sollten auch die letzten Schritte zur endgültigen Privatisierung der Banken getan werden. Es ging um die zwei großen Staatsbanken, Landsbankinn und Bunadarbankinn. Die erste gab es schon seit 1886, und von 1927 bis 1961 fungierte sie sogar als Notenbank. Bunadarbankinn, die Bank der Landwirtschaft, wurde 1930 gegründet und galt als eine sehr stabile Bank. Erste Schritte in Richtung privater Eigentumsverhältnisse waren schon 1998 unternommen worden, als beide Banken zu Aktiengesellschaften umgebildet wurden, obwohl der Staat weiterhin Haupteigentümer blieb. Jetzt sollte der kontrollierende Staatsanteil verkauft werden, und ein Privatisierungskomitee bereitete den Verkauf vor. Genauer gesagt waren es zwei Komitees. Das eine setzte sich aus Beamten und Fachleuten zusammen, die jedoch von der Politik nominiert waren. Das andere bestand aus vier Ministern der Regierung, und dort wurden alle endgültigen Entscheidungen getroffen: dies waren von der Unabhängigkeitspartei die Minister David Oddsson und Geir Haarde sowie Valgerdur Sverrisdottir und Halldór Asgrimsson von der Progressiven Partei.
In den isländischen Medien ist diese Zeit – dieser Prozess vom Sommer 2002 – ein breites Thema. Es ist eine komplizierte Geschichte, die unter anderem dazu führte, dass ein Experte aus dem Privatisierungskomitee, Steingrimur Ari Arason, zurücktrat, weil er eigenen Angaben zufolge nie im Leben so unsaubere Arbeitsweisen erlebt hatte. Aber die Fakten sprechen für sich: Ursprünglich plante man eine breite Eigentumsverteilung mit vielen Kleinaktionären. Von dieser Politik wich man ab und fand für beide Banken je eine Haupteigentümergruppe, die jede für sich einer der Regierungsparteien nahestanden. Leitender Hauptaktionär der Landsbanki wurde die Samson-Gruppe, mit 45,8 Prozent der Aktien, die sie für zwölf Milliarden Kronen erhielt. Ein ähnlich hoher Anteil von Bunadarbankinn wurde an die so genannte S-Gruppe verkauft. Die Samson-Gruppe, bestehend aus Björgolfur Gudmundsson, seinem Sohn Björgolfur Thor Björgolfsson und deren engem Mitarbeiter Magnus Thorsteinsson, schien – wie der biblische Name andeutet – unglaublich stark. So etwas von Kaufkraft hatten die Isländer noch nie erlebt. Björgolfur, den Älteren, kannte man schon, seine Reederei Hafskip hatte seinerzeit einen spektakulären Konkurs erlitten, der ihn zeitweise in Untersuchungshaft brachte, aber die anderen waren junge Löwen, deren Treiben auf dem isländischen Markt man gespannt entgegensah. Die drei hatten ab 1993 ihr Glück im russischen St. Petersburg im Brauereigeschäft versucht; am Anfang hatten sie mit schwierigen Problemen zu kämpfen, aber langsam ging es aufwärts, und großen Erfolg hatten sie schließlich mit ihrer Brauerei Bravo. Im Jahre 2002 verkauften sie diese an Heineken für vierhundert Millionen US-Dollar, damals fünfunddreißig Milliarden Kronen – Landsbankinn hätten sie also gleich dreimal kaufen können.
Björgolfur Gudmundsson war schon seit einiger Zeit auf den Heimatmarkt zurückgekehrt. Er war mit seinen Partnern in die wachsende Pharmabranche auf Island eingestiegen, und überdies hatte er auch kulturelle Interessen; unter anderem übernahm er im Frühjahr 2002 die Mehrheit am Verlag Edda/Mal og menning, bei dem ich damals als Verleger tätig war und der in finanzielle Bedrängnis geraten war (2007 kaufte die alte Literaturgesellschaft Mal og menning, ursprünglicher Eigentümer des Verlags, die Anteile wieder zurück, aber das ist eine andere Geschichte). Björgolfur war sehr an seinem Renommee gelegen. Er tat sich in den nächsten Jahren als Kunstmäzen hervor und war treibende Kraft beim Bau der isländischen Konzerthalle, die derzeit halbfertig als größte Denkmalsruine der isländischen Megalomanie am Hafen von Reykjavík steht.
Nicht überraschenderweise sagte man Leuten, die in diesen Jahren in Russland reich wurden, Mafiakontakte nach; unter anderem berichtete die englische Zeitung The Guardian (16/6 2005) über mysteriöse Todesfälle im Petersburger Brauereiwesen, und auch auf Island hat es nie an solchen Geschichten gemangelt. Bewiesen ist bisher nichts, und Heineken behauptete seinerzeit, sie hätten die Brauerei Bravo gerade deshalb gekauft, weil sie keine Verbindung zur Mafia hätte.
In den nächsten Jahren tat sich Björgolfur, der Jüngere, als internationaler Investor hervor, nicht zuletzt als Haupteigentümer des Pharmakonzerns Actavis, und im Jahre 2008 listete Forbes ihn auf Platz 307 der reichsten Männer der Welt – in England, wo er lebt, kam er das Jahr davor sogar auf Platz 23 mit einem Privateigentum von über zwei Milliarden Pfund. Seitdem ist er um vierhundert Plätze gefallen. Es darf erwähnt werden, dass die Deutsche Bank in diesen ersten, intensiven Jahren Vater und Sohn bei deren Investitionen den Rücken stärkte.
Aber zurück zum Sommerschlussverkauf 2002: Björgolfur Gudmundsson verfügte schon lange über sehr gute Kontakte zur Unabhängigkeitspartei und hatte auch Parteiämter bekleidet. David Oddsson war daran gelegen, dass die zukünftigen Eigentümer der ältesten isländischen Bank sich auf jeden Fall »auf Gesprächshöhe mit der Partei« befinden würden, wie es der langjährige Redakteur von Morgunbladid, Styrmir Gunnarsson, einmal formulierte. Vielleicht wollte Oddsson auch wenigstens einen Teil des Erlöses vom Brauereiverkauf nach Island holen. Auf jeden Fall ging Landsbanki im Herbst an Samson, obwohl sie nicht das höchste, vielleicht sogar das niedrigste Angebot abgegeben hatten. Und als Björgolfur Gudmundsson danach den ersten, angeblich nach rein fachlichen Gesichtspunkten ausgewählten, »unpolitischen« Aufsichtsrat der Landsbanki der Öffentlichkeit präsentierte, war dessen Vizevorsitzender Kjartan Gunnarsson, Generalsekretär und graue Eminenz der Unabhängigkeitspartei.
Die Progressive Partei wollte daraufhin natürlich, dass ihre »Gesprächspartner« ebenfalls mit am Tisch säßen und auf jeden Fall beim Verkauf von Bunadarbankinn, die der Partei sowieso schon nahestand, bedacht würden. Man verhandelte mit der sogenannten S-Gruppe, die unter anderem aus Firmen bestand, die auf die alte genossenschaftliche Bewegung in der Landwirtschaft zurückgingen; an der Spitze dieser Gruppe befanden sich Finnur Ingolfsson, früher Zentralbankdirektor und Minister für die Progressiven, sowie Elton-John-Fan Olafur Olafsson, der uns schon durch seine Leidenschaft für Hubschrauber bekannt ist. Im Zuge der Privatisierungsdebatte hatte man immer gesagt, man erhoffe sich die Teilnahme ausländischer Investoren, sowohl aus finanziellen wie fachlichen Gründen, und so brachte die S-Gruppe bei den Verhandlungen die französische Großbank Société Générale ins Spiel. Daraus wurde jedoch nichts, und fraglich ist, ob die Franzosen je überhaupt interessiert waren. Stattdessen wies man darauf hin, dass eine deutsche Bank Mitglied der Eigentümergruppe werden wolle. Und zwar die kleine Privatbank Hauck und Aufhäuser, die auch den meisten deutschen Lesern wohl unbekannt sein dürfte. Ihre Rolle in der S-Gruppe ist eher obskur; fest steht nur, dass sie zwei Jahre später ihren Anteil wieder an andere Mitglieder der S-Gruppe verkaufte.