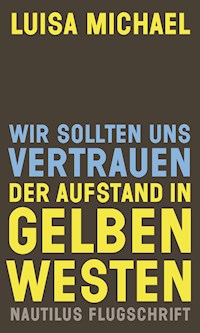
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nautilus Flugschrift
- Sprache: Deutsch
Der Aufstand der Gelbwesten ist nicht vorbei – im Gegenteil, er scheint der Anfang von etwas zu sein, dem ein libertärer Zauber innewohnt. Die "Gilets jaunes" haben die Gräben, die Frankreich zerreißen, schlagartig ausgeleuchtet: zwischen gleißender Metropole und vergessener Provinz; zwischen denen, die von der Abschaffung der Vermögensteuer profitieren, und denen, die auch mit Job kaum über die Runden kommen; zwischen denen mit allen Möglichkeiten und denen im gnadenlos ratternden Hamsterrad des Überlebens. Die "Ökosteuer" auf Benzin war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat: Die Unzufriedenheit über massive soziale Ungerechtigkeit und eine undemokratische Präsidialherrschaft explodierte und wurde rasch zu einer beflügelnden und konstruktiven Wut. Die Forderungen nach echter demokratischer Teilhabe, sozialer Gerechtigkeit und wirkungsvoller Umweltpolitik einigen die äußerst heterogene Bewegung: Sehr unterschiedliche Segmente der französischen Gesellschaft entdecken bei den Gelbwesten ihre Gemeinsamkeiten, lernen sich kennen und respektieren, agieren zusammen und bilden seither ein neues politisches Subjekt, das sich nicht festlegen oder vereinnahmen lässt. Luisa Michael, die seit zwanzig Jahren im Pariser Stadtteil Belleville lebt und dort u.a. in Initiativen für die Rechte der Migrant*innen aktiv ist, schildert ihre Erfahrungen und die anderer Pariser*innen mit und zunehmend in der Bewegung, in der städtische Intellektuelle und rebellierende Jugendliche aus der Banlieue zusammenkommen, schwarze Nannys aus Paris und weiße Arbeitslose aus der Provinz, Gewerkschafter*innen und bisher unpolitische Kleinbürger*innen. Dabei stellt sie fest, dass die GJs Traditionslinien fortsetzen: von der Commune über den Mai '68 bis Nuit Debout und Occupy. Von Anfang an hat sich die gelbe Bewegung auch mit bestehenden Kämpfen verbunden. Luisa Michael hat sich mit skeptischer Neugierde angenähert, hat hingesehen und hingehört – und schließlich selber die gelbe Warnweste übergestreift. Ihr Buch schildert diesen Prozess und die Entwicklung der Gelbwestenbewegung nach dem Motto der Zapatist*innen: "Fragend gehen wir voran!".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUISA MICHAEL ist eine in Paris lebende Deutsche, die hier als Zeugin berichtet. Mit skeptischer Neugierde hat sie sich den »Gilets Jaunes« angenähert, hat hingesehen und hingehört – und schließlich selber die gelbe Warnweste übergestreift. Der Tradition folgend, in der z. B. auch das Unsichtbare Komitee steht, bleibt sie anonym.
LUISA MICHAEL
WIR SOLLTEN UNS
VERTRAUEN
DER AUFSTAND IN
GELBEN
WESTEN
Editorische Notiz: Der Fotograf der
Abbildungen im Innenteil dieses Buches
ist Alexandre Pierrepont, Gilet Jaune aus
Belleville.
Alle französischsprachigen Zitate
wurden von der Autorin übersetzt,
wenn nicht anders angegeben.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2019
Originalveröffentlichung · Erstausgabe Oktober 2019
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
eISBN 978-3-96054-214-8
Zineb Redouane gewidmet
Den Gilets Jaunes,besonders denen von Belleville und Montreuil
»Sie sind also nicht mehr aktuell, die Gilets Jaunes. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir überlassen den Raum innerhalb der ›Aktualität‹ gerne jenen, denen so viel daran liegt und die sie in all ihren Bestandteilen fabrizieren. Wir beschäftigen uns lieber mit dem Realen – das sie unausgesetzt bedroht. Wir sind genau diese Konstante.
Wir sind das Reale in seiner ganzen Intensität.«
Die Gilets Jaunes von Belleville, Juni 2019
Inhalt
Wir sollten uns vertrauen. Der Aufstand in gelben Westen
Demonstration »Das Grosse Spiel: Gelbe Mannschaft«
Die Spieler*innen
Die Gegner
Los geht’s
Der kollaborative Stadtplan
Die Bewegung
Eure Mittel
Strategie im Fall einer Abriegelung durch die blaue Mannschaft
Symbolische Orte für die Auseinandersetzung
Ratschläge, Vorkehrungen:
Ihr seid in einer anderen Stadt?
Anhang
Appell der 2. Versammlung der Versammlungen der GJs
»Wer’s glaubt, wird svelig!«
Anmerkungen
Das, was hier beschrieben wird, was hier zu Wort kommt, ist erst ein Anfang. Der Anfang eines Prozesses, der sich nicht mehr aufhalten und nicht mehr wegdenken lässt. Es sind die ersten sechs Monate eines Aufstands, den manche schon 2007 kommen sahen,1 auf den sie seither hofften.
Es ist unwahrscheinlich, dass Hunderttausende, indirekt sogar Millionen Französinnen und Franzosen diesen Anfang wieder vergessen. Sie werden nicht vergessen, dass sie auf einmal eine Stimme hatten. Sie haben in kürzester Zeit gelernt, ihre Stimme zu erheben, und werden es weiterhin tun. Sie werden nicht vergessen, dass sie sich auf einmal mit ihren Nachbar*innen und mit Wildfremden verbunden wussten, und sie werden sich das, was sie gemeinsam aufgebaut haben, nicht nehmen lassen. Sie werden nicht ihr Hochgefühl vergessen, das sie in den Augen von bis eben noch Unbekannten gespiegelt sahen. Ihr neu entdecktes Selbstbewusstsein wird sich nicht einfach verflüchtigen. Sie nehmen sich seit einem halben Jahr die Freiheit, die Sache selber in die Hand zu nehmen, ihre Sache. Ausgerechnet sie, denen von einer herrschenden Elite und von den Verhältnissen, in denen sie (über-)leben, immer neu bescheinigt wird, dass sie nichts sind.2
Jetzt, nach einem halben Jahr voller Überraschungen, ungeahnter kollektiver und individueller Lernprozesse, jetzt, da auch in Algerien und Sudan unter ganz anderen Bedingungen die Menschen ihre Gemeinsamkeiten und ihre Unterschiede und Differenzen als Reichtum entdecken und erleben, jetzt, da so viele voneinander wissen und miteinander verbunden sind: Jetzt will ich darüber berichten. Jetzt, da wir mittendrin sind und gemeinsam überlegen und handeln. Holprig. Unbeholfen. Zweifelnd. Dann wieder grandios in der plötzlich aufblitzenden Klarheit. Vor allem im Insistieren auf Unabhängigkeit. Manchmal berauscht von der Schönheit unseres unreinen Aufstands.
Jetzt, Ende Mai 2019, da die »Versammlung der Versammlungen« von Commercy vom 26.–27. Januar und die von Saint-Nazaire vom 6.–8. April hinter uns liegen und diejenige von Montceau-les-Mines vom 29.–30. Juni, während ich schreibe, vorbereitet wird; jetzt also, da die basisdemokratische Konstituierung der Bewegung weiter gediehen ist, als wir es jemals zu hoffen gewagt hätten: Jetzt will ich darüber berichten und fange an mit den Worten eines Gilet Jaune, der bereits eine Woche nach Beginn des Aufstands meinte: »Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich denke, wir sollten uns vertrauen.« Mit dieser vorsichtigen Zuversicht und dem Entschluss dieses Mannes, sich und den anderen Gelbwesten zu vertrauen, teilte er »damals« – vor einem halben Jahr – etwas von dem mit, womit er, womit sie da draußen sich seit ein, zwei Wochen selber überraschten, irgendwo, ausgerechnet an den Kreisverkehren, diesen Niemandsorten. Sich und alle Welt überraschten – und eine selbstgewisse Regierung nachhaltig in Panik versetzten.
Sie überraschten sich und auch mich immer wieder. Die Gilets Jaunes – die GJs – waren (und sind) nicht »fertig«, nicht »am Ende« des Prozesses oder irgendeiner Etappe angelangt. Sie gingen von Anfang an das Wagnis ein, sich ihrem von allen Beteiligten mitgestalteten Prozess anzuvertrauen – der naturgemäß außer Kontrolle und voller Überraschungen ist. Dieser Bewegung, dieser Entwicklung versuche ich mit meiner Erzählung zu folgen. Deshalb bleibt aus meinen früheren Aufzeichnungen manches stehen, was ich streichen oder ändern müsste, wollte ich eine abschließende Einschätzung eines gesellschaftlichen Phänomens liefern.
Gerade in ihrer Schlichtheit waren sie frappierend: Bilder von ein paar Leuten in gelben Warnwesten, die im November 2018 irgendwo beieinanderstanden, konzentrierte Blicke auf DIN-A4-Blätter geheftet, diese Leute, die nacheinander jeweils einen Abschnitt des Texts in ihren Händen vorlasen. Leute, die noch nie im Leben große Reden geschwungen hatten, die noch nie vor Publikum gesprochen hatten. Leute, die sich das, was sie uns mitteilten, zuvor gemeinsam überlegt hatten. Ihre Gedanken, in ihre Worte gefasst. Entstanden in Stunden und Tagen, bei Regen und Kälte draußen auf der Straße an einem der Niemandsorte verbracht. Entstanden als Ergebnis ihres gemeinsamen Nachdenkens über das, was sie nicht mehr ertragen wollten. Woraus sich für sie eine erste Ahnung ergab, in welche Richtung es gehen könnte. Wie sie, wie wir versuchen könnten aufzubrechen. Und zusammenzubleiben in unserer Vielfalt.
»Lassen wir uns nicht vereinnahmen!«, liest ein junger Mann von dem Blatt in seiner Hand. »Es lebe die direkte Demokratie!«3 Und klar und selbstbewusst sprechen sie es aus, jüngere und ältere Frauen und Männer in gelben Warnwesten, dass sie, dass wir keine Repräsentanten brauchen, die am Ende an unserer Stelle sprechen … Wozu das denn wohl gut sein solle? Das reproduziere nur das System – ein durch und durch abzulehnendes System, gegen das sich die Bewegung wende … Das könne nur von der Basis ausgehen … »Wenn sie uns hören wollen, dann jede und jeden von uns – oder keinen.
Wenn die Regierung ›Repräsentanten‹ empfangen will, dann nicht, um unsere Wut und unsere Forderungen besser zu verstehen – sie will uns eingrenzen und unterkriegen! Genau wie sie es mit den Gewerkschaftsführungen macht, sucht sie Vermittler, Leute, mit denen sie verhandeln kann. Auf die sie Druck ausüben kann, um den Aufstand zu befrieden. Leute, die sie dann vereinnahmen und dazu bringen kann, dass sie die Bewegung spalten, um sie schließlich ad acta legen zu können.
Bei alldem rechnet sie aber nicht mit der Kraft und der Intelligenz unserer Bewegung. Sie kapiert nicht, dass wir uns sehr wohl was überlegen, uns organisieren, unsere Aktionen weiterentwickeln, sodass sie ganz schön ins Schwitzen kommt und die Bewegung nur immer weiter wächst! (…)
Wir aus Commercy rufen euch daher auf, überall in Frankreich Basiskomitees zu bilden, die als regelmäßige Vollversammlungen funktionieren. Orte, an denen das Wort sich befreit, wo wir es wagen, uns auszudrücken, uns gegenseitig auszubilden und zu unterstützen. Wenn es denn unbedingt Delegierte braucht, dann auf der Ebene jedes lokalen Basiskomitees der Gelbwesten, so nah wie möglich an der Stimme der Bevölkerung. Mit imperativem Mandat, zurückrufbar und wechselnd. Transparent. Und auf der Grundlage des Vertrauens. (…)
So werden wir es schaffen, denn damit umzugehen, das sind die da oben nicht gewohnt! Und das macht ihnen richtig Angst.
Wir lassen uns nicht dirigieren. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und vereinnahmen.
Keine selbsternannten Repräsentanten und Sprecher! Nehmen wir die Macht über unser Leben wieder selber in die Hand! Es leben die Gelbwesten in ihrer Vielfalt!«
Woher kommt, nur zwei Wochen nach der Eruption der Gelbwestenbewegung, der Gilets Jaunes in ganz Frankreich, dieser geradezu libertär anmutende Aufruf? Woher die Einsicht in die Mechanismen der Vereinnahmung? Woher das Selbstbewusstsein und der Mut, dem intelligent zu trotzen, »auf der Grundlage des Vertrauens« – in sich selbst und alle, die eingeladen sind, sich an dem Prozess zu beteiligen?
Der Aufruf kommt aus Commercy.
Französinnen und Franzosen verbinden mit Commercy möglicherweise die Madeleine, und mit diesen Küchlein verbindet eine belesene Mittelschicht Proust. Das Sandgebäck wurde der Legende nach von Madeleine, einer hübschen Bäckersgehilfin dieses Namens aus Commercy, dem damaligen Fürsten Stanislas angeboten. Der benannte es nach ihr. Damit ist schon fast erschöpfend benannt, womit die Gemeinde Commercy verzweifelt versucht, Tourist*innen anzulocken. Das knapp 6000 Seelen zählende Provinznest liegt nahe einem Nationalpark an der Strecke Straßburg–Paris, und, so das Kalkül des Tourismusbüros, eignet sich für einen Abstecher, während man selbstverständlich »eigentlich« in die Hauptstadt des Landes oder die des Elsass strebt. Außer der Madeleine-Produktion (zwei Familienbetriebe), dem beeindruckenden Schloss und einem hübschen historischen Stadtkern hat Commercy nicht viel zu bieten, nur im Herbst noch Trüffel und ein paar Läden für Trüffelprodukte in den pittoresken Altstadtgässchen. Davon einmal abgesehen ist Commercy der Ort, an dem ein paar tausend Menschen zu Hause sind, mit dem sie Erinnerungen verbinden, wo sie leben, arbeiten oder Arbeit suchen. Oder den sie verlassen müssen, weil sie keine finden. Commercy ist in der Konkurrenz der »Destinationen«, die sich für die touristische Vermarktung eignen, weit abgeschlagen. Wovon leben die Leute dort? Auf einer Website taucht Commercy als eine der ärmsten französischen Städte auf, mit einer Arbeitslosenrate, die 2015 bei ca. 25% lag; aktuellere Angaben finde ich nicht.4 Außerdem stoße ich auf einen Kommentar dazu, was man an diesem Ort liebt (die Madeleines) oder hasst (nix los, sonntags tote Hose). Ein zehnminütiges Amateurfilmchen von 1991 auf YouTube scheint Letzteres zu illustrieren.5 Da ist jemand am Ortsrand ein paar Schritte auf einem Feldweg hügelan gestiegen und hält von dort minutenlang auf ein paar Häuser da unten, einen Ausläufer von Commercy, im Vordergrund Getreide, das von der Brise gestreichelt wird. Dann fährt die Kamera auf einer schmalen Landstraße durchs Grüne, irgendein Grünes, könnte auch in Brandenburg sein, und wieder werden Häuser von einem anderen Hügel herab beäugt, könnte ebenfalls in Brandenburg sein. Kein Schloss, keine pittoreske Altstadt, nur in der Ferne irgendeine Trasse. Der unspektakuläre Film wurde in all den Jahren keine 2000 Mal angeklickt. Er handelt nur davon, dass jemand aus Commercy dort zu Hause ist, dass für ihn oder sie und ein paar andere dieser Wohnblock, diese Reihenhäuschen, diese Felder, diese Wegbiegung bedeutsam sind.
Mehr war über Commercy per Google kaum in Erfahrung zu bringen – bis 2018. Inzwischen steht ganz obenan das Video der dortigen GJs, die ihren zweiten Aufruf verlesen.6 »Die, die nichts sind«, wie es, den Präsidenten zitierend, heißt, haben sich unüberhörbar gemeldet, haben das Wort ergriffen und befreit.
Am 1. Dezember 2018, dem dritten landesweiten Samstag der Blockaden und Proteste – den Aufruf von Commercy kannte ich da noch nicht – wollte ich mir einfach nur mal ein Bild machen: Was sind das für Leute, diese Gelbwesten? Wie sind die drauf?
Ich tat es Eric Hazan gleich und ging, wie so oft in Paris, spazieren, diesmal allerdings in einem mir eher fremden Arrondissement, dem edlen achten. Seit fast zwanzig Jahren lebe ich zwischen Paris und München bzw. Berlin. In Paris ist es ganz eindeutig der Nordosten der Stadt und das Viertel Belleville, in dem ich zu Hause bin, ein sogenanntes »Quartier Populaire«, also eines, wo die weniger Betuchten wohnen. Wie Hazan, Pariser Verleger von La Fabrique und Spezialist in Sachen Aufstände, Revolten und Revolutionen, deren Subjekt diese Stadt oft genug war, stellte ich fest: Paris ist diesmal nicht das Zentrum des Aufstands. Jetzt ist die Stadt Schauplatz oder Schlachtfeld eines Aufstands, der in sie hineingetragen wird, wie er es im Gespräch mit einem Médiapart-Journalisten formuliert hat.7
Mir war natürlich bewusst, dass der von mir in Paris erhaschte winzige Zipfel einer Bewegung, die kaum zwei Wochen zuvor in ganz Frankreich, sogar in La Réunion8 explodiert ist, nicht repräsentativ sein kann. Aber auch abgesehen von meinem sehr begrenzten Blickfeld – es gibt wohl niemanden, auch nicht unter den GJs selber, der beanspruchen könnte, einen Überblick zu haben. Oder für sie sprechen zu können, was dennoch von ihnen erwartet wird, denn Medien und Politik scheinen sich nichts anderes vorstellen zu können, mit nichts anderem umgehen zu können als mit Repräsentant*innen oder mit (selbsternannten) Expert*innen. Vereinzelt haben sich GJs darauf eingelassen, während sich die meisten von solchen Ansinnen, für die anderen zu sprechen oder Sprecher vorzuschicken, schnell wieder distanzieren oder sie von vornherein ablehnen.
Ich gestehe: Als diese Leute in phosphoreszierenden Warnwesten Mitte November alle Welt überraschten, indem sie überall im Land Straßen blockierten, weil sie die angekündigte Erhöhung der Dieselsteuer in Rage brachte, war meine – ebenso arrogante wie ignorante – erste Reaktion: Höhere Spritpreise, was ist daran verkehrt? Ich hätte nichts dagegen, wenn das Autofahren so richtig teuer würde.
Dann drang auch zu mir, der selbstgerechten Autogegnerin, durch, dass diese Gelbwesten da draußen in der Provinz, anders als ich, auf das Auto angewiesen sind. Menschen in der Provinz leben in peri-urbanen Zusammenhängen, von denen ich so viel Ahnung habe wie von … La Réunion. Es sind Menschen, die sowieso kämpfen müssen, um einigermaßen selbstbestimmt leben zu können. Menschen, die durch höhere Kraftstoffpreise in echte Bedrängnis geraten, auch wenn sie nicht gerade verhungern oder obdachlos werden: eine untere Mittelschicht mit begründeter Angst vor dem Absturz oder auch bereits der realen Erfahrung des Absturzes in eine von ihnen als unwürdig empfundene Situation.
Allmählich fragte ich mich, welches Fass die Erhöhung der Dieselpreise da eigentlich zum Überlaufen gebracht hat für Millionen französischer Normalos, von denen Hunderttausende sich binnen kürzester Zeit an Autobahnauffahrten, Kreuzungen und Mautstellen trafen, sich in den sozialen Medien darüber verständigten und gemeinsam Konsequenzen zogen.
Im Januar 2019, sechs Wochen nach Beginn der ersten Kreiselblockierungen, gibt es in Le Monde diplomatique ein Dossier zum Thema. Es ist überschrieben: »Der französische Aufstand«9. Serge Halimi stellt unter der Überschrift »Wenn alles an die Oberfläche drängt«10 eine historische Analogie zu den Streiks der Arbeiter vom Mai/Juni 1936 in Frankreich her: »Schon damals die gleiche Überraschung der oberen Klassen bezüglich der Lebensbedingungen der Arbeiter*innen und angesichts ihrer Forderung nach Anerkennung ihrer Würde.« Und er zitiert Simone Weil in diesem Zusammenhang: »›All jene, die nicht die geringste Ahnung von diesem Sklavenleben haben, begreifen nicht, was das Entscheidende ist. Bei dieser Bewegung geht es keineswegs um diese oder jene einzelne Forderung, so wichtig sie auch sein mag. (…) Vielmehr, nachdem man sich immer gebeugt hat, alles ertragen hat, alles monatelang, jahrelang still geschluckt hat, geht es darum, es zu wagen: sich wieder aufzurichten, aufrecht zu stehen. Und seinerseits das Wort zu ergreifen.‹«
Auch ich hatte keine Ahnung. Vor allem hatte ich keine Ahnung davon, dass ich keine Ahnung hatte. Ich hatte herablassend vermutet: Sind das Leute, die den Klimawandel für eine Fiktion halten? Womöglich Nationalist*innen, Rassist*innen? Schließlich gab es Berichte von rassistischen Übergriffen der GJs, in ihrer Mehrheit weiße Französinnen und Franzosen. Würden sie sich im Handumdrehen von Marine Le Pen oder Jean-Luc Mélenchon11 vereinnahmen lassen?
Ich sah mir YouTube-Videos von den rassistischen Übergriffen durch GJs an. Ich las die Berichte und nahm sie ernst. Es sind wohl Einzelfälle, aber sicher gibt es mehr davon, die nicht dokumentiert sind. Doch dann mache ich mir klar: Dies ist ein echter Volksaufstand. Ein »unreiner« Aufstand, nicht gewerkschaftlich oder sonstwie organisiert oder kontrolliert. Und unter einigen hunderttausend Durchschnittsfranzösinnen und -franzosen (wie unter einer solchen Anzahl von Durchschnittsdeutschen …) hegt ein gewisser, in letzter Zeit wohl zunehmender Prozentsatz rassistische Einstellungen. Das ist verheerend, zumal der Prozentsatz kein unerheblicher ist. Was aber auf die Gelbwesten wie auf die Durchschnittsbevölkerung ebenfalls zutrifft: Den Berichten und Videos ist zu entnehmen, dass vielfach sofort zum Schutz der Angegriffenen eingegriffen und der Rassismus verurteilt wurde.
Laut einer am 11. Dezember 2018 von Le Monde12 veröffentlichten Erhebung auf der Grundlage einer Befragung von 166 GJs mittels Fragebögen und Gesprächen bei deren Blockadeaktionen und Demos zählen sich 5% von ihnen zur extremen Rechten, über die Hälfte zur Linken oder extremen Linken. Weniger als 200 Befragte sind natürlich nicht repräsentativ – der Bericht hat, wie alles, was derzeit an verallgemeinernden Feststellungen über die GJs versucht wird, nur wenig Aussagekraft.
Einer der Initiator*innen der Bewegung, der nach wie vor als »führende« Persönlichkeit stark wahrgenommen wird und von sich reden macht, Eric Drouet, hat noch im Juni 2018 Macron vorgeworfen, zu viel Geld für die Versorgung der Migrant*innen auszugeben, das besser für die sozialen Belange »der Franzosen« angelegt wäre.13 Bei anderer Gelegenheit, ebenfalls vor dem Aufstand der GJs, äußerte er sich auf Facebook gehässig über die Flüchtenden im Dschungel von Calais.
Was offenbaren oder beweisen diese und weitere Hinweise auf rechte Orientierungen mancher oder vieler GJs? Was bedeutet es andererseits, wenn eine weitere bekannte GJ-Persönlichkeit, die schwarze Karibikfranzösin Priscilla Ludosky, offenbar kein Problem damit hat, mit Drouet in einem Atemzug genannt zu werden und mit ihm zusammen aufzutreten? Jedenfalls ist es bis Januar 2019 so. Dann distanziert sie sich von ihm – aber keineswegs aufgrund seiner womöglich rechten politischen Gesinnung.14 Was bedeutet es, wenn es im 2. »offiziellen Kommuniqué« der GJs von Ende November 2018 einleitend heißt: »Es ist wichtig, dass jede/r, die oder der sich an dieser Bewegung beteiligen will, dies tun kann, unabhängig welches seine oder ihre Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung, Gender, Religion sein mag. Dasselbe gilt für diejenigen, die fest zu dieser Bewegung gehören. (…) Nein, die GJs sind keine Herde nationalistischer, faschistischer oder anderer Schafe, die einer extremistischen Bewegung nachlaufen, so wie unsere Bewegung auch durch keine Partei oder Gewerkschaft repräsentiert wird.«15
Was bedeutet »offizielles Kommuniqué« in diesem Zusammenhang? Es gibt keine Organisationsstruktur, in die sich alle GJs einfügen, innerhalb derer Beschlüsse nach einem festgelegten Prozedere gefasst würden. Es gibt keine Instanz, die einzelne GJs beauftragen könnte (oder wollte), sich in der Öffentlichkeit in ihrem Namen zu äußern oder es ihnen zu untersagen. Was einerseits im zitierten Kommuniqué formuliert wird oder was andererseits Eric Drouet als ein prominenter GJ in der Vergangenheit von sich gegeben hat, ist eben nicht repräsentativ oder repräsentiert jeweils nur eine Facette der Bewegung neben anderen, möglicherweise konträren, die allesamt ernstzunehmen sind. Auch die Möglichkeit ist ernsthaft ins Auge zu fassen, dass jemand wie Drouet durch die Bewegung, mit der Bewegung, in der seine – berechtigten – Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Umverteilung des Reichtums von anderen geteilt werden, die Chance hat, krude Theorien hinter sich zu lassen.
Die weit verbreitete Haltung, lieber abzuwarten und zuzusehen, wie sich die eine oder andere Tendenz »am Ende« durchsetzt, nur »um ja nichts falsch zu machen«, ist in meinen Augen eine apolitische. Es ist die normale Herangehensweise der meisten gut Informierten, die Zeitung lesen, interessiert Arte-Sendungen ansehen, sich besorgt über dies oder das äußern, eine Partei wählen, eine andere auf gar keinen Fall – und die jedenfalls keine Verantwortung übernehmen.
Die GJs unterschiedlichster Couleur aber haben sich dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen, oder wurden durch eine beflügelnde und plötzlich bei vielen gleichzeitig aufgeflammte Wut dazu getrieben, erstmals das als gemeinsam erlebte Schicksal in die Hand zu nehmen. Sie sind vielleicht zu optimistisch, aber sie scheinen in ihrer Mehrheit zu denken: Wir sollten uns vertrauen und kritisch fragend vorangehen.
Gelegentlich flattert die Trikolore bei Ansammlungen gelber Westen, oder es wird mit erhobener Faust die Marseillaise gesungen. Ich frage mich, was hat die nachvollziehbare Wut über eine Spritpreiserhöhung, die viele empfindlich trifft, mit nationaler Identität zu tun? Ich nehme mir vor, bei nächster Gelegenheit eine Trikolore schwenkende Gelbweste zu fragen, was ich tatsächlich auch schon sehr bald tue. In dieser wie so vielen anderen Fragen wird mir meine Ahnungslosigkeit im Laufe der Zeit klar und verschaffen mir die GJs befreiende Perspektivwechsel.
Viele Fragen sind für mich noch weit offen, als ich auf einen Beitrag auf lundimatin stoße, dem Blog, dessen Newsletter mit Analysen, Essays, Debattenbeiträgen ich seit rund zwei Jahren jeden Montag bekomme. Die anonymen Redakteur*innen entschuldigen sich dafür, dass sie ihre Leser*innen derzeit sogar mehrfach die Woche mit »Artikelsalven« belästigen. Für kritische Intellektuelle ist so ungeheuer viel zu erforschen und zu kommentieren angesichts einer breiten Erhebung, die sich rasend schnell fern der Reichweite der Pariser Diskurse gebildet hat, Diskurse über Alternativen zum Kapitalismus, über die seit Jahren stattfindende neoliberale Zurichtung Frankreichs, über Kolonialismus und Rassismus, über Projekte von besetzten Gebäuden oder Gebieten (ZAD), ihre gewaltsame Räumung durch den Staat und seine Ordnungskräfte, die rassistische Polizeigewalt und vieles andere mehr, was wir – links-libertär Gesonnene – bisher in Paris quasi unter uns diskutiert haben. Die Herausforderung scheint zu sein, sich angesichts der von unseren Debatten unberührten Bewegung nicht dazu hinreißen zu lassen, von oben herab und weit weg auszusortieren, was nicht ins eigene »linke«, »kritische« Framing passt. Auf lundimatin also lese ich nun diesen Text, der mich nachhaltig beeindruckt. Junge Leser*innen des Blogs, Pariser Studierende, solche (stelle ich mir vor), die am 1. Mai im schwarzen K-Way16 beim Schwarzen Block marschieren, überredeten den Vater von einer*m von ihnen – einen kleinen Angestellten in einem mittleren Betrieb in der Provinz –, nach langer hitziger Diskussion, einen Beitrag für den libertären Blog zu schreiben.17
Dieser 57-jährige Autor macht zunächst klar, dass er stolz ist, zu den Gelbwesten zu gehören, aber keine »Wahrheit« über sie verbreiten könne oder wolle, nur so viel: »Was uns verbindet, ist unsere Wut und unsere Aktion – einerseits viel, andererseits sehr wenig. Doch zumindest zeigt sich dabei: Es gibt uns.« Ihn ärgern die Behauptungen von Politiker*innen und Medien, die, noch ehe die Gelbwesten richtig losgelegt hätten, ihnen unterstellten, sie seien Idioten, die auf dem Recht bestünden, den ohnehin schon schwer beeinträchtigten Planeten weiter zu verpesten.18 Dass der Planet in diesem miserablen Zustand sei, läge nicht an denen, die mit ihrem Auto zur Arbeit führen, sondern daran, dass Unternehmen und Politik jahrelang alles dafür getan hätten, »die Wirtschaft ungehindert machen zu lassen, anstatt sich um die Tiere, unsere Gesundheit, unsere Zukunft zu kümmern. Und genau so machen sie weiter, während sie uns für ihre pseudo-ökologische Wende, die die Probleme keinesfalls angemessen lösen wird, tief in die Taschen greifen. Diese Leute haben sich auf so ungefähr jedem Gebiet unglaubwürdig gemacht, und jetzt sollen wir ihnen in Sachen Ökologie und Überleben der Menschheit vertrauen? … Was wir blockieren, ist unser alltägliches Leben: die Landstraßen, die Nationalstraßen, die Einkaufszentren und Industriegebiete.« Er erzählt von netten Gewerkschafter*innen, die zu den Blockaden der GJs gekommen seien, um auf sie einzureden, sie sollten sich doch am Arbeitsplatz organisieren. Er gibt ihnen grundsätzlich Recht, nur »das Problem ist, dass wir nicht alle in großen Unternehmen arbeiten, wo das Kräfteverhältnis so ist, dass wir Druck aufbauen können … Sicher, das Land zu blockieren, das ist nicht unbedingt revolutionär.«
Als ich das lese, denke ich mir: Doch, genau das ist revolutionär! Mann, ihr seid viel zu bescheiden! Wie haben wir immer gerade das herbeigesehnt! Die anarchistisch inspirierten Graffitis an Pariser Hauswänden, vor Jahren schon, fallen mir ein: »Es ist das Fließen, das diese Welt aufrechterhält – blockieren wir alles!«19 Das war ein Poster an einer Mauer, ich glaube, zur Zeit der massenhaften Proteste gegen den »Ersteinstellungsvertrag« CPE20. Ich habe es fotografiert – aber es war ja nur ein Traum, eine Ahnung von etwas, das, würde es umgesetzt, den Wahnsinn des Kapitalismus ausbremsen könnte. Natürlich nur, wenn wirklich viele, überall gleichzeitig blockierten… Die Parolen auf Demos: »Bloquons tout!«, »Blockieren wir alles!«, habe ich natürlich auch gerufen, gerne. Das Buch von Jake Alimahomed-Wilson und Immanuel Ness, Choke Points – Logistics Workers Disrupting the Global Supply Chain21, fällt mir ein und natürlich La Réunion, die Gelbwesten dort, die umfassenden Blockaden von Hafen, Flughafen, Verwaltung, durch die die kolonialistischen Ausbeutungsverhältnisse nicht nur symbolisch infrage gestellt werden.22
Dieser Vater eines*r jungen linksautonomen Intellektuellen äußert sich tatsächlich mit einer grandiosen Bescheidenheit. Nichts weniger als Revolution, Umsturz, eine tiefgreifende Veränderung, das scheint ihm einerseits unumgänglich angesichts all dessen, »was uns erstickt, versklavt, nervt und uns rundum unglücklich macht«. Darüber hat er vermutlich mit seinen studierenden Kindern gesprochen. Doch so viel ehrlicher als großspurige »Revolutionäre« aller Art steht er zu dem, was ihn zögern lässt, zu dem, »was uns hält, und woran wir festhalten« – »eine Art zu leben (…), die Familie, mit Freunden zusammen grillen, die Arbeitskollegen – das kann einem unwichtig vorkommen, aber, sorry, nein, wir verbringen die Abende nicht damit, Arte zu schauen oder das Wochenende mit Museumsbesuchen.« Was heißt das, frage ich mich, warum berührt es mich? Er liebt das Leben, sein Leben da in der französischen Provinz, das ihm andererseits immer mehr vergällt wird. Er ist sich bewusst, dass viele, die anspruchsvolleren Wochenendbeschäftigungen nachgehen als mit Freund*innen zu grillen, auf seine Art zu leben und das Leben zu genießen herabsehen. Er entschuldigt sich fast für seine Unbedarftheit und hält zugleich daran fest. Er weiß, was er hat an seiner Familie, seinen Freund*innen, seinen Kolleg*innen, seiner Stadt à la Commercy. Zugleich ist er sich sehr wohl bewusst, dass es keine heile Welt ist. Er weiß, wovon er spricht, von dem, »was uns erstickt, versklavt, nervt und uns rundum unglücklich macht«. Er erlebt das sicherlich intensiver und direkter, weniger abgefedert als manch ein*e gepflegt Reisende*r oder manch ein*e Museumsbesucher*in, die sich auch über all das Gedanken machen und über eine Veränderung nachsinnen. Revolution? Darüber lassen sich kritische Metropolenbewohner*innen möglicherweise unbeschwerter aus als er. Aber er, der ältere Mann aus der Provinz, der stolz die gelbe Warnweste trägt, ahnt, dass es vor allem er und seine Leute sind, die die Revolution machen, falls es dazu kommt. Dass sie nicht bloß darüber nachdenken – und im Zweifelsfall auch den unwägbaren Preis zahlen würden.
»Außerdem«, kommentiert er die Bewegung weiter, »ich kenne mich nicht gut aus in Geschichte, aber ich glaube nicht, dass die, die 1789 oder 1968 auf die Straße gegangen sind, schon bevor es losging ganz genau wussten, was sie wollten und in welche Richtung sie gehen wollten. Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich denke, wir sollten uns vertrauen.«
Er versteht die Angst, die das Unbekannte bei vielen auslöst, die Befürchtungen, dass die GJs »ein vom Front National23 manipuliertes Fascho-Ding sind« oder werden. Ob es dazu kommt, das kann er nicht sagen, doch bisher treffe es nicht zu. »Es wäre das Ende der Bewegung«, sagt er. Und ja, es gebe offenbar Rassist*innen und Homophobe unter den GJs, auch wenn er das selber bei den Blockaden nicht erlebt hat – »aber es ist unsere Aufgabe, dem vor Ort und ohne viel Federlesens entgegenzutreten, und nicht der Job von aufgeblasenen Redakteuren in ihren grandiosen Fernsehauftritten. Ihre blöden Ratschläge, die können sie sich sonstwohin stecken.«
Er schließt, trotzig und selbstbewusst: »Die Regierenden und die Journalisten, sollen die sich doch über uns lustig machen, wenn sie sehen, wie wir einen Kreisverkehr blockieren und manchmal dabei kindisch rumhopsen, aber seit Samstag fühlen wir uns ein bisschen weniger allein und sind ein bisschen glücklicher.«
Am 1. und am 8.12.2018 – wie sich später herausstellen würde, zwei für viele Gelbwesten emblematische »Akte« (so die Bezeichnung der »gelben Samstage«) – bin ich ausnahmsweise in den »schönen Vierteln« spazieren gegangen. Um ehrlich zu sein: Zu diesem Zeitpunkt war es schon ein ausgesprochen politischer »Spaziergang«. Vorsichtshalber ließ ich diesmal meinen grundsätzlich demo-erprobten Hund zu Hause, ahnte nach den Bildern und Berichten, vor allem von Akt II, bereits, dass es mindestens zu heftigem Gedränge und unvorhergesehenen Sprints kommen würde.24 Es war abzusehen, dass die »Ordnungskräfte« großzügig Tränengas und Wasserwerfer einsetzen, wenn nicht zu massiveren Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen greifen würden. Es war mir klar, dass auch die zurückhaltendsten und vorsichtigsten Demonstrant*innen unversehens in gefährliche Situationen geraten konnten, Situationen, in denen es vor allem darauf ankommt, auf sich und aufeinander aufzupassen.
Am 8.12. – Akt IV – ist es mir trotzdem gelungen, unbehelligt bis in den Kern der Kampfzone vorzudringen. Ich war sogar kurz auf den Champs-Elysées, sah von weitem den Arc de Triomphe und von nahem die akkurat pressholzummantelte Schaufensterfront von Adidas. Man hatte es sich nicht nehmen lassen, uns darauf fein säuberlich mit Schablone gesprayt zu versichern, dass wir, come what may, an 7 von 7 Tagen 24 Stunden lang Sneakers von Adidas einkaufen können, selbstverständlich, im Netz, wie immer. Tröstlich. Doch was, wenn das Zeug nicht mehr geliefert wird, weil Lager und Straßen blockiert sind?! Nicht auszudenken … oder doch?!
Eric Hazan schrieb schon 2011: »Die Champs-Elysées haben einen Niedergang erlebt – irgendwann in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts schrieb ich, sie erinnerten an den Duty-free-Bereich eines internationalen Flughafens (…): Das gilt nach wie vor, aber das Standing des Flughafens hat sich weiter verschlechtert, und man bekommt da nicht mal mehr ein ordentliches Glas Wein. Es gibt nur noch Pseudo-Pizzerien und echte Fast-Food-Läden«.25 An einem Tag wie diesem, an dem das Shopping-Angebot fein säuberlich verschalt ist, lässt sich Hazans »Bewertung« nicht wirklich überprüfen, aber ich vermute, sie trifft auch sieben Jahre danach immer noch zu.
Unser Weg zu den Champs-Elysées führt durch heute ausnahmsweise stille Straßen und hat was von, um im Bild zu bleiben, Flughafen-Security bei höchster Terrorwarnstufe: die gepanzerten Fahrzeuge der Ordnungskräfte, ein jeder von ihnen selber ebenfalls gepanzert von Kopf bis Fuß. Viele zusätzlich hinter haushohen mobilen Gittern zum Schutz vor dem ungepanzerten und unbewaffneten Volk. Das Volk: überwiegend Leute aus der Provinz, so erlaube ich mir zu schließen, aus ihren unprätentiösen Klamotten, den praktischen Arbeitsschuhen, dem uneleganten, um nicht zu sagen un-pariserischen Gang, dem Zögern manchmal, um sich zu vergewissern: Wo sind wir hier eigentlich, wo geht’s überhaupt hin? Kein Mensch kennt das verdammte Viertel. Das Volk, das von den Gepanzerten durch Gitter hindurch beäugt, ins Visier genommen wird, hat diese prächtigen Straßen und Plätze allenfalls schon mal im Fernsehen gesehen. Jetzt ist es gekommen, in gelben Westen oder auch ohne, zieht ungerührt an den Gepanzerten und der abgeriegelten Pracht vorüber, plaudernd, lachend, mampfend – gegen Mittag kommt allmählich Hunger auf, ein kleiner Carrefour-Supermarkt in einer Nebenstraße hat sich nicht verbarrikadiert und bietet Sandwiches und Ähnliches an. In Grüppchen, die zusammen- und wieder auseinanderfließen, und einzeln, mitten auf den fast autofreien Straßen, spazieren wir, mal flotter, mal gemütlicher. Manche machen Pause und setzen sich auf eine Stufe in den Eingang eines der vielen geschlossenen, teilweise vernagelten Restaurants, Bankfilialen, Geschäfte.
Hier und da verteile ich Flugblätter, die auf die Demo für die Rechte der Migrant*innen am 18. Dezember hinweisen.26 Sie werden interessiert genommen, gefaltet und weggesteckt oder im Gehen gelesen. Jemand dreht sich zu mir um: »Das ist sehr wichtig.« Ich bin erleichtert über diese Resonanz in einem mir noch fremden Kontext. In meinem Viertel, Belleville, verteilen wir von der Initiative 20ème solidaire oder »Solidarisches 20. Arrondissement« die Flugblätter für den 18. Dezember seit einigen Wochen an den Métro-Ausgängen, wo sie von vielen Passant*innen ohne Zögern genommen werden. Belleville ist ein traditionelles Einwander*innen-Viertel und zugleich eines mit linken Strukturen. 20ème solidaire, die Initiative, mit der ich dort verbunden bin, setzt sich mit Migrant*innen, unseren Nachbar*innen, für deren Rechte ein, wobei wir als grundsätzlich Privilegierte uns in den Dienst ihrer Selbstermächtigung nach ihren Vorgaben und Wünschen stellen.
Die Demo am 18. Dezember – der Anlass ist der internationale Tag der Migrant*innen – wird ein großer Erfolg werden, medial allerdings kaum beachtet. Tausende beteiligen sich allein in Paris, ganz überwiegend Migrant*innen aus den ehemaligen Kolonien Westafrikas, und manche von ihnen tragen gelbe Warnwesten. Ganz im Sinne des Flugblatts: »Überall in Frankreich: Kommt am 18. Dezember um 18 Uhr zusammen. Mit Weste, gelber, roter oder oranger oder auch ohne. Mit und ohne Papiere. Schwarz vor Wut und solidarisch. Um unsere Brüder und Schwestern zu ehren, die tot sind. Leuchtet hell und seid laut. Für die Freiheit und die Gleichheit.« Unterschrieben ist der Aufruf von Hunderten Gruppen, Initiativen, NGOs, Parteien, Gewerkschaften, man könnte flapsig sagen: von allem links der Sozialistischen Partei, darunter auch meine »angestammten« Zusammenhänge: die UJFP27 (die französische Schwesterorganisation der deutschen Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost28), die ATMF29 (der Arbeiterverein der Marokkaner*innen Frankreichs) und natürlich 20ème solidaire30. Die UJFP und die ATMF agieren gemeinsam gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für gleiche Rechte – »in Frankreich, Palästina und überall«.
Anfang Dezember, während ich die Bewegung der GJs entdecke, bange ich immer noch, ob sich womöglich herbe Unvereinbarkeiten mit dem herausstellen, was meinen politischen Freund*innen und mir am Herzen liegt: eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg für alle.
Als ich an diesem 8. Dezember ein paar Gelbwesten sehe, von denen eine die Trikolore dabei hat, ergreife ich die Gelegenheit und frage die Frau, warum, in diesem Kontext. Sie und die anderen um sie herum antworten bereitwillig: »Unser Protest richtet sich nicht gegen Frankreich, im Gegenteil, wir sind für Frankreich.« Aber sie wollen ein Frankreich, in dem alle gleiche Rechte haben. Dieser Bezug auf die Nation – er bleibt mir fremd, obwohl ich natürlich weiß, dass er in Frankreich grundsätzlich ein anderer ist als in Deutschland.31
YouTube-Filme von Gelbwesten, die mit erhobenen Fäusten die Nationalhymne singen – wie würde ich einen solchen nationalstolzen Gesang aus deutschen Kehlen empfinden?
Die Marseillaise, sage ich mir, ist ein Lied vom Aufstand gegen die Unterdrücker*innen. So meinen sie es wohl, wenn sie sie für sich reklamieren. Natürlich lassen sich Nationalhymnen und -flaggen und alle möglichen identitätsstiftenden Fetische zur Beschwörung von nationalen Wir-Gefühlen für unterschiedlichste Leute und deren diverse Anliegen als »Vereinendes« – gegen ein fiktives feindliches oder minderwertiges »Anderes« – missbrauchen. So vieldeutig changiert übrigens auch das »Grab des unbekannten Soldaten« innerhalb des Arc de Triomphe, um den am 1. Dezember der Kampf zwischen Ordnungskräften und recht unterschiedlichen GJs tobte. Den Tags, die, natürlich nur für wenige Stunden, das nationale Symbol schmückten,32 etwa »Anarchist«, »Mai 68, Dezember 2018« oder »Die extreme Rechte wird verlieren«, ist zu entnehmen, dass um und unter dem Bogen einerseits eher anarchistisch bzw. links eingestellte GJs aktiv waren, denen nichts Nationales heilig ist. Manchen von ihnen ist es durchaus zuzutrauen, dem Grab des unbekannten Soldaten, Teil des Ensembles, mit wenig Respekt zu begegnen. Andererseits bezeugen zahlreiche Berichte und Bilder, dass sich GJs schützend um das Grab versammelten, die Marseillaise sangen und dass Einzelne von ihnen auf die Randalierer schimpften und »Friedlich, friedlich!« riefen, was wiederum für Marine Le Pen ein willkommener Anlass war, diese Gelbwesten zu loben, selbstverständlich ohne sie zu fragen, ob sie Wert darauf legten.33 Das Anliegen der so Gepriesenen mag es vielmehr gewesen sein, den Soldaten zu ehren, den außer seinen nächsten Angehörigen niemand kennt, einer, der von Politiker*innen und Generälen in deren Kriegen geopfert wurde. Viele GJs, ob sie nun ausgesprochen nationalstolz sind oder nicht, sehen vermutlich die Parallele: die Arroganz der Macht, die sie, ihr Leben, ihre Nöte und Bedürfnisse ignoriert, und das schamlos. Denn die aktuelle Verkörperung dieser Macht, Macron, tritt nicht einmal der Form nach für das Wohl aller Französinnen und Franzosen ein, sondern ganz unverblümt für das einer Elite, der er dabei behilflich ist, sich auf Kosten der Bevölkerung zu bereichern. Allgegenwärtige Tags und Slogans wie »Nieder mit Macron!« oder »Macron Démission!«, die anfingen, mir auf die Nerven zu gehen, weil sie, wie mir schien, unpolitisch die Wut auf eine Person ausdrücken, sie leuchteten mir allmählich immer mehr ein. Sie hörten auf, mich unangenehm an das Gehetze deutscher Rechter zu erinnern. Wenn die »Merkel muss weg!« schreien, dämonisieren sie deren Politik gegenüber Geflüchteten und Migrant*innen. Bei den Gelbwesten geht es um soziale Gerechtigkeit – für alle.
Am Dienstag nach dem denkwürdigen Akt III versammelten sich konservative Herrschaften, uniformiert und hoch dekoriert, allen voran der General Bruno Dary, »Präsident der Flamme«, an dem Grab, um, bebend vor Empörung über die angebliche »Schändung« vom Samstag, ihrerseits die Marseillaise anzustimmen, diesmal gegen das aufständische Volk, trotzdem mit denselben Worten.34
Leider kann man den unbekannten Soldaten nicht mehr fragen, welcher Ehrung er den Vorzug geben würde. Oder doch? Tatsächlich komme ich unverhofft in den Genuss eines Interviews mit ihm. Seine Antworten konnten erfreulicherweise durch Tischrücken eruiert werden. Als Medium fungierte der Philosoph Alain Brossat.35 Dem klagt der »Kamerad unbekannter Soldat« erst mal, wie sehr ihm die mit Orden behängten Typen, die »Sechs-Sterne-Gorillas«, und die Tourist*innen und ihre nervige Brut auf den Wecker gehen. Darunter, während des höchste Konzentration erfordernden spiritistischen Exklusivinterviews, ausgerechnet ein kleiner »Boche«, ein »Fritz«, ein Deutscher … Nicht auszuhalten, das ganze Affentheater, das ihn regelmäßig am Schlafen hindert – und dann seien da endlich Leute gekommen, Menschen, »die normal reden, sagen, was sie wollen, und die ganz genau wissen werden, warum und wofür sie sich geschlagen haben. Und echt, glaubst du’s, fast wären mir die Tränen gekommen, als ich hörte, was sie gerufen haben: ›Macron Démission! Les Gilets Jaunes triompheront!‹«
Aber, hakt das Medium nach, die Gewalt, die Verwüstungen …
Der Geist unter der ewigen Flamme weist den Philosophen unwirsch zurecht, er solle aufhören, das Geschwätz der Medien nachzuplappern. Er habe in den langen Nächten, wenn ihn nur vier Bullen bewachten und im Übrigen Ruhe herrsche, viel Zeit nachzudenken. Da sei ihm schon lange klar geworden, dass es nicht mehr ewig so weitergehen könne. »Der Korken wird rausfliegen, das explodiert, die Leute werden sich erheben (…). Und als ich dann neulich hörte, dass das näher kommt (…), die Schreie, die Granaten, die Angriffe und Gegenangriffe, und dass die Gilets Jaunes den anderen ganz schön zu schaffen machen – da hab ich mir gesagt, das ist genial … Und als sie dann von überallher auf den Platz einfielen und sich ganz dicht um die Gruft drängten, ich sag dir, da hätte ich am liebsten den Deckel hochgehoben und sie in die Arme geschlossen!«
Fraternisieren, oder was …
»Na klar, und noch ein bisschen mehr als das!«
Der unbekannte Soldat ist überzeugt, es hilft nur noch »ein ordentlicher, ein echter Aufstand! Und den haben wir jetzt, voilà«. Und selbst wenn der in sich zusammenfallen sollte, wäre er immer noch froh, dass er überhaupt stattgefunden habe. »Indem man die Leute so übel unter Druck setzt, lässt man das Volk wiederauferstehen – es kann gar nicht anders sein. Und zwar kein Operetten-Volk. Sondern ein fuchsteufelswildes. Eins, das randaliert – ganz klar. Das werden die nie kapieren – die anderen …«
Und sag mal, was hast du eigentlich gemacht, bevor du den unbekannten Soldaten gegeben hast?
»Ich war Drucker, Anarchist, hab ›La Guerre Sociale‹36 gelesen …«
Also deine Revolte, die kommt von ganz schön weit her …
»Von sehr weit, und sie wird es noch weit bringen …«
Was mir in den Tagen der ungezügelten Revolte auch allmählich klarwurde: Du kannst nicht überall sein, du verpasst ungleich mehr als du mitbekommst. Gerne hätte ich dem unbekannten Soldaten, der mir inzwischen nicht mehr so unbekannt vorkommt, am 1. Dezember die Ehre erwiesen.
Ein Teil des Aktes III der GJs war eine Demo, die am Pariser Bahnhof Saint-Lazare losging. Das Facebook-Event dazu lief unter der Überschrift: »Die Quartiers in gelber Weste« – gemeint war, dass Bewohner*innen der Quartiers Populaires, oft auch als »sensible« oder »schwierige« Viertel bezeichnet, bei diesem Akt die gelbe Weste überziehen und dabei sein würden.





























