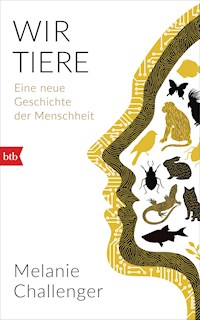
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine vollkommen neue Geschichte der Menschheit.
Wir Menschen sind die neugierigsten, emotionalsten, einfallsreichsten, aggressivsten und gleichzeitig verwirrendsten Tiere auf dem Planeten. Doch wie gut kennen wir uns wirklich? Hadern wir mit unserer eigenen tierischen Natur und vernachlässigen damit einen zentralen Aspekt unseres Menschseins? Challengers revolutionäres Buch kombiniert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus Natur- und Umweltgeschichte, Biologie und Philosophie, und führt uns thematisch von den frühen Agrargesellschaften über die Antike und die Moderne bis hinein in die nahe Zukunft der künstlichen Intelligenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Wir Menschen sind die neugierigsten, emotionalsten, einfallsreichsten, aggressivsten und gleichzeitig verwirrendsten Tiere auf dem Planeten. Doch wie gut kennen wir uns wirklich? Hadern wir mit unserer eigenen tierischen Natur und vernachlässigen damit einen zentralen Aspekt unseres Menschseins? Challengers revolutionäres Buch kombiniert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus Natur- und Umweltgeschichte, Biologie und Philosophie, und führt uns thematisch von den frühen Agrargesellschaften über die Antike und die Moderne bis hinein in die nahe Zukunft der künstlichen Intelligenz.
Zur Autorin
MELANIE CHALLENGER, studierte Literatur und Sprache an der Universität Oxford. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Librettistin für klassische Musik, bevor sie sich der Erforschung naturgeschichtlicher und bioethischer Themen widmete. Ihr erstes Buch On Extinction zählte laut Publisher’s Weekly zu den besten Sachbüchern des Jahres 2012. Sie ist außerdem preisgekrönte Lyrikerin. Unter anderem adaptierte sie als Librettistin das Tagebuch von Anne Frank als Chorwerk für James Whitbourn, der dafür mit einem Grammy geehrt wurde. Für ihre Arbeiten über die kanadischen Inuit erhielt Melanie den renommierten Darwin Now Award. Die British Antarctic Survey machte sie für ihre Arbeiten über die Geschichte des Walfangs zum Fellow. Derzeit ist sie Mitglied des Nuffield Council on Bioethics und lebt mit ihrer Familie mitten in einem Waldstück.
Melanie Challenger
WIR TIERE
Eine neue Geschichte der Menschheit
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »How to Be Animal: A New History of What it Means to Be Human« im Verlag Canongate Books Ltd., Edinburgh.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe August 2021
Copyright der Originalausgabe © Melanie Challenger, 2021
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE.
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Gill Heeley
Umschlagmotiv: © Gill Heeley
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24897-0V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Allein lässt sich der Mensch weder verstehen noch retten.
Mary Midgley
Inhalt
Der unauslöschliche Stempel
Der Traum von Größe
Bürgerkrieg im Kopf
Fremde der Schöpfung
Das Tagewerk der Sterne
Koda: Von der Schönheit des Tierseins
Ausgewählte Literatur
Dank
Abbildungsverzeichnis
Sachregister
Der unauslöschliche Stempel
Der Mensch mit allen seinen edlen Eigenschaften, mit der Sympathie, welche er für die Niedrigsten empfindet, mit dem Wohlwollen, welches er nicht bloß auf andere Menschen, sondern auch auf die niedrigsten lebenden Wesen ausdehnt, mit seinem gottähnlichen Intellekt, welcher in die Bewegungen und die Konstitution des Sonnensystems eingedrungen ist, [trägt] mit allen diesen hohen Kräften doch noch in seinem Körper den unauslöschlichen Stempel eines niederen Ursprungs.
Charles Darwin, The Origin of Species
Die Welt wird heute von einem Tier beherrscht, das sich nicht als Tier begreift. Und die Zukunft wird von einem Tier entworfen, das kein Tier sein will. Die Folgen bleiben nicht aus. Denn wenn die Geschichte vor ein paar Millionen Jahren bei einem aufrecht gehenden Affen mit einem Faustkeil begann, ist sie inzwischen bei einem haarlosen Primaten angelangt, der mit seinen Werkzeugen nach den Molekülen des Lebens greift.
Der Mensch selbst ist heute eine weitaus stärkere evolutionäre Kraft als die sexuelle Auslese oder die selektive Zuchtwahl. Mithilfe der Entdeckungen der Genforschung und Gentechnik können wir auf vielfältige Weise in die organische Struktur von Tieren eingreifen, auch in unsere eigene. Wir erschaffen Nagetiere mit menschlichen Leber- und Nervenzellen. Wir züchten Lachse, die nach unserem Terminkalender wachsen. Wissenschaftler können das Erbgut so manipulieren, dass sich todbringende Mutationen durch eine ganze Population von Wildtieren verbreiten.
Der Rest der Biosphäre befindet sich derweil in der Krise. In den Meeren, Wäldern, Wüsten und Steppen verschwinden Arten mit atemberaubender Geschwindigkeit. Aus geologischer Sicht sind wir Menschen eine Eiszeit, eine furchtbare Naturgewalt. Unsere Städte und Fabriken hinterlassen ihre Spuren im Erdreich, in den Zellen von Tiefseelebewesen und in den Teilchen hoch oben in der Stratosphäre. Bedauerlicherweise wissen wir nicht, wie wir uns dem Leben gegenüber verhalten sollen. Was auch daran liegt, dass wir nie für uns geklärt haben, welche Bedeutung andere Lebensformen haben – wenn sie denn überhaupt eine haben.
Wir können uns bestenfalls darauf einigen, dass wir eine Sonderstellung einnehmen. Seit Jahrhunderten leben wir so, als hätten wir nichts mit der Tierwelt zu tun. Wir glauben, dass wir über eine Zutat von einzigartigem Wert verfügen, etwa die Vernunft oder das Bewusstsein. In den Augen der Religionen sind wir keine Tiere, sondern Wesen mit einer Seele. Weltliche Religionen wie der Humanismus feiern unseren Sieg über den Aberglauben. Und die meisten von uns gehen wie selbstverständlich davon aus, dass zwischen uns und dem Rest der Tierwelt eine Art magische Grenze verläuft.
Die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier war nie problemlos, doch in den letzten Jahrhunderten war sie immer schwerer zu rechtfertigen. Wir tun so, als stünden unsere Bedürfnisse über denen aller anderen Lebewesen. Aber wenn wir im menschlichen Tier nach etwas suchen, das wir als »Person«, als »sittliches Wesen« oder gar als »Seele« bezeichnen können, geraten wir in arge Schwierigkeiten. Wir enden bei dem Irrglauben, dass wir irgendetwas an uns haben, das nicht organisch und an sich gut oder wertvoll ist. Was schließlich darin gipfelt, dass manche von uns unsterblich werden, ihr Gehirn optimieren oder gleich zur Maschine mutieren wollen.
Was nicht heißen soll, dass es keine benennbaren Unterschiede zwischen uns und dem Rest des Lebens gäbe. Denn dass wir der Welt bewusst gegenübertreten, ist ein atemberaubender Beleg dafür, wie weit sich das Leben entwickeln kann. Wir tauschen uns über abstrakte Vorstellungen aus und schlagen Abbilder von uns selbst aus Steinen. Wie ein Schwarm von Staren scheint unser Erleben mehr zu sein als die Summe unserer Teile. Von frühester Kindheit an verfügen wir über ein Identitätsgefühl, ein Kaleidoskop von Erinnerungen. Zu den Werkzeugen, mit denen wir unser Überleben und unsere Fortpflanzung sichern, gehören Fantasie und Täuschung, Selbstbeherrschung und Zukunftsvision. In einer Mischung aus Sinneseindrücken, Emotionen, verborgenen Impulsen und intimen Erzählungen träumen wir und malen uns die Zukunft aus.
Der menschliche Geist ist ein faszinierendes Naturphänomen. Doch unsere spezifische Intelligenz, zu der auch unser subjektives Bewusstsein gehört, bereichert uns nicht nur, sondern sie gestattet uns auch ein flexibleres Verhalten, insbesondere gegenüber unseren Artgenossen.
Nicht umsonst bestehen wir seit frühester Zeit darauf, dass unser Erleben einen Sinn und Wert hat, der den starren Verhaltensmustern anderer Tiere abgeht. Muss es nicht etwas geben, das sich nicht auf das bloß Tierische reduzieren lässt? So mancher meint, wenn wir keine Kultur hätten, wären wir den übrigen Lebewesen dieser Erde ähnlicher und müssten wieder mit Köpfchen und Körperkraft die zum Überleben nötigen Kalorien heranschaffen. Künstler vermitteln diese Botschaft gern und zeichnen das Bild eines den Naturgewalten unterworfenen Menschen. Doch gerade darin erkennen wir das Potenzial eines Bewusstseins, das – soweit wir wissen – in unserem Sonnensystem einmalig ist. Und da ist er wieder, dieser sonderbare Widerspruch, dass wir auf der einen Seite so offensichtlich mit allem in unserer Welt verwandt und auf der anderen so auffällig anders sind.
Wir sind das mythische Wesen, das unsere Vorfahren einst an Höhlenwände gezeichnet haben – der Therianthrop, halb Tier, halb Gott. Wir sind tierischer Körper – der Teil von uns, der blutet und altert – und dann ist da der einzigartige Teil, der unserer Intelligenz, unserem Bewusstsein, unserem Geist zu entspringen scheint. Wie der Philosoph George Kateb schreibt, sind wir »das einzige Tier, das nicht nur Tier, und die einzige natürliche Art, die teils unnatürlich ist«. Dem begegnen wir überall. Wir sind Tiere, wenn wir einander umarmen und als blutverschmierte Neugeborene aus dem Mutterleib kommen, aber nicht, wenn wir einen Eid ablegen. Wir sind Tiere, wenn wir unsere Zähne in das Fleisch auf unserem Teller schlagen, aber nicht am Arbeitsplatz. Wir sind Tiere, wenn wir auf dem Operationstisch liegen, aber nicht, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen. Dieser Riss durch das Menschsein soll uns vor der Sinnlosigkeit der kreatürlichen Existenz bewahren, und er ist das Fundament, auf dem wir unsere ganze Welt errichten. Er hebt uns an die Spitze des Lebens. So kommt es, dass wir die menschliche Welt für reich halten, und die Tierwelt daneben für ihren blassen Schatten, und dass wir unser eigenes Wohl als das höchste erdenkliche Gut ansehen.
Es gibt durchaus Menschen, die glauben, dass wir ein Tier ohne besondere Herkunft und Bestimmung sind, und dass wir sogar ein ausgesprochen räuberisches Tier sind, auf das die Welt auch gut verzichten könnte. Doch kaum jemand handelt nach dieser Überzeugung. Wir alle leben so, als sei die menschliche Welt bedeutsam und unser Verhalten mehr oder weniger gut so.
Vielleicht könnte man es dabei bewenden lassen. Doch unser Tiersein verfolgt uns. Viele unserer Grundüberzeugungen rühren aus der Weigerung anzuerkennen, dass wir organische Wesen sind. Wir fühlen uns unwohl mit den tierischen Aspekten unseres Daseins. Tiere leiden und sterben ohne Sinn und Zweck. Als ein Wesen, das mit Eichen genauso verwandt ist wie mit Quallen und allen anderen Lebensformen, wären wir von Krankheitserregern, Verletzungen und Umweltveränderungen bedroht. Alles, was uns lieb und wert ist, muss aus der ungezähmten Landschaft befreit werden. Ein Tier zu sein wäre uns peinlich. Schlimmer noch: Es wäre gefährlich.
Doch die Geschichte lässt uns hoffen, dass wir anders sind als das restliche irdische Gesocks. Unser wahres Wesen bewahrt uns vor dem tierischen Los. Wo andere Tiere leiden und sterben, werden wir erlöst – ob durch das Paradies, eine glänzende Zukunft oder eine Maschine. Wir können uns über unsere tierischen Körper und unsere organische Natur erheben. Die unbeherrschbaren Naturgewalten können unserem eigentlichen Wesen nichts anhaben. So leben wir in einem sonderbaren Nebel des Vergessens. Indem wir uns einreden, dass uns ein realer und radikaler Bruch von allen anderen Lebewesen trennt, werden wir uns selbst zum unauflöslichen Rätsel.
Daher ist unser Verhältnis zu unserem Tiersein gestört. Mit einem Anflug von Panik denken wir daran, dass wir in einer chaotischen Welt leben. Vieles von dem, was uns lieb und teuer ist – unsere Beziehungen, das Gefühl von Verliebtsein und Liebe, Schwangerschaft und Geburt, die Freude des Frühlings, die Lust an einer guten Mahlzeit –, ist körperlich, weitgehend unbewusst und vor allem tierisch. Und auch unsere größten Ängste – vor Leid, Demütigung, Einsamkeit, Schmerz, Krankheit, Tod – entspringen tierischen Instinkten und den gemeinsamen Bedürfnissen aller Lebewesen. Was ist der wesentliche Teil unseres Erlebens? Die animalischen, körperlichen Empfindungen? Oder das geistige Flackern einer eigenwilligen, Geschichten erzählenden Intelligenz? Leider werden wir aus beidem nicht schlau. Mit unserer vielschichtigen Welterfahrung können wir uns durchaus einreden, dass wir die harsche Wirklichkeit des Tierseins hinter uns gelassen haben. Doch das ist ein Irrtum. Das menschliche Leben mag eine Mischung sein aus Fleisch und Traum, doch auch unsere Träume sind noch immer die eines Tiers. Sie sind nicht über den Körper erhaben, der sie hervorbringt. Es wäre Unsinn zu glauben, unsere Gaben hätten uns zu etwas gemacht, das nicht tierisch ist.
So leben wir hinter einer unsichtbaren Membran, durch die wir jederzeit hindurch und auf die andere Seite fallen können. Wir müssen nur die Augen öffnen, um zu erkennen, was wir wirklich sind – eine denkende und fühlende Kolonie von Energie und Materie, eingehüllt in Fleisch, das bebt, wenn es friert oder liebt. Wir sind Wesen aus organischem Material und Elektrizität, die verletzt und gefressen werden, und sich wieder in der geheimnisvollen Physik des Universums verlieren können. Menschsein ist Tiersein. Doch das wollen wir nicht einsehen, denn wir sind mit der Überzeugung groß geworden, etwas ganz anderes zu sein.
Im Gegensatz zu früheren Generationen wissen wir jedoch heute Dinge, die noch vor nicht allzu langer Zeit als Gotteslästerung galten. So wissen wir nicht nur, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern auch, dass wir selbst nicht der Mittelpunkt des Lebens sind. Vielmehr sind wir ein Tier, das weiß, dass es ein mit dem dunklen Geflecht von Zeit und Energie verwobenes Tier ist. Die menschliche Art ist unauflöslich Teil des Lebens auf unserem Planeten, und keine eigene und einmalige Schöpfung.
Würden wir noch in kleinen Gruppen über die afrikanische Savanne streifen, wäre dieses Wissen folgenlos. Doch wir sind Milliarden, und wir leben auf allen Kontinenten der Erde. Mit unserem technischen und industriellen Fortschritt haben wir uns von unserer tierischen Natur entfernt, wir haben sie zum Objekt der Medizin gemacht und begreifen unseren Körper nur noch als mangelbehafteten Teil unserer selbst. Wir wundern uns, wie schwach unser Fleisch ist und wie anfällig für Begierden und Krankheiten. Wir geben Milliarden aus, um Krankheit und Alter zu besiegen, und wir arbeiten daran, unsere Fortpflanzung aus dem chaotischen Dunkel unserer Schlafzimmer und Gebärmütter zu befreien.
In unserer Sorge um das menschliche Wohl greifen wir heute sogar in das Leben selbst ein. Die Bedeutung dieser Entwicklung kann man gar nicht überschätzen. Techniken, die auf unsere organische Struktur abzielen, erinnern uns daran, dass wir Tiere sind. Eine technische Revolution aber, die Anatomie, Physiologie und Verhaltensweisen von Lebewesen ausbeutet, könnte unvereinbar sein mit unserer Psyche. Wir riskieren einen galoppierenden Prozess, in dem wir aus Furcht vor unserem Tiersein eine immer furchterregendere Welt erschaffen – nicht weil die Welt selbst immer grausiger oder blutiger würde, sondern weil wir paradoxe Techniken zum Einsatz bringen, die unsere existenziellen Ängste immer weiter schüren.
Bei einer Konfrontation mit der bedrohlichen Wirklichkeit werden wir vermutlich versuchen, uns noch stärker gegenüber dem Rest der Natur abzuschotten. Dabei ist noch nicht absehbar, welche Form diese Abschottung annehmen wird. Wir könnten zum Beispiel versuchen, andere Tiere auszurotten oder zu domestizieren. Oder wir könnten die menschliche Sonderstellung betonen, indem wir uns zu Übermenschen aufschwingen oder unsere tröstlichen Illusionen nähren. Oder wir könnten uns Menschen selbst beseitigen. Sie können das als übertrieben abtun, aber sehen Sie sich um – schon heute machen wir von jeder dieser Möglichkeiten Gebrauch.
Natürlich könnte man nun annehmen, an unserem schwierigen Verhältnis zu unserem Tiersein seien nur die moderne Zivilisation und eine kleine Gruppe von Philosophen schuld. Das Gebet Mitákuye Oyás’iŋ der Lakota, oft übersetzt mit »Alle sind verbunden«, unterscheidet sich schließlich ganz erheblich von der jüdisch-christlichen Vorstellung vom Menschen als dem Ebenbild Gottes. Manche Kulturen betonen die Einzigartigkeit des Menschen mehr als andere, weswegen sich die allgemeineren Aussagen in diesem Buch eher auf diese Kulturen beziehen. Doch der Konflikt mit dem Tiersein ist keine kulturelle Erfindung. Unsere Vorstellungen werden auf dem Amboss der Natur des Menschen geschmiedet. Heute hört man immer wieder, dass es eine »Natur des Menschen« nicht gebe, doch das ist nicht ganz richtig. Vieles in unserer Welt funktioniert, weil wir uns als Tiere so ähnlich sind, dass man uns als Spezies bezeichnen kann. Unsere Selbstbilder spielen zwar eine ausgesprochen wichtige Rolle, doch sie ändern nichts an unseren gemeinsamen organischen und psychischen Eigenschaften. Die verschiedenen Ideologien der Welt haben versucht, einige der Ärgernisse zu bewältigen, die mit unserem Tiersein einhergehen. Doch das sind nicht nur Aufgaben, die uns die Evolutionsgeschichte zu unserer Erlösung aufgibt. Wir sind eine Spezies, die über ihr eigenes Sein reflektiert. Die grundlegenden Schwierigkeiten mit dem Tier sein bleiben bestehen, egal, in welche Kultur oder welches Zeitalter wir geboren werden. Als Lebewesen unter einer Vielzahl anderer Lebewesen zu leben bringt für uns alle echte Nöte und Konflikte.
Dieses Buch ist eine Verteidigung des Tierseins. Es will uns und unsere offensichtlichen Unterschiede keineswegs herabwürdigen. Es ist auch kein Plädoyer für eine falsch verstandene Natürlichkeit. Unsere tierische Herkunft gibt uns unseren Platz in der Welt. Sie ist das Fundament, von dem aus wir dem Leben einen Sinn geben. Dazu müssen wir jedoch erst einmal anerkennen, dass wir Tiere sind. Aber das ist leichter gesagt als getan. In Wahrheit leben wir einen Widerspruch: Es ist zwar offensichtlich, dass wir Tiere sind, doch irgendetwas in uns will das nicht wahrhaben. Das müssen wir verstehen. Und wenn wir verstanden haben, dass wir Tiere sind, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was daraus folgt.
In seinem Gedicht Der heilige Franziskus und die Sau schreibt Galway Kinnell, Lebewesen bräuchten eine Art Selbstliebe zu ihrer einmaligen organischen Form. In gewisser Weise ist das der Überlebenstrieb. Doch er findet auch, dass es »manchmal nötig ist / Einem Ding seine Schönheit neu zu zeigen«. Dieses Buch ist ein Versuch, das Lebewesen Mensch zu verstehen. Aber es will noch mehr: Es will uns die Schönheit des Tierseins neu zeigen.
Der Traum von Größe
Stürmt nicht auch die ganze Menschheit blindlings, von einem Traum von Macht und Größe getrieben, auf die dunklen Pfade ausschweifender Grausamkeit und ausschweifenden frommen Eifers? Und was ist im Grunde die Jagd nach der Wahrheit anderes?
Joseph Conrad, Lord Jim
Nach oben fallen
Wir Menschen sind Teil eines langen Prozesses des aufkeimenden Lebens, der uns mit allem in unserer Welt verbindet. »Es ist wahrlich eine großartige Ansicht, dass aus so einfachem Anfang sich eine endlose Reihe immer schönerer und vollkommenerer Wesen entwickelt hat und noch fortentwickelt«, schreibt Charles Darwin im Schlusssatz seiner Entstehung der Arten. Noch verstehen wir nicht, wie die ersten lebenden Zellen in der Frühphase der Erdgeschichte entstanden sind. Unser Heimatplanet war ein zerklüfteter, mineralischer Ort, ohne Hunger, ohne Moral und ohne die berauschende Buntheit unserer heutigen Erde mit ihren Gräsern und Blumen. Stellen Sie sich eine rauchverhangene und von Asteroiden bombardierte Welt vor, und denken Sie sich das Leben weg. In der Hitze der Tiefseeschlote oder in den Lachen des dampfenden Festlandes geschah es irgendwie, dass sich primitive Zellen regten und durch die rätselhafte Angelegenheit des Energieerhalts und -umsatzes sammelten.
»Das Leben ist im Grunde die beiläufige Folge einer Reaktion zur Energienutzung«, meint der Biochemiker Nick Lane dazu. Oder, wie es der österreichische Physiker Erwin Schrödinger 1943, kurz nach dem Ende der blutigsten Schlacht der Kriegsgeschichte in Stalingrad, in einem Vortrag ausdrückte, die lebende Materie scheint »den raschen Verfall in einen leblosen Gleichgewichtszustand zu verhindern«. Egal, ob uns dieses chemische Ereignis extrem selten oder im Gegenteil unvermeidlich erscheint, wir können sagen, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen Leben und Nicht-Leben markiert.
Genau wie alles Leben vom bariumhaltigen Wasser der Tiefseeschlote bis zum Inneren einer tierischen Zelle nur besteht, indem es etwas aus seiner Umwelt entnimmt, haben alle bekannten irdischen Lebensformen im Grunde dieselben biochemischen Grundlagen. Außerdem ist das Leben erblich, das heißt, auch wenn eine glitzernde Welle für ihr Zustandekommen genauso Energie benötigt wie ein Lebewesen, das in ihr schwimmt, bringt nur Letzteres Nachkommen hervor, die ihm ähnlich sind. Von der Kolibakterie bis zum Elefanten gehen alle neuen Lebewesen aus der Teilung einer einzigen Zelle hervor. Mehr noch, alle lebenden Zellen auf unserem Planeten speichern Erbinformationen in Form von Desoxyribonukleinsäure und arbeiten mit chemischen Reaktionen, die durch die Anwesenheit dieser Säure beschleunigt werden.
Vor mehr als drei Milliarden Jahren ging aus diesen Protozellen dann wahrscheinlich das erste bakterielle Leben auf der Erde hervor. Lange bevor ein tierisches Auge Landschaften wahrnahm, waren die Ozeane das Reich der Bakterien. Nach einiger Zeit bewirkte die Evolution einen erstaunlichen Wandel: Auf Felsen ließen sich Kolonien von Cyanobakterien nieder, und diese winzigen Stränge von blaugrünen Lebewesen taten etwas, das den Planeten für immer verändern sollte: Mithilfe des Sonnenlichts kurbelten sie ihren Lebenszyklus an, und als Abfallprodukt produzierten sie Sauerstoff. Als diese Bakteriengemeinschaften wuchsen, ermöglichten sie erst die Entstehung von Sauerstoff erzeugenden Pflanzen und schließlich von Sauerstoff atmenden Lungen wie der unseren. Gleichzeitig beeinträchtigten sie die Lebensbedingungen von Lebewesen wie dem geheimnisvollen Spinoloricus cinziae, einem Mehrzeller, der erst kürzlich im Mittelmeer entdeckt wurde und gänzlich ohne Sauerstoff auskommt.
Lynn Margulis stellte 1967 die Theorie auf, dass Tiere und Pflanzen, anders als die ersten bakteriellen Lebensformen, ihre Herkunft einem Phänomen namens Endosymbiose verdanken. Das bedeutet, dass eine Zelle eine andere schluckt, ohne sie zu verdauen. Zunächst war der Widerstand gegen diese Theorie noch groß, doch ein Jahrzehnt später wurde sie von der Genforschung bestätigt. Heute gehört sie zum wissenschaftlichen Gemeingut. Der Beweis für die Endosymbiose ist die Anwesenheit von Mitochondrien und Chloroplasten in tierischen und pflanzlichen Zellen, die sich unabhängig von diesen Zellen vermehren und ihr eigenes Erbgut haben. Die Mitochondrien unserer Zellen, die Nährstoffe aufnehmen und in Energie verwandeln, sind die Geister der Bakterien, die unsere fernen Vorfahren einst geschluckt haben.
Versetzen Sie sich noch einmal zurück in die Vergangenheit, aber nicht auf die rauchende, leblose Erde, sondern ins Kambrium vor rund 500 Millionen Jahren. Inzwischen gibt es Tiere. Die Meere sind von Wesen wie den Anomalocarididen bevölkert, garnelenartigen Tieren mit zwei gebogenen Greifarmen, mit denen sie sich andere Tiere ins Maul führen. Zu keinem anderen Zeitpunkt werden in den Fossilienfunden so viele verschiedene Stämme von Lebewesen gezählt, und es folgte eine Phase gewaltiger Diversifizierung. Eine mögliche Erklärung für diese Explosion der Lebensformen ist, dass mehr freier Sauerstoff zur Verfügung stand. Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass damals die Kalziumkonzentration im Wasser stark anstieg. Wieder andere Theorien vermuten einen Wettlauf von Räuber und Beute, und damit zusammenhängend die Evolution des Auges. Sicheres aber weiß niemand.
Doch die außergewöhnliche Vielfalt der Lebensformen, die im Burgess-Schiefer in den kanadischen Rocky Mountains gefunden wurde, die versteinerten Skelette, die männliche und weibliche Anatomie vieler Arten, die Greifer und Stacheln von Jägern und Gejagten, zeigen uns, wie tief wir in ein riesiges System des Energieaustauschs verstrickt sind. Lebewesen und ihre Umwelt sind immer Gegenstand von Veränderung und Tod. Eine Zeit lang kann eine Lebensform dieser Entwicklung widerstehen, aber nicht für immer.
NASA-Forscher Michael Russell, in dessen Büro eine Kopie der Großen Welle vor Kanagawa von Hokusai hängt, beschrieb das Leben einmal als »Entropiegenerator«. Das Leben verringert seine innere Entropie, indem es die verfügbare Energie aus seiner Umgebung nutzt und als Wärme abgibt, die wiederum die Entropie der Umgebung erhöht. Entropie, umgangssprachlich auch Unordnung genannt, ist das Maß für die Verteilung der Energie innerhalb eines Systems. Physikalischen Laien sagt das vermutlich nicht viel. Hier hilft uns Paul Simon weiter. In einem seiner Songs aus dem Jahr 1972 singt er: »Everything put together sooner or later falls apart …« (Alles, was zusammengefügt wird, wird früher oder später geschieden …) Stellen Sie sich einen Gin Tonic vor. Das gefrorene Wasser der Eiswürfel hat eine geringere Entropie als der Alkohol der Umgebung. Die Gin-Moleküle sind beweglich und schmiegen sich in jeden Behälter, in den sie gegossen werden. Doch die Moleküle im Eis sind weniger zufällig angeordnet und geben ihre Form nur auf, wenn Energie in Form von Wärme zugeführt wird und sie aus dem Verbund löst.
Die geordnete Form eines Organismus lässt sich als vorübergehender Zustand geringer Entropie verstehen, der durch den Verbrauch von Energie ermöglicht wird. Unter physikalischen Gesichtspunkten ist es deshalb absolut schlüssig, andere Tiere zu fressen, sobald genug davon herumschwimmen. In einem humorvollen Aufsatz, in dem der Biologe Alexander Schreiber die irrigen Vorstellungen der Evolutionsgegner widerlegt, fasst er den Austausch von Energie und Abfall unter Tieren und Umwelt so zusammen: »Alle Organismen erhalten ihren Zustand der geringen Entropie, indem sie verfügbare Energie ›fressen‹ und Entropie ›scheißen‹. Energie ist nötig, um die Steuerungsprozesse in unserem Körper aufrechtzuerhalten, und Unordnung muss mit unseren Ausscheidungsprodukten entsorgt werden. Vielleicht ist selbst unser Bewusstsein ein Mittel ›zur Nutzung überschüssiger Energie‹, wie Russell meint.«
Der Physiker Jeremy England vertrat unlängst die Auffassung, die Reproduktion von Organismen sei »eine gute Möglichkeit zur Verteilung von Energie«. Seiner Theorie zufolge könnte das zweite Gesetz der Thermodynamik – das Gesetz der Zunahme der Entropie – der Grund sein, warum sich Materie zu Lebensformen organisiert. Sollte sich das als richtig erweisen, zeigt sich darin ein grundlegender Zusammenhang zwischen Leben und Nicht-Leben, und eine merkwürdige Gemeinsamkeit zwischen Schneeleoparden und Schneeflocken. »Die Versuchung ist groß zu spekulieren, welche Naturphänomene unter das große Dach der von Energiedissipation angetriebenen adaptiven Organisation passen.«
Das Leben auf unserem Planeten lässt sich grob in autotrophe und heterotrophe Organismen unterteilen, also in solche, die selbst Energie aus Sonnenlicht und weiteren chemischen Reaktionen gewinnen, und andere, die ihre Energie von diesen Selbsterzeugern beziehen. Das Ungewöhnliche an uns Menschen ist, dass wir es geschafft haben, immer mehr Energie zu verbrauchen, ohne zu einer anderen Art mutieren zu müssen. Unser Geheimnis ist eine Mischung aus sozialem Lernen, komplexer Kultur und Technik. Wir müssen keine neue Spezies werden, um die Klauen eines Allosaurus zu bekommen – wir können einfach Informationen über den Bau von Sprengköpfen und Kraftwerken weitergeben. Mit anderen Worten: Wir verändern unsere Werkzeuge, nicht unseren Körper. Hunderttausende Jahre lang kamen wir mit Feuer und Speer aus, dann domestizierten wir unsere Nahrungsmittel. Die nächste Revolution war die Mechanisierung von Produktionsverfahren, die wir als Industrielle Revolution bezeichnen; mit ihrer Hilfe konnten wir uralte Lagerstätten organischer Energie im Erdinnern anzapfen und verbrennen.
Es dauerte fast die gesamte Menschheitsgeschichte, um auf eine Population von einer Milliarde zu kommen. Unmittelbar nach der ersten Industriellen Revolution wuchs die Weltbevölkerung dann um mehr als 50 Prozent. In den hundert Jahren vor 1920 verdoppelte sich die landwirtschaftliche Produktion, seither verdoppelt sie sich etwa alle zehn Jahre. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wuchs die Weltbevölkerung alle zehn bis fünfzehn Jahre um eine Milliarde. In der Regel sind dem Bevölkerungswachstum von Organismen durch Konkurrenz, Fressfeinde oder Parasiten Grenzen gesetzt. Doch unser Bevölkerungswachstum stieß eine Blüte der Wissenschaften an. In den letzten gut hundert Jahren haben wir schier unglaubliche Möglichkeiten entdeckt, unsere Lebenserwartung zu steigern und die Bedrohung durch Krankheiten zu verringern. Historiker bezeichnen das Zeitalter auch als »die große Beschleunigung«. Dieser Zeit verdanken wir zum Beispiel Antibiotika oder Genmanipulation.
Doch je größer die Menschheit und je größer die Bedürfnisse jedes Einzelnen werden, umso stärker ziehen wir wichtige Erdsysteme in Mitleidenschaft. Das ist allseits bekannt. Die Menschheit ist heute gespalten in Pessimisten, die den unvermeidlichen Zusammenbruch herannahen sehen, Optimisten, die glauben, dass sich die Lage stabilisiert und wir mithilfe unserer Vernunft eine nachhaltigere Welt schaffen werden, und in Futuristen, die sich für keines der beiden Szenarien erwärmen können und deshalb in unsere Flucht investieren. So kommt es, dass die einen Alarm schlagen, andere saubere Energiequellen entwickeln, und wieder andere Kolonien auf dem Mars planen. So ist unsere Zeit.
Eines wissen wir mit Sicherheit: Irgendwann wird unser Planet wieder leblos sein. Wenn wir von der Vergangenheit der Erde träumen, dann sehen wir, dass es hin und wieder zu Massensterben von Lebewesen kam, vor allem verschuldet von Asteroiden und durch die Achsenneigung des Planeten erzeugte Eiszeiten. Der Katastrophe folgte jedes Mal ein neuer Karneval des Lebens. Doch das wird nicht immer so sein. In Hunderten Jahrmillionen wird eine Intensivierung der Sonneneinstrahlung genetische und strukturelle Veränderungen bewirken, die die Photosynthese einschränken. Die einstmals unbändige Vielfalt von Pflanzen wird zusammenschrumpfen, bis nichts mehr von ihr übrig bleibt. Mit dem Tod der Pflanzen wird viel weiteres Leben verschwinden. Wir neigen dazu, Pflanzen zu übersehen oder gedankenlos zu behandeln, doch sie sind der Nährboden für mehrzellige Tiere wie uns. Ohne sie sind wir verloren.
Und wenn wir noch ein paar weitere Jahrmilliarden in die Zukunft blicken, dann kommen die dynamisch herumwirbelnden Konvektionsströme im Erdinnern zum Erliegen; die darin geschmolzenen Elemente, denen wir die Eisenzeit und unsere Münzen verdanken, werden nicht mehr umgerührt, und das Magnetfeld der Erde bricht zusammen. Damit verlieren wir unseren liebgewonnenen Schutzschirm, und die Sonnenwinde fegen über unseren Planeten hinweg. Unsere Atmosphäre mit ihren lauschigen Abenden und windigen Herbsttagen wird zerstört, die Meere verdunsten. Vielleicht harren noch einige Überlebenskünstler wie Deinococcus radiodurans aus, auch bekannt unter dem Spitznamen »Conan das Bakterium«, die selbst den unwirtlichsten Bedingungen trotzen. Doch auf längere Sicht wird die Erdoberfläche schmelzen und alles Leben enden.
Bis heute weiß niemand, warum es uns gibt oder was im Herzen des Kosmos vor sich geht. Wir wissen jedoch sehr wohl, dass Lebewesen genauso übel sein können wie die Kräfte, durch die sie hervorgebracht werden. Die Biologie kommt mit Gewalt in die Welt, ob mit Energie oder gewaltiger Hitze. Das Sonnensystem und die Erde springen grausig mit Lebewesen um, während sie gleichzeitig immer neue Formen und Veränderungen ermöglichen. Der dorfgroße Komet, der den Krater von Chicxulub in die Erdoberfläche schlug und kurzzeitig die biologische Vielfalt auf der Erde vernichtete, schuf Raum für neue Lebewesen, darunter auch den Menschen. Aus einer Sicht ist der Komet ein Bösewicht, aus einer anderen ein Gottesgeschenk.
Trotz alledem leben wir nach Regeln, die uns sagen, was gut und richtig ist. Wir sind überzeugt, dass unsere Liebe und unser Erleben einen Wert haben. Kaum jemand würde das hinterfragen wollen. Trotzdem ist es nicht einfach, unser Leben und Tun auf festen Boden zu stellen, wenn die Welt, in die wir geboren werden, nicht offensichtlich gut ist. Wenn wir hinausblicken auf den Baum vor dem Fenster, dessen im Wind rauschende Blätter von Pilzen befallen sind, und wenn wir sehen, wie unter dem Baum ein Vogel ein Schneckenhäuschen aufpickt, um an den weichen Bewohner heranzukommen, dann kann es uns schwerfallen, Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu finden. Auf der Suche nach dem Guten, Wahren und Schönen stoßen wir auf Viren, Bakterien, Krankheiten und Räuber, die dessen Existenz infrage stellen, auch wenn sie durchaus Dinge bewirken können, die aus unserer Sicht begrüßenswert sind. Inwieweit sind wir Teil von alledem?
Tatsache ist, dass die Stimmungen und Empfindungen, die unserem Erleben solche Intensität verleihen, aus dem Rohstoff unserer Umwelt gemacht sind. Wir empfinden das Wiegen der Bäume als schön, und das Fleisch des Vogels als wohlschmeckend. Alles, was wir genießen, wird von Prozessen hervorgebracht, denen es gleichgültig ist, was wir für richtig oder falsch halten. Ob uns das gefällt oder nicht – was uns im Leben wichtig ist, kommt aus einer Welt ohne jeden moralischen Sinn.
Vergangenen Sommer besuchte ich in der Wüste von Utah eine fossile Fundstätte von Dinosauriern, die hier einst auf der Futtersuche durch ein Bachbett streiften. Das ist etwas ganz anderes, als einen Saurier fein säuberlich aufgebaut im Museum zu sehen. Einer der Paläontologen legte einen Oberschenkelknochen frei, der größer war als mein Kind. Aber nicht nur die Gliedmaßen waren gigantisch. Auch die Zähne und Klauen wurden in ihrer ganzen gewaltigen Bösartigkeit greifbar. Das also bringt der Energiebedarf hervor, dachte ich bei mir.
Kurz vor unserem Abschied deutete unser junger Guide auf einige dunkle Linien in einem nahen Felsen. »Wir wissen noch nichts Genaues, aber das könnten Spuren von frühen Säugetieren sein.« Mit zusammengekniffenen Augen starrten mein Mann und ich auf den schlackigen Fels – vielleicht markierten die Linien den Bau eines kleinen nachtaktiven Insektenfressers und möglichen Vorfahren der Klasse der warmblütigen, Milch produzierenden Tiere, zu der auch wir gehören.
Die jeweilige Energieverteilung kann mal Tötungsmaschinen wie den Tyrannosaurus rex begünstigen und mal Superorganismen wie Ameisen. In jedem Fall sind hier Kräfte am Werk, die nichts mit Fortschritt und Moral zu tun haben. In der Evolution des Lebens halten sich Lust und Leid, Schmerz und Zärtlichkeit die Waage. In der Wildnis, in der Gehirne etwas größer sein müssen als unter domestizierten Lebewesen, ist der Tanz von Räuber und Beute ein Motor der unermüdlichen Innovation. Wenn eine Art ihre Intelligenz oder Verhaltensweisen forciert, dann meist nur, um einer anderen den Tod zu bringen. Es ist eine schmerzliche Wahrheit, dass bei vielen Arten die meisten Jungtiere das erste Lebensjahr nicht überleben. Zum Glück erspart die Evolution dem Lachsweibchen mütterliche Gefühle für die vielen hundert Eier, die sie ablegt, denn nur zwei Prozent davon werden das Erwachsenenalter erreichen. Es ist besser, sie weiß nicht, was mit den verbleibenden passiert, die in den Mägen anderer Tiere, auch anderer Lachse, oder auf menschlichen Cocktailpartys landen.
Doch gerade mit dem Leid und Tod, den sie bringen, können Raubtiere eine Stütze des Ökosystems mit seiner Fülle und Artenvielfalt sein. Jäger existieren auf allen Ebenen eines natürlichen Systems, das so riesig und dynamisch ist, dass man kaum ein einzelnes Tier herausdeuten und seine Auswirkungen vorhersehen kann. Die Dynamik von Räuber und Beute verändert alles, vom Verlauf von Epidemien in einer Population bis zur Kohlendioxidabscheidung. Das Paradebeispiel für den Nutzen von Raubtieren war die Wiedereinführung des Wolfes im Yellowstone Park im Jahr 1995. Die Ankunft der Wölfe setzte eine Abfolge von Veränderungen in Gang, die bis heute nachwirken. Die letzten Wölfe waren in den Dreißigerjahren in den Fallen von Wilderern verendet. Danach nahm die Zahl der Elche zu. Nach der Rückkehr der Wölfe wanderten die Elche mehr, die stark verbissenen Weiden wuchsen nach und boten eine Nahrungsquelle für Biber, die mit ihren Dämmen Bäche aufstauten und damit Lebensräume für Fische und Vögel schufen. Die von den Wölfen gerissene Beute bot zusätzliche Nahrung für eine ganze Reihe von Aasfressern, allen voran Raben und Grizzlybären. Aus Sicht der biologischen Vielfalt sind die Wölfe notwendig und gut. Was die Jagd für die anderen Tiere nicht angenehmer macht. Die Untersuchungen von Liana Zanette und Michael Clinchy zeigen, dass die Begegnung mit einem Jäger die Angstzentren der Gejagten so stark aktiviert, dass dies noch Wochen später nachweisbar ist. Diese Belastung geht auf Kosten des allgemeinen Wohlbefindens eines Tiers.
Wir sind genauso aus dieser Logik geboren wie jedes andere Lebewesen auf dieser Erde. In unseren grundlegenden Aktivitäten unterscheiden wir uns kaum von anderen Arten. Wir töten und verzehren andere Tiere, um uns Energie zuzuführen. Wir scheiden Abfallprodukte in Form von Fäkalien und Urin aus. Wir riechen von Artgenossen abgesonderte Chemikalien und reagieren darauf. Wir kommunizieren, suchen Partner und ziehen unseren Nachwuchs groß. Und irgendwann enden die chemischen Prozesse in unserem Körper, und wir werden restlos von einer Armee aus Mikroben zerlegt. Damit gehen wir in den Rest der Tierwelt ein. Wir kommen aus demselben Urgrund. Unsere Körper und Erfahrungen sind Teil von prekären Lebensprozessen, die uns furchtbare Mechanismen und Taktiken genauso an die Hand geben wie nützliche. Im Ganzen haben wir mindestens so viel Schmerz und Leid über das Leben auf der Erde gebracht wie jedes andere Raubtier. Und auch wir erleben Schmerz und Leid.
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die Evolution eine Richtung hat. Nehmen wir Mehrzeller wie Pflanzen, Pilze und Tiere. Sie haben sich mehrmals unabhängig voneinander entwickelt, aber einige sind auch ins Einzellerdasein zurückgekehrt, allen voran Pilze. Einer Theorie zufolge gingen Mehrzeller aus der Kooperation verschiedener Arten von Einzellern hervor. Das ist ein attraktiver Gedanke. Genauso ist es möglich, dass es bei der Teilung von Einzellern zu Fehlern kam. Aus den Zellen, die sich nicht trennten, könnte sich später ein eigenes Gewebe entwickelt haben. Dazu kommt die ungewisse Rolle der Viren. Heute sind sie unser Fluch und bringen Krankheit und Tod, doch die Gene einiger Viren könnten dafür verantwortlich sein, dass sich verschiedene Zellen zu unterschiedlichen Organen und Geweben im Körper eines Tiers entwickelten. Das heißt, das Leben ist weder gut, noch entwickelt es sich in eine bestimmte Richtung.
Das allein wäre unerträglich, bestünde nicht die Möglichkeit, dass der Mensch etwas Besonderes ist. Etwas Entscheidendes bewahrt uns vor den Fährnissen des irdischen Daseins. Man sagt uns, es entspringe dem Kern der menschlichen Natur, einem wesentlichen Teil von uns. Es lässt sich weder sehen noch messen, doch es macht uns zur wichtigsten Lebensform auf Erden. Anhänger eines Schöpfergottes glauben an die Existenz einer Seele, die nur dem menschlichen Körper innewohnt. Humanistische Denker glauben an die Existenz seelenähnlicher geistiger Kräfte, zu denen nur das menschliche Gehirn imstande ist. Beides sind Argumente dafür, dass der Mensch kein Tier ist, zumindest nicht im Kern.
Hier klingen ältere Diskussionen an. Vertreter des Mechanismus glaubten, dass die Seele die Vernunfttätigkeit des Gehirns steuert und in einem maschinenartigen Körper steckt. Dem widersprachen die Animisten, die glaubten, dass alle lebende Materie über eine Anima, eine Seele, verfüge, und die Vitalisten, die der Ansicht waren, dass lebende Materie mit einer besonderen Zutat versehen sein muss, die Bewegung und Veränderung gestattet.
Wer glaubt, dass wir von einem Schöpfer erschaffen wurden, der hält sich an das Internationale Komitee der Menschenwürde (eine katholische Organisation, die eine biblische Lesart vertritt): »Die wahre Natur des Menschen ist nicht das Tier, sondern ein Mensch, geschaffen als Ebenbild Gottes.« Im humanistischen Denken, das mit der europäischen Renaissance aufkam, sind wir als »Person« mehr als nur ein Organismus. Für Immanuel Kant ist das Tier eine Sache, der Mensch dagegen »Zweck an sich selbst«. Diese Aussage begegnet uns in unterschiedlicher Form immer wieder. Wie es der amerikanische Philosoph Eric T. Olson ausdrückt, der als »Animalist« das Gegenteil glaubt: »Diese Philosophen erklären uns zu Nicht-Tieren mit einer engen Beziehung zum Tier.«
Für viele Menschen hatte und hat dieser Gedanke etwas zutiefst Tröstliches. Ob es die Seele oder eine andere Eigenschaft ist, sie erlöst den Menschen von einer verworrenen archaischen Natur. Sie bewahrt uns vor den Schwierigkeiten, in die uns die Amoral der Natur stürzt. Der Gedanke nahm zwar je nach Epoche eine etwas andere Form an, doch wir Menschen haben immer etwas Übernatürliches, das uns errettet. So kommt es, dass den großen Theorien vom Sinn des menschlichen Lebens eher ein Duft der psychologischen Notwendigkeit als der rationalen Klarheit anhaftet.
Kritiker des westlichen Individualismus neigen dazu, die Beziehung zwischen Mensch und Tier in anderen Kulturen zu verklären. Es stimmt zwar, dass sich die Ansichten je nach Kultur erheblich unterscheiden. So sehen zum Beispiel animistische Gesellschaften nicht nur den Menschen als wertvoll an, sondern auch Tiere und Pflanzen. Heute sind viele dieser kleineren Gesellschaften bedroht. Dabei wird die Komplexität ihrer Wahrnehmungen und Praktiken häufig übersehen. Zwar sehen viele nichtwestliche Traditionen Menschen und Tiere als Erben eines spirituellen Reichs, doch selbst im Buddhismus ist die Wiedergeburt in Form eines Tiers kein Grund zur Freude. Auch unser Bild von den vegetarischen Hindus hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun. In Indien, wo sich 80 Prozent der Menschen als Hindus bezeichnen, ernähren sich nur 20 Prozent tatsächlich vegetarisch. Dazu kommt, dass Mensch und Tier nicht auf derselben spirituellen Ebene stehen. In den Upanishaden macht zum Beispiel der Gott Shiva klar, dass Menschen einmalig sind, weil sie aufgrund ihres Wissens handeln können.
Einige Vorstellungen vom Menschen sind in unseren zunehmend vernetzten Populationen und Ökonomien zu einer Art Gemeingut geworden. Die Menschenwürde ist beispielsweise etwas, das alle besitzen, und sie hat sich als Richtschnur für unser Verhalten etabliert. In einem wegweisenden Urteil zur Todesstrafe kam die südafrikanische Richterin Kate O’Regan beispielsweise zu dem Schluss, »die Anerkennung des Rechts auf Würde trägt dem angeborenen Wert aller Menschen Rechnung«. Diese Vorstellung, wie wir sie heute verwenden, wurde in europäische Verfassungen und Psychen eingeschrieben, während die Familien noch ihre Toten aus dem Zweiten Weltkrieg heimholten. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland heißt es zum Beispiel: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.«





























