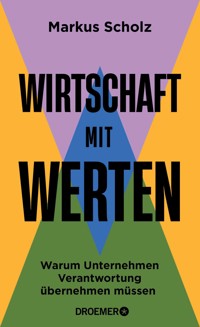
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Passen Gewinnstreben und gesellschaftliche Verantwortung zusammen? Markus Scholz, Professor für Management und Unternehmensethik an der TU Dresden, untersucht in seinem Sachbuch anhand zahlreicher Praxisbeispiele aus Deutschland und der Welt, inwiefern Unternehmen eine Verantwortung für die Verteidigung der Werte der liberalen Demokratie haben und ob ethisches Wirtschaften überhaupt möglich ist. Er fordert: Unternehmen müssen sich ihrer Verantwortungzur Verteidigung der offenen Gesellschaft endlich stellen, sonst stehen uns dunkle Zeiten bevor. In den vergangenen 20 Jahren engagierten sich immer mehr Unternehmen für ökologische, gesellschaftliche und zunehmend auch für politische Themen. Das für lange Zeit geltende Mantra, nachdem die einzige Verantwortung von Unternehmen die Maximierung von Profiten sei, schien nicht mehr zu gelten. Sich für den Schutz der Umwelt, für mehr Diversität, und Toleranz einzusetzen gehörte zum guten Ton, oder zumindest zur Marketing-Strategie der Unternehmen: Brauereien wollen den Regenwald retten, Burgerketten und Supermärkte setzen sich für Inklusion ein, Tech-Konzerne wollen Menschenrechte schützen, Banken und Versicherungen werben mit Regenbogenflaggen. Spätestens seitdem sich Oligarchen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg an die Seite von Donald Trump stellen und eine Abkehr von solchen Initiativen fordern, schränken zahlreiche Unternehmen ihr Engagement für gesellschaftliche und ökologische Themen radikal ein – der Zeitgeist ändert sich. Was bleibt vom Thema Unternehmensverantwortung zu einer Zeit, in der die offen Gesellschaft bedroht ist? Geht es Unternehmen um echte Werte, oder vor allem um die Wahrung ihrer Profitinteressen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Prof. Dr. Markus Scholz
Wirtschaft mit Werten
Warum Unternehmen Verantwortung übernehmen müssen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sollen Unternehmen und ihre Führungskräfte Verantwortung für den Schutz der liberalen Demokratie übernehmen und sich aktiv gegen den wachsenden Rechtspopulismus stellen? Ausgehend von der Einsicht, dass die liberale Demokratie und die soziale Marktwirtschaft in Deutschland untrennbar miteinander verbunden sind, zeigt Markus Scholz, wie die individuelle Freiheit in Gefahr gerät, wenn eine dieser Säulen ins Wanken kommt. Er argumentiert, dass die größte Bedrohung durch populistische Parteien nicht allein in ihren Programmen liegt, sondern in den Herrschaftstechniken, mit denen sie nach einer Machtübernahme zentrale Strukturen der offenen Gesellschaft schwächen. Zugleich diskutiert er, warum und unter welchen Bedingungen politisches Engagement von Unternehmen legitim und wirksam ist und wie es so gestaltet werden kann, dass gesellschaftliche Spaltungen nicht vertieft werden. Das Buch verbindet Analyse, Kritik und konkrete Handlungsvorschläge für ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung
Die Verantwortung von Unternehmen: Wert schaffen, Werte beschützen
Was erwarten wir von Unternehmen?
Business and politics should never mix – oder doch?
Die offene Gesellschaft: Ein Bollwerk gegen den Totalitarismus
Das Erbe der Aufklärung
Liberale Demokratie und offene Gesellschaft: Schutz gegen die Unfreiheit
Liberale Demokratie und Marktwirtschaft
Die Lehren aus dem Naziterror
Deutschlands politisches Fundament: Die freiheitlich-demokratische Grundordnung
Deutschlands ökonomisches Herz: Die soziale Marktwirtschaft
Soziale Marktwirtschaft und liberale Demokratie bedingen einander
Neue Herausforderungen durch die Feinde der Freiheit
Der Schutz der offenen Gesellschaft und die Rolle der Unternehmen
The business of business is not just business
Ist ein Engagement gegen die AfD Diebstahl?
Die Kritik der Wirtschaftsverbände an der AfD
Populisten: Eine Gefahr für Unternehmen und die offene Gesellschaft
Ist die AfD rechtsextrem? Wie wichtig ist das?
Was Populisten so gefährlich macht
Die Paranoia der Populisten und ihre Herrschaftstechniken
Herrschaftstechnik 1: Einschränkung der Medienfreiheit
Herrschaftstechnik 2: Vereinnahmung des Staates
Herrschaftstechnik 3: Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit
Herrschaftstechnik 4: Klientelpolitik, Patronage und Vetternwirtschaft
Herrschaftstechnik 5: Diffamierung der Zivilgesellschaft und Diskreditierung der Opposition
Die Herrschaftstechniken der Populisten und der Schaden für die Unternehmen
Die Grenzen des politischen Engagements von Unternehmen
Beyond the Win-win-Wonderland
Republikanische Unternehmensbürger
Kosten und Risiken des politischen Engagements
Unternehmen sind keine Experten für politisches Engagement
Wie ein gelingendes Engagement gegen Populismus aussehen kann
Keine Garantie für den Erfolg, aber viel Gefahr
Die Legitimität des politischen Engagements: Geister, die ich rief
Woker Kapitalismus: Das falsche Spiel mit der Moral
Was Unternehmen jetzt tun sollten – eine Agenda zur Stärkung der liberalen Demokratie
Konsistenz und Kohärenz sichern
Politisches Engagement an demokratische Strukturen rückbinden
Gewerkschaften und betriebliche Mitbestimmung aufwerten
Aufsichtsräte stärken
Zivilgesellschaft fördern
Ausblick
Dank
Anmerkungen
Für Nathan, in der Zuversicht, dass er in einer offenen Gesellschaft aufwachsen kann.
Einleitung
Die Familie Dahl züchtet und verkauft Erdbeeren. Zuerst in der mecklenburgischen Provinz, nach der durch den Weltkrieg bedingten Flucht in Ostholstein. Im Zuge der Wende kam die Konkurrenz billigerer Erdbeeren aus Polen auf. Um den Hof nicht schließen zu müssen, planten die Nachkommen des Unternehmensgründers Karl Dahl den Direktverkauf ihrer Erdbeeren. Vor allem in Ost- und Norddeutschland tauchen im Frühjahr und Sommer die Verkaufswagen von »Karls Erdbeerhof« an vielen Bahnhöfen und Straßen auf. Die Dahls bauen neben den Erdbeeren nicht nur viele andere regionale Lebensmittel an, sondern betreiben auch mehrere Freizeitparks unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. In diesen sogenannten Erlebnis-Dörfern findet man Hofläden, Manufakturen und Fahrgeschäfte.
An den Eingängen von jedem »Karls Erlebnis-Dorf« hängt ein Schild mit einer Botschaft: »Ausländer-Feinde müssen leider draußen bleiben.« Das Schild ist von Robert Dahl, dem Geschäftsführer des Unternehmens, persönlich unterschrieben.1
Damit bezieht Dahl eine politische Haltung, positioniert sich klar an der Seite seiner ausländischen Mitarbeiter – und zumindest implizit auch gegen rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte in Deutschland.
Der Unternehmer Dahl ist mit diesem politischen Engagement nicht allein. Nachdem sich in Deutschland mit der Alternative für Deutschland (AfD) eine politische Kraft mit eindeutig rechtspopulistischem und womöglich rechtsextremem Charakter etabliert hat, engagieren sich zahlreiche Managerinnen und Unternehmerinnen politisch gegen Rechtspopulismus, Extremismus und für die Resilienz der liberalen Demokratie.
Als die AfD-Parteichefin Alice Weidel bei einer Debatte im Deutschen Bundestag im Mai 2018 mit ihrer Rede von »Kopftuchmädchen, alimentierten Messermännern und sonstigen Taugenichtsen« provozierte2, meldete sich der damalige Siemens-CEO Joe Kaeser auf Twitter (heute: X) zu Wort: »Lieber Kopftuch-Mädel als Bund Deutscher Mädel. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Da, wo die Haupt-Quelle des deutschen Wohlstands liegt.«3
Durch die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv im Januar 2024, das die sogenannten Remigrationspläne rechtspopulistischer und rechtsextremer Akteure publik gemacht hat, und die daraufhin einsetzenden breiten zivilgesellschaftlichen Proteste in Form von großen Demonstrationen und Kundgebungen mit Hunderttausenden von Teilnehmern hat sich das politische Engagement zahlreicher Unternehmen weiter intensiviert.
Prominent äußerte sich beispielsweise Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und warnte vor den Gefahren, die vom Rechtspopulismus für den Wirtschaftsstandort Deutschland ausgehen: »Rechtspopulisten und -extremisten spalten nicht nur die Gesellschaft, ihre Konzepte führen auch direkt in den wirtschaftlichen Abstieg.«4 Der bekannte Schraubenhersteller und Selfmade-Milliardär Reinhold Würth schreibt vor diesem Hintergrund offene Briefe an seine über 80000 Mitarbeiter und fordert sie auf, die AfD nicht zu wählen.
Noch weiter geht der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Thomas Rabe – er legt Mitarbeitern, die die AfD unterstützen, ein Nachdenken über eine Kündigung nahe.5 Überall im Land formieren sich zudem von Unternehmen getragene kollektive Kampagnen wie etwa »Wirtschaft für ein weltoffenes Deutschland«, die sich für Offenheit und Toleranz einsetzen.
Das politische Engagement von Unternehmen und ihren Führungskräften gegen Rechtspopulismus und für den Schutz der offenen Gesellschaft in Deutschland und anderswo geschieht zu einer Zeit erheblicher politischer Verwerfungen.
Vor nur etwas mehr als 25 Jahren, zum Ende der 1990er-Jahre, herrschte in den westlichen Industrieländern eine beinahe euphorische Zuversicht, verbunden mit mehr als nur als einer Spur Triumphalismus. Es schien, als hätten sich die Ideale der Aufklärung und des Liberalismus, verkörpert in der Kombination aus liberaler Demokratie und – mehr oder weniger sozial geprägten – marktwirtschaftlichen Ordnungen endgültig durchgesetzt.
Der an der Stanford University lehrende Politikwissenschaftler Francis Fukuyama sprach in diesem Zusammenhang vom »Ende der Geschichte« – also von jenem Punkt, an dem sich das vermeintlich beste aller politischen Systeme dauerhaft etabliert habe. Die offene Gesellschaft erschien nicht nur als normativ überlegen, sondern auch als historisch alternativlos.
Heute, zum Beginn des zweiten Viertels des 21. Jahrhunderts, nur knapp achtzig Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und nur drei Jahrzehnte nach dem Fall der Berliner Mauer, zeigt sich die globale politische Landschaft in einem krassen Wandel.
Die am Ende des 20. Jahrhunderts vorherrschende historische Hoffnung auf eine weltweite Verbreitung der liberalen Demokratie ist weitgehend verflogen. Stattdessen lässt sich eine gegenläufige Entwicklung beobachten: Liberale Demokratien befinden sich weltweit in Rückzugsgefechten, während autokratische Strömungen zunehmend die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit prägen.6
In der Europäischen Union zeigten die Brüder Jarosław und Lech Kaczyński in Polen und heute insbesondere Viktor Orbán in Ungarn, wie der Rückbau der offenen Gesellschaft hin zu illiberalen Systemen aussehen kann. Xi Jinping in der Volksrepublik China und Vladimir Putin in Russland reagieren ihre Länder praktisch als Alleinherrscher. In Indien transformiert Narendra Modi die größte Demokratie der Welt in einen hindu-nationalistischen Staat – die Liste der Länder, in denen die offene Gesellschaft von ihren Feinden schwer bedrängt wird, ist lang.
Am gravierendsten in diesem Zusammenhang ist der erneute Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus. Trump regiert seit Januar 2025 zum zweiten Mal als amerikanischer Präsident die größte Volkswirtschaft und das militärisch stärkste Land der Welt. Am Beispiel seiner Präsidentschaft lassen sich die Gefahren, die von Populisten für alle Freunde der Freiheit und deshalb auch für Unternehmen ausgehen, geradezu in Reinkultur beobachten.
Wirkte Trumps politisches Handeln während seiner ersten Amtszeit (2017–2021) noch impulsiv und wenig geplant, geht er jetzt strategischer vor. Außenpolitisch untergräbt er die multilaterale politische und ökonomische Zusammenarbeit sowie das System der kollektiven Sicherheit. Unter dem Vorwand eines uneingeschränkten Volksmandats greift er im Inneren der USA die Unabhängigkeit von Justiz, Presse, Kultureinrichtungen und Wissenschaft an. Er und seine Anhänger erfinden »alternative Fakten« sowie »innere Feinde« und instrumentalisieren Sicherheitsbedenken, um ihre Macht zu sichern. Tausende Akademiker, darunter über 25 Nobelpreisträgerinnen und -träger rufen mittlerweile in einem Manifest dazu auf, sich gegen die Rückkehr des Faschismus zu stellen.7
Und wie verhalten sich in dieser Lage die als so mächtig gepriesenen US-Unternehmen und ihre Führungskräfte? Sie kuschen vor dem Präsidenten und den Häschern seiner (Make America Great Again) MAGA-Bewegung. Obwohl sich zahlreiche der großen und kleineren US-Unternehmen in den vorangegangenen Jahren für Diversität, Nachhaltigkeit und Menschenrechte eingesetzt haben, beerdigte das Gros dieser Unternehmen dieses Engagement nach der Machtübernahme von Trump im Handstreich.
Der Handelsriese Walmart und die Fast-Food-Kette McDonald’s distanzierten sich fast umgehend nach der Wiederwahl Trumps von Projekten für Vielfalt und Gleichberechtigung, alle (!) US-amerikanischen Großbanken verließen bereits vor der Amtseinführung Trumps die führende Klimainitiative, die Net Zero Banking Alliance (NZBA), und der Facebook-Mutterkonzern Meta änderte spektakulär seine Regeln zu Faktenchecks und Hassrede: Dort ist es jetzt nicht mehr verboten, »Frauen als Eigentum oder Haushaltsinventar zu bezeichnen« oder im Zusammenhang mit Homosexualität und Transsexualität von »Geisteskrankheit oder Anomalie« zu sprechen.8
Eine öffentliche Kritik am amerikanischen Präsidenten und seiner Politik, wie sie von Unternehmen noch während seiner ersten Amtszeit zu hören war, ist so gut wie vollständig verstummt. Der Kotau der amerikanischen Wirtschaftselite vor Donald Trump, inklusive der Millionenspenden für dessen Inauguration, lässt bei manchen Beobachtern bereits unschöne Erinnerungen an die deutschen Industrie-Granden im Reichstagspräsidentenpalais im Februar 1933 aufkommen, die Hitler beklatschten, finanziell aufrüsteten und sich schöne Zeiten ausmalten.9
Aber 2025 ist nicht 1933, und die Vereinigten Staaten sind nicht Deutschland. Zwar wird auch hierzulande die liberale Demokratie durch Rechtspopulisten und Extremisten bedroht, aber dagegen regt sich erheblicher Widerstand – auch durch das politische Engagement von Unternehmen, wie ich eingangs beschrieben haben.
Das politische Engagement (nicht nur) deutscher Unternehmen ist meines Erachtens bemerkenswert und diskussionswürdig.
Jahrzehntelang galt in den Chefetagen vieler Unternehmen weitgehend unhinterfragt die Maxime des berühmt-berüchtigten Ökonomen Milton Friedman: »Die soziale Verantwortung von Unternehmen besteht darin, den Gewinn zu steigern.« (Im Original: »The social responsibility of business is to increase its profits.«) Die Übernahme einer gesellschaftlichen, vielleicht sogar politischen Verantwortung über die Gewinnmaximierung hinaus wurde bestenfalls als fragwürdiges moralisches Beiwerk verstanden – und schlimmstenfalls als Verrat an den Interessen der Anteilseigner.
Tatsächlich sollte uns das politische Engagement von Unternehmen gegen die AfD im Besonderen – sowie gegen Rechtspopulismus und Extremismus im Allgemeinen – zu denken geben, und zwar selbst dann, wenn wir die entsprechenden Ziele grundsätzlich begrüßen.
Einerseits erscheint uns das politische Engagement von Unternehmen womöglich als notwendig und wünschenswert, weil wir selbst kritisch auf die politischen Umtriebe der Rechtspopulisten blicken und Unternehmen als Partner zur Verteidigung der liberalen Demokratie verorten. Andererseits stellt sich die grundsätzliche demokratietheoretische Frage, wie es zu rechtfertigen ist, dass Unternehmen als extrem wirkungsmächtige Akteure ihre beträchtlichen Ressourcen und ihre öffentliche Reichweite dafür nutzen, um sich aktiv gegen eine politische Partei zu positionieren, die im Rahmen demokratischer Wahlen mit allen anderen Parteien konkurriert und in Teilen Deutschlands sowie auf Bundesebene bereits zu den stärksten politischen Kräften zählt. Kurz: Was legitimiert diese Wirtschaftsakteure dazu, ihren Einfluss zur gezielten politischen Intervention zu nutzen?
Ich stelle deshalb in diesem Buch die folgende zentrale Frage: Sollen sich Unternehmen beziehungsweise ihre Führungskräfte für den Schutz der liberalen Demokratie und gegen den um sich greifenden Rechtspopulismus engagieren?
Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, was die liberale Demokratie eigentlich ist und, vor allem, wofür sie geschaffen wurde.
Ich werde deshalb im ersten Kapitel zeigen, dass die liberale Demokratie – und die soziale Marktwirtschaft, die mit ihr in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis steht – die politische Ausprägung der Ideen der Aufklärung und des Liberalismus darstellt. Letztlich schützt, so meine hier formulierte, aber eigentlich nicht neue These, die liberale Demokratie in Verbindung mit der sozialen Marktwirtschaft die Freiheit jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers. Wird die liberale Demokratie bedroht, gerät folglich auch diese individuelle Freiheit in Gefahr.
Im zweiten Kapitel stelle ich die Gründe vor, warum ein politisches Engagement von Unternehmen zugunsten des Schutzes der liberalen Demokratie begrüßt und gefordert werden sollte. Dabei gehe ich deutlich über die bislang von zahlreichen Wirtschaftsforschungsinstituten, Verbänden und CEOs angeführten, eher kurzfristigen instrumentellem Argumente hinaus – etwa, dass die AfD deutschen Unternehmen schaden könnte, wenn sie beispielsweise den Dexit fordert und ausländische Arbeitskräfte vergrault. Stattdessen zeige ich, dass die eigentliche Gefahr populistischer Parteien nicht nur in ihren Programmen liegt, sondern in den Herrschaftstechniken, zu denen sie aufgrund ihrer politischen Paranoia nahezu zwangsläufig greifen, sobald sie politische Macht erlangen.10 Es ist der Gebrauch dieser Techniken, der die liberale Demokratie und mit ihr die institutionellen und ökonomischen Grundlagen, auf denen das unternehmerische Handeln in der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg beruht, untergräbt. Unternehmen können daran kein Interesse haben.
Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie sich konkret engagieren sollen, und die politische Legitimation für dieses Engagement bleibt fragil. Im ungünstigsten Fall kann ein solches Engagement sogar unerwünschte Nebenwirkungen entfalten und gesellschaftliche Spannungen verschärfen.
Mit diesen Fragen und Risiken setze ich mich im dritten Kapitel ausführlich auseinander und mache dann im vierten Kapitel konkrete Vorschläge, wie Unternehmen ihr Engagement zugunsten der liberalen Demokratie in einer Art und Weise gestalten können, dass es gleichermaßen wirksam ist und in einem hohen Maße legitim bleibt.
Ich schließe meine Überlegungen mit einem Ausblick auf die nächste Zukunft.
Die Verantwortung von Unternehmen: Wert schaffen, Werte beschützen
Was erwarten wir von Unternehmen?
Von Unternehmen und ihrem Spitzenpersonal wird in offenen Gesellschaften eine Menge – und anscheinend immer mehr – erwartet. Für viele selbstverständlich sollen Unternehmen innovative Produkte und Dienstleistungen schaffen, die in Preis und Qualität kompetitiv sind – wir wollen tolle E-Bikes, Smartphones, Spielkonsolen, Autos und Medikamente zu erschwinglichen Preisen.
Unternehmen sollen zudem möglichst viele und attraktive Arbeitsplätze bereitstellen, Steuern zahlen und sich, das ist hoffentlich selbstverständlich, an geltende nationale und internationale Gesetze halten.
Die weit überwiegende Mehrheit der deutschen Unternehmen erfüllt diese Erwartungen ausgezeichnet. Deutsche Produkte und Dienstleistungen sind immer noch weltweit beliebt, die hiesigen Arbeitsplätze gelten im globalen Vergleich als sicher und gut bezahlt – nicht zuletzt aufgrund der Errungenschaften der betrieblichen Mitbestimmung und der Sozialpartnerschaft, einem zentralen Merkmal der sozialen Marktwirtschaft.
Unternehmen kofinanzieren zudem mittels der von ihnen entrichteten Steuern und Sozialabgaben einen weit ausgefächerten Sozialstaat, der seinen Bürgern Sicherheit sowie den Zugang zu einem vergleichsweise modernen Bildungs- und Gesundheitssystem ermöglicht, eine gute Infrastruktur bereitstellt und eine international hochgeschätzte Kulturlandschaft fördert. Deutschland ist wegen seiner starken Unternehmen eines des wohlhabendsten, sichersten und sozialsten Länder der Welt.
Unternehmen übernehmen außerdem häufig freiwillig gesellschaftliche Verantwortung und engagieren sich im weitesten Sinne sozial: Sie helfen mit Spenden aus, wo der Staat mitunter nicht genügend Mittel zur Verfügung stellt, sie unterstützen Umweltprojekte, Krankenhäuser, Kinderheime, Stadtteilprojekte, fördern Kulturinstitutionen, Hochschulen und vieles andere mehr. Dieses Engagement zeigt sich in vielfältigen Initiativen:
Die Deutsche Telekom fördert beispielsweise mit ihrer »Ich kann was!«-Initiative die digitale Teilhabe junger Menschen aus sozial benachteiligten Milieus. In der Metropolregion Rhein‑Neckar, insbesondere am Standort Ludwigshafen, unterstützt BASF jährlich über 150 lokale Projekte in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur, Soziales und Umwelt. Bosch leistet über die Robert Bosch Stiftung, eine der größten unternehmensverbundenen Stiftungen Europas, substanzielle Beiträge zum Gemeinwohl. Die Stiftung fördert Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Völkerverständigung und demokratische Teilhabe. Ihr Engagement reicht von lokalen Bildungsprojekten bis hin zu internationalen Forschungskooperationen und strukturwirksamen Modellvorhaben. Und die Supermarktkette REWE engagiert sich in Kooperation mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) in mehreren groß angelegten Umweltschutzprojekten.
All dieses Engagement ist freiwillig, geht über die jeweilig spezifische Geschäftstätigkeit hinaus und hat erklärtermaßen das Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu leisten. Für viele Empfänger sind diese Unterstützungen, die man auch in der Fachsprache als Corporate Philanthropy bezeichnet, überlebenswichtig, sie fördern jedenfalls die Menge und Qualität des Angebots.
Vor dem Hintergrund des Erstarkens rechtspopulistischer und rechtsextremer Strömungen in Deutschland fordern nun außerdem zahlreiche prominente Stimmen, dass sich Unternehmen darüber hinaus gegen Rechtsextremismus und Populismus sowie für den Schutz der offenen Demokratie einsetzen sollen.
Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) von 2021 bis 2024, äußerte sich wiederholt und deutlich kritisch gegenüber der AfD und ruft Unternehmen dazu auf, öffentlich Stellung zu beziehen. »Eine politische Bewegung, die die Wende rückwärts zu Nationalismus beschwört, ist schädlich für dieses Land: für die Wirtschaft und für Ansehen und Erfolg Deutschlands im globalen Kontext. Wir tun gut daran, uns den Aussagen der AfD auch öffentlich deutlich entgegenzustellen: Klar zu sagen, sie zu wählen ist kein harmloser Protest, sondern das ist eine Partei, die schädlich ist für die Zukunft unseres Landes und von uns allen.«11
Marcel Fratzscher, der Präsident des einflussreichen Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), sieht Unternehmen und ihre Vorstände ebenfalls in der Verantwortung: »Die Vorstände in den Unternehmen müssen jetzt Farbe bekennen gegen rechts (…).«12
Die Einschätzungen von Russwurm und Co. werden auch seitens der Wissenschaft geteilt, u.a. von den an der renommierten Universität St. Gallen lehrenden Professoren Thomas Beschorner und Thomas Hermann: »Mehr und mehr Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben in den vergangenen Tagen klar Stellung gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt bezogen. Das ist gut! Zugleich sind weitere Anstrengungen durch die Wirtschaft notwendig, denn es steht etwas auf dem Spiel.«13
Diese Aufrufe werden von zahlreichen Unternehmen begrüßt und umgesetzt – viele Unternehmen engagieren sich bereits politisch für den Schutz der offenen Gesellschaft.
»Die Evolution hat uns gelehrt: Blau ist keine gute Wahl«, ließ etwa der Handelsriese Edeka über soziale Medien und ganzseitige Zeitungsannoncen wissen. Nur wenig subtil rief das Unternehmen mit dieser Kampagne zum Wahlboykott der AfD bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst 2024 auf.
Edeka war mit dieser klaren politischen Positionierung keinesfalls allein. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte auch der Aufruf des Evonik-Chefs Christian Kuhlmann an Manager, »authentisch und direkt« gegen rechte Umtriebe vor(zu)gehen.14,15
Darüber hinaus engagieren sich zahlreiche Unternehmen mittlerweile kollektiv für den Schutz der offenen Gesellschaft. In der Kampagne »Made in Germany – Made by Vielfalt« setzten über 150 führende deutsche Unternehmen ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus und Extremismus.
Zu den teilnehmenden Firmen gehören unter anderem Vorwerk, Dr. Oetker, Miele, Deichmann, Otto und Boehringer Ingelheim. Zudem haben sich in Deutschland einige größere wirtschaftsnahe Vereine und Organisationen gegründet, die sich offensiv für Vielfalt, Weltoffenheit und die Stärkung der liberalen Demokratie in Deutschland einsetzen.
In der Initiative »We Stand for Values« treten über dreißig namhafte deutsche Unternehmen, darunter BMW, Siemens, BASF und Mercedes‑Benz, öffentlich für Demokratie, Vielfalt und Toleranz ein. Gemeinsam fordern sie ihre rund 1,7 Millionen Beschäftigten auf, ihr Wahlrecht zu nutzen, und setzen damit ein deutliches Zeichen gegen Populismus und Extremismus.
Das Bundesnetzwerk »Wirtschaft für ein weltoffenes Deutschland« versteht sich als parteipolitisch neutrales, wirtschaftliches Bündnis – von Handwerksbetrieben bis zu Großunternehmen – und setzt sich aktiv für Demokratie, Weltoffenheit und Vielfalt ein. Über 2700 Unternehmen (Stand Frühjahr 2025





























