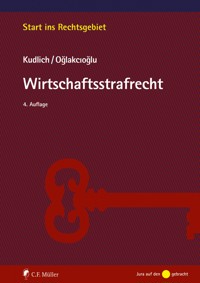
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Konzept der Leading-Cases: Das Lehrbuch behandelt die in der juristischen Ausbildung und Prüfung relevanten Bereiche des Wirtschaftsstrafrechts. Für den "Start ins Rechtsgebiet" wurden die Materien bewusst "StGB-lastig" ausgewählt (Betrug, Untreue, Subventions- und Kreditbetrug, Insolvenzstrafrecht), das Nebenstrafrecht (Schutz des Kapitalmarkts, Finanz-, Bilanz-, Wettbewerbsstrafrecht) wird nur selektiv behandelt. Nach einführenden Kapiteln zu Begriff, Prinzipien, Auslegungsgrundsätzen und kriminologischen Grundlagen des Wirtschaftsstrafrechts wird der Stoff anhand von zentralen Leitentscheidungen präsentiert, die den Ausgangspunkt für eine Einführung in das jeweilige Teilgebiet bilden. Daran schließt sich eine vertiefte Darstellung der anlässlich der Entscheidung diskutierten Sonderprobleme an. Auf diese Weise werden einführender Überblick und vertiefte Kenntnis der Leading-Cases kombiniert. Den verfahrensrechtlichen Besonderheiten des Wirtschaftsstrafrechts ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Gesetzestexte, Definitionen, zahlreiche Beispiele, instruktive Übersichten, ausgewählte Prüfungsfragen sowie Hinweise auf weiterführende Literatur erleichtern das Arbeiten mit dem Buch. Die Neuauflage: Für die Neuauflage ist das Lehrbuch auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung und Rechtsprechung gebracht und deutlich erweitert worden. Eingearbeitet wurden u.a. das Hinweisgeberschutzgesetz, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das Finanzmarktstärkungsgesetz, die 10. GWB-Novelle sowie das Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz (SanInsFoG). Die Grundlagen der Geldwäsche/-prävention sind in einem eigenen Kapitel dargestellt. Als neue Leading-Cases wurden die Entscheidungen zum Cum-Ex-Skandal und zu den Corona-Subventionen aufgenommen, weitere prominente Wirtschaftsstrafsachverhalte wie zB Wirecard und Maskendeals sind berücksichtigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wirtschaftsstrafrecht
von
Hans Kudlich
und
Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Autoren
Dr. Hans Kudlich ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Dr. Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, Medizinstraf-recht und Rechtsphilosophie an der Universität des Saarlandes und Richter am Saarländischen Oberlandesgericht.
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9104-5
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221 1859 599Telefax: +49 6221 1859 598
www.cfmueller.de
© 2025 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des e-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine e-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Auch die 3. Auflage des Werks ist freundlich aufgenommen worden. Neben den allfälligen Aktualisierungen auf Grund von neuer Rechtsprechung und Literatur sind auch in dieser Auflage gesetzgeberische Aktivitäten und Pläne (u.a. das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Hinweisgeberschutzgesetz, das Finanzmarktstärkungsgesetz usw.) nachzuzeichnen. Schließlich wurde das Lehrbuch um ein weiteres Kapitel zur Geldwäschebekämpfung ergänzt. Das didaktische Konzept, insbesondere im „Besonderen Teil des Wirtschaftsstrafrechts“ einen Schwerpunkt auf das Wirtschaftsstrafrecht im StGB sowie die StGB-nahen Materien zu legen und Stoff hier – soweit vorhanden – an wichtigen Leitentscheidungen zu verdeutlichen, wurde beibehalten. Dabei wurden zwei Kapitel um neue Leading-Cases (sog. „Cum-Ex-Skandal“ und Corona-Subventionen) ergänzt.
Wir hoffen, dass damit unser Buch auch weiterhin – im wahrsten Sinne des Namens der Reihe – einen hilfreichen Start in ein Rechtsgebiet verschaffen kann, dessen praktische und wissenschaftliche Bedeutung in den vergangenen Jahren noch einmal rasant zugenommen hat.
Für die große Unterstützung bei der großflächigen Erfassung der mittlerweile kaum noch zu überblickenden Aufsatzliteratur sowie bei der Korrektur der Fahnen danken wir unseren gesamten wundervollen Teams in Erlangen und Saarbrücken und dabei insbesondere Frau Aline Thome, Herrn Fatih Anil Uzun, Frau Kim Leonie Roth, Frau Julia Abbas, Frau Lara Osseili, Frau Muriel Brixner und Frau Annalena Gras.
Erlangen/Saarbrücken im März 2025
Hans KudlichMustafa Temmuz Oğlakcıoğlu
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Das vorliegende Werk zum Start ins Wirtschaftsstrafrecht basiert im Wesentlichen auf einem Vorlesungsskript, das der Mitautor Kudlich seit einer Reihe von Jahren – mit teils variierenden Inhalten, aber doch einem festen Kern – in der Vorlesung Wirtschaftsstrafrecht zur Verfügung gestellt hat. Seine Wurzeln gehen damit in eine Zeit zurück, in der ein ausführliches Skript geboten war, da es noch kaum für Studierende geeignete Lehrbücher zum Wirtschaftsstrafrecht gab. (…) Nach vier einführenden Kapiteln wird der Stoff anhand von zentralen (und meist neueren) Leitentscheidungen präsentiert, die den Anlass für eine Einführung in das jeweilige Teilgebiet bilden, der sich eine vertiefte Darstellung der anlässlich der Entscheidung diskutierten Sonderprobleme anschließt. Auf diese Weise werden einführender Überblick und vertiefte Kenntnis der leading cases, welche die Diskussion im Wirtschaftsstrafrecht in hohem Maße prägen, kombiniert.
Wie bei allen Lehrwerken in diesem (in der universitären Ausbildung) relativ jungen Rechtsgebiet hat sich auch für uns die Frage der Stoffauswahl gestellt, da ein allgemein anerkannter Kanon dessen, was in der Universität im Wirtschaftsstrafrecht gelehrt werden muss, noch nicht in Sicht ist. Wir haben für den „Start ins Rechtsgebiet“ die Materien bewusst „StGB-lastig“ ausgewählt und das Nebenstrafrecht nur selektiv behandelt.
Hinweise auf (…) vertiefenden Werke finden sich bei uns – in bewusst überschaubarer Zahl – zum einen in den Fußnoten; zum anderen werden am Ende der meisten Kapitel (insbesondere neuere) Monographien zu den behandelten Themengebieten aufgezählt. Dabei haben wir wiederum die Schwerpunktstudenten vor Augen, die nach den Prüfungsordnungen vieler Universitäten eine Seminararbeit zu schreiben haben. Für diese ist ein Rückgriff auf solche (in den Kommentaren oft nicht hinreichend nachgewiesenen) Monographien aber unverzichtbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur
1. TeilEinführung
§ 1Begriff des Wirtschaftsstrafrechts und kriminologische Grundlagen
I.Begriff des Wirtschaftsstrafrechts1 – 14
1.Problemstellung1 – 3
2.Begriffsbestimmung aus kriminologischer Sicht4, 5
3.Strafprozessual-kriminaltaktische Begriffsbildung des § 74c GVG6 – 8
4.Begriffsbestimmung aus rechtsdogmatischer/rechtsgutorientierter Sicht9 – 14
II.Phänomenologie des Wirtschaftsstrafrechts (kriminologische Grundlagen)15 – 24
1.Personenbezogene Charakteristika des Wirtschaftsstrafrechts16
2.Tatbezogene Charakteristika des Wirtschaftsstrafrechts17, 18
3.Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts in der Praxis und polizeiliche Kriminalstatistik19 – 22
4.Wirtschaftsstrafrecht zwischen „Klassenstrafrecht“ und modernem Ostrakismos23, 24
III.Rechtsquellen und Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts in Deutschland25 – 43
1.Vorschriften im Kernstrafrecht27, 28
2.Gesetzesblöcke im Nebenstrafrecht29 – 36
3.EU-Recht37 – 41
4.Wirtschaftsstrafrecht AT?42, 43
§ 2Besondere Prinzipien der Bildung von Tatbeständen im Wirtschaftsstrafrecht
I.Gesetzgebungsprinzipien44 – 53
1.Sonderdelikte45, 46
2.Abstrakte Gefährdungsdelikte47, 48
3.Überkriminalisierung?49, 50
4.Häufige Anordnung von Fahrlässigkeitstatbeständen51 – 53
II.Blankettstraftatbestände und normative Tatbestandsmerkmale54 – 85
1.Blankettgesetze im „engeren Sinn“ (echte Blankettgesetze, sog. Außenverweisungen)56 – 60
2.Blankettgesetze im „weiteren Sinn“ (unechte Blankettgesetze, sog. Binnenverweisungen)61 – 66
3.Auswirkungen von Blanketttatbeständen und normativen Merkmalen auf die strafrechtliche Irrtumsproblematik67 – 85
III.Erlaubnis- und Genehmigungsvorbehalte im Wirtschaftsstrafrecht86 – 90
1.Die Erlaubnis als überindividuelles Pendant zur individuellen Einwilligung86, 87
2.Verwaltungsaktsakzessorietät?88
3.Zur dogmatischen Einordnung der verwaltungsrechtlichen Erlaubnis bzw. Genehmigung89, 90
IV.Behördliche Gestattungsakte als Abwägungs- und Angemessenheitsfaktoren i.R.d. § 34 StGB – Rechtfertigender Notstand in Krisenzeiten?91, 92
§ 3Grundsätze und Schwierigkeiten bei der Auslegung von Wirtschaftsstraftatbeständen
I.(Restriktive) Auslegung von Generalklauseln und Maßstabsfiguren93 – 95
II.Wirtschaftliche Auslegung96 – 98
III.Richtlinienkonforme Auslegung?99, 100
IV.Behandlung von Schein- und Umgehungshandlungen101 – 105
§ 4Verantwortung von und im Unternehmen
I.Das Unternehmen als zentraler Schauplatz wirtschaftsstrafrechtlicher Delinquenz106 – 108
II.Verantwortung von Unternehmen109 – 142
1.Zur Diskussion um ein Verbandssanktionengesetz110 – 117
a)Reformdruck110, 111
b)Einwände gegen eine „Unternehmensstrafe“ in der tradierten Strafrechtsdogmatik112, 113
c)Sanktionen gegen Verbände?114, 115
d)Überblick über die aktuelle Diskussion und politische Entwicklungen116, 117
2.Bebußung von Gesellschaften im Ordnungswidrigkeitenrecht nach § 30 OWiG118 – 131
a)Grundgedanke des § 30 OWiG119 – 122
b)Tatbestand des § 30 OWiG123 – 128
aa)Anknüpfungstat123
bb)Tauglicher Täterkreis124
cc)Betriebsbezogene Pflichtverletzung/(beabsichtigte) Bereicherung des Verbands125 – 127
dd)Handeln in Funktion der verantwortlichen Leitungsposition128
c)Rechtsfolge des § 30 OWiG129 – 131
3.Sonstige Sanktionen und Maßnahmen gegen Unternehmen132 – 134
4.Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) als Unternehmenssanktionenrecht durch die Hintertür?135 – 142
a)Überblick und Systematik137
b)Ordnungswidrigkeit nach § 24 LkSG138 – 142
III.Strafbarkeit im Unternehmen143 – 164
1.Horizontale Verantwortungsstrukturen144, 145
2.Vertikale Verantwortungsstrukturen146 – 156
a)Verantwortung als mittelbarer Täter, § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB?147 – 149
b)Wechselseitige Zurechnung, § 25 Abs. 2 StGB?150, 151
c)Strafbarkeit wegen Unterlassen, § 13 StGB?152, 153
d)Verschiebung der Verantwortung „nach unten“? (Zur Frage der sog. Delegation)154 – 156
3.Haftungsbegründung beim Vertreter, § 14 StGB157 – 161
a)Organhaftung, § 14 Abs. 1 StGB158, 159
b)Betriebsleiterhaftung, § 14 Abs. 2 StGB160
c)Fehlerhaftes Organ/Fehlerhafter Betriebsleiter, § 14 Abs. 3 StGB161
4.Die Aufsichtshaftung nach § 130 OWiG162 – 164
2. TeilAusgewählte Problemstellungen und Regelungskomplexe des Wirtschaftsstrafrechts
§ 1BGHSt 37, 106: Die Lederspray-Entscheidung Produktstrafrecht und Gremienentscheidungen
I.Strafrechtliche Produkthaftung166 – 169
II.Kausalitätsprobleme in der strafrechtlichen Produkthaftung und die Lösung des BGH im Ledersprayfall170 – 188
1.Kausalität trotz nicht abschließend geklärter Wirkungsweise der Stoffe171 – 177
a)Lösung über Risikoerhöhungslehre174
b)Lösung des BGH175 – 177
2.Kausalitätsbegründung bei Gremienbeschlüssen178 – 183
3.Strafbares Unterlassen im Rahmen der Produkthaftung184 – 188
a)Garantenstellung in Produkthaftungsfällen und „Ingerenz-Lösung“ des BGH im Lederspray-Urteil185, 186
b)Ressortverantwortung und Generalverantwortung in Krisenzeiten187
c)Unterlassungskausalität bei psychisch vermittelten Kausalverläufen188
§ 2BGHSt 66, 182: „Cum-Ex“ Beihilfe durch berufsbedingtes Verhalten – zugleich Grundzüge des Steuerstrafrechts
I.Die Steuerhinterziehung als Wirtschaftsstraftat oder „Kavaliersdelikt“?190 – 192
II.Steuern und Steuerrecht – Eine kurze Einführung193 – 198
1.Die Bundesrepublik Deutschland als Steuerstaat193 – 195
2.Das Steuerverfahren196
3.„Steuerrecht AT“ – Die Abgabenordnung von 1977197, 198
III.Einige Grundbegriffe des Steuerstrafrechts199 – 238
1.Überblick199, 200
2.Verfahrensrechtliche Besonderheiten201, 202
3.Die Steuerhinterziehung, § 370 AO203 – 221
a)Zur Deliktsnatur des § 370 AO204, 205
aa)Blankett oder normative Tatbestandsmerkmale?204
bb)Der Täterkreis der Steuerhinterziehung205
b)Der Tatbestand des § 370 AO im Einzelnen206 – 219
aa)Die Taterfolge des § 370 Abs. 1 AO: Steuerverkürzung oder Vorteilserlangung206 – 209
bb)Die Tathandlungen des § 370 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AO210 – 216
cc)Sonstige Tatbestandsvoraussetzungen, insb. Kausalität und Vorsatz217 – 219
c)Vollendung und Versuch220, 221
4.Die strafbefreiende Selbstanzeige, § 371 AO222 – 234
a)Rechtsnatur222 – 224
b)Voraussetzungen225 – 227
c)Ausschluss der Selbstanzeige gem. § 371 Abs. 2 AO228 – 234
5.Zwischenfazit zum Ausgangsfall: Strafbare Einkommensteuerhinterziehung durch die Cum-Ex-Händler?235 – 238
IV.Unterstützung fremder Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten – Die Strafbarkeit eines Bankangestellten wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung239 – 252
1.Das Problem der Beihilfe durch berufsbedingtes Verhalten im Allgemeinen241 – 248
2.Neutrale Beihilfe in Cum-Ex-Fällen249 – 252
V.Zur Strafe bei Steuerhinterziehung: Die „Millionenrechtsprechung“253 – 255
§ 3BGHSt 54, 44: Berliner Stadtreinigung Der Betrug als Wirtschaftsstraftat – zugleich Überlegungen zur strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung
I.Der Betrug gem. § 263 StGB als das Wirtschaftsdelikt schlechthin?257 – 259
II.Grundzüge der Betrugsstrafbarkeit260 – 295
1.Rechtsnatur des § 263 Abs. 1 StGB260
2.Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 263 Abs. 1 StGB im Einzelnen261 – 294
a)Tathandlung: Täuschung263 – 273
b)Irrtum274 – 280
aa)Irrtum der Hilfsperson bzw. des „einfachen“ Angestellten278, 279
bb)Irrtum des höherrangigen Organs bzw. Entscheidungsträgers280
c)Vermögensverfügung281 – 284
d)Vermögensschaden285 – 293
aa)Schadenskompensation288
bb)Schadensgleiche Vermögensgefährdung289 – 292
cc)Abgrenzung Eingehungs- und Erfüllungsbetrug293
e)Subjektiver Tatbestand294
3.Sonstiges295
III.Betrug gem. § 263 Abs. 1 StGB durch überhöhte Rechnungsstellung? Die Lösung des BGH im Berliner Stadtreinigungsfall „Part 1“296 – 302
1.Erklärungsinhalt bei überhöhter Rechnungsstellung297 – 301
2.Zwischenergebnis302
IV.Betrug durch Unterlassen Die Lösung des BGH im Berliner Stadtreinigungsfall „Part 2“303 – 323
1.Betrug durch Unterlassen – Grundlagen304 – 311
2.Unterlassungshaftung im Unternehmen – § 263 StGB als Schauplatz für die sog. Geschäftsherrenhaftung312 – 323
a)Garantenstellung aus Ingerenz313
b)Garantenstellung durch Übernahme eines Pflichtenkreises314 – 317
c)Viel Lärm um nichts? Ein Exkurs zur Garantenstellung sog. „Compliance-Officer“318 – 323
§ 4BGHSt 66, 115: Corona-Hilfen und BGHSt 38, 186: Rheinausbau Betrugsderivate und ihre Bedeutung im Wirtschaftsrecht
I.§ 263 StGB in der Wirtschaft – oft thematisch einschlägig, aber nur selten tatsächlich verwirklicht?325
II.Strafrechtlicher Schutz des staatlichen Subventionswesens326 – 341
1.Staatliche Subventionen – Chancen und Risiken326
2.Der Betrug nach § 263 StGB im Zusammenhang mit Subventionen327, 328
3.Der Subventionsbetrug gem. § 264 StGB329 – 337
a)Rechtsnatur und kriminalpolitische Bedeutung329
b)Überblick und Systematik330, 331
c)Der Anwendungsbereich der Vorschrift – Zum Subventionsbegriff nach § 264 Abs. 8 StGB332, 333
d)Die Tathandlungen des § 264 StGB334 – 337
4.Corona-Hilfen und Subventionsbetrug338 – 341
III.Kreditbetrug gem. § 265b StGB342 – 344
1.Rechtsgut und Anwendungsbereich343
2.Die Tathandlungen des § 265b StGB im Überblick344
IV.Strafrechtlicher Schutz des öffentlichen Vergabewesens345 – 366
1.Grundlagen: Das öffentliche Vergaberecht345 – 349
2.Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, § 298 StGB350 – 359
a)Rechtsgut und Deliktscharakter350
b)Die Tatbestandsmerkmale des § 298 StGB im Einzelnen351 – 359
aa)Ausschreibung351, 352
bb)Tathandlung353 – 359
3.„Submissionsbetrug“ – Die Lösung des Rheinausbau-Falles durch den BGH in einer Zeit vor § 298 StGB360 – 366
§ 5BGHSt 59, 80: Matched Orders Strafrecht des Kapitalmarkts und Anlegerschutz (zugleich Grundbegriffe des Bilanzstrafrechts)
I.Strafrechtlicher Schutz des Kapitalmarkts368 – 398
1.Ausgewählte Strafvorschriften zum Schutz des Kapitalmarkts im Überblick373 – 389
a)Kapitalanlagebetrug, § 264a StGB373 – 375
b)Straftaten nach dem WpHG376 – 387
aa)§ 119 Abs. 3 Nr. 1-3 WpHG: Insiderhandel, Empfehlung und verbotene Offenlegung378 – 383
bb)Kurs- und Marktmanipulation, § 119 Abs. 1 WpHG384 – 387
c)§ 49 BörsG388, 389
2.Falschangabedelikte und Bilanzstrafrecht390 – 398
a)§§ 331 ff. HGB393 – 396
b)§ 400 Abs. 1 Nr. 1 AktG397, 398
II.Strafbarkeit durch matched orders, BGHSt 59, 80399 – 405
§ 6BGHSt 50, 331: Der Fall Mannesmann Die Untreue im Wirtschaftsstrafrecht
I.„Untreue passt immer“?407 – 410
II.Grundlagen der Untreuestrafbarkeit, § 266 StGB411 – 437
1.Rechtsgut411
2.Zur Verfassungsmäßigkeit des § 266 StGB412 – 414
3.Systematik des § 266 StGB415
4.Die Tatbestandsmerkmale des § 266 StGB im Einzelnen416 – 437
a)Gemeinsamer Bezugspunkt: Vermögensbetreuungspflicht416 – 419
b)Die Tatmodalitäten des § 266 Abs. 1 StGB420 – 423
c)Insbesondere: Die Vermögensbetreuungspflichtverletzung424 – 431
aa)Die Akzessorietät der Pflichtverletzung424
bb)Zum Verhältnis von Vermögensbetreuungspflicht und deren Verletzung425
cc)Untreue als Gläubigerschutzvorschrift? Zur Frage eines tatbestandsausschließenden Einverständnisses426 – 431
d)Der Vermögensnachteil und die nur im Grundsatz übertragbare Schadensdogmatik aus § 263 Abs. 1 StGB432 – 435
e)Vorsatz436, 437
III.Akzessorietät der Untreue am Beispiel der Zahlung überhöhter Vorstandsvergütungen – Der Fall Mannesmann438 – 451
1.Aktienrechtliche Grundlagen: Die Feststellung der aktienrechtlichen Pflichtverletzung439 – 443
2.Die Beurteilung der Vermögensbetreuungspflichtverletzungen durch das LG Düsseldorf und den BGH im Mannesmann-Fall444 – 451
a)Die Notwendigkeit einer gravierenden Pflichtverletzung und ihre Bestimmung nach dem LG Düsseldorf444 – 446
b)Die doppelte „Abkürzung“ des BGH im Mannesmann-Fall447 – 450
c)Exkurs: Zur Strafbarkeit der Vorstandsmitglieder451
§ 7BGHSt 47, 295: Die Drittmittelentscheidung Korruption und Untreue im öffentlichen Sektor
I.Korruption als wirtschafts(straf)rechtliches Phänomen453 – 458
II.Grundzüge und Systematik der Korruptionsdelikte nach §§ 331 ff. StGB459 – 480
1.Die Tatbestandsmerkmale der §§ 331 ff. StGB im Einzelnen463 – 475
a)Amtsträgereigenschaft463, 464
b)Diensthandlung oder Dienstausübung465 – 469
c)Vorteil470 – 472
d)Tathandlungen473 – 475
2.Restriktionsbemühungen476 – 480
a)Einschränkungen nach dem Grundsatz der Sozialadäquanz bei kleineren Zuwendungen?476, 477
b)Sponsoring, Fundraising und Co: Zwischen begrüßenswerter Kooperation und illegaler Korruption478 – 480
III.Das Problem der Drittmitteleinwerbung und die Entscheidung des BGH im Herzklappenfall, BGHSt 47, 295 ff.481 – 489
1.Problemaufriss481
2.Anknüpfung an den Vorteilsbegriff482, 483
3.Lösung des BGH: Anknüpfung an das ungeschriebene Merkmal der Unrechtsvereinbarung484 – 487
4.Rechtfertigung der Drittmittelannahme durch Genehmigung, § 331 Abs. 3 StGB?488
5.Zwischenergebnis489
IV.Untreue gem. § 266 StGB durch Drittmittelakquise?490 – 493
1.Untreue durch Nichtabführung der Drittmittel an die Universität?491
2.Untreue durch überteuerten Produktkauf (sog. Kick-back-Phänomen)?492, 493
§ 8BGHSt 52, 323: Siemens-ENEL Korruption und Untreue im privaten Sektor (einschließlich einiger Hinweise zum Wettbewerbsstrafrecht)
I.Der freie Wettbewerb als „Motor“ der freien Marktwirtschaft495 – 497
II.Grundzüge des Wettbewerbsstrafrechts498 – 506
1.Überblick498
2.Verbotene Werbung: § 16 UWG499 – 501
3.Geheimnisverrat: § 23 GeschGehG502 – 506
III.Bestechung und Bestechlichkeit im privaten Sektor, § 299 StGB (Fall Siemens-ENEL)507 – 528
1.Zur Wiederholung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede des § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 StGB zu den §§ 331 ff. StGB509, 510
2.Die Tatbestandsmerkmale des § 299 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 StGB im Übrigen511 – 517
a)Täterkreis511 – 516
b)Tathandlungen517
3.Das „Geschäftsherrenmodell“ in § 299 Abs. 1 Nr. 2 und 299 Abs. 2 Nr. 2 StGB518 – 520
4.Das Problem der Auslandsbestechung unter Geltung des § 299 a.F. und die Lösung des BGH im Fall Siemens-ENEL, BGHSt 52, 323521 – 528
IV.Eine „Zugabe“ vom BGH mit Folgen: Strafbare Untreue durch Bildung und Fortführung schwarzer Kassen?529 – 543
1.Zum Begriff der schwarzen Kasse530, 531
2.Die Verletzung einer qualifizierten Vermögensbetreuungspflicht532
3.Streitpunkt Vermögensschaden – Ein neues Verständnis von der Untreue?533 – 543
a)Bisherige Bewertung schwarzer Kassen533
b)Das Schadensmodell des 2. Senats – Entziehen der Dispositionsmöglichkeit als Vermögensnachteil534, 535
c)Kritik in der Literatur536 – 543
V.Exkurs: Weitere Fälle der Strafbarkeit korruptiven Verhaltens im privaten Sektor544 – 549
§ 9BGHSt 50, 299 ff.: Kölner Müllverbrennungsskandal Der strafrechtliche Amtsträgerbegriff
I.Der strafrechtliche Amtsträgerbegriff im Wirtschaftsstrafrecht551 – 553
II.Die Legaldefinition des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB554 – 569
1.Beamte und Richter554 – 560
2.Sonst öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. b StGB561
3.Für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB562
4.Sonstige Bestellung zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c StGB563 – 569
III.Das „Sorgenkind“ § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c StGB und seine Auslegung in der Rechtsprechung – Ein Rückblick anhand ausgewählter Entscheidungen570 – 589
1.Vor dem Korruptionsbekämpfungsgesetz: Maßgeblichkeit der Vertriebsform571, 572
2.„Unbeschadet der Organisationsform“ – Die Entwicklung der Gesamtbewertungslehre573 – 581
3.Gesamtbewertungslehre vs. Art. 103 Abs. 2 GG582 – 585
4.„Bestellung“ und Wahrnehmung als (zusätzliche) Korrektive?586 – 589
IV.Das Sonderproblem der Kooperation von Privaten und öffentlicher Hand und die Lösung des BGH im Kölner Müllverbrennungsskandal, BGHSt 50, 299 ff.590 – 594
V.Korruptionsstrafrecht und ausländische Amtsträger sowie internationale Bedienstete, § 335a StGB595 – 598
§ 10BGHSt 31, 118: Der GmbH-„Boss“ Grundzüge des Insolvenzstrafrechts – zugleich Fragen des faktischen Geschäftsführers
I.Strafrechtliche Risiken in der wirtschaftlichen Krise600
II.Grundzüge des Insolvenz(straf)rechts601 – 608
1.Überblick und Systematik der Strafvorschriften603 – 606
2.Entwicklung des Insolvenz(straf)rechts607
3.Der Krisenbegriff und die Legaldefinitionen der InsO als gemeinsame Merkmale der §§ 283 ff. StGB608
a)Zahlungsunfähigkeit, § 17 InsO609 – 612
b)Drohende Zahlungsunfähigkeit, § 18 InsO613, 614
c)Überschuldung, § 19 InsO615 – 618
4.Objektive Bedingung der Strafbarkeit619
III.Die Straftatbestände im Einzelnen620 – 636
1.Der Bankrott, § 283 StGB620 – 627
2.Gläubiger- und Schuldnerbegünstigung, §§ 283c, 283d StGB628, 629
3.Insolvenzverschleppung gem. § 15a InsO am Beispiel der GmbH630 – 636
a)Überblick630, 631
b)Die Insolvenzantragspflicht632 – 635
c)Täterkreis des § 15a InsO636
IV.Der faktische Geschäftsführer und die Lösung des BGH (BGHSt 31, 118)637 – 640
V.Exkurs: Die Abgrenzung von Bankrott zur Untreue641 – 649
1.Problemaufriss641 – 643
2.Frühere Rechtsprechung: „Interessentheorie“644 – 646
3.Abkehr von der Interessentheorie, BGHSt 57, 229647 – 649
§ 11BGHSt 48, 307: Der Geschäftsführer in der Zwickmühle Grundrisse des Arbeitsstrafrechts
I.Der Unternehmer im Arbeitsmarkt651
II.Arbeitsstrafrecht – Begriff und Überblick652 – 660
1.Schutz des Arbeitnehmers653 – 656
2.Schutz des Arbeitsmarkts657 – 660
a)Illegale Arbeitnehmerüberlassung und illegale Ausländerbeschäftigung658, 659
b)Illegale Beschäftigung von Ausländern, § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III, §§ 10, 11 SchwarzArbG660
III.§ 266a StGB – Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt661 – 690
1.Sozialversicherungsrechtliche Grundlagen662 – 666
2.Die Tatbestände des § 266a Abs. 1 bis 3 StGB im Überblick667, 668
3.Insbesondere § 266a Abs. 1 StGB669 – 690
a)Tauglicher Täterkreis669, 670
b)Tatobjekt und Tathandlung671 – 675
c)Veruntreuen in „Krisenzeiten“: Das Sonderproblem der Zahlungsunfähigkeit676 – 679
aa)Vollständige Zahlungsunfähigkeit677
bb)Kollision von Zahlungspflichten678, 679
d)Die Kollision von strafrechtlicher Zahlungspflicht und gesellschaftsrechtlichem Zahlungsverbot680 – 688
aa)Problemaufriss680, 681
bb)Der Geschäftsführer in der Zwickmühle und die Lösung des BGH682 – 688
e)Subjektiver Tatbestand689, 690
§ 12BGHSt 55, 288 ff.: Siemens – AUB Schutz der betrieblichen Mitbestimmung und Grenzen der Untreuestrafbarkeit
I.Die betriebliche Mitbestimmung und ihr strafrechtlicher Schutz im Allgemeinen692 – 695
II.Die konkreten strafrechtlichen Fragestellungen696, 697
III.Steuerhinterziehung durch Abzug der (mittelbaren) AUB-Unterstützung als Betriebsausgaben698 – 704
1.Das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Nr. 10 EStG als Brückennorm698
2.Auslegung des § 119 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG699 – 703
a)Der Regelungsgehalt des § 119 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG – ein spontaner Zugriff699
b)Der Jedermanns-Charakter der Vorschrift als entscheidendes Argument700
c)Argumente aus der Entstehungsgeschichte701
d)Systematische Argumente mit Blick auf §§ 108 ff. StGB702
e)Der „Geist der betrieblichen Mitbestimmung“ als teleologisches Super-Gegenargument?703
3.Ergebnis und ergänzende steuerstrafrechtliche Bewertung704
IV.Untreue durch Unterstützung einer Arbeitnehmervereinigung bei ungewissem Ertrag?705 – 712
1.Verstoß gegen § 119 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG als Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht706
2.Verstoß gegen ein allgemeines Schädigungsverbot als Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht707 – 711
3.Prozessuale Lösung des BGH712
V.Ausblick: Die Effektivität der Einflussnahme zwischen Skylla der BetrVG-Straftaten und Charybdis der Untreue713 – 715
VI.Exkurs: Überhöhte Betriebsratsvergütung (der Fall Volkswagen)716 – 723
1.Ausgangspunkt716, 717
2.Überblick zum betriebsverfassungsrechtlichen Vergütungssystem718 – 721
3.Strafbarkeitsrisiken722, 723
§ 13BGHSt 57, 79: Sanktionen im Wirtschaftsstrafrecht – zugleich Einführung in das Außenwirtschaftsstrafrecht
I.Achtung Kontrolle! Der (nicht) freie Warenverkehr725 – 729
II.Die Strafvorschriften des AWG730 – 737
1.Die Reform des AWG durch das Außenwirtschaftsmodernisierungsgesetz730 – 733
2.Überblick und Systematik734 – 736
3.Einordnung des Ausgangsfalles737
III.Sanktionen im Wirtschaftsstrafrecht, insb. die Einziehung738 – 756
1.Überblick738 – 741
2.Insbesondere Voraussetzungen und Folgen der der Einziehung von Taterträgen742 – 745
3.Das Bruttoprinzip und seine Einschränkungen746 – 756
a)Einschränkungen des Bruttoprinzips nach der alten Rechtslage749 – 751
aa)Tathandlungsspezifische Bestimmung des erlangten „etwas“749, 750
bb)Die weite Auslegung des Bruttoprinzips durch den 1. Strafsenat751
b)Die „Funktionsweise“ des Bruttoprinzips nach der neuen Rechtslage752 – 756
IV.Die Lösung in BGHSt 57, 79 – altes und neues Recht757, 758
§ 14BGHSt 67, 130: Geldwäsche als Anschlusswirtschaftsdelikt und intertemporales Strafrecht – zugleich Grundzüge des Bankstrafrechts
I.Die Geldwäsche als Wirtschaftsstraftat und ihre „Bekämpfung“ durch das Strafrecht760 – 783
1.Das Beste kommt zum Schluss? Das Phänomen der Geldwäsche als Folge von Wirtschaftsdelinquenz760 – 762
2.Fundamentalkritik763 – 766
3.Überblick und Systematik767 – 769
4.Der Tatbestand des § 261 Abs. 1 S. 1 im Einzelnen770 – 783
a)Das Tatobjekt des § 261 StGB: aus einer rechtswidrigen Vortat herrührender Gegenstand771 – 776
b)Die Tathandlungen des § 261 StGB777, 778
c)Tatbestands- und Strafbarkeitsausschluss (Abs. 1 S. 2 und 3, Abs. 7)779, 780
d)Vorsatz (und Leichtfertigkeit)781
e)Tätige Reue bzw. strafbefreiende Selbstanzeige nach Abs. 8782
f)Sanktionen, insb. Einziehung nach Abs. 10783
II.Geldwäsche a.F. versus Geldwäsche n.F. – BGHSt 67, 130 und das mildere Recht784 – 799
1.Das Wirtschaftsstrafrecht als wiederkehrender Anwendungsfall intertemporaler Strafrechtsnormen784, 785
2.§ 2 StGB als Konkretisierung des Rückwirkungsverbots: Grundregel und „lex-mitior“-Prinzip786 – 790
3.Die Bestimmung des milderen Gesetzes nach dem Grundsatz strikter Alternativität791, 792
4.Die Lösung des BGH im konkreten Fall, BGHSt 67, 130793 – 799
III.Geldwäscheprävention durch das GwG und Bankstrafrecht800 – 816
1.GwG und Aufsichtssanktionen802 – 804
2.Kritik805 – 807
3.Die Straftatbestände des KWG808 – 811
4.Strafrechtliche Haftung nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)812 – 816
§ 15Überblick zum Wirtschaftsstrafverfahrensrecht
I.Grundlagen817
II.Strafverfolgungsbehörden im Wirtschaftsstrafverfahren818, 819
III.Das Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen820 – 834
1.Einleitung des Verfahrens820, 821
2.Erkenntnisquellen und Beweismittel822
3.Durchsuchung und Beschlagnahme823 – 829
4.Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO830 – 834
IV.Die Hauptverhandlung in Wirtschaftsstrafsachen835 – 839
1.Allgemeines835
2.Insbesondere die Verständigung in der Hauptverhandlung, § 257c StGB836 – 839
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere(r) Ansicht
a.E.
am Ende
a.F.
alte Fassung
abl.
ablehnend
ABl.
Amtsblatt
AEAO
Ausführungserlass zur Abgabenordnung
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der europäischen Union
AG
Aktiengesellschaft; Amtsgericht
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative(n)
AMG
Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
Art.
Artikel
ArztR
Zeitschrift für Arztrecht
AufenthG
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
Aufl.
Auflage
AÜG
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
AWG
Außenwirtschaftsgesetz
BaFin
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bayr.
Bayerisch
BB
Betriebsberater
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHSt
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BKA
Bundeskriminalamt
BörsG
Börsengesetz
BT-Drs.
Bundestagsdrucksache
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
ChemG
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen
Def.
Definition
DepotG
Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz)
ders.
derselbe
dies.
dieselbe
diff.
differenzierend
DM
Deutsche Mark
DStZ
Deutsche Steuerzeitung
EG
Europäische Gemeinschaft
EGStGB
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EGVO
Verordnung zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention
EStG
Einkommensteuergesetz
EUBestG
Gesetz zu dem Protokoll vom 27. September 1996 zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EUV
Vertrag über die Europäische Union
f./ff.
folgend(e)
FS
Festschrift
GA
Goltdammers Archiv für Strafrecht
gem.
gemäß
GenG
Genossenschaftsgesetz
GG
Grundgesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR
GmbH-Rundschau
GRUR
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
h.A.
herrschende Ansicht
h.L.
herrschende Lehre
h.M.
herrschende Meinung
HeimArbG
Heimarbeitsgesetz
HGB
Handelsgesetzbuch
HRRS
Online Zeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht
i.d.F.
in der Fassung
i.d.R.
in der Regel
i.e.S.
im engeren Sinne
i.R.d.
im Rahmen des, im Rahmen der
i.S.d./e.
im Sinne des/einer
i.Ü.
im Übrigen
i.V.m.
in Verbindung mit
i.w.S.
im weiteren Sinne
InsO
Insolvenzordnung
IntBestG
Gesetz zu dem Übereinkommen vom 17. Dezember 1997 über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr
JA
Juristische Arbeitsblätter
JR
Juristische Rundschau
Jura
Juristische Ausbildung
JuS
Juristische Schulung
JZ
Juristenzeitung
Kap.
Kapitel
KG
Kommanditgesellschaft, Kammergericht
KO
Konkursordnung
krit.
kritisch
Kriminalistik
Zeitschrift für Kriminalistik
KWG
Gesetz über das Kreditwesen
KWKG
Kriegswaffenkontrollgesetz
LFBG
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
LG
Landgericht
Lit.
Literatur
LkSG
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Lsg.
Lösung
m.a.W.
mit anderen Worten
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
MaKonV
Verordnung zur Konkretisierung des Verbotes der Marktmanipulation
MDR
Monatsschrift des Deutschen Rechts
Mio.
Millionen
MOG
Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen
MoMiG
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
MuSchG
Mutterschutzgesetz
n.F.
neue Fassung
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR
Neue Zeitschrift für Strafrecht Rechtsprechungsreport
NZWiSt
Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht
o.Ä.
oder Ähnliches
o.g.
oben genannte(s/r)
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OLG
Oberlandesgericht
OrgKG
Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität
OWiG
Ordnungswidrigkeitengesetz
PartG
Gesetz über politische Parteien
PatG
Patentgesetz
PKS
Polizeiliche Kriminalstatistik
PublG
Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen
Rn.
Randnummer
Rspr.
Rechtsprechung
S.
Seite
SchwarzArbG
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
SDÜ
Schengener Durchführungsübereinkommen
SGB
Sozialgesetzbuch
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
str.
strittig
StraFo
Strafverteidiger-Forum
StrRG
Strafrechtsreformgesetz
StV
Strafverteidiger
SubvG
Gesetz gegen die missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen
SVR
Zeitschrift für Straßenverkehrsrecht
UmwG
Umwandlungsgesetz
UStG
Umsatzsteuergesetz
u.U.
unter Umständen
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VAG
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen
VO
Verordnung
VOB/A
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A
VOL/A
Verdingungsordnung für Leistungen Teil A
WeinG
Weingesetz
WiKG
Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
WiStG
Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts
wistra
Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WM
Wertpapiermitteilungen
WpHG
Gesetz über den Wertpapierhandel
WpÜG
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
ZIS
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZJS
Zeitschrift für das Juristische Studium
ZPO
Zivilprozessordnung
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
zust.
zustimmend
ZWH
Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur
Achenbach/Ransiek/Rönnau (Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 6. Aufl. 2023 (A/R/R/Bearbeiter)
Assmann/Schneider, Wertpapierhandelsrecht, 8. Aufl. 2023 (A/S/Bearbeiter)
Brettel/Schneider, Wirtschaftsstrafrecht, 3. Aufl. 2023 (Brettel/Schneider)
Brüssow/Petri, Arbeitsstrafrecht, 3. Aufl. 2021 (Brüssow/Petri)
Fischer, Strafgesetzbuch, 72. Aufl. 2025 (Fischer)
Gercke/Kraft/Richter, Arbeitsstrafrecht, 3. Aufl. 2021 (GKR/Bearbeiter)
Göhler, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 19. Aufl. 2024 (Göhler/Bearbeiter, OWiG)
Graf/Jäger/Wittig, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2024 (G/J/W/Bearbeiter)
Hellmann, Wirtschaftsstrafrecht, 6. Aufl. 2023 (Hellmann)
Hellmann, Fälle zum Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl. 2023 (Hellmann, Fälle)
von Heintschel-Heinegg/Kudlich (Hrsg.), BeckOK StGB, 63. Edition 2024 (BeckOK-StGB/Bearbeiter)
Herzog, Geldwäschegesetz, 5. Aufl. 2023 (Herzog/Bearbeiter)
Hilgendorf/Kudlich/Valerius (Hrsg.), Handbuch des Strafrechts, 2019 ff. (HStrR/Bearbeiter, Band)
Joecks/Jäger/Randt, Steuerstrafrecht, 9. Aufl. 2023 (Joecks/Jäger/Randt/Bearbeiter)
Karlsruher Kommentar, Ordnungswidrigkeitengesetz, 5. Aufl. 2018 (KK-OWiG/Bearbeiter)
Kett-Straub/Kudlich, Sanktionenrecht, 2. Aufl. 2021
Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017 (Kühl AT)
Lackner/Kühl/Heger, Strafgesetzbuch, 30. Aufl. 2023 (Lackner/Kühl/Heger)
Leipziger Kommentar, Strafgesetzbuch, 12. Aufl. 2007 ff.; 13. Aufl. 2019 ff. (LK/Bearbeiter)
Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, Besonderer Teil, Teilband 1, 11. Aufl. 2019 (Maurach/Schroeder/Maiwald)
Momsen/Grützner, Wirtschaftsstrafrecht, 2. Aufl. 2020
Müller-Gugenberger (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht, 8. Aufl. 2024 (M-G/Bearbeiter)
Münchener Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2024 (MK-StGB/Bearbeiter)
Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 2023 (NK/Bearbeiter)
Otto, Grundkurs Strafrecht – Die einzelnen Delikte, 7. Aufl. 2004 (Otto)
Park (Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, 6. Aufl. 2024 (Park/Bearbeiter)
Rengier, Strafrecht Besonderer Teil I, 26. Aufl. 2024 (Rengier BT I)
Rolletschke, Steuerstrafrecht, 5. Aufl. 2021 (Rolletschke)
Roxin/Greco, Strafrecht Allgemeiner Teil Band 1, 5. Aufl. 2020 (Roxin AT I)
Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil Band 2, 2003 (Roxin AT II)
Satzger/Schluckebier/Werner (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 2024 (SSW/Bearbeiter)
Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 30. Aufl. 2019 (Sch/Sch/Bearbeiter)
Schröder, Kapitalmarktstrafrecht, 5. Aufl. 2025 (Schröder, Kapitalmarktstrafrecht)
Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik, 24. Aufl. 2021 (Schwind)
Streng, Strafrechtliche Sanktionen – Die Strafzumessung und ihre Grundlagen, 3. Aufl. 2012
Thüsing (Hrsg.), Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 4. Auf. 2018 (Thüsing/Bearbeiter)
Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, 5. Aufl. 2017 (Tiedemann)
Wabnitz/Janovsky, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 6. Aufl. 2025 (W/J/S/Bearbeiter)
Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil, 54. Aufl. 2024 (Wessels/Beulke/Satzger)
Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Strafrecht Besonderer Teil 2, 46. Aufl. 2023 (Wessels/Hillenkamp/Schuhr)
Wittig, Wirtschaftsstrafrecht, 6. Aufl. 2023 (Wittig)
1. TeilEinführung
§ 1Begriff des Wirtschaftsstrafrechts und kriminologische Grundlagen
Literatur:Tiedemann, Rn. 27-86; ders. JuS 1989, 689 ff.; Wittig, § 1-3; W/J/S/Dannecker/Bülte 1. Kap.; Achenbach, Jura 2007, 342 ff.; Montenbruck, JuS 1987, 713 ff.; Otto, ZStW 96 (1984), 339 ff.; Volk, JZ 1982, 85 ff.; Wenzl, WiStra 2024, 51
I.Begriff des Wirtschaftsstrafrechts
1.Problemstellung
1
Im deutschen Recht gibt es kein Gesetz, welches alle Straftatbestände des Wirtschaftsstrafrechts abschließend zusammenfasst und so als Definition für den Begriff des „Wirtschaftsstrafrechts“ herangezogen werden könnte. Ein Blick in das insoweit verheißungsvoll klingende WiStG (genauer: das Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts von 1954) verrät, dass diese Vorschriftensammlung nur ein kleinflächiges, in der Praxis eher unbedeutendes Teilgebiet des Wirtschaftsstrafrechts zum Gegenstand hat, nämlich Preisregulierungen (z.B. Mietpreisüberhöhungen), Konkretisierungen des Wucherstrafrechts und Regelungen zur Marktordnung.[1] Das Fehlen eines einheitlichen Gesetzes ist darauf zurückzuführen, dass viele Straftatbestände des Wirtschaftsstrafrechts in unmittelbarem Bezug zu außerstrafrechtlichen Regelungen stehen, weswegen die jeweilige Strafvorschrift meist innerhalb der zivil- bzw. öffentlich-rechtlichen „Hauptmaterie“ platziert wird.[2] Man spricht insofern auch von der Akzessorietät wirtschaftsstrafrechtlicher Tatbestände.[3] Diese Akzessorietät führt nicht nur zu Besonderheiten hinsichtlich der Ausgestaltung der Straftatbestände (vgl. Rn. 44 ff.), sondern mitunter auch dazu, dass eine Anwendung der strafrechtlichen Vorschriften häufig außerstrafrechtliche Spezialkenntnisse aus dem jeweiligen Rechtsgebiet erfordert.[4] Das Wirtschaftsstrafrecht ist somit oftmals im sog. Nebenstrafrecht verortet.[5] Andererseits gibt es auch Vorschriften, die im Kernstrafrecht – also im StGB selbst – zu finden sind, aber gerade im Wirtschaftsleben eine entscheidende Rolle spielen, so etwa der Betrug gem. § 263 Abs. 1 StGB oder die Untreue gem. § 266 StGB.
2
Dies alles führt dazu, dass wirtschaftsstrafrechtliche Straftatbestände über verschiedenste Rechtsgebiete und Regelungsmaterien zerstreut sind und der Begriff des „Wirtschaftsstrafrechts“ somit nicht aus einem abgeschlossenen Regelwerk heraus definiert werden kann. Hinzu kommt, dass wirtschaftsrechtliche Sachverhalte meist komplex strukturiert sind, so dass sie nicht immer mit einem einfachen Straftatbestand erfasst werden können. Die Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität divergieren aufgrund der permanenten technischen und wirtschaftlichen Veränderungen in einer hochindustrialisierten Gesellschaft ständig, so dass auch der Begriff des Wirtschaftsstrafrechts laufend in Bewegung bleibt. Als Wirtschaftsstrafrecht im weiteren Sinn ließe sich die Pönalisierung von Verstößen gegen Regelungen der Wirtschaftslenkung verstehen, die sich im Laufe der Geschichte (zurückreichend bis ins römische Recht) immer weiter fortentwickelte und gerade in Krisenzeiten als Regulierungsinstrument für das Wirtschaftswesen[6] fungieren sollte.[7] Dies wäre allerdings mehr eine Beschreibung als eine exakte Definition.
3
In der Literatur werden unterschiedliche Ansätze zur Definition des Wirtschaftsstrafrechts beschritten:[8] Anknüpfungspunkte sind hierbei zum einen kriminologische (vgl. im Folgenden 2.), zum anderen aber auch gesetzessystematische (sodann 3.) bzw. schutzgutorientierte (abschließend 4.) Aspekte:
2.Begriffsbestimmung aus kriminologischer Sicht
4
Ein klassisch-kriminologischer Ansatzpunkt zieht Auffälligkeiten bezüglich des Täterkreises und der Art der Tatbegehung für die Begriffsbestimmung heran: Zu dieser täterbezogenen Klassifizierung gehört der von Sutherland eingeführte und geprägte Begriff der „white collar criminality“ (Weißer-Kragen-Kriminalität), wonach Wirtschaftsstraftäter Personen mit Ansehen und hohem sozialen Status sind, welche die Straftat im Rahmen ihrer Berufsausübung begehen.[9]
Eine täterorientierte Begriffsbestimmung ist im Hinblick auf das Prinzip des Tatstrafrechts nicht unproblematisch.[10] Eine Definition sollte sich am gesetzlichen Tatbestand bzw. an der gesetzlich formulierten Tatbegehung orientieren. Berücksichtigt man aber, dass wirtschaftsstrafrechtliche Tatbestände oftmals auf besondere Eigenschaften des Täters abstellen, mithin als „echte Sonderdelikte“ ausgestaltet sind, sind zumindest diese Bedenken etwas entkräftet.
5
Dieser Begriff ist indes zunächst zu eng, da er nur einen bestimmten sozialen Täterkreis erfasst. Erweitert man den Ansatz Sutherlands etwas und bezieht den Umstand ein, dass Wirtschaftsstraftaten typischerweise im Rahmen der Berufsausübung begangen werden („occupational crime“), geht man wiederum zu weit, weil jede Straftat in Ausübung eines Berufes erfasst wäre; überspitzt formuliert würde dann die Tötung eines Patienten durch einen Arzt zum Wirtschaftsstrafrecht gehören. Möglich wäre es, in einem weiteren Schritt das „Berufsfeld“ zu konkretisieren und Wirtschaftsstrafrecht als „corporate crime“ (Verbandsstrafrecht) zu bezeichnen, nämlich im Hinblick darauf, dass Wirtschaftsstraftaten meist im Zusammenhang mit einer Tätigkeit in einem Unternehmen begangen werden. Solch ein Ansatz, der letztlich nur den Firmensitz juristischer Personen (genauer Körperschaften des Zivilrechts) als potentiellen „Tatort“ des Wirtschaftsstrafrechts ansieht, ist wiederum zu eng.
Ein weiterer kriminologischer Begriff, der aber nicht für eine Begriffsdefinition heranzogen werden kann,[11] sondern einen speziellen Erklärungsansatz für Wirtschaftskriminalität als solche bildet, ist der des „homo oeconomicus“: Dieser Ansatz geht von der These aus, dass der stets auf Profit ausgerichtete Mensch der Neuzeit immer dann zum Straftäter wird, wenn der erwartete Nutzen aus der Straftat höher ist als der Nutzen aus einer legalen Tätigkeit. Der Staat müsse sich daher dazu berufen fühlen, eine Straftat so „teuer“ wie möglich zu machen und selbst hierbei die Regeln der Wirtschaftlichkeit (also insbesondere im Rahmen der Strafverfolgung) zu berücksichtigen.[12]
3.Strafprozessual-kriminaltaktische Begriffsbildung des § 74c GVG
6
Eine Definition könnte auch anhand der prozessualen Zuständigkeit landgerichtlicher Wirtschaftsstrafkammern gebildet werden.[13]
§ 74c Abs. 1 GVG lautet:
(1) 1Für Straftaten
1.
nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz, dem Halbleiterschutzgesetz, dem Sortenschutzgesetz, dem Markengesetz, dem Designgesetz, dem Urheberrechtsgesetz, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, der Insolvenzordnung, dem Aktiengesetz, dem Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen, dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, dem Handelsgesetzbuch, dem SE-Ausführungsgesetz, dem Gesetz zur Ausführung der EWG-Verordnung über die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, dem Genossenschaftsgesetz, dem SCE-Ausführungsgesetz und dem Umwandlungsgesetz,
2.
nach den Gesetzen über das Bank-, Depot-, Börsen- und Kreditwesen sowie nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz, dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz,
3.
nach dem Wirtschaftsstrafgesetz 1954, dem Außenwirtschaftsgesetz, den Devisenbewirtschaftungsgesetzen sowie dem Finanzmonopol-, Steuer- und Zollrecht, auch soweit dessen Strafvorschriften nach anderen Gesetzen anwendbar sind; dies gilt nicht, wenn dieselbe Handlung eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz darstellt, und nicht für Steuerstraftaten, welche die Kraftfahrzeugsteuer betreffen,
4.
nach dem Weingesetz und dem Lebensmittelrecht,
5.
des Subventionsbetruges, des Kapitalanlagebetruges, des Kreditbetruges, des Bankrotts, der Verletzung der Buchführungspflicht, der Gläubigerbegünstigung und der Schuldnerbegünstigung,
5a.
der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen, der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr sowie der Bestechlichkeit im Gesundheitswesen und der Bestechung im Gesundheitswesen,
6.
a)
des Betruges, des Computerbetruges, der Untreue, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt, des Wuchers, der Vorteilsannahme, der Bestechlichkeit, der Vorteilsgewährung und der Bestechung,
b)
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, dem EU-Finanzschutzstärkungsgesetz und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
soweit zur Beurteilung des Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind,
ist, soweit nach § 74 Abs. 1 als Gericht des ersten Rechtszuges und nach § 74 Abs. 3 für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung gegen die Urteile des Schöffengerichts das Landgericht zuständig ist, eine Strafkammer als Wirtschaftsstrafkammer zuständig. 2Die §§ 120 und 120b bleiben unberührt.
§ 74c GVG stellt einen Katalog von Straftaten auf, die als Wirtschaftsstraftaten angesehen werden,[14] wobei eine Einteilung in zwei Gruppen vorgenommen werden kann:
7
Während in den Nummern 1-5a spezifische Wirtschaftsdelikte aufgezählt werden, bei denen das Vorliegen einer Wirtschaftsstraftat und somit die Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer unwiderlegbar vermutet wird (sog. geborene Wirtschaftsstraftatbestände), sind in Nummer 6 allgemeine Straftatbestände genannt, die zur Wirtschaftskriminalität zählen, wenn „zur Beurteilung des Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind“ (sog. gekorene Wirtschaftsstraftatbestände). Damit sind insbesondere komplizierte, schwer zu durchschauende Mechanismen des Wirtschaftslebens gemeint, deren raffinierter Missbrauch Wirtschaftsstrafsachen kennzeichnet (Umgehungs- und Scheinhandlungen in der wirtschaftsrechtlichen „Grauzone“, vgl. noch Rn. 101 ff.).[15]
8
Eine exakte Definition der Wirtschaftskriminalität enthält § 74c GVG jedoch nicht, sondern setzt diese allenfalls voraus. Wenigstens sind der Vorschrift Indizien zu entnehmen, die für eine Definition verwertet werden können. So lässt der (nicht abschließende) Katalog bereits erahnen, dass im Wirtschaftsstrafrecht nicht allein das Vermögen geschützt wird, was für eine rechtsgutorientierte Begriffsbestimmung von entscheidender Bedeutung ist. Exemplarisch seien die nach § 74c Abs. 1 Nr. 4 GVG einbezogenen Vorschriften des Wein- oder Lebensmittelgesetzes (§ 48 WeinG) genannt, die nicht nur Vermögensinteressen der Weinlieferanten- und Produzenten schützen sollen, sondern auch Leben und Leib der Konsumenten im Auge haben.[16] Ähnliches gilt für Embargoverstöße gegen §§ 17 Abs. 1, 18 Abs. 1 AWG, die den Schutz des „Weltfriedens“ bezwecken.
4.Begriffsbestimmung aus rechtsdogmatischer/rechtsgutorientierter Sicht
9
Verfolgt man diesen Rechtsgutsgedanken weiter und versucht, den Begriff des Wirtschaftsstrafrechts unter Rückgriff auf das geschützte Schutzgut zu bestimmen, gelangt man zu dem Folgeproblem, was unter dem Begriff der „Wirtschaft“ zu verstehen sein soll, der den Anknüpfungspunkt für ein etwaiges Rechtsgutskonzept bilden müsste.[17]
10
Ein weites Verständnis dahingehend als jeder Angriff auf Rechtsgüter, der in irgendeiner Weise einen wirtschaftlichen Bezug aufweist, wäre unergiebig: Der Begriff der Wirtschaft „generell“ erfasst nämlich die Gesamtheit aller Einrichtungen, wie Unternehmen, private und öffentliche Haushalte, und wirtschaftlichen Handlungen, die der planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs dienen, wozu insbesondere die Herstellung, der Verbrauch und die Verteilung von Gütern zählen. Legt man eine solche Interpretation zu Grunde, würde jede vermögensrechtliche Strafvorschrift unter die Definition des Wirtschaftsstrafrechts fallen, insbesondere wären auch allgemeine Eigentums- und Vermögensdelikte wie der Diebstahl gem. § 242 StGB und der unbefugte Gebrauch eines Fahrzeugs gem. § 248b StGB erfasst.
11
Konkretisieren ließe sich der wirtschaftsstrafrechtliche „Schutzbereich“ durch eine Eingrenzung auf funktionell wichtige Zweige bzw. Einrichtungen der Volkswirtschaft; man könnte insofern vom Wirtschaftsverwaltungsstrafrecht sprechen, das neben den abstrakten Kollektivrechtsgütern (wie die Chancengleichheit im Wertpapierhandelswesen oder den Schutz des Kreditwesens, vgl. § 74c Abs. 1 Nr. 2 GVG) auch die Instrumente des Wirtschaftsverkehrs als Schutzobjekte erfasst (Buchführung und Bilanz, vgl. §§ 331 ff. HGB, EDV und bargeldloser Zahlungsverkehr, vgl. §§ 202a, 263a, 146, 151 f., 266b, 269, 303a, 303b StGB). Diesem sehr umfassenden Begriff fehlt lediglich die Einbeziehung von Individualinteressen: Der Schutz des Einzelnen (Verbraucher, Konkurrent) kommt in vielen Tatbeständen mit wirtschaftsrechtlichem Bezug zum Vorschein, so dass im Wege einer Synthese aller angestellten Überlegungen folgende (im Einzelnen sicherlich modifizierbare) Definition des Wirtschaftsstrafrechts festgehalten werden kann:
12
Wirtschaftsstrafrecht ist die Gesamtheit der Straftaten (und Ordnungswidrigkeiten), die bei wirtschaftlicher Betätigung unter Missbrauch des im Wirtschaftsleben notwendigen Vertrauens begangen werden und nicht nur eine individuelle Schädigung herbeiführen, sondern auch Belange der Allgemeinheit (Kollektivrechtsgüter) berühren.
13
Entscheidend sind somit folgende drei Aspekte, die zumindest gedanklich „durchgeprüft“ werden sollten, wenn die Frage aufgeworfen wird, ob eine bestimmte Norm bzw. ein konkreter Sachverhalt wirtschaftsstrafrechtlicher Natur ist:
•
Vorliegen eines wirtschaftlichen Bezugs des strafbaren Verhaltens,
•
Ausübung eines Berufes,
•
Ausnutzen bzw. Missbrauch des Vertrauens gegenüber dem Wirtschaftsverkehr.
14
Was als Wirtschaftsstrafrecht bezeichnet werden kann, ist somit in hohem Grade systemabhängig. Bestand und Reichweite systemschützender Strafvorschriften hängen davon ab, welches System (freie Marktwirtschaft, Kapitalismus) überhaupt gilt.[18] Daneben existieren allerdings auch Verhaltensweisen, die gänzlich unabhängig von einem bestimmten Wirtschaftssystem sind (etwa Betrügereien im Rahmen des elektronischen Zahlungsverkehrs).
Beispiel: Im sog. Wirecard-Skandal wird dem ehemaligen Zahlungsdienstleister Wirecard vorgeworfen, durch Bilanzmanipulationen in großem Umfang Anleger getäuscht zu haben, die aufgrund der vermeintlichen guten Geschäftsergebnisse Wirecard-Aktien gekauft haben. Allerdings ist es in diesem Fall nicht bei der betrügerischen Täuschung einzelner Anleger geblieben: Schon die große Zahl an Geschädigten und die hohen Summen, über deren Existenz getäuscht worden ist, zeigen ein besonderes Ausmaß und eine Art von Systemrelevanz der Täuschung. Hinzu kommt, dass der Skandal geeignet ist, das Vertrauen in den Kapitalmarkt allgemein zu erschüttern. Auch die systematische Täuschung der für die Abschlussprüfungen zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch das Wirecard-Management tangiert das Wirtschaftssystem, in welchem die Abschlussprüfung großer Gesellschaften eine wichtige Rolle spiel, insgesamt.
[Bild vergrößern]
II.Phänomenologie des Wirtschaftsstrafrechts (kriminologische Grundlagen)
15
Das Wirtschaftsstrafrecht unterscheidet sich von anderen Kriminalitätsarten sowohl in personeller als auch tatbezogener Hinsicht. Dies wirkt sich auch auf die polizeiliche Kriminalstatistik aus und bildet sich überdies in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Einschätzung des Phänomens aus.
1.Personenbezogene Charakteristika des Wirtschaftsstrafrechts
16
Im Vergleich zu anderen Kriminalitätsarten weicht der Wirtschaftsstraftäter vom typischen Täterprofil ab: Oft handelt es sich um Personen mit Bildung und hohem Status. Der Wirtschaftsstraftäter hat ein gesundes Sozialleben, ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und beruflich selbstständig. Das Bild vom „white collar crime“-Täter wird hier bestätigt.[19] Nach Untersuchungen stammen rund ein Viertel der wirtschaftsstrafrechtlich in Erscheinung getretenen Täter aus dem Kreis des Topmanagements von Unternehmen (wobei in Deutschland die Quote sogar bei 32 % liegt).[20] Nicht selten werden die Delikte von Beschäftigten juristischer Personen, sonstiger bürokratischer Organisationen oder Verbänden begangen (man rufe sich den Begriff des „occupational crime“ in Erinnerung). Wirtschaftsstrafrecht ist oft von Anonymität zwischen Täter und Opfer geprägt, was tendenziell zu einer niedrigeren Hemmschwelle führt. Hat der Täter kein konkretes Opfer vor sich, fehlt ihm auch das Unrechtsbewusstsein, wobei sich dieser Effekt mit wachsender Größe des Unternehmens, sprich wachsender Anonymität, verstärkt. Die personelle Distanz zwischen Täter und Opfer wird auch durch den statistischen Befund bestätigt, wonach weniger als 10 % der registrierten Wirtschaftsstrafrechtssachverhalte auf Strafanzeigen der Opfer zurückgehen. Bemerkenswert ist, dass trotz des relativ kleinen Täterkreises hohe Zahlen von Einzelfällen und Geschädigten registriert werden.
2.Tatbezogene Charakteristika des Wirtschaftsstrafrechts
17
Typisch für das Wirtschaftsstrafrecht sind die komplexen und schwer aufzudeckenden Sachverhalte, in denen (ggf. als Folge neuer Geschäftsideen) immer wieder neue Phänomene und Fragen auftreten.[21] Das arbeitsteilige Vorgehen[22] und Verteilen der strafrechtlich relevanten Handlungen auf verschiedene Ebenen führen dazu, dass eine Rekonstruktion des Sachverhalts für die ermittelnden Behörden im Einzelfall äußerst schwierig ist. Das Auseinanderfallen von Ausführungstätigkeiten, Informationsbesitz und Entscheidungsmacht eröffnet gerade in Großunternehmen „verlockende“ Verschleierungsmöglichkeiten. Den Tätern stehen aufgrund ihres hohen sozialen Status auch moderne Technologien und kostspielige Instrumente zur Verfügung, die sie für die Deliktsbegehung bzw. für die Verheimlichung ihrer illegalen Tätigkeit missbrauchen können. Bei schwerer Wirtschaftskriminalität treten internationale Verflechtungen und Beziehungen zur organisierten Kriminalität hinzu.[23] Vor allem im Bereich der Finanzdelikte intensivieren globale Kontakte die Verdunkelungsgefahr, zumal die Zuständigkeit der Ermittlungsbehörden meist nur bis zur innerstaatlichen Grenze reicht.[24]
18
Wirtschaftsstraftaten führen in der Regel zu einer herausragenden Schadenshöhe[25]: Nach Untersuchungen entstehen mittelständischen Unternehmen mit bis zu 1000 Beschäftigten finanzielle Verluste bis zu 11 % (mehr als 1 Million €). Bei größeren Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten liegt die Quote sogar bei 31 %.[26] Nicht zu unterschätzen ist auch der immaterielle Schaden in Form des Reputationsverlusts, soweit es zur Aufdeckung einer Straftat kommt.
In Bezug auf Wirtschaftsstraftaten wird auch oft auf die sog. „Sogwirkung“ hingewiesen, wonach ein Unternehmen (etwa im Bereich der Korruption) faktisch dazu gezwungen werde, zu den gleichen kriminellen Methoden zu greifen wie seine Konkurrenten. Empirisch ist dies allerdings noch nicht nachgewiesen. Ähnliches gilt für die „Spiralwirkung“ von Wirtschaftsdelikten, wonach Wirtschaftskriminalität zu weiterer Kriminalität Dritter führe (Urkundenfälschung, Ausspähen von Daten etc.).[27]
3.Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts in der Praxis und polizeiliche Kriminalstatistik
19
Mit dem Stichwort „Aufdeckung“ ist man im Wirtschaftsstrafrecht an einen Punkt gelangt, der ebenfalls Besonderheiten mit sich bringt. Kriminologisch ist v.a. im Rahmen statistischer Befunde stets zu berücksichtigen, dass es sich bei Wirtschaftsstraftaten um sog. Kontrolldelikte handelt. Sowohl staatlich als auch innerbetrieblich wird großer Wert auf kontinuierliche und gründliche Kontrollen gelegt. Die Überprüfung und Kontrolle erfolgt hierbei durch spezialisierte Behörden (z.B. das Gewerbeaufsichtsamt, das Finanzamt als Steuerfahnder, die Zollbehörden[28] sowie das Bundesaufsichtsamt für Wertpapierhandel). Sogar das Ermittlungsverfahren ist sog. Schwerpunktstaatsanwaltschaften, in Steuerstrafverfahren gem. § 386 AO den Finanzbehörden überlassen.[29]
Mit Entstehung der Wirtschaftsstrafkammern hat sich auch nach und nach das Pendant der Schwerpunktstaatsanwaltschaft herausgebildet (erstmals im Jahre 1968 in Nordrhein-Westfalen), die fast ausschließlich mit der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten befasst ist und sich durch fachkundige Wirtschaftsreferenten unterstützen lässt.
20
Diese Kontrolldichte führt dazu, dass viele Straftaten erst gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen, da die Betriebsleiter einen Imageverlust vermeiden wollen und daher lediglich arbeitsrechtliche bzw. disziplinarrechtliche Schritte einleiten. Die ständige Überprüfung erschwert auch Aussagen über das Dunkelfeld. Schließlich könnte man meinen, dass gerade aufgrund der ständigen Überprüfung die Aufklärungsquote sehr hoch ist. Anderseits könnte gerade die Notwendigkeit ständiger Kontrollen ein Indiz für eine hohe Dunkelziffer sein („Kontroll-Paradox“).
21
Eine statistische Verzerrung ergibt sich auch aus dem Umstand, dass die Ermittlungsbehörden oftmals (im Wege von „Vor“-Urteilsabsprachen) mit außerstrafrechtlichen Instrumenten, sprich Auflagen, Weisungen etc. arbeiten und somit viele tatsächlich begangene Wirtschaftsdelikte erst gar nicht angeklagt werden.[30] Dies mag auf die komplexen und umfangreichen Sachverhalte zurückzuführen sein, bei denen bereits die Schadensermittlung Schwierigkeiten mit sich bringt.[31]
22
Da die Schwerpunktstaatsanwaltschaften auch nicht immer die Polizei beteiligen, werden viele dieser Fälle nicht von der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst. Dennoch lassen sich der PKS einige kriminologisch bzw. kriminalistisch verwertbare Tendenzen zum Wirtschaftsstrafrecht entnehmen:
•
Dominant ist der Betrug gem. § 263 StGB, dessen Anteil von 1997 bis 2002 zwischen 58-68 % ausmachte, in der Folgezeit bis 2018 aber auf 46 % der Wirtschaftsstraftaten[32] zurückging (was auf die veränderte bzw. „modernisierte“ Tatbegehung zurückzuführen sein mag, bspw. in Form des EC-Karten Betrugs, der nach § 263a StGB strafbar ist).
•
Die Delinquenz steigt bei Zusammenhängen mit Arbeitsverhältnissen.
•
Die Schätzungen zu den materiellen Schäden bezogen auf Hell- und Dunkelfeld schwanken zwischen 5 und 28 Milliarden Euro.
4.Wirtschaftsstrafrecht zwischen „Klassenstrafrecht“ und modernem Ostrakismos[33]
23
Die Wahrnehmung von Wirtschaftsstraftaten und auch des Umgangs der Strafverfolgungsbehörden mit ihnen[34] scheint in den letzten Jahrzehnten einen beachtenswerten Wandel vollzogen zu haben: Obwohl auch heute noch manche Wirtschaftsstraftaten (z.B. Steuerhinterziehung, jedenfalls in nicht erheblichen Größenordnungen) als „Kavaliersdelikt“ angesehen werden, mit denen man am Stammtisch eher einmal zu prahlen geneigt ist als mit einem begangenen Raubüberfall oder einer sexuellen Nötigung, scheint sich die gesellschaftliche Wahrnehmung der Wirtschaftsstraftäter insgesamt verschoben zu haben. Mit dieser Verschiebung korrespondiert auch die größere praktische Bedeutung im Sinne einer vermehrten Verfolgung[35] solcher Taten. Während früher Unternehmer, die eine gefestigte soziale Stellung hatten und für Arbeitsplätze und Aufschwung verantwortlich waren vielfach mehr oder weniger „sakrosankt“ gewesen zu sein schienen, wird wirtschaftliches Handeln noch heute in einer Intensität strafrechtlich kontrolliert, dass man sich mitunter durchaus die Frage stellen darf, ob es richtig ist, wenn der Strafrichter ex post den Ausgang komplexer wirtschaftlicher Entscheidungen beurteilen soll bzw. will, die er in der Rolle des Unternehmers ex ante niemals hätte treffen können.
24
Von daher wird man zumindest heutzutage auch seriöserweise nicht (mehr) den Vorwurf einer „Klassenjustiz“[36] erheben können, wenn ein Manager beim Verdacht der Untreue im Millionenbereich letztlich mit einer Verfahrenseinstellung nach § 153a StPO gegen Geldauflage[37] oder jedenfalls mit einer Bewährungsstrafe[38] „davonkommt“. Von „Klassenjustiz“ kann schon deshalb nicht gesprochen werden, weil eine Vielzahl von (Ermittlungs-)Verfahren letztlich mit Verfahrenseinstellungen oder jedenfalls ohne vollstreckbare Freiheitsstrafe enden, und zwar quer durch alle Kriminalitätsbereiche. Hinzu kommt, dass die Beschuldigten in Wirtschaftsstrafverfahren durch die öffentliche Berichterstattung[39] oft ungleich schwerer getroffen werden als „anonyme“ Straftäter und dass es sich vielfach um Vorwürfe handelt, die a priori überhaupt nur einen bestimmten, in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden Personenkreis treffen können: So kann etwa nur derjenige, der (in nicht unerheblichem Umfang) Steuern zu bezahlen hat, auch nennenswert Steuern hinterziehen; nur derjenige, der Arbeitgeber ist, kann Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung vorenthalten etc. Nimmt man weiter in den Blick, wie etwa in den letzten Jahren eine Korruptionshypertrophie (um nicht zu sagen: Korruptionshysterie) um sich gegriffen hat, die dazu führt, dass viele Formen des „Anstands“ (z.B. das Glas Wasser oder die Tasse Kaffee für den Außenprüfer des Finanzamtes) unter Generalverdacht gestellt werden, liegt der Vorwurf eines Wirtschaftsstrafrechts als „Klassenjustiz“ kaum näher[40] als das umgekehrte Bild einer „Scherbengerichtsbarkeit“,[41] mit der in einer Neidgesellschaft wirtschaftlich erfolgreiche Personen unter Kontrolle gehalten werden sollen.
III.Rechtsquellen und Entwicklung des Wirtschaftsstrafrechts in Deutschland
25
Wie bereits erläutert, sind die einschlägigen Normen des Wirtschaftsstrafrechts nicht in einem Gesetzeswerk zusammengefasst, sondern verteilt im Kern- sowie Nebenstrafrecht zu finden. Nicht selten basiert das inländische Recht auf internationalen Vereinbarungen (wie bspw. das EUBestG) bzw. Vorgaben der EU (vgl. im Folgenden).
Nicht gänzlich unerwähnt bleiben soll ein Alternativentwurf des StGB von 1977, der das geltende Wirtschaftsstrafrecht unter der Überschrift „Straftaten gegen die Wirtschaft“ zusammenfasste.[42] Solch ein System bringt den Vorteil mit sich, möglichst viele Wirtschaftsstraftaten „auf einen Blick“ erfassen zu können, zumal eine Regelung im Kernstrafrecht eine stärkere Signalwirkung haben kann (Stichwort „Generalprävention“). Problematisch daran ist aber, dass die Strafvorschriften aus ihrem Zusammenhang gerissen werden und man – soweit man kein 12.000 Seiten langes StGB haben will – innerhalb der Vorschriften auf andere Gesetze verweisen muss (sog. „Blanketttechnik“, siehe Rn. 54 ff.).
26
Orientiert man sich am Begriff des Unternehmens[43] und dessen Beziehungen zur „Umwelt“, lassen sich die wesentlichen Gesetzesblöcke des Wirtschaftsstrafrechts wie folgt zusammenfassen:[44]
[Bild vergrößern]
1.Vorschriften im Kernstrafrecht
27
Zunächst seien die „traditionellen“ und auch praktisch bedeutsamen Wirtschaftsstraftatbestände des Betrugs gem. § 263 StGB[45] und der Untreue gem. § 266 StGB[46] genannt, die auch als „Vorreiter“ des Wirtschaftsstrafrechts bezeichnet werden können. Das praktisch eher unbedeutende Wirtschaftsstrafgesetz von 1954 wurde bereits genannt. Das erste Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 29.7.1976 ergänzte das StGB um den Subventions- und Kreditbetrug, §§ 264, 265b StGB, welche die Strafbarkeit durch Verzicht auf schwer nachweisbare Merkmale (insbesondere den Eintritt eines Vermögensschadens) vorverlagern.[47] Hinzu kam das vorher in der Konkursordnung geregelte „Insolvenzstrafrecht“[48], §§ 283-283d StGB, und der Individualwucher, § 291 StGB, wobei die Gelegenheit auch zur Neufassung des Erschleichens von Leistungen, § 265a StGB, genutzt wurde. Nicht zu vergessen ist die Geldwäsche als zentrales Wirtschafts-Anschlussdelikt, die in den letzten Jahren mehrmals reformiert und erweitert wurde.[49]
28
Durch das 18. Strafrechtsänderungsgesetz vom 28.3.1980 wurde das Umweltstrafrecht (§§ 324 ff. StGB) in das StGB eingefügt, das mit dem 45. StrRÄndG nochmals umfassend reformiert und den europäischen Vorgaben (vgl. im Folgenden) angepasst wurde.[50] Mit dem zweiten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 15.5.1986 folgten weitere Ergänzungen (§§ 263a, 269, 270, 303a, 303b, 202a, 152a, 266b StGB), wobei auch verschiedene Vorschriften über die Beitragshinterziehung in § 266a StGB zusammengeführt wurden.[51] Am 13.8.1997 folgte das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, das die §§ 331 ff. StGB umfassend reformierte, insbesondere nun angebotene Vorteile erfasste, die nicht für eine „konkrete Diensthandlung“ angenommen wurden.[52] Schließlich wurden auch die Vorschriften zu Bestechung bzw. Bestechlichkeit im privaten Sektor in das StGB aufgenommen, §§ 299 ff. StGB (früher § 12 UWG a.F.),[53] die im Jahr 2016 durch § 299a StGB gegen die Bestechlichkeit im Gesundheitswesen ergänzt wurden. 2017 erfolgte die Einführung einer speziellen Strafbarkeit des Sportwettbetrugs sowie der Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben in §§ 265c, 265d StGB.[54]
2.Gesetzesblöcke im Nebenstrafrecht
29
Weitere Rechtsquellen des Wirtschaftsstrafrechts finden sich in zahlreichen Nebengesetzen, die vorliegend nicht abschließend dargestellt werden können.[55] Allerdings seien im Voraus einige bedeutsame Gesetzesblöcke genannt, die vergleichsweise häufiger eine Rolle spielen können.
30
Hierzu zählt zunächst das Finanzstrafrecht, das sich seinerseits in zwei Gruppen aufteilen lässt. Die erste Gruppe ist das in den §§ 370 ff. AO geregelte Abgabenstrafrecht, welches sich auf Steuern, Zölle und Abschöpfungen bezieht und somit auch den praktisch besonders wichtigen Tatbestand der Steuerhinterziehung enthält.[56] Bei der anderen Gruppe handelt es sich um das Ausgabenstrafrecht, das insbesondere das Erschleichen staatlicher Subventionen und Kreditbetrügereien erfasst, welches aber im Kernstrafrecht geregelt ist, vgl. § 264 StGB.[57]
31
Der strafrechtliche Schutz des Kapitalmarkts erfolgt durch das Börsen- sowie Wertpapierhandelsgesetz vom 26.7.1994. Zu nennen sind hier der strafbare Insiderhandel oder die Kursmanipulationen, welche nach § 119 WpHG strafbar sind.[58]
32
Das Bilanzstrafrecht in den §§ 331 ff. HGB wird durch zahlreiche Spezialvorschriften im AktG, GmbHG sowie GenG ergänzt, die ihrerseits auch das Strafrecht der Kapitalgesellschaften beinhalten (wobei sich die Vorschriften strukturell ähneln und teilweise gemeinsam geltende Vorschriften in der InsO zu finden sind).[59] Infolge zahlreicher Bank- und Finanzkrisen hat auch die Relevanz der Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften des KWG (§§ 54 ff.) sowie des ZAG (§§ 63 ff.) zugenommen, die sich unter den Begriff des Bankstrafrechts fassen lassen.[60]
33
Das Wettbewerbsstrafrecht





























