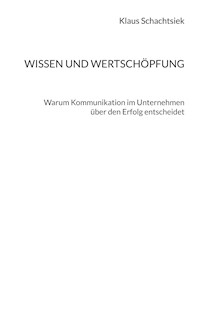
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch geht es um die Frage, wie ein Unternehmen Know-how verwertet, also wie unser Wissen zu Wertschöpfung wird. Kooperation und Kommunikation der Akteure stehen dabei im Mittelpunkt. Die Kernaussagen sind: - Qualität der Kommunikation bestimmt das operative Geschäft. Mangelnde Kommunikation bewirkt Reibungsverluste. Herkömmliche Maßnahmen zur Optimierung der Prozesse oder auch Umstrukturierungen verstärken dieses Problem, solange die operative Kommunikation dabei nicht im Fokus steht. - Viele Projekte scheitern immer wieder an der internen Verständigung. Offenbar fehlt uns ein Bewusstsein über Chancen und Risiken des Kommunizierens, weil diese in Schule, Ausbildung und Studium kaum thematisiert werden. - Dieses Buch erklärt deshalb in verständlicher Weise, was eigentlich kommunizieren bedeutet, wie Missverständnisse entstehen und wie sie vermeidbar sind. Dabei werden Erkenntnisse der linguistischen Pragmatik und der Informationswissenschaft verbunden mit unternehmerischem Denken und Beobachtungen in verschiedenen Betrieben. Diese Perspektive kann helfen, die operative Kommunikation im Unternehmen, und damit dessen wirtschaftlichen Erfolg, zu verbessern. - In einem weiteren Schritt wird das Verhältnis Kommunikation und Wissensbestände eines Unternehmens beleuchtet. Das Buch zeigt, wieso die Entwicklung neuen Wissens, Wissensmanagement und Innovation letztlich Ergebnisse kommunikativer Prozesse sind. - Wissen ist Voraussetzung für den Erwerb von Kompetenzen. Im letzten Teil des Buches wird erläutert, welche Kompetenzen zur Produktivität eines Unternehmens gebraucht werden. Um das Zusammenspiel der Kompetenzen organisieren zu können, ist eine übergreifende kommunikative Kompetenz erforderlich, die insbesondere von Führungskräften verlangt wird. - Zielgruppe sind angehende Führungskräfte, Manager auf mittlerer und leitender Ebene, Multiplikatoren, Lehrende und interessierte Laien. Dieses Buch ist bewusst nicht wissenschaftlich geschrieben. Zum Verständnis reichen gesunder Menschenverstand und Neugier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warum sind manche Unternehmen erfolgreicher als andere?
In diesem Buch geht es um die Frage, wie ein Unternehmen Know-how verwertet, wie also Wissen zu Wertschöpfung wird.
Kooperation und Kommunikation der Akteure stehen dabei im Mittelpunkt. Das operative Geschäft wird durch kommunikative Prozesse gesteuert. Mangelnde Verständigung führt zu Reibungsverlusten. Auch die Entwicklung von neuem Wissen und Innovationen wird durch gelingende Kommunikation beflügelt.
Um das Zusammenspiel der Kompetenzen organisieren zu können, ist eine übergreifende kommunikative Kompetenz erforderlich, die insbesondere von Führungskräften verlangt wird.
Inhaltsverzeichnis
1.
Wissen und Wertschöpfung
1.1. Vorwort
1.2. Einleitung
2.
Treibende Kräfte
2.1. Produktionsfaktoren
2.2. Wertschöpfung
2.3. Wissen
2.4. Kommunikation
2.5. Zusammenspiel der Kräfte
3.
Kommunikation in der Theorie
3.1. Was ist Kommunikation?
3.2. Was heißt verstehen?
3.3. Was heißt missverstehen?
3.4. Was ist eine Sprache
3.5. Intermezzo zur Verständigung
4.
Kommunizieren im Unternehmen
4.1. Wie läuft Ihr Betrieb?
4.2. Wie reden wir eigentlich miteinander?
4.3. Gesamtnote: bedingt ausreichend
4.4. Wir werden besser
4.5. Besser kommunizieren: beschreiben und erklären
4.6. Was heißt Unternehmenskommunikation?
5.
Informationen im Unternehmen
5.1. Informationen – immer und überall
5.2. Informationen verschiedener Art
5.3. Wie fließen Informationen im Unternehmen?
5.4. E-Mail: Fluch und Segen
5.5. Alternativen zur E-Mail
6.
Wissen im Unternehmen
6.1. Wissenswert
6.2. Welches Wissen brauchen wir?
6.3. Was können wir wissen?
6.4. Wissen wächst?
6.5. Wissen wirkt
6.6. Wissensmanagement? Wozu?
7.
Mehr Wertschöpfung
7.1. Mehr Leistung
7.2. Mehr Kompetenz
7.3. Kompetenz und Führung
7.4. Digitalisierung
7.5. Exkurs: Maschinen verstehen
7.6. Unternehmen im Wandel
8.
Zur Orientierung
9.
Nachwort
10.
Danke
11.
Über mich
1. Wissen und Wertschöpfung
1.1. Vorwort von Prof. Dr. Rudi Keller
Dieses Buch beleuchtet das Innenleben eines Unternehmens und beschreibt Phänomene, die wir in der Regel selbst nicht bemerken. Weil sie hinter der alltäglichen Betriebsamkeit versteckt sind. Wir arbeiten immer mehr, immer schneller, und manchmal wundern wir uns, dass die Projekte nicht so recht vorankommen. Alle geben ihr Bestes, und dennoch ist das Zusammenarbeiten oft schwierig. Was ist das, das wir so oft nicht bemerken?
Jede Kooperation basiert auf Kommunikation. Gelingt diese nicht oder nicht reibungslos, laufen die Dinge nicht so, wie sie sollten. Genau das bemerken wir oft nicht, weil die Zeit drängt, der Kunde wartet, der Chef ungeduldig wird. Oder weil wir einfach auf diesem Auge blind sind.
Der Autor dieses Buches hat in seiner Beratungstätigkeit viele verschiedene Unternehmen von innen gesehen. Dabei stellte er fest, dass der Faktor Kommunikation meist als völlig selbstverständlich betrachtet wird, obwohl es in der internen Verständigung häufig klemmt. Es wird zwar viel in Organisation, Umstrukturierungen und Optimierungsmaßnahmen investiert. Die operative Kommunikation jedoch steht hierbei nicht im Fokus.
In der Unternehmenskommunikation haben Unternehmen in den letzten Jahren viel dazugelernt. So sind etwa Geschäftsberichte, die lange Zeit als lästige Pflichtübung galten, wesentlich ansprechender und vor allem lesbarer geworden. Auch rhetorische Fähigkeiten von Unternehmenslenkern bei Vorträgen oder Bilanzpressekonferenzen haben sich verbessert. Der Außendarstellung wird mehr Bedeutung beigemessen.
Die interne Kommunikation, insbesondere im operativen Geschäftsbetrieb, wird jedoch als weniger wichtig angesehen. Offenbar besteht genau da, wo es für gut laufende Geschäfte auf möglichst reibungslose Verständigung ankommt, wenig Gespür für Chancen und Risiken des Kommunizierens.
Hierauf richtet der Autor seinen Blick. Sein Ziel ist es, die Wirkung der operativen Kommunikation auf das Wirtschaftsgeschehen bewusst zu machen. Dabei wird u. a. zu fragen sein, was eigentlich kommunizieren bedeutet, was tatsächlich geschieht, wenn wir uns verstehen und wenn wir uns missverstehen.
Hierzu hat die Sprach- und Kommunikationswissenschaft, insbesondere die linguistische Pragmatik, erhellende Erkenntnisse zu bieten, die jedoch außerhalb der Universitäten nur wenig bekannt sind. Wirtschaft und Wissenschaft haben immer noch gewisse Berührungsängste. Der Autor kennt beide Seiten; und darin liegt der Wert dieses Buches.
Er ist in einer mittelständischen Unternehmerfamilie aufgewachsen, hat Sprachwissenschaft und Informationswissenschaft studiert und war viele Jahre als selbstständiger Unternehmer tätig. Sein Ansatz kann deshalb nur interdisziplinär sein.
Betriebswirtschaftliches Denken verbunden mit linguistischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen in Sachen Kommunikation im Unternehmen eröffnen eine neue Perspektive: Wissen über die Mechanismen des Kommunizierens zu mehr Wert transformieren.
Wie können wir besser arbeiten? Wie können wir mehr Wissen entwickeln und nutzen? Wie erwerben wir mehr Kompetenzen?
Lassen Sie sich auf diese Fragen ein. Sie können nur gewinnen.
Rudi Keller
1.2. Einleitung
Worum geht es in diesem Buch? Der Titel mag Sie überraschen. Was hat Wissen mit Wertschöpfung zu tun? Und welche Rolle soll in diesem Zusammenhang die Kommunikation im Unternehmen spielen?
Einfach gesagt: Ohne Wissen gibt es keine Wertschöpfung. Bei allem, was wir tun, müssen wir wissen, wie es geht. Know-how heißt deshalb das Zauberwort in jedem Unternehmen, ob groß oder klein. Wir gehen davon aus, dass ein bestimmtes Know-how nötig ist, um Güter entwickeln, herstellen und vermarkten zu können. Deshalb glauben wir auch gerne, dass ein Mehr an Wissen zu mehr Wertschöpfung führt. Das scheint aber, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen zutreffend zu sein. Know-how führt nicht automatisch zu wirtschaftlichem Erfolg. Sonst würden keine Projekte scheitern, obwohl sie mit ausgewiesenen Fachleuten besetzt sind. Woran liegt das?
Wenn unser Wissen-wie-es-geht einen Wert bekommen soll, reicht es nicht, Wissen im Kopf zu haben. Wir müssen es in die Praxis umsetzen, also im wahrsten Sinne etwas daraus machen. Das können wir in der Regel nur, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Kooperieren bedeutet, sich zu verständigen. Und hier kommt die Kommunikation ins Spiel. Ohne Verständigung gibt es keine Kooperation. Nur wenn es uns gelingt, uns über Ziele und Wege, Ansichten und Einsichten, Gefühle, Wünsche und Werte zu verständigen, können wir gut zusammenarbeiten. Deshalb ist Wertschöpfung von der Qualität der Kommunikation abhängig. Daraus ergibt sich ein Problem – und eine Chance.
Das Problem: Unzureichende oder misslingende Kommunikation bremst die Abläufe. Mit allem Aufwand, den wir zur Wertschöpfung betreiben, produzieren wir gleichzeitig Verluste.
Die Chance besteht darin, dass wir diese Verluste reduzieren können, wenn es gelingt, die Kommunikation zu verbessern. Eine bessere Verständigung beflügelt die Arbeit in jedem Projekt und wirkt positiv auf das gesamte Unternehmen.
Das klingt einleuchtend. Aber wie sieht die Realität aus?
Die unangenehme Wahrheit ist: In den meisten Unternehmen wird viel aneinander vorbei geredet. Das hört niemand gerne, besonders wenn es um das eigene Unternehmen geht. Spricht man dieses Thema etwa in der Führungsetage an, so ist die gängige Antwort: „Kommunikationsprobleme mag es geben, aber nicht bei uns.“ Fragt man weiter unten nach, so spürt man ein Unbehagen über schlechte interne Abstimmung, über den schleppenden Verlauf von Projekten oder deren Scheitern. Es geht nicht um Einzelfälle. Man klagt allenthalben über die tägliche Flut von Informationen, noch mehr E-Mails, endlose Meetings, die von der Arbeit abhalten. Das führt zwangsläufig zu weniger Produktivität.
Um hier gegenzusteuern, bietet eine breit aufgestellte Coaching-, Trainer- und Beraterbranche eine Vielzahl eher therapeutischer Maßnahmen, oder man versucht es technisch-organisatorisch mit Prozessoptimierung, mehr Informationstechnik, mehr Vernetzung. Dabei fällt auf, dass das Kernproblem der internen Kommunikation, nämlich die Qualität der Verständigung durch sprachliche (nicht technische) Mittel, kaum angegangen wird. Das bedeutet: Wenn die Art zu kommunizieren nicht verbessert wird, nehmen wir bei allen Optimierungsmaßnahmen die Verluste mit, die eben durch mangelnde Kommunikation verursacht werden. Soviel wir auch optimieren, das Ergebnis bleibt suboptimal. Fatal ist, dass Reibungsverluste exponentiell zunehmen, wenn das Unternehmen wächst bzw. wenn mehr Akteure mit mehr Wechselwirkungen beteiligt sind.
Wie reduzieren wir nun diese Verluste? Indem wir die Qualität der Kommunikation verbessern. Das ist die Chance. Der Schlüssel hierzu heißt: Wechsel der Perspektive.
Wir sind gewohnt, ein Unternehmen durch Zahlen und Messwerte zu steuern. Dabei wird übersehen, dass betriebliche Ergebnisse immer auch Ergebnisse der kommunikativen Vorgänge sind. Letztere haben wir nicht im Blick, weil wir Kommunikation für selbstverständlich halten (wir können ja alle Deutsch), obwohl wir wissen, dass Missverständnisse an der Tagesordnung sind.
Richten wir den Fokus auf das, was wir Kommunikation nennen, dann sehen wir, dass wir kommunizieren gewöhnlich mit informieren gleichsetzen. Deshalb informieren wir uns gegenseitig über alles und zu jeder Zeit – dank Informationstechnik in Echtzeit. So fördern wir die Informationsflut, unter der wir alle leiden. Wir müssen nicht schneller und nicht noch mehr informieren, sondern besser kommunizieren – nicht uns gegenseitig in Kenntnis setzen, sondern uns verständigen. Verständigung geschieht nicht durch informieren, sondern durch verstehen. Wenn wir ein Verständnis erreichen wollen, brauchen wir Diskurs. Dann können wir Resonanz erwarten, also mehr als Kenntnisnahme. Allerdings setzt dies voraus, dass unser Reden resonanzfähig ist. Auch wenn uns das nicht immer gelingt, wird allein das Bemühen weniger Rückfragen, weniger Missverständnisse, weniger Zeitverlust hervorbringen.
Der Aufwand für einen Perspektivenwechsel zur besseren Kommunikation ist relativ gering. Jedenfalls wesentlich geringer als viele herkömmliche Optimierungsmaßnahmen. Die Wirkung zeigt sich mehrfach, zunächst durch weniger Reibungsverluste im operativen Geschäft.
Ein weiterer Bereich bietet die Chance, Potenziale freizusetzen: der Wissensbestand des Unternehmens. Das gesamte Know-how, von dem wir schließlich leben, steckt überall in den Köpfen. Dieses Expertenwissen gilt es zu verbreiten. Möglichst viele Mitarbeiter sollen darüber informiert sein und sich damit auseinandersetzen. Und es verstehen, sonst haben wir keinen Know-how-Transfer, sondern nur Informationsaustausch. Wissenserwerb heißt letztlich, Informationen in Zusammenhängen zu verstehen. Hierbei helfen Gespräche, Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Gelingende Kommunikation wirkt dann als Katalysator.
Viele Unternehmen ahnen nicht, wie viel Wissen in ihnen steckt. Sie werden es erfahren, wenn sie miteinander darüber reden. Und vielleicht ist manche Innovation schon im Verborgenen vorhanden, wir haben nur keine Ahnung davon.
Know-how-Entwicklung und Wissenserwerb sind unser Kernthema als Folge des digitalen Wandels. Der Ersatz menschlicher Arbeit durch Maschinen – mit negativen und positiven Auswirkungen – ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite stehen neue Möglichkeiten einer Mensch-Maschine-Interaktion und völlig neue Geschäftsmodelle. Je mehr wir hierüber wissen, neu dazulernen und daraus verwertbares Know-how entwickeln, desto größer sind die Chancen, Wandel sinnvoll zu beeinflussen. Eben weil unser Nachhol- und Lernbedarf groß und die Zeit knapp ist, brauchen wir eine bessere Kommunikation. Lernen geschieht durch kommunizieren.
Wie können wir die Chancen einer besseren Kommunikation realisieren?
Kommunikation im Unternehmen ist eine Führungsaufgabe. Wir haben viele fachlich kompetente Führungskräfte. Allerdings wenige, die ein dezidiertes Verständnis von Wirkungen, Schwachstellen und Risiken von Kommunikation haben – weil es nicht Teil ihrer Ausbildung war. Folglich können wir hier keine ausgeprägte kommunikative Kompetenz erwarten. Diese zu erwerben ist dringend erforderlich, damit Führung besser verstanden wird. Und damit alle Mitarbeiter motiviert werden, ebensolche Kompetenz zu entwickeln und durch sie die Verständigung im Unternehmen, im operativen wie im Bereich Wissen, effizienter werden kann.
Wenn von Effizienz die Rede ist, denken wir meist an mehr Geschwindigkeit, mehr Technik, mehr Digitalisierung. Auch unsere Kommunikation soll durch mehr Technik effizienter werden, so verspricht man uns. Merkwürdig, dass es trotz (oder wegen?) zunehmender Kommunikationstechnik immer noch und immer wieder zu Missverständnissen kommt. Probleme der Verständigung sind in der Qualität gleichgeblieben, in der Summe nehmen sie zu. Digital können wir uns genauso missverstehen wie zu analogen Zeiten des Bindfaden-Telefons. Das sollte uns zu denken geben.
Lange haben wir geglaubt, mehr Technik helfe automatisch zu mehr Erkenntnis, zu Wachstum und Entwicklung. Wir fangen gerade an zu verstehen, dass eher unsere kommunikative Kraft uns befähigt, aus Wissen mehr Wert zu schöpfen, besser zusammenzuarbeiten, Wissen zu teilen und Kompetenzen zu entwickeln. Zu einer gelingenden Kommunikation in einer digitalisierten Welt haben wir noch viel Gesprächsbedarf. Dieses Buch ist ein Beitrag dazu.
Ich wünsche Ihnen eine wertschöpfende Lektüre und freue mich auf Ihr Feedback.
Klaus [email protected]
2. Treibende Kräfte
Wenn wir von Unternehmen sprechen, gehen wir selbstverständlich davon aus, dass ein wirtschaftlicher Betrieb das tut, wozu er da ist: produktiv sein, Wert schöpfen und nachhaltig Gewinne generieren. Wie kommt es eigentlich dazu? Was ist nötig, damit Produkte oder Leistungen entstehen? Einfacher gefragt: Wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen?
Diese Frage scheint die Betriebswirtschaftslehre allein nicht zu beantworten. Sonst würden nicht manche Unternehmen trotz ökonomischer Expertise scheitern. Offenbar sind also weitere Faktoren mit am Werk. Dieses Kapitel zeigt, • welche Kräfte beteiligt sind, • wie sie sich dynamisch entwickeln, • sich gegenseitig beeinflussen und schließlich • warum ein Unternehmen erst durch das Zusammenspiel dieser Kräfte lebendig wird (und bleibt).
2.1. Produktionsfaktoren
Die klassische Antwort auf die Frage, wie ein Wirtschaftsgut hergestellt werden kann, lautet: Wir brauchen die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital. Das Zusammenwirken dieser Faktoren bringt ein Produkt hervor. Am einfachsten können wir uns das in der Landwirtschaft vorstellen. Der Boden wird bearbeitet, und die Ernte bringt Geld. So entsteht Kapital durch die Kombination von Arbeit und Boden.
Dieser Zusammenhang gilt grundsätzlich auch für andere, nichtagrarische Wirtschaftsbereiche, wobei wir natürlich die Produktionsfaktoren differenzierter betrachten müssen. Der Begriff Boden ist nicht mehr lediglich Ackerboden, er umfasst auch Gebäude, Anlagen, Maschinen, Werkzeuge. Der Faktor Arbeit bedeutet jede Tätigkeit, die darauf ausgerichtet ist, Einkommen zu erzielen. Kapital meint jede Art von Finanzmitteln etc. So lassen sich herkömmliche Arten des Wirtschaftens beschreiben, in denen etwas hergestellt wird. Im Zuge der Zeit reichen die genannten drei Faktoren jedoch nicht aus. Also kommen weitere hinzu. Schon um den Acker bestellen zu können, musste der Landwirt wissen, was er wie zu tun hat, damit der Boden Ertrag bringt. Wissen wurde vorausgesetzt, wenn auch nicht explizit genannt. Heute ist Wissen zu einem weiteren Produktionsfaktor geworden, zuweilen unter dem Begriff Humankapital, womit der Kenntnis- und Ausbildungsstand der Mitarbeiter erfasst werden soll.
Dies scheint sinnvoll, denn unser Wirtschaften hat sich vom einfachen Herstellen wegentwickelt. Wir leben inzwischen weniger von der Produktion von Wirtschaftsgütern als vielmehr von Ideen, aus denen Produkte und Leistungen hervorgehen. Wenn wir heute von arbeiten sprechen, denken wir vorwiegend an Arbeit im Kopf. Auch physische Arbeit setzt eine gedankliche Vorarbeit in Form von Planung und Organisation voraus, ohne die ein wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich wäre. Technische Entwicklungen, Vernetzung und Digitalisierung legen nahe, dass dem Produktionsfaktor Wissen eine große Bedeutung zukommt, wenn nicht gar eine größere als den übrigen Faktoren Arbeit, Boden, Kapital. Aber damit nicht genug: Die Entwicklung zeigt, dass der Bereich künstliche Intelligenz ebenfalls zu einem weiteren Produktionsfaktor geworden ist.
Können wir nun mit den oben erwähnten Produktionsfaktoren erklären, warum ein Unternehmen Erfolg hat und warum manche Unternehmen keinen Erfolg haben? Wohl kaum.
Das Zusammenbringen verschiedener Faktoren, seien sie noch so differenziert, sagt noch nichts darüber, wie diese kombiniert und gewichtet werden müssen bzw. darüber, wie sich deren Zusammenspiel gestalten muss, damit ein wirtschaftlicher Erfolg entsteht. Die Dynamik eines Unternehmens ergibt sich nicht aus statischen Faktoren.
Die Erklärung, wirtschaftliche Leistung entstehe aus der Kombination der Produktionsfaktoren, ist für ein grundsätzliches Verständnis wirtschaftlicher Logik dennoch gültig. Aber was bewirken diese Faktoren? Wie wirken sie aufeinander, und wie sollten sie wirken?
Diese Fragen lenken den Blick auf das Spiel der Kräfte im laufenden Betrieb. Um also zu verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert, scheint hier der Schlüssel zu liegen. Schauen wir also, welche Kräfte zum Tragen kommen.
Ich gehe von drei wirkmächtigen Kraftfeldern aus.
Das erste nenne ich Wertschöpfung und meine damit alles, was mit dem operativen Geschäft verbunden ist, also der originäre Gegenstand der Betriebswirtschaft. Mit anderen Worten: alles, was die Verwertung von Know-how betrifft.
Als zweites sehe ich den Bereich Wissen im Unternehmen. Dies ist sozusagen der Lieferant von Know-how und umfasst alle Kenntnisse, Erkenntnisse, Ideen und Erfahrungen, die im Unternehmen vorhanden sind bzw. entwickelt werden.
Das dritte Kraftfeld ist die Kommunikation im Unternehmen. Sie ist das Bindeglied zwischen Wissen und Wertschöpfung. Ohne Kommunikation könnte weder das Wissen wirksam werden, noch könnte ein operatives Geschäft funktionieren.
Bevor wir auf das Zusammenspiel dieser Kräfte eingehen, möchte ich diese zunächst im Einzelnen näher betrachten.
2.2. Wertschöpfung
Ohne Wertschöpfung besteht kein Unternehmen. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt allen Wirtschaftens. Aus dem, was wir tun, muss mehr herauskommen, als wir hineingegeben haben. Wenn der Aufwand größer ist als der Erfolg, sprechen wir nicht von Wirtschaften, sondern eher von Hobby. Der Output muss also größer sein als der Input.
Damit Wertschöpfung entstehen kann, sind wirtschaftliche Güter oder Produkte nötig. Diese können entstehen, indem wir Rohstoffe verarbeiten, Teile zusammensetzen oder auch, im Falle von Dienstleistungen, Ideen oder Kenntnisse weiterentwickeln und diese anderen Menschen zur Verfügung stellen. Wesentlich dabei ist, dass ein so erzeugtes Wirtschaftsgut mehr wert ist als die Summe seiner Teile. Dadurch, nämlich durch Veredelung, entsteht ein Mehrwert. Ohne diesen ist ein Erzeugnis kein Wirtschaftsgut im wirtschaftlichen Sinne. Wesentlich ist ferner, dass ein möglicher Kunde diesen Mehrwert unserer Leistung verstehen kann und erkennt, dass ihm genau dieses Produkt fehlt – sei es für seinen Wirtschaftsbetrieb oder für sein persönliches Wohlempfinden. Dieses Moment ist deshalb entscheidend, weil unsere Produkte ansonsten nicht verkauft würden. Erzeugte Produkte, die in unserem Warenlager liegen, bzw. Dienste, die niemand in Anspruch nehmen will, führen nicht zu Wertschöpfung sondern auf Dauer zum Ruin. Im wirtschaftlichen Sinne ist ein gutes Produkt immer ein verkauftes Produkt. Und ein Dienst wird zur Dienstleistung, wenn ein Kunde diese Leistung will. Ein Mehrwert bleibt solange ein potenzieller Wert, bis der Kunde dieses Mehr an Wert für sich selbst versteht und dafür bezahlt. Erst dann kann der Anbieter ebenfalls einen Wert realisieren, der als Ertrag verbucht wird. Dieser Ertrag muss höher sein als der Aufwand. Das alles ist, wie wir sehen, mehr als eine einfache Rechenaufgabe.
Das Berechnen des Aufwandes bleibt jedoch ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette. Denn grundsätzlich gilt: Je geringer der Aufwand für die Entwicklung eines Produktes oder einer Leistung ist, desto größer sind die Chancen einer Wertschöpfung. Der Aufwand wird bestimmt durch Produktionsfaktoren und Betriebsmittel, die Art der Herstellung, die damit verbundenen Abläufe, den Grad der Standardisierung oder Automatisierung etc.
Das führt zu der Frage, wie denn überhaupt ein Wirtschaftsgut entstehen kann. Woher wissen wir, dass unser Produkt überhaupt herstellbar ist und wie? Die Antwort liegt im Wissen. Wir brauchen viel Know-how, um aus den gegebenen Faktoren und unter gegebenen Bedingungen ein Produkt oder eine Leistung herstellen und vermarkten zu können. Dieses Wissen ist ein Produktionsfaktor. Hätten wir es nicht, wären alle anderen Faktoren wertlos, weil wir nichts mit ihnen anzufangen wüssten.
Die nächste und eigentlich wichtigste Frage ist, wie wir uns den Weg zur Wertschöpfung vorstellen. Wie sieht ein Geschäftsmodell aus, das das Verhältnis von Input und Output bestimmt?
Auf diese Frage gibt es vereinfacht gesagt zwei Perspektiven:
Man fokussiert sich auf den Input und versucht, den Aufwand zur Herstellung eines Produktes so gering wie möglich zu halten.
Man konzentriert sich auf den Output in der Absicht, mit dem gegebenen notwendigen Aufwand ein möglichst gutes Produkt herzustellen.
Beide Perspektiven können zum gleichen Ergebnis führen. Das heißt, die entstandenen Produkte aus 1 und aus 2 müssen sich augenscheinlich nicht unterscheiden. Aber das gilt nur in einer Momentaufnahme. Die daraus folgenden Konsequenzen jedoch sind sehr unterschiedlich.
Die erste Perspektive ist charakterisiert durch ein ausgeprägtes Kostendenken. Geringe Transaktionskosten vergrößern die Marge bis zum fertigen Produkt. Bei einem Produkt mit deutlichem Alleinstellungsmerkmal ist das relativ einfach zu bewerkstelligen. Man nimmt dabei das Produkt bzw. dessen Preis als statische Größe. Je weniger Kosten ich hiervon abziehen muss, desto größer ist mein Ertrag. Komplizierter wird es, wenn mehrere vergleichbare Produkte auf dem Markt sind, wenn also mein Alleinstellungsmerkmal nicht mehr gilt. Im Vergleich zum Wettbewerb muss mein Produkt dann preiswerter sein als das der anderen. Um das zu erreichen, müssen meine Kosten weiter sinken. Bei gesättigter Marktlage führt das zu einer Kostenspirale nach unten. Jedes Produkt muss billiger werden, koste es, was es wolle. Es entsteht ein Preisdiktat, weil jeder den anderen unterbieten will. Und diese Billig-Denke führt zu Kannibalismus. Dabei ist das jeweils Billigste extrem volatil. Der beste Preis hält nur solange, bis ein anderer noch billiger daherkommt.
Natürlich ist Wertschöpfung auf diese Weise möglich. Wir sehen viele Unternehmen, die nach diesem Prinzip arbeiten, und als Konsumenten freuen wir uns mitunter über sinkende Preise bei austauschbaren Produkten. Allerdings verschwinden auch einige solcher Unternehmen von der wirtschaftlichen Oberfläche. Die Gefahr besteht darin, dass Kostensenken auf Teufel komm raus an die Substanz gehen kann. Nämlich zunächst an die Substanz des Produktes, das wahrscheinlich immer schlechter wird, weshalb der Kunde es nicht mehr will. Dann auch an die Substanz des Unternehmens, weil man mit immer weniger Aufwand irgendwann ein Produkt nicht mehr herstellen, geschweige denn neue Produkte entwickeln kann.
Die zweite Perspektive ist charakterisiert durch ein Qualitätsdenken. Je besser das Produkt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, einen guten Preis dafür zu erzielen. Ein Wettbewerbsvorteil wird nicht im niedrigeren Preis sondern in besseren Produkteigenschaften gesehen. Treten vergleichbare Produkte auf, muss das Produkt weiterentwickelt werden, um sich deutlich zu unterscheiden. Idealerweise ist das Produkt einmalig oder hat zumindest eine einmalige Eigenschaft. Der Aufwand wird nicht wesentlich im Hinblick darauf gesehen, was er kostet, sondern was er ermöglicht. Deshalb werden Einsparungen nicht um jeden Preis vorgenommen, sondern im Hinblick auf die Produktqualität. Insofern ist das Produkt eine dynamische Größe. Es muss im Wettbewerb ständig verbessert werden.
Das Streben nach besserer Produktqualität treibt auch interne Verbesserungen an. Qualitätsmanagement ist Pflicht. Deshalb werden Wertschöpfungsketten ständig geprüft und optimiert. Einsparpotenziale in den Prozessen können so erkannt werden. Einsparungen dienen nicht dem Abbau von Ressourcen, sondern dazu, vorhandene Kräfte besser zu nutzen, nämlich zur Entwicklung herausragender Produkte und Leistungen.
Diese beiden Perspektiven wird es im wahren Leben wahrscheinlich nicht in Reinform geben. Überschneidungen und Mischformen sind möglich. Aber sie zeigen tendenziell verschiedene Vorstellungen von Wertschöpfung, nämlich
einerseits Wettbewerb um niedrigere Preise, also etwas Gutes machen mit immer weniger Einsatz. Man rechnet mit Kosten – gemäß der alten Kaufmannsweisheit „Der Gewinn liegt im Einkauf“, je billiger, desto besser;
andererseits: Wettbewerb um bessere Produkte, also das Beste machen aus vorhandenen Ressourcen. Man rechnet mit Potenzialen, die es zu nutzen gilt.
Wir wollen nicht verkennen, dass Kosten grundsätzlich in beiden Perspektiven ein wichtiges Thema sind. Die Frage ist aber, wie man Kosten bewertet bzw. welche Kosten nötig sind und welche nicht. Unnötige Kosten sind solche, die nicht der Wertschöpfung dienen. Sie liegen meist in den Prozessen und weniger im Einkauf. Oft gilt auch: je billiger die Beschaffung, desto höher die Prozesskosten.
Wie auch immer man Kosten und deren Wirkung im Wertschöpfungsprozess bewerten mag: Es macht wenig Sinn, diese Überlegungen nur der Arithmetik zu überlassen. Dieser Schluss drängt sich auf, wenn man sieht, dass Unternehmen an Produkten festhalten, die am Markt nicht zu platzieren sind, oder dass man Marktanteile über den Preis erkämpft, ohne damit Gewinn zu machen. Hier stellt sich die Frage, ob eine zu starke Fokussierung auf die Kostenseite weniger Aufmerksamkeit für eine Weiterentwicklung des Produktes respektive des Unternehmens zur Folge hat. Kann eine solche Art der Wertschöpfung wirklich sinnvoll sein?
Welche Art von Wertschöpfung man bevorzugt, hängt von vielen Faktoren ab. Letztlich auch von persönlichen Einstellungen und unseren Wünschen, wie wir zukünftig leben, arbeiten und wirtschaften wollen. Denn vergessen wir nicht: Jede Form der Wertschöpfung enthält ein Stück Zukunft. Der heute erwirtschaftete Gewinn stärkt das Unternehmen und damit seine Überlebensfähigkeit morgen. Auch wenn niemand die Zukunft vorhersagen kann, müssen wir veränderte Bedingungen erwarten, z. B. Ressourcenverknappung, kürzere Zyklen, wachsenden wirtschaftlichen Druck, mehr Komplexität. Ein rein betriebswirtschaftlicher Fokus auf Wertschöpfung, wie das oben beschriebe Kostendenken, wird uns in Zukunft kaum weiterhelfen.
Wir können davon ausgehen, dass der Wettbewerb um bessere Produkte zusammen mit einer intelligenten Nutzung vorhandener Ressourcen unser Wirtschaften antreiben wird. Dies wird mehr, vor allem bessere Kooperation und Kommunikation erfordern, ebenso wie ein Mehr an Wissen.
2.3. Wissen
Woher kommt das Wissen, das wir zur Wertschöpfung brauchen? Ganz einfach. Es wird mitgebracht. Jeder, der an der Wertschöpfung mitarbeitet, verfügt über entsprechendes Wissen, das in der Ausbildung erlernt wurde. Der Bäckermeister weiß, wie man Brot bäckt. Der Verfahrensingenieur weiß, wie aus Rohöl Benzin entsteht etc. Das einmal erworbene Wissen der Fachleute reicht jedoch, wie allgemein bekannt, nicht aus, um dauerhaft eine Wertschöpfung zu gewährleisten. Die Welt ändert sich ständig, und damit verändern sich auch die Bedingungen des Wirtschaftens. Neues Wissen muss her, das die täglich entstehenden neuen Informationen einbezieht. Darüber besteht allgemeiner Konsens. Wir müssen auf dem Laufenden bleiben, uns weiterentwickeln. Aber wie machen wir das?
Man könnte meinen, wir bräuchten unser mitgebrachtes, also in Schule und Ausbildung erworbenes Wissen lediglich durch aktuelle Informationen über neue Sachverhalte, Techniken, Probleme, Lösungen etc. zu ergänzen – so, wie wir eine Software updaten. Nein, so geht es nicht.
Die Vorstellung, dass unser Wissen im Laufe der Zeit veraltet bzw. sich vervielfacht, geht von der Annahme aus, Wissen sei eine Art Inventarliste, die aktualisiert oder erweitert werden muss. Eine häufige Verwechslung besteht darin, die ständig steigende Menge an Informationen für einen Zuwachs an Wissen zu halten. Informationen als solche sind noch kein Wissen. Die Menge allein ist eher diffus und macht uns nicht klüger. Informationen sind lediglich Daten, die in einem Kontext stehen. Daten sind strukturierte Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Bilder. Das können z. B. Messwerte sein, sagen wir „4,5 Liter/100 km“. Dieses Datum hat noch keinen informativen Charakter, es sei denn, wir ergänzen „4,5 Liter“ mit Kraftstoff, der pro 100 gefahrene Kilometer verbraucht wird. Das muss nicht explizit gesagt werden, auch wenn wir das quasi mitdenken, gehört es zum Kontext. Dieser Kontext macht aus Messwerten eine Information. Und was sagt uns diese Information? Nichts. Es sei denn, wir wissen, dass Kraftstoffe aus endlichen Ressourcen hergestellt werden, dass geringer Verbrauch weniger Geld und weniger Emission kostet. Mit diesem Wissen können wir die Information sinnvoll einordnen. Wissen entsteht aus Informationen, also Sachinhalten, insofern diese strukturiert, miteinander verknüpft, unterschieden, bewertet, eingeordnet, letztlich verstanden werden. Vereinfacht könnte man sagen: Wissen besteht aus verstandenen Informationen.
Das Entwickeln von Wissen geschieht also durch einen mentalen Prozess, über den wir uns Wissen im wahrsten Sinne aneignen können. Folglich ist Wissen immer an Menschen gebunden. Wissen gibt es nur im Kopf. Insofern kann es streng genommen kein Wissen in Büchern oder auf anderen Datenträgern geben. Ich kann zwar ein Buch schreiben und darin mein Wissen kundtun. Für die Leser hat aber dieses mein Wissen den Status von Informationen, die erst durch das Verstehen beim Lesen in das Wissen des Lesers eingehen können. Verstehen bedeutet einordnen in ein bereits vorhandenes System aus Kategorien und Werten. Eine neue Information kann ich nur dann verstehen, wenn mein Gedankensystem, man kann auch sagen mein Vorwissen, so ist, dass ich das Neue einordnen kann. Ansonsten kann ich eine Information zwar zur Kenntnis nehmen, aber ich verstehe sie nicht. Wissen ohne Verstehen ist eine Illusion und in Wahrheit nur eine Menge von Informationen.1
Jede gedankliche Auseinandersetzung geschieht mithilfe von Kategorien bzw. Begriffen, die ein Denken überhaupt erst möglich machen. Begriffe sind gedankliche und gleichzeitig sprachliche Gebilde. Deshalb ist Denken nur mit Sprache möglich. Beide sind untrennbar miteinander verbunden, wie zwei Seiten einer Medaille. Sprache bestimmt das Denken und umgekehrt. Wir können nur in Sprache denken, und wir können nur denken, weil wir eine Sprache haben. Ohne Sprache gibt es kein Denken, kein Verstehen, kein Lernen und kein Wissen.
Die Aneignung von Wissen ist also letztlich ein auf Sprache basierender Vorgang. Wir brauchen einen Diskurs, damit sich Wissen entwickeln kann. Bei diesem diskursiven Prozess werden Dinge einer mentalen Struktur zugeordnet, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Muster erkannt und Zusammenhänge hergestellt.
Ein solcher Diskurs kann mit mir selbst, quasi als Selbstgespräch, stattfinden oder mit anderen Menschen, indem wir uns über Sachinhalte und Themen auseinandersetzen. Beides kann unser Wissen bereichern. Miteinander reden kann also lehrreich sein.
Wissen wächst in unserem Kopf. Das Wesentliche dabei ist der Verarbeitungsprozess. Einflüsse von außen können diesen Vorgang in Gang setzen, aber nicht ersetzen. Es gibt keinen Nürnberger Trichter. Wissen kann man nicht einfach hochladen, so wie wir eine Software updaten. Wissen kann man auch nicht übertragen oder kopieren. Wir können es höchstens mitteilen. Durch einen Diskurs kann sich dann im Kopf des anderen neues Wissen entwickeln. Streng genommen ist die Entwicklung von Wissen das Ergebnis eines kommunikativen Prozesses.
Und dies ist naturgemäß kein einmaliger Vorgang. Wir lernen ständig hinzu, jedoch nicht, indem wir Neues einfach hinzuaddieren. Unser Vorwissen muss Neues verarbeiten und integrieren. Dieses Vorwissen ist ein Schatz an Erfahrungen. Dazu gehört auch zu wissen, wie man sich neues Wissen aneignen kann. Je mehr Erfahrung wir haben bzw. je mehr wir früher gelernt haben, desto mehr und desto leichter werden wir später neues Wissen erwerben können. Je mehr man weiß, desto mehr kann man dazulernen bzw. wer viel mitbringt, kann viel hinzugewinnen. Wissen entsteht aus Wissen.
Überlegen wir nun, was wir mit dem erworbenen Wissen anfangen können. Dazu brauchen wir zunächst eine Differenzierung: Wissen ist nicht gleich Wissen. Nicht mit jedem Wissen kann man gleich viel anfangen. Und wer viel weiß, kann nicht unbedingt viel. Was wir brauchen, im Leben wie im Unternehmen, ist eine gewisses „Gewusst-wie“, wir nennen es auch Know-how.
Wissen, wie es geht, befähigt uns zum Handeln. Ich weiß zum Beispiel, dass man auf einem Fahrrad fahren kann. Aber dieses Wissen allein macht mich nicht zum Radfahrer. Fahrradfahren lernt man durch Fahrradfahren. Zu wissen, dass es etwas gibt (Know-that), ist das eine. Zu wissen, wie es geht (Know-how), ist ein anderes. Das Erste hat mit Kennen zu tun, das Zweite eher mit Können. Das eine geht nicht ohne das andere.
Es liegt auf der Hand, dass beides, nämlich Kennen und Können, miteinander einhergehen müssen, damit ein Wissen gleich welcher Art nützlich werden kann. Für Unternehmen heißt das zum Beispiel: Es ist wichtig, zu wissen, was ein Projekt ist. Gut sind auch Kenntnisse über Projektmanagement. Wichtiger und besser jedoch ist es, Projekte sinnvoll, d. h. durchführbar aufsetzen und vor allem managen, d. h. steuern und zum Ziel führen zu können. Mit Blick auf Wertschöpfung bedeutet das vereinfacht: Kennendes Wissen ist gut, gekonntes Wissen ist besser.
2.4. Kommunikation
Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, in dem überhaupt nicht kommuniziert wird. Es wird Ihnen nicht gelingen. Ein solches Unternehmen gibt es nicht, es wäre nicht lebensfähig, weil es erstens nichts herstellen und zweitens nichts verkaufen könnte. Denn jedes Unternehmen, ob klein oder groß, vom Friseursalon bis zum Großkonzern, ist auf das Zusammenwirken verschiedener Akteure angewiesen: Mitarbeiter, Lieferanten, Behörden, Kunden etc. Alle Akteure müssen in bestimmter Weise zusammenarbeiten. Ohne Kooperation gibt es kein Unternehmen.
Kooperationen entstehen nicht von ungefähr. Wenn wir mit wem auch immer zusammenarbeiten wollen, müssen wir aufeinander zugehen, uns über Ziele und Wege einigen. Sobald die Zusammenarbeit läuft, müssen wir uns ständig über das weitere Vorgehen abstimmen. Kooperieren heißt also zuerst kommunizieren. Denn nichts läuft von selbst. Über alles, was eine Zusammenarbeit ausmacht, müssen wir uns verständigen. Kommunikation ist deshalb die Kraft, die erstens eine Kooperation überhaupt ermöglicht und zweitens diese in Gang hält.
Damit beides gelingen kann, ist es nicht nur wichtig, miteinander zu reden. Beim Reden alleine kann man sich wunderbar im Kreis drehen. Das kennen wir alle. Wir wollen doch eigentlich ein Ziel erreichen, das ist doch der Sinn des Zusammenarbeitens. Deshalb ist wichtiger als reden, dass wir uns verstehen.2
Wie machen wir das? Natürlich benutzen wir dazu unsere Sprache. Natürlich sage ich deshalb, weil uns diese quasi von Natur aus mitgegeben wurde, weil wir sie in unserem alltäglichen Leben hinreichend gut beherrschen und ganz natürlich anwenden. Im beruflichen Alltag jedoch reicht das nicht. Wir müssen uns nämlich, sobald wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, über bestimmte Sachverhalte einigen. Dazu brauchen wir gemeinsame Begriffe, also Fachausdrücke, technische Bezeichnungen, Abkürzungen, Funktionsbezeichnungen etc., die für jeden Beteiligten dasselbe aussagen. Damit wissen wir, worüber wir eigentlich reden bzw. worüber wir uns verständigen wollen. Eine solche Fachsprache, man nennt es auch Terminologie, gibt es in unterschiedlicher Ausprägung für jede Branche, für jedes Unternehmen, für jedes Projekt und für jede Aufgabe. Es gibt sie auch dann, wenn sie uns gar nicht bewusst ist oder wenn sie nicht explizit dokumentiert wird, was in vielen Unternehmen der Fall ist.
Eine Terminologie entwickelt sich in allen Fachgebieten. Sie hat den Sinn, dass alle Akteure idealerweise unmittelbar wissen, worum es geht. Ein sehr ökonomisches Prinzip. Je klarer nun die einzelnen Termini definiert sind und je mehr sich die Akteure über deren Bedeutung bewusst sind, desto besser wird das allgemeine Verständnis sein. Ein gemeinsames Begriffsverständnis ist also die Basis für eine gut funktionierende Kommunikation im Unternehmen und für jede fruchtbare Zusammenarbeit.
Diese Terminologie findet Niederschlag im gesamten Unternehmen. Überall, wo Belange des Unternehmens besprochen und in Texten beschrieben werden, ist sie enthalten - bei internen E-Mails, in Prozessbeschreibungen, Anweisungen, technischen Dokumentationen, Produktbeschreibungen, Angebotstexten, vertraglichen Vereinbarungen etc. Besser gesagt: Sie sollte dort überall verwendet werden und vor allem konsequent einheitlich. Denn je mehr die entsprechende Wortwahl im Unternehmen gelebt wird, desto selbstverständlicher wird sie für alle Beteiligten. Und umso schneller entwickelt sich eine für das Unternehmen spezifische eigene Sprache.
Jedes Unternehmen hat in der Tat eine eigene Sprache, als spezifische Variante unserer allgemeinen Umgangssprache. Sie ist ein alltägliches Arbeitsinstrument. Alles, was im Unternehmen läuft – oder auch nicht – wird mit dieser Sprache beschrieben und gesteuert, selbst wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Folglich muss diese Sprache für alle Beteiligten klar und verständlich sein. Geläufig ist auch der neudeutsche Begriff „Corporate Language“ im Zusammenhang mit Marketing und Werbung. Im eigentlichen Sinne betrifft diese Sprache jedoch das gesamte Unternehmen („Corporate“). Sie sollte deshalb auch flächendeckend bekannt sein und Verwendung finden. Problematisch wird es, wenn zum Beispiel die Marketingabteilung andere Begriffe verwendet als der Rest des Unternehmens, das ist leider keine Seltenheit.
Warum ist es wichtig, die Sprache des Unternehmens bewusst zu benutzen und zu pflegen? Weil dadurch der gesamte Informationsfluss im Unternehmen flüssiger wird. Das ist die Voraussetzung für eine zielführende Zusammenarbeit. Jede Unklarheit beeinträchtigt die Kooperation, es entstehen Verzögerungen durch Missverständnisse, unnötiges Nachfragen, etc. Solche Reibungsverluste kosten Unternehmen sehr viel Geld. Und in Zukunft, wenn die Ressource Zeit noch knapper wird, werden sich solche Verluste potenzieren, wenn wir die Kommunikation und damit das Zusammenarbeiten nicht verbessern.
Was es bedeutet, mit einer klaren Sprache im Unternehmen effizient zu kommunizieren, werden Sie spätestens dann spüren, wenn Sie mehrsprachig arbeiten. Kaum ein Unternehmen kann heute noch lediglich in einer Sprache operieren. Bei Übersetzungen ist eine strukturierte Ausgangssprache die halbe Miete, weil eine sinngetreue Wiedergabe eher dann gewährleistet ist, wenn die Ausgangstexte eindeutig formuliert wurden. Irreführende Interpretationen lassen sich vermeiden.
Die Entstehung einer Unternehmenssprache können wir uns vorstellen wie einen Produktions- oder Veredelungsprozess. So wie im operativen Geschäft Produkte und Leistungen aus Rohmaterial entwickelt werden, so entsteht auf Seiten der Kommunikation aus intern definierten Begriffen durch deren ständige Verwendung eine eigene Sprache. Dabei bildet die Terminologie quasi den kommunikativen Rohstoff. Die Entstehung einer Unternehmenssprache geschieht grundsätzlich ohne unser bewusstes Zutun. Durch alltäglichen Sprachgebrauch bilden sich automatisch bestimmte Termini und Ausdrucksweisen heraus. Wir können diese Entwicklung also sich selbst überlassen, was in den meisten Unternehmen geschieht. Wir können aber auch bewusst Einfluss darauf ausüben, wie die Sprache unseres Unternehmens aussehen soll. Und das wird sich sehr bald sehr positiv auf die Kommunikation im Unternehmen auswirken. Allein deshalb, weil die Sprache das Werkzeug ist, mit dem wir ständig kommunizieren. Mit einem besseren Werkzeug wird die Kommunikation im Unternehmen also ständig verbessert, und zwar aus sich selbst heraus.
Grundsätzlich ist eine gemeinsame Sprache nicht nur Ausdruck einer Sprachgemeinschaft, vor allem bildet sie eine Gemeinschaft. Sie hat eine identitätsbildende Kraft und hält damit ein Unternehmen von innen heraus zusammen. Eine gelebte Unternehmenssprache schafft in allen Köpfen mehr Klarheit und Bewusstsein über das eigene Unternehmen. Das wirkt intern auf das Betriebsklima und die Qualitätskultur.3 Das erleichtert auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Einbindung von Externen.
Hinzu kommt noch ein wichtiger Aspekt: Sobald eine Kooperation mit einem anderen Unternehmen angestrebt wird – und das wird in großen und kleinen Unternehmen immer häufiger der Fall sein –, vervielfacht sich der Kommunikationsbedarf. Wenn dann keine klare Sprache vorhanden ist, kommt so manche eigentlich sinnvolle Kooperation gleich zu Beginn ins Stocken, bevor an Synergieeffekte zu denken ist. Viele Unternehmenszusammenschlüsse und Projekte sind genau daran schon gescheitert. Dieses Problem entsteht grundsätzlich in jeder kollaborativen Arbeitsform.
Wir sehen: Die Sprache eines Unternehmens ist mehr als schöne Worte. Sie ist kein dekoratives Beiwerk, nichts Äußerliches und vor allem kein Luxus. Sie ist der Kern der Kommunikation im Unternehmen. Kommunikation ist der Nährstoff der Kooperation, also jeder Form der Zusammenarbeit. Die gemeinsame Arbeit dient der Wertschöpfung, dem eigentlichen Ziel jedes Unternehmens. Im Hinblick darauf ermöglicht Kommunikation die Umsetzung von Wissen zu Kapital. Ohne Kommunikation bliebe Wissen wertlos, und Wertschöpfung könnte nicht entstehen.
2.5. Zusammenspiel der Kräfte
Das Zusammenspiel der beschriebenen Bereiche möchte ich mit einer Dreieinigkeit vergleichen, also einer Einheit, die aus drei Konstituenten besteht. Keine darf fehlen, sonst zerfällt die Einheit. Wenn wir ein Unternehmen als Einheit in diesem Sinne betrachten, dann sind die drei Konstituenten die genannten Kraftfelder Wissen, Wertschöpfung und Kommunikation. Einfach gesagt: Das Unternehmen steht auf drei Säulen. Bildlich gesprochen klingt das recht solide. Was auf drei Beinen steht, wackelt nicht. Denken Sie an einen Hocker oder ein Fotostativ. Die Standfestigkeit auf zwei Beinen oder gar nur einem ist schwieriger oder auch riskant. Das gilt auch für Unternehmen, von denen wir nach verbreiteter Meinung annehmen, sie seien dann besonders gefestigt, wenn wir ausreichende Kenntnis in Betriebswirtschaft haben, also alle Regeln der Wertschöpfung im weitesten Sinne beherrschen. Warum ist das problematisch?
Nehmen wir der Einfachheit halber ein produzierendes Unternehmen und fragen uns, wie eigentlich eine wirtschaftliche Leistung entsteht. Das wären in diesem Falle marktfähige Endprodukte.
Produkte bestehen aus Rohstoffen oder vorgefertigten Teilen, die in einem Verarbeitungs- oder Veredelungsprozess fertiggestellt werden. Dazu brauchen wir eine bestimmte betriebliche Organisation, in der wir die Herstellung auf mehrere kooperierende Mitarbeiter verteilen. Wenn wir dann die Produkte am Markt verkaufen, ist die wirtschaftliche Leistung erreicht. Diese besteht aus dem Erlös aller Güter eines Unternehmens. Leistung ist, als Gegenbegriff zu Kosten, alles das, was wir mit einem unternehmerischen Aufwand erzielen. Das Ziel ist also definiert. Aber wie erreichen wir dieses Ziel? Das sagt uns die Betriebswirtschaft leider nicht. Oder finden wir dort Antworten auf zum Beispiel folgende Fragen:
Ist das Produkt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überhaupt herstellbar?
Haben wir das nötige Know-how und die entsprechenden Mitarbeiter?
Sind die Abläufe richtig geplant, können wir sie optimieren?
Wie organisieren wir die Zusammenarbeit? Funktioniert die Kooperation im Betrieb? Wo sind Schwachstellen?
Wie entwickeln wir neue Produkte, damit das Unternehmen morgen noch (mehr) Erfolg hat?
Ohne die Antworten parat zu haben, erahnen wir, dass diese Fragen wichtig sind für unternehmerischen Erfolg. Wir ahnen auch, dass die Betriebswirtschaft hierfür nicht zuständig ist. Offenbar muss man, um Ertrag zu erwirtschaften, mehr können als rechnen.
Und offenbar können wir das auch. Denn es kommt ja durchaus zu Wertschöpfung, wenn auch nicht immer und nicht immer optimal. Da sind wohl andere Kräfte mit am Werk, die wir kaum wahrnehmen, wenn wir den Fokus auf den betriebswirtschaftlichen Teil legen. Sollten wir alles Übrige tatsächlich dem Zufall überlassen?
Das wäre schade, weil wir Chancen verpassen würden, wie wir besser wirtschaften können. Schauen wir uns also an, welche weiteren Faktoren zum Erreichen einer wirtschaftlichen Leistung eine wichtige Rolle spielen. Neben dem angestammten Bereich der Betriebswirtschaftslehre, wir nennen das hier die Säule Wertschöpfung, haben wir es mit den Bereichen Wissen und Kommunikation zu tun.
Ich behaupte, dass jede wirtschaftliche Leistung, ganz gleich ob im produzierenden oder dienstleistenden Gewerbe, ob in großen oder kleinen Unternehmen, ob auf Unternehmens-, Projekt- oder Auftragsebene, dass also jegliche wirtschaftliche Leistung auf diesen drei Säulen steht.
Diese drei Säulen tragen jedes Unternehmen, jedes Projekt und jeden Job. Sie haben die Eigenschaft, dass, wenn eine der Säulen schwächelt, eine Schieflage entsteht. Die Stabilität dessen, was diese Säulen tragen, nämlich das Unternehmen oder das Projekt, hängt davon ab, ob alle drei gleichermaßen stark ausgeprägt sind.
Wie können wir uns das vorstellen?
Nehmen wir an, diese drei stehen nebeneinander und tragen ein gemeinsames Dach (Unternehmen, Projekt, Job). Innerhalb dieser Säulen können wir verschiedene Ebenen ausmachen, wobei die unterste Ebene sehr elementare Dinge enthält, sozusagen das Fundament. Die oberen, darauf aufbauenden Ebenen bestehen aus komplexeren Strukturen. Betrachten wir nun diese Säulen im Einzelnen. Sie sehen wie folgt aus:
Abb. 1: Drei Säulen des Unternehmens
Die linke Säule Wissen besteht aus (von unten nach oben) Zeichen, Daten, Informationen und Know-how. Daten, also strukturierte Zeichen, sind das Fundament, aus dem sich durch Kontextualisierung Informationen entwickeln, die durch mentale Verarbeitung, also durch Verstehen, zu Know-how und letztlich zu Wissen werden.
Die rechte Säule Wertschöpfung besteht aus Rohstoffen, Produkten, Erträgen und Kapital. Die aus Rohstoffen entwickelten Produkte ergeben Erträge, also Gewinn, der zu Kapital wird.
Die dritte, mittlere Säule Kommunikation enthält die Terminologie, die in Sätzen und Texten Niederschlag findet, woraus sich eine unternehmensspezifische Sprache bildet. Diese ist das Medium zur Verständigung bzw. zur Kommunikation im Unternehmen.
Die Elemente dieser Säulen beschreibe ich bewusst von unten nach oben, weil sie sich – man kann es erahnen – in eben dieser Richtung entwickeln. Diese Säulen wachsen mit der Zeit. Einzelne Elemente werden nach oben hin zu komplexen verdichtet. Mit anderen Worten:
Bis es zu Wissen kommt, müssen sich Daten zu Informationen strukturieren, die mental verarbeitet werden müssen.
Bis es zu Wertschöpfung kommt, müssen Rohstoffe zu Produkten verarbeitet und diese zu Gewinn gemacht werden.
Bis die Kommunikation funktioniert, muss die Sprache des Unternehmens, bestehend aus Terminologie und Texten, strukturiert und aktiv gebraucht, also lebendig gehalten werden.
Durch diesen Entwicklungsprozess, nennen wir ihn Veredelung, nehmen Stabilität und Wirkungskraft zu. Die Kräfte der Säulen entwickeln sich ebenso wie das Unternehmen. Je stärker sie sind, desto weiter ist das Unternehmen entwickelt. Wie können wir uns diese Veredelung vorstellen?
In der Säule Wissen geschieht dies durch mentale Verarbeitung. Indem wir uns mit Sachverhalten, mit anderen Menschen (und uns selbst) auseinandersetzen, können die aus Daten bestehenden Informationen zu Wissen verdichtet werden.
In der Säule Kommunikation bildet sich die Fähigkeit zur Verständigung, indem wir die sprachlichen Elemente täglich benutzen. Sprachliche Strukturen entstehen und werden verändert durch kollektiven Gebrauch.
In der Säule Wertschöpfung letztlich entsteht Kapital aus Erträgen, die mit den aus Rohstoffen entwickelten Produkten erwirtschaftet werden. Dies geschieht durch praktische Anwendung des Wissens (Know-how) innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette und durch die darin gewonnene Erfahrung.
Abb. 2: Veredelung, vertikale Entwicklung und Kräfte
Die Kräfte der drei Säulen haben nicht nur eine vertikale Wirkung, sondern wirken auch in horizontaler Richtung.
Horizontal, also zwischen den Säulen, haben wir auf der obersten Ebene schon gesehen, dass die Kraft des Wissens auf die Säule Kapital wirkt, vermittelt durch die Kraft der Kommunikation. In entgegengesetzter Richtung wirkt übrigens auch die Kapitalseite auf das Wissen. Man kann zum Beispiel aus der Art, wie Wertschöpfung erzielt wurde, Schlüsse ziehen und lernen, wie man den Weg vom Rohmaterial zum Kapital optimieren kann. Das kann zu neuem Wissen führen – sofern es einen Diskurs über die wertschöpfenden Prozesse gibt.
Auch auf den darunterliegenden Ebenen sind Kräftewirkungen zwischen den Säulen zu beobachten. Zum Beispiel auf der Ebene Informationen, Texte, Produkte. Sind nämlich Informationen textlich gut formuliert, also nachvollziehbar und verständlich, dann wirkt das auf die Entstehung der Produkte, weil der Produktionsprozess glatter verlaufen kann.
Wir merken: Die vertikalen und horizontalen Kräfte beruhen auf Diskurs. Wir können auch sagen: Sie sind wesentlich kommunikativer Natur. Das ist für die Säulen Wissen und Kommunikation leicht nachvollziehbar. Es gilt jedoch auch für den Bereich Wertschöpfung bzw. den Produktionsprozess (als Teil der Wertschöpfung).
Auf den ersten Blick scheint Produktion zwar eine lediglich technische Weiterverarbeitung zu sein. Sehen wir jedoch genauer hin, wird deutlich: Jeder Produktionsprozess wird, sofern das entsprechende Knowhow verfügbar ist, gedanklich geplant, sprachlich beschrieben, in Sprache erklärt und erst dann technisch umgesetzt. Wie das geschehen soll, darüber müssen sich alle Beteiligten verständigen. Auch darüber, ob das Vorgehen in der Praxis gut läuft. Sind Prozesse verbesserungsbedürftig (auch darüber muss man sich verständigen), werden sie wieder mit Hilfe von Sprache neu dirigiert und danach, sofern die Änderung verstanden wurde, technisch geändert. Was bliebe von unserem operativen Geschäft übrig, gäbe es hier keinen Diskurs?
Das heißt: Kommunikation steckt in allen Teilen. Damit alle Teile zusammenarbeiten können, ist Kommunikation unerlässlich. Die Säule Kommunikation, um im Bild zu bleiben, wirkt über sich selbst hinaus (dargestellt durch gestrichelte Linien in der folgenden Abbildung 3). Sie ist das Bindeglied zwischen Wissen und Wertschöpfung (horizontal). Und sie verhilft innerhalb dieser Bereiche zur Weiterentwicklung bzw. Veredelung (vertikal). Das Gesamtgeschehen vertikal und horizontal wird letztlich von diskursiven Kräften getrieben. Kommunikation ist die Schnittmenge von Wissen und Wertschöpfung.
Abb. 3: Kommunikation als Schnittmenge
Noch einmal zurück zu der Behauptung, dass diese drei Säulen nur gemeinsam die Kraft zu wirtschaftlicher Leistung haben.
Reicht es nicht aus, einen Know-how-gesteuerten Produktionsprozess zu haben, um Kapital bilden zu können? Brauchen wir nicht eigentlich nur zwei Säulen, also Wissen und Kapital? Wenn doch diese beiden gleich stark entwickelt sind, haben wir auf der einen Seite das Wissen und auf der anderen Seite niveaugleich das Kapital. Wissen ist doch Kapital, oder?
Leider nein. Weil beide nicht zueinander finden, das Wissen nicht zum Kapital und umgekehrt (Wissen macht nicht unbedingt reich und Kapital ist nicht unbedingt intelligent). Sie erreichen nicht automatisch das gleiche Niveau. Die beiden Säulen Wissen und Kapital funktionieren nämlich nicht von allein wie kommunizierende Röhren – es sei denn, man kommuniziert.
Wissen kann nur dann zu Kapital werden, wenn wir unser Wissen durch Kommunikation in die Tat umsetzen. Umsetzen, also operationalisieren, können wir nur dann etwas, wenn wir uns mit anderen darüber verständigen, dazu brauchen wir Kooperationsformen, welche auch immer: Jede Form der Zusammenarbeit ist auf Kommunikation angewiesen.
Deshalb sind die drei Säulen Wissen, Kommunikation und Wertschöpfung nur gemeinsam wirksam. Jede für sich alleine ist macht- und wirkungslos. Wissen an sich ist nutzlos, es sei denn, wir tragen es nach außen. Ein Produktionsprozess ohne das „Wissen-wie“ ist kein Prozess, sondern Chaos, aus dem weder ein Produkt, Gewinn noch Kapital erwachsen wird. Ebenso nutzlos wäre Kommunikation als Selbstzweck.
Die Kraft eines Unternehmens entsteht durch das Zusammenspiel dieser drei Säulen. Jedoch nicht wie bei den drei Musketieren nach dem Motto „Einer für alle und alle für einen“, sondern: Alle müssen gleich stark sein. Fällt einer aus oder ist einer schwächer als die anderen, werden alle geschwächt. Die Schwäche eines Einzelnen ist die Sollbruchstelle für das Ganze. Stellen wir uns hierzu ein paar Szenarien vor.
Wenn das Wissen schwach ist, schlägt das aufs Kapital, denn wir können nicht die intelligentesten Produkte erwarten, auch nicht besonders gute Prozesse.
Wenn die Kommunikation schwächelt, schlägt sich das auf der Kapitalseite nieder, weil mangelnde Verständigung zu Reibungsverlusten, also zu Gewinneinbußen führt.
Ist die Kapitalseite schwach, weil die Produkte nicht stimmen oder die Prozesse ineffizient sind, hilft auch starkes Wissen nicht, es sei denn, Letzteres produziert Ideen, die via Kommunikation zur Verbesserung führen. Mit viel Kapital und wenig Ahnung kann man sicher eine Zeit lang überleben. Aber woher kommen neue Ideen?
Wie man es dreht und wendet: Wir brauchen alle drei Säulen mit gleicher Kraft. Isoliert bewirken sie nichts. Gemeinsam können sie Wunder bewirken.
So sieht der Idealfall aus. Und in der Wirklichkeit?
Die häufigste Konstellation ist diese: Bei ausgeprägtem Know-how auf der einen Seite (Wissen) und viel Betriebsamkeit auf der anderen Seite (Wertschöpfung) ist die Kommunikation im Unternehmen schwach ausgeprägt, was dazu führt, dass die beiden Säulen Wissen und Wertschöpfung nur bedingt wirksam werden können.
Das wird selten bemerkt, weil eine Bremswirkung – falls sie denn überhaupt als solche konstatiert wird – nicht der Kommunikation sondern eher anderen Faktoren zugeordnet wird (Trägheit der Masse, unmotivierte Mitarbeiter, Konkurrenz aus China, Wirtschaftskrise, oder …). Man glaubt eben gerne, es ginge nicht anders.





























