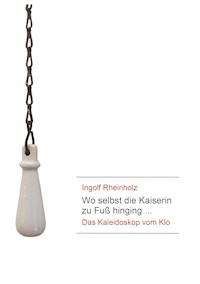
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jeder von uns verbringt täglich mindestens 15 Minuten auf der Toilette - in durchschnittlich 70 Lebensjahren befinden wir uns also neun Monate an dem Ort, wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht. Kein Wunder, dass das Klo nicht nur hier und heute von kulturgeschichtlicher Bedeutung ist: Schon Nofretete besaß in der Wüstenstadt Aton ein eigenes Stilles Örtchen, Anthony Quinn teilte sich in jungen Jahren einen Donnerbalken mit seiner Familie und die ersten Menschen im Weltall hatten recht irdische Probleme. Und wie behalfen sich eigentlich Adam und Eva ohne Klopapier?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Aldrin, Buzz: Die Aborte der Astronauten – Was auf dem Mond in die Hose ging
Kapitel 2
Bachseitz, Kurt: Spuk beim Zahnarzt – Wie der Geist Chopper aus der Kloschüssel sprach
Kapitel 3
Bardot, Brigitte: Diven vor und hinter der Klotür – Warum Liebhaber die Bardot und die Hepburn sitzen ließen
Kapitel 4
Bebel, August: Ordinäre Inszenierungen im Theater – Als Buh-Rufe noch das kleinere Übel waren
Kapitel 5
Bismarck, Otto: Wer wohnt schon gerne in Kackenberg? – Das richtige Wort für alle Fälle
Kapitel 6
Burns, Tom: Die Brillen-Schlange beim Psychiater – Fabeltiere in Klo und Kanalisation
Kapitel 7
Connery, Sean: Ein Stammplatz für den Oscar – Was Filmstars im Klo zur Schau stellen
Kapitel 8
Duchamp, Marcel: Wie ein Urinal zum Kunstwerk wurde – Ein Haufen Geld für „Merda d'artista“
Kapitel 9
Dulles, Allen W.: Vom Donnerbalken auf's Dixi-Klo – Wie japanische Soldaten den US-Geheimdienst täuschten
Kapitel 10
Dürer, Albrecht: Das Klo in der Küche – Warum man im Mittelalter mehr Bier als Wasser trank
Kapitel 11
Ebstein, Katja: Das Klo als Dreck-Apotheke – Wofür Urin noch heute gut sein soll
Kapitel 12
Ernst August: Das falsche Tun am falschen Örtchen – Was hätte der Prinz denn Anderes tun sollen?
Kapitel 13
Eva: Am Anfang war das Feigenblatt – Wie das Papier auf die Klorolle kam
Kapitel 14
Fallada, Hans: Der Reinfall mit dem Gummipötterchen – Was Kaiserin Sisi auf Reisen stets dabei hatte
Kapitel 15
Franz Joseph I.: Wohin der Kaiser zum Telefonieren ging – Das Besondere am WC von W.C
Kapitel 16
Gechter, Michael: Kondome aus gutem Hause – Der Abtritt als Schatzgrube für Historiker
Kapitel 17
Goethe, Johann Wolfgang von: Der Dichterfürst und sein „Pot schamber“ –Wie der Mensch auf den Nachttopf kam
Kapitel 18
Goloschtschonin, Tschaja I.: Schmutzige Indizien gegen Zarenmörder – Wie die Psyche auf den Darm schlagen kann
Kapitel 19
Guinness, Alec: Etikette bis zum letzten Hosenknopf – Wie peinlich ein Toilette-Fehler sein kann
Kapitel 20
Harington, Sir John: Das erste WC der Welt – Weil ein Dichter keine „Rosen pflücken“ wollte
Kapitel 21
Hemingway, Ernest: Wen das Fenster schlägt – So lebensgefährlich kann es auf der Toilette sein
Kapitel 22
Honecker, Erich: Flugblätter aus dem Klofenster – Was Nazi-Gegner auf die Toilette trieb
Kapitel 23
Isabella von Bourbon-Parma: Ein Nachtstuhl für die große Liebe – Wie gemütlich Franzosen zusammen drückten
Kapitel 24
Jennings, George: Wie das WC seine Brille bekam – Warum nicht jeder einen Sitzplatz wünscht
Kapitel 25
Joyce, James: Liebe auf den ersten Blick ins Klo – Wie prominente Männer sich daneben benommen haben
Kapitel 26
Karajan, Herbert von: Das Privatklo als Statussymbol – Warum James Brown ins Gefängnis raste
Kapitel 27
Kohl, Helmut: Der Klo-Spion im Kanzler-Jet – Wohin Notdurft zwischen Himmel und Erde führen kann
Kapitel 28
Lass, Barbara: Gefahr für Herz und Hirn – Warum Pressen plötzlich einen Infarkt auslösen kann
Kapitel 29
Laue, Max von: Die Wasserbombe des Nobelpreisträgers – Vom fahrlässigen Umgang mit dem Nachtgeschirr
Kapitel 30
Liselotte von der Pfalz: Klatsch und Schmutz aus Versailles – Beim Sonnenkönig stank es zum Himmel
Kapitel 31
Luther, Martin: Eine göttliche Eingebung – Was Menschen auf dem Klo so alles durch den Kopf ging
Kapitel 32
Marlar, Richard A.: Das Geheimnis der Koprolithen – Wie edle Wilde als Kannibalen entlarvt werden konnten
Kapitel 33
Marshal, Sir John: Wo die erste Spülung rauschte – Wie modern man schon vor Jahrtausenden am Indus hauste
Kapitel 34
Meysel, Inge: Von der Klotür in die Herzen der Fans – Welche Rolle die Toilette im Theater spielte
Kapitel 35
Mielke, Erich: Ein WC leistet Widerstand – Wie die Stasi es mit einem Klositz zu tun bekam
Kapitel 36
Moses: Mit der Schaufel durch die Wüste – Warum die Israeliten immer schön sauber blieben
Kapitel 37
Neuss, Wolfgang: Neben Ihnen steht einer – Was Prominente in der Toilette ertragen mussten
Kapitel 38
Nofretete: Die Schöne und ihr Klo – Wohin auch die Frau vom Pharao zu Fuß ging
Kapitel 39
Olivier, Laurence: Wenn die Spülung Schicksal spielt – Wie Sekt aus der Kloschüssel sprudelte
Kapitel 40
Patel, Vallabhbai: Nicht ohne meine Zeitung – Worüber Hemingway sich auf der Toilette amüsierte
Kapitel 41
Pöpel, Edgar: Wenn der Chef auf dem Klo schnüffelt – Wie pfiffige Arbeiter ihren Platz behaupteten
Kapitel 42
Pulver, Liselotte: Jokus auf dem Lokus – Welch groben Scherz sich die „rote Erzherzogin“ erlaubte
Kapitel 43
Quinn, Anthony: Jedem Po sein eigenes Klo – Der lange Weg der Toilette in die Intimsphäre
Kapitel 44
Ringelnatz, Joachim: Mit der Fluppe auf das Klo – Was heimliches Rauchen so alles angerichtet hat
Kapitel 45
Schlitt, Karl-Adolf: Wie ein U-Boot sich selbst versenkte – Auf hoher See werden alle Schiffer zu Akrobaten
Kapitel 46
Scholz, Gustav: Mord und Totschlag auf dem Klo – Wie „Bubi“ seinen letzten Kampf verlor
Kapitel 47
Schumacher, Michael: Mit Pampers auf die Piste – Wie Rennfahrer und Fußballer ihr Publikum verblüfften
Kapitel 48
Sim, Jae-duck: Als Glückskind geboren – Wenn eine Frau auf die Toilette geht und als Mutter wieder raus kommt
Kapitel 49
Simonis, Heide: Demokratie unter Blasendruck – Welch großen Einfluss kleine Geschäfte auf die Politik hatten
Kapitel 50
Skladanowsky, Max: Als die Bilder laufen lernten – Wie nicht nur der Nachttopf im Kino Karriere machte
Kapitel 51
Trudeau, Margaret: Sex auf dem Klo in allen Höhenlagen – Wie man Mitglied wird im Club 20000
Kapitel 52
Vélez, Lupe: Wie der „Vulkan von Mexiko“ erlosch – Freitod auf dem stillen Örtchen
Kapitel 53
Vespasian: Non olet – Wie man stinkreich werden kann, wenn man nicht die Nase rümpft
Kapitel 54
Victoria: Das erste WC in Deutschland – Wie lange der Hochadel noch am Nachttopf festhielt
Kapitel 55
Virchow, Rudolf: Das Ringen um die Rieselfelder – Warum die Berliner erst meckerten, dann aber länger lebten
Kapitel 56
Wells, Denise: Es lebe die Töpfchengleichheit – Warum Frauen gern zu zweit und Männer lieber allein auf dem Klo sind
Kapitel 57
West, Mae: Keine Angst vor Bakterien – Warum man vom Klo allein nicht krank wird
Kapitel 58
Winnetou: Sitzen statt Spritzen – Wie Männer in die Knie gezwungen werden und Frauen sich erheben
Kapitel 59
Wittelsbach, Ernst von: So machten es die alten Rittersleut
'
– Wie ein Bayer den rheinischen Frohsinn rettete
Kapitel 60
Xu Hu: Reich werden durch Verstopfung – Karrieren, die im Klo begannen
Kapitel 61
Zappa, Frank: Hose runter und hinsetzen – Wie unkonventionell Künstler ihre Meinung zeigten
Kapitel 62
Zum Schluss: Kreuz und quer durchs Klo
Vorwort
Jeder Mensch muss „müssen“. Im Durchschnitt einmal „Groß“ und fünfmal „Klein“ am Tag, wie Demoskopen ermittelt haben, worüber tagtäglich mindestens 15 Minuten vergehen. Weiter gerechnet über Wochen, Monate, Jahre hinweg, verbringt der Normalverbraucher von 70 Jahren seines Lebens etwa neun Monate auf der Toilette – und nur fünf Monate mit Sex.
Zugegeben: Die fünf Monate sind zweifelsohne die weitaus schöneren. Über sie wird ja auch wahrlich genug geredet und geschrieben. Dabei kann der Mensch, wenn es denn sein muss, monatelang ohne Sex auskommen – ohne die Verrichtungen auf dem Klo kaum einen Tag. Den Körper vorne und hinten zu entleeren ist das dringendste aller menschlichen Bedürfnisse. Das kann jeder bestätigen, der sich im Bedürfnisfall auf der falschen Seite der Klotür befindet – der davor stehen muss, nicht dahinter sitzen darf. Anders jedoch als der Sex ist die Toilette und alles, was im weiten Umkreis dazugehört, noch immer eine Tabuzone. Darüber spricht man wenig. Igitt! Darüber liest man nicht. Hier aber doch!
Die Toilette und ihr weiter Umkreis sind ein Mikro-Kosmos. In dieser diskreten Welt im Kleinen geschieht dasselbe wie in der großen weiten Welt (nur der Duft ist ein anderer): Klatsch und Skandale, Sex und Crime, Sterben und Morden, Genie und Wahnsinn, Geschäft und Karriere, Medizin und Politik, Kunst und Technik, Menschliches und Allzumenschliches. Über Ereignisse in allen diesen Lebensbereichen berichtet das Buch. Es ist keine trockene Chronik und keine umfassende Enzyklopädie, sondern eine Plauderei auf Papier, ein kurzweiliges Lese-Buch im wahrsten Sinne des Wortes. Mit vielen Geschichten aus Gegenwart und Vergangenheit sowie mit Ereignissen, die über den ovalen Brillenrand weit hinaus reichen. Mit ein bisschen Jokus vom Lokus, mit etwas Fortbildung für Klugscheißer, ab und an mit einem Aha-Erlebnis. Im Zweifelsfalle mit ebensolchem Augenzwinkern zu lesen, mit dem es geschrieben worden ist.
Dieses Buch kann, muss aber nicht unbedingt, auf dem stillen Örtchen gelesen werden. Seine Lektüre ist an jedem anderen Ort möglich. Keine Angst vor Nebenwirkungen: „Geschrieben stinkt Scheiße nicht“, beruhigt der französische Literaturkritiker Roland Barthes. Auch keine Angst vor Wiederholungen. Das böse Wort mit „Sch“ wird nicht noch einmal vorkommen. Es geht auch ohne. Ausgenommen in Zitaten, bei denen das unvermeidlich ist, sowie in Zusammensetzungen, in denen es nicht mehr so schlimm erscheint.
Dieses Buch hat seine eigene Geschichte, und die ist eine Personalie wert:
Schwiefert, Anna, geborene Seidel, verwitwete Kristen, war die große Liebe meiner jungen Jahre – meine Oma. In den Sommerferien durfte ich aus dem nordmärkischen Flecken Zechlin zu ihr in den chemiedurchwehten Vorort Erkner bei Berlin fahren. Oma wohnte in der Breitscheidstraße 55/56, in Stube und Küche unterm Dach sowie mit einem Plumpsklo auf dem Hof, das nur über die hölzerne Abdeckung der Senkgrube davor zu erreichen war. Deren Bohlen waren im Laufe der Jahre brüchig geworden, worauf Oma mehrmals hingewiesen hatte – erfolglos. Eines Sommers, es muss Anfang der 1950er Jahre gewesen sein, geschah, was geschehen musste.
Nach dem Frühstück griff Oma sich den großen eisernen Schlüssel mit dem Markknochen als Anhänger und verschwand nach unten. Sie kam und kam nicht wieder. Eine Ewigkeit später schnaufte sie die Treppe hoch, noch immer empört über das, was ihr widerfahren war: Die morschen Bohlen hatten nachgegeben, und sie war bis zum Bauchnabel in die Senkgrube eingetaucht! Glücklicherweise hatte ihre Freundin, Frau Sielisch von nebenan, das Malheur mitbekommen. Sie befreite Oma aus ihrer Notlage, sorgte für eine gründliche Säuberung und versorgte sie mit sauberer Wäsche. Es war gerade noch mal gut gegangen!
Der Clou folgte am nächsten Vormittag. Nun endlich erneuerten Handwerker die Abdeckung der Senkgrube. Oma betrachtete ihr Tun mit grimmiger Genugtuung und sprach dann den mir unvergesslichen Satz: „Ja, ja, erst muss das Kind in den Brunnen fallen ... “ Weder das eine noch das andere stimmte!
Diese Geschichte ist wahr. Ehrlich! Sie hat Nachwirkungen bis heute. Seit der Beinahe-Katastrophe auf dem Plumpsklo in Erkner bin ich sensibilisiert für den Themenkreis Toilette und alles, was im weiten Umkreis dazugehört. Von nun an bin ich zwar nicht mit einer Klo-Brille auf der Nase herumgerannt, habe aber immer ein Auge auf das gehabt, was darüber berichtet wurde. Mal eine Meldung in der Zeitung, mal eine Begebenheit aus einem Buch. Ich sammelte alles. Für später, zum Schreiben als Zeitvertreib im Rentenalter.
Später kam früher als gedacht. Im April 1997 wurde ich krank – Darmkrebs, ausgerechnet. Nun hatte ich zwar die Zeit zum Schreiben, aber nicht die Kraft dafür. Dazu verhalfen mir allmählich wieder meine Retter in Weiß, im Besonderen Dr. Michael Fromm sowie Professor W. Heitland und Professor H.W. Präuer aus München. Ihnen und ihren MitarbeiterInnen sei gedankt. Und vor allem Mauzo, meiner Frau, die mitgelitten und mitgeholfen hat.
Kapitel 01
Die Aborte der Astronauten – Was auf dem Mond in die Hose ging
Aldrin, Buzz, Apollo-11-Astronaut, war auf dem Mond zwar nur die Nr. 2, mogelte sich aber mit einem dringenden menschlichen Bedürfnis doch noch in die Ersten-Liste.
Bei der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969 hatte Kommandant Neil Armstrong auf seinem Recht auf Vortritt bestanden und jenen kleinen Schritt getan, der „ein großer Sprung für die Menschheit“ sein sollte. Aldrin folgte 20 Minuten später. Er machte keine großen Worte, sondern betrachtete nachdenklich den Staub, den er mit seinem ersten Schritt im Meer der Ruhe aufgewirbelt hatte und tat dann etwas, das er erst Jahre später öffentlich machte: „Neil ist zwar der erste Mensch, der den Mond betreten hat, aber ich war der erste, der sich auf dem Mond in die Hose gemacht hat“ – wobei ihm Millionen ebenso begeisterte wie ahnungslose Erdmenschen per Fernsehen zuschauten.
Peinlich war Buzz Aldrin seine Ersttat überhaupt nicht. Denn für einen Notdurftfall war vorgesorgt und der Raumanzug dementsprechend konstruiert worden. Der vordere Auslass des männlichen Körpers war über einen Schlauch mit dem Eingang einer Zweit-Blase aus Kunststoff verbunden, die der Astronaut an der Hüfte trug. In ihr wurde der Urin so lange zwischengelagert, bis er in der Landefähre verstaut werden konnte. Der jungfräuliche Boden des Mondes blieb unbefleckt.
Selbst wenn Edwin E. Aldrin nicht nur seine Blase sondern auch noch den Darm hätte entleeren müssen, wäre das keine Katastrophe gewesen. Er trug bei der sogenannten Außerbord-Aktivität eigens dafür entwickelte Unterwäsche; dazu gehörten besonders gut abgedichtete Hosen, die zwar Luft, aber keine Flüssigkeit durchließen, und die mit saugfähigem Material ausgelegt waren. Anschaulicher formuliert: Der Supermann steckte in Windeln. Drastischer noch: Er trug sein Klo am Körper.
Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat nie ein Geheimnis aus den Apollo-Pampers gemacht. Im Gegenteil, sie stellte sie sogar zur Schau. Unter anderem im Science Museum in London die Spezial-Windelhose, die Alan Shepard von der Apollo-14-Crew im Februar 1971 beim Steinesammeln und Golfspielen auf dem Mond getragen, ganz offensichtlich aber nicht benutzt hat.
Zehn Jahre zuvor hätte derselbe Mann eine derart nützliche Unterwäsche dringend nötig gehabt. Am 5. Mai 1961 lag Alan Shepard in seiner Mercury-Kapsel – flach auf dem Rücken, das Becken höher als der Kopf, die Oberschenkel senkrecht nach oben, die Unterschenkel rechtwinklig abgeknickt. Er wartete darauf, als erster Amerikaner von einer Rakete in den Himmel gehoben zu werden. Weil nur ein kurzer Hüpfer von 15 Minuten vorgesehen war, gab es keinerlei Vorkehrungen für Hygiene an Bord. Die Folgen des Versäumnisses hatte der Astronaut – buchstäblich – auszubaden.
Die Lage seines Körpers löste den Gauer-Henry-Reflex aus (benannt nach dem deutschen Arzt Otto Gauer und seinem amerikanischen Kollegen James Henry). Er läuft wie eine Kettenreaktion ab: Aus den hochgelagerten Beinen strömt mehr Blut in den Oberkörper, Sensoren im Herzen erfassen dieses Anfluten, und Hormone aktivieren daraufhin die Nieren, die nun mehr Harn produzieren, um über die Blase ein vermeintliches Zuviel an Flüssigkeit auszuscheiden.
Der erste Mensch im Weltraum hatte vor dem Start ein ähnliches Problem mit der Blase gehabt, allerdings eine andere Lösung dafür gefunden. Gagarin hatte während der Vorbereitungszeit reichlich Tee getrunken und dieser drängte auf dem Weg zur Startrampe immer heftiger, den Körper zu verlassen. Der Kosmonaut wusste sich zu helfen. Er stoppte den Bus, nestelte sich durch die vielen Lagen seines Raumanzugs und ließ an einem Reifen des Fahrzeugs dem Urin freien Lauf. Seine Befreiungstat wurde Tradition. Seither legen alle russischen Kosmonauten sowie ausländischen Gaststarter im Raumfahrtzentrum Baikonur auf dem Weg zur Startrampe eine solche Pinkelpause ein.
Sowohl Astro- als auch Kosmonauten hatten in den frühen Jahren der Raumfahrt dasselbe Handicap: In ihren kleinen Kapseln war einfach nicht Platz genug für ein Klo (erst 1973 kreiste in dem amerikanischen Skylab die erste Toilette um die Erde). Wer damals „musste“, der musste Prozeduren vollziehen, die unangenehm und, nun ja, anrüchig waren. Diese Kehrseite des technischen Fortschritts haben Edwin E. Aldrin und alle seine Apollo-Kameraden so erlebt:
Das „kleine Geschäft“ war vergleichsweise einfach erledigt. Die Raumschiffer koppelten ihr bestes Stück mittels einer Art Kondom als Adapter an einen Schlauch. Durch ihn wurde der Urin in einen Abwassertank gesaugt und von dort über Bord verklappt. Sein Ausstoß bot jedes Mal den Akteuren ein faszinierendes Schauspiel: Vakuum und Kälte verwandelten den Urin in glitzernde Kristalle, Myriaden davon umhüllten die Kapsel und entschwebten allmählich in des Weltraums unendliche Weiten. Ganz ohne Komplikationen verlief diese Prozedur nicht immer. Bei Charles Duke von Apollo 16 beispielsweise verlor das Koppelstück den Anschluss an seinen Körper und Urin rieselte daneben. Das Opfer nahm die Panne gelassen hin, als „warmer Strom am linken Bein und ein Stiefel voll Urin“.
Das „große Geschäft“ machte weitaus mehr Umstände. Mittel zum Zweck war ein Plastikbeutel. Zunächst wurde dieser mit einem Klebestreifen passgenau am Hinterteil befestigt um die festen Ausscheidungen aufzunehmen. War das erledigt, musste dem Beutel ein Desinfektionsmittel zugesetzt und mit dem Inhalt kräftig durchgeknetet werden, um Bakterien zu töten, die sonst Gärung und Geruch verursacht hätten. Letztendlich landete die Packung in einer Art Container, als ein Mitbringsel zur Erde. Diese Verfahrensweise zog sich über eine Stunde hin, oft noch länger. Für den Fall, dass ein Astronaut währenddessen sich erbrechen musste, war dem Klo-Kit noch eine Tüte beigefügt. Auch dabei verlief nicht alles nach Vorschrift. Bei Apollo 10 etwa haperte es nach Gebrauch des Beutels mit dem Verschluss und ein kleines Häufchen entschwebte in die Kabine. Thomas Stafford, Eugene Cernan und John Young hänselten sich gegenseitig wegen der Herkunft des Stücks Anstoß; Houston hörte mit, doch welchem der drei Astronauten das Missgeschick widerfahren war, blieb ungeklärt.
Angesichts dieser Umstände ist es verständlich, dass die Raumfahrer sich vor dem „Drücken“ drücken wollten. Für dieses Verlangen fanden sie Verständnis bei den NASA-Chefs und auch Hilfe. Der Stuhlgang im Weltraum konnte natürlich nicht gänzlich verhindert, wohl aber durch Manipulation des Darmes vermindert werden. „Vor dem Start wurden im Allgemeinen ballaststoffarme Kost und Abführmittel genutzt. Während des Fluges wurden zusätzlich zu dieser Ernährung auch Medikamente angewendet, um die Darmbeweglichkeit zu verringern“, berichtet ein offizielles Apollo-Abschlussdokument. Eigentlich sind diese Medikamente zur Behandlung von Durchfall bestimmt gewesen, ihre Anwendung zur Verringerung der Ausscheidungen war eindeutig ein Missbrauch. Nichtsdestoweniger druckte ein Hersteller hinterher stolz auf die Packungen: „Benutzt von Astronauten während der Gemini- und Apollo-Raumflüge.“
Auf andere Weise musste sich in einem Notfall die Besatzung der sowjetischen Raumstation Mir behelfen. Im Juni 1997 war sie von einem unbemannten Versorgungsschiff gerammt worden, wobei Sonnenzellen für die Stromerzeugung beschädigt wurden. Bis der Schaden behoben war, saß die Mannschaft unter Wassili Ziblijew im Dunkeln, konnte sich kein Essen warm machen und die Toilette nicht benutzen. Sie meisterte die Situation mit einem strikten Sparprogramm: Wenig trinken und kaum etwas essen, um Blase und Darm möglichst ruhig zu stellen. Nur wenn es nicht länger auszuhalten war, wurde die ganze Raumstation gezielt zur Sonne hin ausgerichtet. So verschafften sich die Männer wieder Elektrizität für einige Minuten und eine ebenso knappe Zeit fürs „große Geschäft“.
Die Toilette der russischen Mir-Station funktionierte im Prinzip ebenso wie die der amerikanischen Space-Shuttle-Raumtransporter – wie ein Staubsauger, dessen nach unten gerichteter Luftstrom in der Schwerelosigkeit die Wasserspülung ersetzte. Bei der NASA sollte sie noch moderner sein und noch feiner funktionieren. Deshalb ließ man sich allein den Prototyp mehr als 23 Millionen Dollar kosten, und deshalb mussten alle Shuttle-Astronauten ein ganz spezielles Toiletten-Training absolvieren. Geübt wurde das Kunststück, hinterwärts den Haufen genau in der Mitte einer nur handtellergroßen Stelle am Boden der Kloschüssel abzusetzen; dort war der Luftstrom am stärksten und seine Wirkung am besten. Wie gut oder schlecht das gelang, wurde von unten mit Bildern einer Fernsehkamera kontrolliert. Erst wenn die Zielgenauigkeit zufriedenstellend war, erhielt der Abort-Absolvent die Starterlaubnis.
In der Praxis allerdings war die US-Sanitärtechnik, gelinde gesagt, recht störanfällig. Bei zwei von drei Shuttle-Flügen bereitete sie anfangs unliebsame Überraschungen. Entweder hatte sich Toilettenpapier um eine Art Quirl im Gehäuse gewickelt und die ganze Anlage lahmgelegt, oder das Abflussrohr nach außen war durch einen Eiszapfen verstopft, oder ein Ventil klemmte, so dass die Benutzer eine Zange aufs Klo mitnehmen mussten.
Besonders übel erging es Frau und Mannschaft der Mission STS-7 mit dem Shuttle Challenger im Juni 1983. Und das auch noch bei einer Premiere: Mit der Physikerin Sally Kristen Ride startete zum ersten Mal eine Amerikanerin in den Weltraum. Große Umstände hatte die NASA wegen der Frau an Bord nicht gemacht. Einzig der Einlauftrichter am Schlauch zum Auffangen des Urins war der weiblichen Anatomie angepasst worden – mehr oval, nicht kreisrund wie bei den Männern. Dank dem herrschte im Himmel die „potty parity“ (= Töpfchengleichheit), für die Wells, Denise auf Erden noch kämpfte: Sally Ride konnte im Stehen pinkeln. Das große Geschäft erledigte sie ohnehin wie ihre männlichen Mitflieger – allerdings zog sie einen Vorhang zu, wenn sie die Hosen runterlassen musste.
Drei Tage lang ging das gut. Dann meldete Challenger an Houston ein Problem, das zuvor schon Astronauten in Schwesterschiffen das Leben schwer gemacht hatte: Der Luftstrom der Toilette änderte plötzlich seine Richtung; anstatt die Fäkalien aus dem Klo nach unten abzusaugen, schleuderte er sie nach oben gegen die Brille – und wohl auch noch ein bisschen weiter.
Wie Sally Ride und ihre vier Begleiter drei Tage und drei Nächte lang den Gestank ertragen und den Ausfall der Toilette bewältigt haben, ist bis heute ihr Geheimnis. Schon damals wurde offiziell kein Wort darüber verloren; alle diesbezüglichen Mitteilungen zwischen Shuttle und Bodenstation wurden nicht über Sprechfunk, sondern mit abhörsicheren Fernschreiben ausgetauscht – „Top Secret“. Selbst als Challenger vorzeitig am 24. Juni 1983 auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien landete (nicht wie üblich nahe beim Startplatz Cape Canaveral in Florida), wurde dieses Ausweichmanöver mit dem an sich unbedeutenden Ausfall zweier Hilfsstromaggregate begründet. Dass das nichts anderes als eine ganz faule Ausrede war, witterte das Bodenpersonal sofort nach der Landung. Als sich die Tür öffnete, entwich dem Raumtransporter ein derart penetranter Latrinengeruch, dass er nur mit dem Schutz durch Atemmasken betreten werden konnte.
Wenn heute relativ wenig Klagen über das Klo im Kosmos zu hören sind, liegt das auch daran, dass allein noch die Internationale Raumstation ISS einsam ihre Kreise um die Erde zieht; mal abgesehen vom Pendelverkehr zur Ver- und Entsorgung und zum Austausch der Mannschaft. Daraus zu folgern, dass die Toiletten dort wartungsfrei funktionieren würden, wäre ein Trugschluss. Es gab den denselben Ärger wie zuvor.
Als die ISS noch fliegen lernte, war nur ein Abort an Bord, und zwar im russischen Modul Swesda. Sieben Jahre lang funktionierte es zur Zufriedenheit der internationalen Besatzung. Im Mai 2008 versagte es, plötzlich und unerwartet. Die Pumpe, die Flüssiges vom Festen trennte, war ausgefallen und mit ihr der Luftstrom zum Absaugen der Exkremente. Die drei Mann an Bord kannten einen Ausweg – hinüber in die russische Sojus-Kapsel, die vorsichtshalber als Rettungsboot angekoppelt war. Dort lagerten Plastikbeutel, ähnlich den „Apollo Bags“, die bereits Buzz Aldrin gebraucht hatte. Nötigenfalls genügten sie für die Notdurft: hineinmachen, zumachen und sich wieder wohlfühlen! Ein Besatzungsmitglied bastelte eine Zwischenlösung und meldete an das russische Flugleitzentrum in Koroljow bei Moskau: „Der Defekt konnte mit Bordmitteln behoben werden.“ Zur selben Zeit waren bereits Originalersatzteile unterwegs nach Cape Canaveral in Florida, und wenige Tage später brachte das Shuttle Discovery die Fracht zur Raumstation.
Spätere Probleme hatten denselben Ursprung, nämlich in der Pumpe, und sie fanden dieselbe Lösung: Mit dem Shuttle kam der Klempner. Heute sind Komplikationen mit dem Abort im Orbit längst nicht mehr so schwerwiegend. Mittlerweile gibt es drei Toiletten in der ISS. Wenn es sein muss, dann kann man ja beim Nachbarn aufs Klo gehen.
Bis zum Jahr 2020 soll die Raumstation in Dienst sein. Wie es danach im Weltraum weitergehen wird, ist noch völlig offen. Vielleicht fliegt wirklich einmal ein Mensch zum Mars, möglicherweise sogar mit einer perfekt funktionierenden Toilette (sie müsste mindestens zwei Jahre lang durchhalten). Sollte jedoch irgendwann wieder ein amerikanischer Astronaut auf dem Mond landen, dann hat er einen speziellen Auftrag der NASA zu erfüllen. Buzz Aldrin und Neil Armstrong haben im Jahre 1969 im Apollo-Landeteil jeweils zwei kleine und zwei große Beutel voller Ausscheidungen hinterlassen. Diese sind zu bergen und zur Erde zu bringen. Zu einer genauen Untersuchung, wie die Bakterien in ihnen die lebensgefährliche kosmische und solare Strahlung ertragen beziehungsweise ob sie diese überhaupt überlebt haben.
Richard L. Sauer und George K. Jorgensen: Biomedical Results of Apollo, NASA-Internet-Publikation + New Scientist vom 1. April 1982 + stern, Nr. 35/97 + Die Welt vom 28. Juni 1983
Kapitel 02
Spuk beim Zahnarzt – Wie der Geist Chopper aus der Kloschüssel sprach
Bachseitz, Kurt, Zahnarzt in Neutraubling (Oberpfalz), muss von allen guten Geistern verlassen gewesen sein, als er einen bösen Spuk inszenierte.
Anscheinend aus dem Nichts ertönte ab April 1981 in seiner Praxis eine Stimme, die sich „Chopper“ nannte. Anfangs schaltete sie sich in Telefonate zwischen Arzt und Patient ein: „Was du machst, das bringt ja doch nichts.“ Dann krächzte und quäkte sie, (vermeintlich) aus der Kloschüssel und aus dem Spuckbecken neben dem Behandlungsstuhl. Patienten mussten sich auf einen Anschiss gefasst machen: „Nimm deinen Hintern weg“, tönte es einer Frau auf der Toilette entgegen und „Mach deinen Mund zu, du stinkst“ einem Mann, der gerade in das Becken spucken wollte.
Chopper geisterte bald durch den ganzen deutschen Blätterwald. „Die Stimme ist kalt, hallt nach und klingt blechern. Es ist eine Stimme, die dem Zuhörer einen Schauer über den Rücken jagen kann“, meldete eine Münchner Boulevardzeitung in ihrer ständigen Rubrik „Spuk in der Zahnarztpraxis“. Dank derart guter Presse war „der Geist aus der Toilettenschüssel“, so sein populärer Beiname, auf dem besten Wege, zumindest in Bayern das zu werden, was anderswo die Weiße Frau oder ein Poltergeist ist – ein Lockvogel für Okkult-Touristen, die gar zu gerne ausziehen, das Gruseln zu lernen. Selbst Experten konnten die Karriere des Sprach-Wunders aus dem Klo nicht stoppen. Weder der Parapsychologe, den Chopper verhöhnte: „Hau ab, ich bin nicht schwul.“ Noch die Techniker der Bundespost, die Fangschaltungen installierten und Detektoren bis in die Kanalisation verlegten, ohne jeden messbaren Erfolg.
Dr. med. dent. Kurt Bachseitz hat nie verraten, warum und wie Chopper seine Praxis heimsuchte. Auffällig jedoch war, dass der Geist sich nur dann zu Worte meldete, wenn die junge Zahnarzthelferin Claudia zugegen war und währenddessen den Anwesenden den Rücken zuwandte – montags nie, denn dann war Claudia in der Berufsschule. Schließlich kam die „Sonderkommission Geist“ der Regensburger Kripo dem Spuk auf die Schliche. Beamte beobachteten in einem Spiegel, wie die Helferin die Lippen bewegte, als Chopper wieder einmal böse Worte von sich gab. Sie konstatierten „Tricks mit der menschlichen Stimme, begünstigt durch die ungewöhnliche Akustik der Praxis, vor allem durch die gekachelten Wände“, als äußerst irdische Ursache des übersinnlichen Geschehens. Da gab Chopper seinen Geist auf, Kloschüssel und Spuckbecken verstummten für immer.
Die letzte Geisterstunde schlug im Gericht. Claudia wurde wegen Vortäuschens einer Straftat, Beleidigung und Bedrohung schuldig gesprochen; als Minderjährige kam sie mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe von 1.500 Mark davon. Ihr Chef und seine Frau Margot mussten weitaus mehr zahlen; obendrein stellte die Bundespost für ihre vergeblichen Bemühungen 35.000 Mark in Rechnung. Sie wurden verurteilt, weil das Gericht davon ausging, dass der Spuk im Kopf der Ehefrau entstanden war und die ersten Zwischenrufe beim Telefonieren aus ihrem Munde kamen; erst danach hätten ihr Mann und seine Helferin als Chopper mitgemacht.
Für Dr. Kurt Bachseitz kam strafverschärfend noch hinzu: Er musste sich psychiatrisch behandeln lassen – so sehr war Chopper ihm auf den Geist gegangen.
Abendzeitung vom 5. März 1982 + Süddeutsche Zeitung vom 28. Februar 2002
Kapitel 03
Diven vor und hinter der Klotür – Warum Liebhaber die Bardot und die Hepburn sitzen ließen
Bardot, Brigitte, französische Filmschauspielerin („Ein Weib wie der Satan“), musste die enttäuschende Erfahrung machen, dass Liebe auf dem Klo nicht nur einen Höhepunkt erreichen (wie bei Trudeau, Margaret), sondern dort auch ihr Ende finden kann.
Lange bevor sie ihr Herz für Tiere entdeckte, hatte sie es an Gilbert Bécaud verloren. Sie folgte dem Chansonnier nach Genf, wo seine Tournee im Februar 1958 Station machte. Verborgen vor Fans, Fotografen und vor allem vor Madame Bécaud. Vermummt mit einem Schal bis hoch zum berühmten Schmollmund und unter der hochgeschlagenen Kapuze des Mantels. Versteckt in einer winzigen Toilette neben der Garderobe des Geliebten. Da saß sie nun auf dem Klodeckel und wartete und wartete und wartete. Vor dem Auftritt, während der Pause und auch noch nach der Vorstellung, als das Licht längst ausgeschaltet war. Gegen 2 Uhr in der Frühe wurde sie endlich von einem Adlatus erlöst. Wer nicht kam, das war „Monsieur 100.000 Volt“. Der versprühte seine Hochspannung derweilen anderswo. „Ich weinte vor Wut, Ohnmacht, Verzweiflung und Müdigkeit und schwor mir wieder einmal, dass ich nie wieder im Leben die Geliebte eines verheirateten Mannes sein würde“, wütete die sitzengebliebene Schönheit in ihrer Abschiebe-Zelle. „Nie wieder wollte ich mich in einen Abstellraum, ja schlimmer noch, in ein Scheißhaus sperren lassen.“ Mit dem nächsten Zug verließ Brigitte Bardot sowohl Genf als auch Gilbert Bécaud – und den für immer!
Ein gleichermaßen enttäuschendes Erlebnis wird von Katherine Hepburn („Die Frau, von der man spricht“) berichtet. Auch der amerikanische Filmstar beendete eine Liebe wegen einer Toilette-Affäre, und schuld daran war ebenfalls der Mann. Doch der Verlauf war ganz anders!
Ende der 40er Jahre hatte sich Howard Hughes, das Manager-Multi-Talent im Big Business dieser Zeit, sterblich in sie verliebt. Die Schauspielerin schien schließlich geneigt, ihn zu erhören und fuhr in sein Schlafzimmer mit ihm. Es hätte eine tolle Nacht werden können. Hätte. Wenn nicht der Multi-Milliardär so seine Macken gehabt hätte. Eine davon war die krankhafte Sorge um die Entsorgung seines Darms. Erst befürchtete er es nur, dann hatte er tatsächlich eine chronische Verstopfung. Einmal soll er deswegen geschlagene 26 Stunden auf der Brille verbracht haben. Wie immer ohne den erhofften Erfolg. Einer seiner Leibwächter musste schließlich wieder mit einem Klistier nachhelfen.
Kurz bevor Howard Hughes an diesem Abend zur Sache kommen konnte, trieb es ihn auf die Toilette. Da saß er nun und presste und presste und presste. Auch Katherine Hepburn wartete, jedoch längst nicht so lange wie Brigitte Bardot. Nach einer dreiviertel Stunde waren ihr sämtliche Liebesgefühle vergangen. Sie rauschte davon und war nicht mehr zur Umkehr zu bewegen. Nie wieder. Katherine Hepburn und Howard Hughes blieben, wie es so schön heißt, gute Freunde.
Brigitte Bardot: B. B. Memoiren, Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1996 + Noah Dietrich und Bob Thomas: Howard Hughes – The Amazing Mr. Hughes, Fawcett Publication Inc., Greenwich, 1977
Kapitel 04
Ordinäre Inszenierungen im Theater – Als Buh-Rufe noch das kleinere Übel waren
Bebel, August (1840-1913), Urgroßvater der deutschen Sozialdemokratie, war sowohl ein tatkräftiger Parteipolitiker als auch kulturbeflissener Vorsitzender des Arbeiterbildungsvereins in Leipzig. Als solcher ging er gern ins Theater. Unvergesslich geblieben ist ihm eine Vorstellung im Berlin des Jahres 1867. Nicht wegen guter Darbietungen auf der Bühne, sondern wegen seltsamer Sitten auf der Herren-Toilette.
„Eines Abends besuchte ich mit meiner Frau das Königliche Schauspielhaus. Ich war entsetzt, als ich in einem Zwischenakt in den Raum trat, der für die Befriedigung kleiner Bedürfnisse der Männer bestimmt war. Mitten im Raum stand ein Riesenbottich, längs den Wänden standen einige Dutzend Pots de Chambre (Nachttöpfe, Anm. d. A.), von denen man den benutzten höchst eigenhändig in den großen Kommunebottich zu entleeren hatte. Es war recht gemütlich und demokratisch“, beschrieb Bebel eine der bleibenden Erinnerungen „Aus meinem Leben“.
In Zeiten davor hätte sich wohl kaum jemand über derart ordinäre Zustände im nahen Umfeld der schönen Künste gewundert. Kunstliebende Menschen sind nicht immer und überall konsequent Ästheten gewesen, und in Musentempeln ging es längst nicht immer so zivilisiert zu wie heute. Das bestätigen Szenen, die sich noch Mitte des 18. Jahrhunderts im Theater von Venedig abgespielt haben. Zuschauer, die ihr Wasser nicht halten konnten, entleerten sich ganz ungeniert während der Vorstellung in den Gang zwischen Bühne und erster Reihe. Missfielen die Leistungen der Schauspieler oder Sänger, wurden diese am Ende nicht nur mit schrillen Pfiffen und üblen Beschimpfungen bedacht, wie der Autor Roberto Gervaso berichtet: „Sie dienten auch als Ziel massiver Bombardierung durch Abfälle und Kot, die manche vorsorglich von zu Hause mitgebracht hatten, andere aber erst an Ort und Stelle selbst fabrizierten.“
Gleiches hat sich in französischen Schauspielhäusern zugetragen. Daran erinnert sich der Comte Bussy-Rabutin in seinen Memoiren: „Die Damen de Saulx, de la Tremouille und die Marquise Le Ferte begaben sich nach einer üppigen Mahlzeit in die Komödie. Sie wurden von einem plötzlichen Bedürfnis gezwungen, das, was sie nicht zurückhalten konnten, in ihrer Loge zu entleeren. Dann aber fühlten sie sich vom Gestank so belästigt, dass sie ihre Exkremente zusammenpackten und ins Parterre hinabwarfen.“ Buuuh!
August Bebel: Aus meinem Leben, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Stuttgart, 1997 + Roberto Gervaso: Casanova, Paul List Verlag, München, 1977
Kapitel 05
Wer wohnt schon gerne in Kackenberg? – Das richtige Wort für alle Fälle
Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898), preußischer Politiker und deutscher Reichskanzler, war nicht nur die menschgewordene Pickelhaube, als die er in die Weltgeschichte eingegangen ist. Der Paradepreuße konnte, wenn er wollte, ein sehr charmanter und wortgewandter Gesellschafter sein.
Bei einem Abendessen wollte er. Die Gattin eines ausländischen Diplomaten war seine Tischdame. Sie sprach gut Deutsch und beklagte sich darüber, dass so viele deutsche Worte dasselbe bedeuten würden, zum Beispiel „senden“ und „schicken“ oder „sicher“ und „gewiss“. „Das sind keine Synonyme“, belehrte Bismarck sie. „Ihr Gemahl ist zweifelsohne ein Gesandter, aber kein geschickter. Und wenn jetzt ein Feuer ausbräche, würde ich sie an einen sicheren Ort bringen, keineswegs an einen gewissen.“ Übrigens: Als Bismarck das im Jahre 1860 gesagt haben soll, war er preußischer Gesandter am Zarenhof in St. Petersburg, und zwar ein geschickter.
Der Monarch, der zu dieser Zeit noch König von Preußen war, beendete eine andere Wortklauberei sehr viel deftiger. Als Friedrich Wilhelm IV. von der ostpreußischen Stadt Gumbinnen an der Pissa gebeten wurde, den anstößigen Namen des Flusses ändern zu dürfen, vermerkte er huldvoll am Rand des Gesuches: „Genehmigt. Schlage vor: Urinoko.“ Seine Majestät beliebten zu scherzen.
Es gibt eben gewisse Orte, die einen bestimmten Namen tragen, der immer wieder als Anlass zu üblen Scherzen herhalten muss. Kackenberg im Westerwald gehörte einst dazu. Bis die Bewohner das nicht länger hinnehmen wollten und mit Erfolg auf Umbenennung in Neuhochstein bestanden. Glücklich sind auch die Einwohner von Pinklhof bei Regensburg darüber, dass sie heute in Oberroith wohnen. 06386 Pißdorf und 06231 Pissen jedoch gibt's immer noch (in der Nähe von Halle an der Saale), sowie, ganz idyllisch, den Weiler Pups bei Unterlaus in Oberbayern.
Die Welt vom 29. Mai 1993 + Abendzeitung vom 7. September 1988
Kapitel 06
Die Brillen-Schlange beim Psychiater – Fabeltiere in Klo und Kanalisation
Burns, Tom, Professor für Psychiatrie an der St. George's Hospital Medical School, University of London, sieht in der Regel in scheinbar unerklärlichen Erscheinungen nichts anderes als Symptome einer psychischen Störung und nimmt sie zum Anlass, den betroffenen Menschen zu behandeln. Dass es Ausnahmen davon geben kann, weiß er, seit ihm selbst so etwas widerfahren ist – ausgerechnet auf dem Klo.
Indische Kollegen hatten ihn nach Bangalore eingeladen. Gleich nach der Ankunft fotografierte Professor Burns, so wie er es auf allen Reisen tut, die Unterkunft. Das Bett, die Sitzecke und auch die Toilette. Was er dort durch den Sucher sah, versetzte ihn in Angst und Schrecken: Eine riesige Kobra, die sich um die Kloschüssel schlängelte! Entsetzt schmetterte er die Tür ins Schloss und retirierte zu seinen Gastgebern. Diese nahmen sich seiner wie eines Patienten an, sprachen beruhigend auf ihn ein und machten sich gemeinsam mit ihm auf die Suche. Vergebens. Keine Spur von der Brillen-Schlange.
Der Psychiater fand bald wieder sein seelisches Gleichgewicht. Er erklärte sich das Erlebnis als Halluzination infolge von Stress und Schlafmangel während der langen Anreise, und er wertete diese Erfahrung als einen Gewinn, weil so etwas „das psychiatrische Einfühlungsvermögen steigert“. So weit, so gut. Bis Professor Burns daheim in London den Film aus Indien entwickeln ließ. Auf einem der ersten Fotos sah er – eine riesige Kobra, die sich um die Kloschüssel schlängelte! Woher sie kam, wohin sie kroch, konnte nie ermittelt werden.
Diese tierische Schauergeschichte könnte eine jener modernen Sagen sein, die zwar nicht wahr, aber derart stimmig sind, dass sie für wahr gehalten und als solche nur allzu gern weitererzählt werden. Dazu gehört sie wirklich nicht! Professor Tom Burns beschwört ihre Wahrheit. Er hat sein Erlebnis wissenschaftlich publiziert, und das auch noch samt Foto, im ganz seriösen „British Medical Journal“ (Vol. 314, No. 7082 (1997), S. 727).
Berichte über Schlangen, die aus dem Klo auftauchen wie das Ungeheuer aus dem Loch Ness, geistern immer wieder durch Presse und Internet. Sie sind kein Anlass, von der Brille auf den Nachttopf umzusteigen. Fast alle entpuppen sich als harmlose Zeitungs-Enten, nur wenige erscheinen als leibhaftige Schreckgestalten.
Amtlich geworden ist das, unter anderem, mit einer Meldung aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken: „Ein unerwartetes Bild bot sich einer 74-jährigen Schwanderin, als sie am Sonntagmorgen (22.07.2012,) auf die Toilette wollte. Als sie den Deckel hochhob, erblickte sie in der Schüssel eine Schlange.“ Sie vergaß ihr Vorhaben, knallte den Deckel zu, griff zum Telefon und löste mit dem Notruf eine Kettenreaktion aus.
Erst raste eine Funkstreife zum Tatort: „Der Streife tat das Reptil allerdings nicht mehr den Gefallen, sich ganz offen zu zeigen.“ Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, „die im Garten des Hauses einen Revisionsschacht öffnete und von dort aus das Toilettenabflussrohr flutete“ – und mittels dieser Wassergewalt die Schlange wieder zum Vorschein brachte. Schließlich kam eine Expertin für Schuppenkriechtiere hinzu. Sie identifizierte den Täter als „einen etwa zwei Jahre alten, für Menschen ungefährlichen Königspython“. Sie nahm ihn vorübergehend in Obhut, denn: „Bis geklärt ist, wem das Reptil gehört, bleibt es bei Polizei und Gemeinde als 'Fundsache' registriert.“ Ordnung muss sein!
Selbst die Märchen über Krokodile in der Kanalisation können einen wahren Kern haben. Verbürgt ist allerdings nur der Fang eines Jungtieres im Untergrund des Quai de la Mègisserie in Paris im Jahre 1983. Sehr wahrscheinlich war es ein Mitbringsel aus einem Tropenurlaub gewesen und, nachdem es dem handlichen Kuschelformat entwachsen war, mit dem Spülungswasser entsorgt worden. Dieses Krokodil hatte Glück im Unglück. Es hätte die Dunkelheit und Kälte in der Kanalisation nicht lange überlebt, so aber verbrachte es den Rest seiner Tage artgerecht in einem Aquarium in der Bretagne.
Die „Weißen Krokodile“ in der Kanalisation von New York dagegen sind nichts als Fabeltiere. Wohlgenährt durch Ratten und wegen des fehlenden Sonnenlichts zu Albinos mutiert, hausen sie angeblich dort seit den ersten Meldungen in den 1930er Jahren. Niemand hat sie wirklich je gesehen, dennoch sind sie unsterblich; unter anderem, weil Literaten wie Thomas Pynchon („V“) sie für ihre Werke adoptiert haben – seitenweise schaurig schön.
Für Nachwuchs in der Gruselkiste ist gesorgt, als jüngster krabbelte die Spinne Arachnius gluteus aus dem Internet. Sie lauert unter der Klobrille und beißt ihren Opfern in den Musculus gluteus, vulgo: Gesäß. Folgen der Attacke sind Fieber, Schüttelfrost und Lähmungen. Sogar ein Todesopfer soll es schon gegeben haben – wahrscheinlich ein User, der sich über die E-Mail totgelacht hat. Die Amis, die spinnen!
Medical Tribune, Nr. 37 vom 12. September 1997
Kapitel 07
Ein Stammplatz für den Oscar – Was Filmstars im Klo zur Schau stellen
Connery, Sean, alias James Bond 007, war im Dienste Ihrer Majestät so erfolgreich, dass er auf Orden verzichten konnte, weil er einen Oscar verliehen bekam. Das kleine goldene Männchen mit dem großen Marktwert fand einen Stammplatz auf dem Klo des Doppel-Null-Agenten, neben allen anderen Film-Preisen. „Dort können sie nicht übersehen werden, schließlich geht jeder mal auf die Toilette“, begründet Connery/Bond seine Platzwahl. Für respektlos oder gar undankbar hält er sich nicht: „Das hat nichts damit zu tun, dass ich nichts von den Preisen halte. Ich finde einfach, dass dadurch die Toilette aufgewertet wird.“
Denselben Hintergedanken hatten auch seine Kolleginnen Shirley MacLaine, Susan Sarandon und Emma Thompson: Sie haben ihre Oscars im gleichen Örtchen ausgestellt. Kate Winslet tut das ihren Gästen zuliebe und macht das so plausibel: „Jeder möchte doch gerne einen Oscar anfassen und halten. Also habe ich meinen ins WC gestellt, damit sie sich die ganze 'Wo ist denn dein Oscar?'- Sache ersparen können. Dort kann jeder ihn heimlich in die Hand nehmen und wieder hinstellen.“
So wie diese Akteure halten es viele andere Menschen. Sie nutzen das Klo nicht nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie gestalten ihre Toilette zu einer Art Galerie, in der sie sich selbst zur Schau stellen. Und weil Besucher nun einmal nicht nur im Wohnzimmer auf der Couch sitzen, können sie dort ungeniert Einblick nehmen in das Innenleben ihrer Gastgeber.
Prinzessin Diana nahm im Klo vom Kensington-Palast subtile Rache an Prinz Charles. Sie dekorierte es mit gerahmten Karikaturen, die alle dasselbe Thema hatten: den Noch-Ehemann und dessen damalige Noch-Geliebte Camilla Parker Bowles. Eines der Sammelstücke brachte zum Ausdruck, dass Charles sich auf Drogen testen lassen solle, falls er glaube, Camilla würde gut aussehen. Diana sah das nämlich ganz anders.
John Travolta, Schauspieler und Flugzeug-Freak, lässt Gäste an seinem Hobby teilhaben. In seine Villa in Kalifornien, vor der er seine Boeing parkt wie andere Leute ihren Mercedes vor dem Reihenhaus, hat er eine Original-Jet-Toilette einbauen lassen. Sobald ein Benutzer die Kabine betritt, wird diese von einem Motor sanft hin und her gerüttelt. Da fühlt man sich gleich wie im Himmel!





























