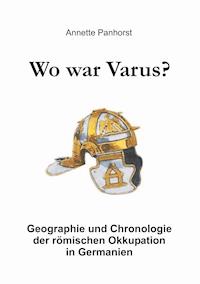
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Varusschlacht war 2009 in aller Munde. Aber es gibt immer noch viele Fragen, die bisher nicht beantwortet wurden. War die Varusschlacht wirklich in Kalkriese? War das Sommerlager des Varus in Minden? War das Winterlager des Tiberius in Anreppen? Nichts davon ist wirklich gesichert. Dieses Buch lässt die Jahre von 15 v. Chr. bis 17 n. Chr. Revue passieren und bezieht sich dabei auf die Texte der Historiker. Hier finden Sie Antworten darüber, was in diesen Jahren wirklich passiert ist. Mit diesem Hintergrund können Sie selbst ermitteln wie alles abgelaufen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Situation
Die Historiker
Die Personen
Das Imperium
Die Ausgangslage
Die Theorie
Lagertheorie
Marschtheorie
Welche Theorie könnte richtig sein?
Augustus in Frankreich
Die Infrastruktur
Römerlager Nijmegen
Römerlager Xanten
Holz-Erde Kastelle
Heeresordnung
Versorgung
Standlager - Ein Beispiel
Straßenbau
Flüsse
Der Mittellandkanal
Drususzeit
Die Unterwerfung Germaniens
Wer war Drusus?
Nordsee - Unternehmung
Drususkanal
Ijssel-Vechte-Kanal
Ems-Vechte-Kanal
Lippefeldzug 11 v. Chr.
Die Emmer
Die Cherusker
Raub der Kinder Arminius und Flavus
Schiffgraben
Aberloh
Wo könnte Aberloh gewesen sein?
Römerlager Aliso
Römerlager Mainz
Die Chatten
Römerlager Rödgen
Römerlager Hedemünden
Zweiter Feldzug an die Elbe
Drusus erreicht die Elbe
Der Unfall
Der Tod des Drusus
Der Hildesheimer Silberfund
Der Schatz von Boscoreale
Wem gehörten die Silberschätze?
Nach Drusus‘ Tod
Tiberiuszeit
Ausbau der Infrastruktur
Wer war Tiberius?
Die Germanen
Friedensvertrag
Nachfolgesuche
Neuer Statthalter Ahenobarbus
Immensum Bellum
Tiberius‘ Rückkehr von Rhodos
Adoptionen
Erneut Feldzüge nach Germanien
Kanal-Einweihung in Holland
Neue Baustelle - Bifurkation
Die Hase [Lepia]
Die Else [Iulia]
Die Staustufen (Kaskaden)
Der Steinbruch
Tiberius‘ Weg ins Cheruskerland und über die Weser
Winterlager des Tiberius
Die Kemenade und das Rittergut Warringhof
Erkundungsfahrt
Triumph für Tiberius
Anreppen - Speicherstadt
Die Werre
Wachtürme
Die Brücke - Viadukt
Löhne - Warenumschlagplatz - Zentrallager
Teutoburger Wald
Wiehengebirge
Geschichte der Diedrichsburg
Angriff auf die Markomannen
Illyrisches Beben
Varuszeit
Romanisierung
Wer war Varus?
Arminius
Sommerlager des Varus
Neue und andere Überlegungen:
Das Sommerlager desVarus
Gerichtsverhandlungen
Plan des Arminius
Das Dreilegionenlager (Sammellager)
Der Angriff
Nach der Lagertheorie
Nach der Marschtheorie
Abschiedsessen - Verrat
Der Anschlag
Die Massenpanik
Das zweite Schlachtfeld
Folterungen
Varus‘ Tod
Reaktion der Legaten
Ausbruch der Fußsoldaten
Auf dem Hohn
Die nächste Flut
Flucht nach Aliso
Feier der Germanen
Ende des Krieges in Pannonien
Reaktion in Rom auf die Ereignisse
Tiberius wieder am Rhein
Germanicuszeit
Nach der „Varus-Katastrophe“
Wer war Germanicus?
Meuterei der römischen Legionen an der Donau
Die prätorischen Kohorten
Meuterei der römischen Legionen am Rhein
Angriff auf die Marser
Feldzüge im Jahr 15 n. Chr.
Raubzug zu den Chatten
Familienstreit
Raubzug zu Segest
Besuch bei Segest
Arminius‘ Reaktion
Raubzug zu den Brukterern
Der große Feldzug zum Schlachtfeld des Varus.
Das Schlachtfeld
Bestattung der Toten
Spurensuche
Aufteilung des Heeres
Caecinas Spurensuche
Kalkriese
Rückweg
Die „Langen Brücken“ [pontes longi]
Rückweg des Germanicus zur Nordsee
Rückweg des Caecina über die „Langen Brücken“
1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
Caecinas Ankunft am Rhein
Doch wo war Germanicus?
Rückweg über die Ems
Vitellius‘ Fußmarsch
Winterlager
Feldzüge im Jahr 16 n. Chr.
Neue Pläne
Ziel des Germanicus
Die neuen Schiffe
Raubzug zu den Chatten
Raubzug nach Aliso
Der große Feldzug nach Osten
Bootsfahrt über das Meer und die Ems
Hase-Überquerung
Ankunft an der Weser
Flavus
Die Weserbrücke
Die Holländer
Veltheim
Vor der Schlacht
Germanicus‘ Ansprache
Arminius Ansprache
Idistaviso - Die Schlacht
Bockshornberg
Großartiger Sieg
Tropaeum Nr. 1
Die Schlacht am Angrivarierwall
Der Damm
Die Falle
Wo könnte die Schlacht gewesen sein?
Blutbach
Tropaeum Nr. 2
Nach der Angrivarier Schlacht
Rückzug
Das Unwetter
Trireme
Nach dem Unwetter
Bestrafung der Germanen
Raubzüge zu den Chatten und Marsern
Winterlager
Tiberius‘ Pläne
Das Jahr 17 n. Chr.
Triumph
Maruboduus
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Kartenteil
Einzugsgebiet der oberen Hase
Staustufen
Treidelpfade
Fußwege der Römer
Großer Weserbogen
Höhenprofil Wartturm bis Lager Anreppen
Die Situation
Die Varusschlacht war im Jubiläumsjahr 2009 in aller Munde. Aber es gibt immer noch viele offene Fragen, die bisher nicht beantwortet wurden.
War Varus in Kalkriese? War sein Sommerlager in Minden an der Weser oder in Hildesheim? War die Varusschlacht in Kalkriese oder in der Dörenschlucht? War das Winterlager des Tiberius in Anreppen oder in Aliso? Nichts von all diesen Aussagen ist wirklich gesichert.
Orte, die als gesichert angesehen werden, können trotz vieler Funde falsch sein. Allen Aussagen muss man ein „Vielleicht“ voranstellen oder hinzufügen.
Namen sind „Schall und Rauch“. Dieser Ausdruck wird oft angewendet, wenn man nicht genau weiß, auf welche Begebenheit ein Name zurückgeführt werden kann. Doch auch diese Aussage kann falsch sein.
Namen haben sehr wohl eine Bedeutung. Jedem Namen liegt eine wirkliche Bedeutung zu Grunde. Es ist daher wichtig zu wissen, dass jedem Namen ein Ursprung zuzuordnen ist, auch wenn die ursprüngliche Bedeutung nicht sofort offensichtlich ist.
Der Ursprung des Namens ist auch geographischen Orten und historischen Begebenheiten zuzuordnen.
Man muss bedenken, dass sich die Römer nur begrenzt bewegen konnten, sie hatten keine Autos, keine Maschinen, alles geschah mit Muskelkraft. Sie versuchten daher, ihre Pläne und Vorstellungen mit Überlegung leichter und einfacher in die Tat umzusetzen. Trotzdem waren viele Bemühungen mit viel Quälerei verbunden.
Im Vergleich zur Technik der Germanen war die römische Technik sehr weit fortgeschritten. Römische Technik hatte bereits einen hohen Standard. Ein Beispiel waren die Wasserleitungen, die Frischwasser aus den Bergen in die römischen Städte brachten.
Die alten Historiker haben uns Schriftquellen hinterlassen, die uns von den Vorstellungen der Römer erzählen. Es ist nun unsere Aufgabe, aus den römischen Plänen die Begebenheiten herauszulesen, ihre Machbarkeit zu erkennen und zu verstehen.
Was planten die Römer damals? Was hatten sie vor?
Die Historiker
Florus
, Publius Annaeus
um 125 n. Chr.
Römischer Geschichtsschreiber
Velleius,
Paterculus, Gaius?
um 20 v. Chr. -nach 30 n. Chr.
Römischer Geschichtsschreiber
Tacitus
, Publius Cornelius
um 56 n.Chr. - um 117 n. Chr.
Römischer Geschichtsschreiber
Strabo(n)
um 63 v. Chr. -nach 28 n. Chr.
Griechischer Geschichtsschreiber
Suetonius
, Caius Tranquillus
um 75 n. Chr. - um 140 n. Chr.
Römischer Geschichtsschreiber
Manilius
, Marcus
lebte z.Zt. der Varusschlacht
Römischer Geschichtsschreiber
Frontinus
, Sextus, Iulius
um 35 n. Chr.-103 n. Chr.
Römischer Geschichtsschreiber
Dio
, Cassius Cocceianus
um 155 n.Chr.-nach 235 n. Chr.
Griechischer Geschichtsschreiber
Die Personen
Die Römer
Augustus
Kaiser in Rom
Quinctilius Varus
Röm. Feldherr in Germanien
Nero Claudius
Drusus
Röm. Feldherr in Germanien, Stiefsohn des Kaisers Augustus, Bruder des Tiberius Nero, Vater des Germanicus
Tiberius
Claudius Nero nach Adoption: Tiberius Julius Caesar
Römischer Feldherr in Germanien, Stiefsohn des Kaisers Augustus, Bruder des Claudius Drusus, Stiefvater des Germanicus, ab 14 n.Chr. Kaiser in Rom
Nero Claudius Drusus Germanicus nach Adoption: Gajus Julius Caesar
Germanicus
Römischer Feldherr in Germanien, Sohn des Claudius Drusus, Stiefsohn des Tiberius Nero
Die Germanen
Arminius (Hermann)
Cheruskerfürst, Sohn des Segimer
Thusnelda
Frau des Arminius, Tochter des Segest
Flavus
Bruder des Arminius
Segest
Vater der Thusnelda
Segimerus
Bruder des Segest
Inguiomerus
Onkel des Arminius
Segimund
Sohn des Segest, Bruder der Thusnelda
Die richtige Rekonstruktion, einmal gefunden, pflegt sich darin zu bewähren, dass auch andere Stücke der Überlieferung, sonst schwer zu verstehen, eine einfache und einleuchtende Erklärung finden.
Delbrück:
Die Geschichte der Kriegskunst
I Das Imperium
Die Ausgangslage
Die Theorie
Über die Römer in Germanien ist schon viel geschrieben worden, viele Geschichten, viele Berichte. Zum Jubiläumsjahr der Varusschlacht 2009 gab es viele Ausstellungen, die drei größten „Imperium“ (Haltern am See), „Konflikt“ (Kalkriese) und „Mythos“ (Detmold) verzeichneten viele Besucher. Die Resonanz in der Bevölkerung war sehr groß, das Interesse an der Varusschlacht hat an Aktualität nichts verloren. Doch noch immer hat die Bevölkerung Zweifel, ob die erzählten „Wahrheiten“ auch der Wahrheit entsprechen1.
Es gab römische Geschichtsschreiber, die die Eroberungen in Germanien schriftstellerisch begleitet haben. Von diesen alten Schriften haben sich einige bis heute erhalten. Diese historischen Quellen sind die Grundlage für unser Verständnis über die damalige Zeit.
Das wichtigste Ereignis dieser Zeit war die Varusschlacht, in der der Cherusker Arminius2 drei Legionen der römischen Armee unter dem Feldherrn Varus vernichtete.
An 700 verschiedenen Orten soll sie stattgefunden haben, die berühmte Varusschlacht. Viele hochrangige Professoren haben sich bemüht, Licht in das Dunkel der Geschichte zu bringen. Auch viele Heimatforscher haben sich der Sache angenommen. Bisher ist nur sicher, dass die Varusschlacht im Herbst des Jahres 9 n. Chr. stattgefunden hat; denn Ort und Ablauf der Schlacht sind bis heute immer noch nicht bekannt und nicht geklärt. Selbst die vielen Funde in Kalkriese beweisen nicht, dass die Varusschlacht in Kalkriese war3.
Vom Verlauf dieser Schlacht gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Die ältere Version wird von den römischen Historikern Paterculus, Tacitus, Florus, Strabon usw. durch nur wenige einzelne Bruchstücke angedeutet.
Die jüngere Version von Cassius Dio Coccelanus (um 200 n. Chr. entstanden) überliefert uns eine zusammenhängende Darstellung, bei der das Wetter eine entscheidende Rolle spielt. Dabei stehen die älteren Schriftsteller wie Paterculus, Tacitus, Florus, usw. im Gegensatz zu dem jüngeren Schriftsteller Cassius Dio.
Die älteren Schriftsteller befürworten die Lagertheorie, der jüngere Schriftsteller Dio beschreibt uns die Marschtheorie. Die Verfechter der Lagertheorie und der Marschtheorie stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Was war denn eigentlich passiert, was war vorausgegangen?
Lagertheorie
Nach der Version der älteren Historiker verbrachte Varus mit seinen drei Legionen, der XVII., XVIII. und XIX. Legion, den Sommer des Jahres 9 n. Chr. in einem Sommerlager im Cheruskerland. Arminius und Varus kannten sich, sie waren sogar befreundet. Varus übte in seinem Lager römische Gerichtsbarkeit über Germanen aus.
Diese älteren Historiker berichten in ihren Schriften, die im ersten Jahrhundert n. Chr. entstanden sind, nur kurz und in Bruchstücken über die Varusschlacht. Sie vermitteln den Eindruck, dass sie den Ort und den Ablauf der Varusschlacht zwar genau kennen, aber ihr Wissen nur andeuten. Sie wollen uns nicht direkt davon in Kenntnis setzen, sie wollen, wenn überhaupt, ihr Wissen nur widerwillig preisgeben.
Nach dieser älteren Version wurde in das Varuslager eingedrungen. Wer oder was eingedrungen ist, wird nicht erwähnt. Man geht davon aus, dass die Germanen das Lager gestürmt haben. Der größte Teil der Römer war anschließend tot, nur wenige hatten den Angriff überlebt. Die Soldaten, die fliehen konnten, kapitulierten in der Nähe des Sommerlagers.
Der römische Feldherr Germanicus besuchte im Jahr 15 n. Chr. das zerstörte Römerlager und das Schlachtfeld, um die Gebeine zu bestatten.
Ein Name des Schlachtortes wird von keinem Autor benannt. Ein römischer Name für das Schlachtfeld ist nicht bekannt. (1)
Marschtheorie
Erst die jüngere Version des Griechen Cassius Dio Coccelanus beschreibt uns eine zusammenhängende Darstellung über einen Schlachtverlauf. Nach Dio’s Sichtweise verlässt Varus das Sommerlager, um mit Hilfe des Arminius einen aufständischen Germanenstamm zu bestrafen. An drei oder vier Marschtagen wird das römische Heer von den Germanen gänzlich vernichtet. Kein Römer kann fliehen oder überleben.
Die Niederlage der drei kampferprobten Legionen ist verheerend und allumfassend. Für diese Schlacht macht Dio das schlechte Wetter in Germanien verantwortlich. Wir wissen nicht, auf welche Quellen er seine Aussagen stützt oder ob die ganze Geschichte seiner Phantasie entsprungen ist.
Der jüngere Geschichtsschreiber Dio lebte 200 Jahre nach der Schlacht und hatte als Informationsquelle nur Senatsakten, die selbst nach Dios Meinung das Ergebnis in einem verfälschten Licht darstellten.
Welche Theorie könnte richtig sein?
Die Quellen zur Varusschlacht sind also nicht einfach und übereinstimmend. Im Gegenteil, die Angaben erscheinen miteinander unvereinbar zu sein, noch schlimmer, sie scheinen einander zu widersprechen. Man könnte sogar den Eindruck gewinnen, dass von zwei völlig verschiedenen Ereignissen die Rede ist. Der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist gravierend.
Trotzdem ist man immer geneigt, diese beiden verschiedenen Versionen zu harmonisieren. Doch die Berichte sind und bleiben grundverschieden. Wir müssen uns entscheiden, welchen Historikern wir vertrauen, den älteren wie Paterculus, Tacitus, Florus usw. oder dem jüngeren Dio.
Die Wissenschaftler in Kalkriese berufen sich auf Dio, also auf die Marschtheorie. Es gibt bis heute zwar viele Funde in Kalkriese, aber immer noch keinen einzigen Beweis, dass die Varusschlacht wirklich in Kalkriese stattgefunden hat. Es hat dort sicherlich ein Scharmützel gegeben, aber die große Varusschlacht ist in Kalkriese trotz der vielen Funde immer noch nicht bewiesen.
Nach meiner Vorstellung kann die Dio-Version nicht stimmen. Arminius konnte unmöglich so viele Krieger aufbieten, die die Römer hätten schlagen können. Ich halte es für nicht machbar, innerhalb von 3 bis 4 Tagen die hochgerüstete römische Armee auch nur annähernd zur gefährden. Arminius hätte auf gar keinen Fall Truppen in entsprechender Größe zusammenziehen können, ohne dass die Römer die Truppenbewegungen bemerkt hätten.
Es wird immer erzählt, dass der Ort der Varusschlacht nicht wichtig sei, da man das Ergebnis kenne. Damit wird vorausgesetzt, dass der Ort austauschbar ist. Dem ist jedoch nicht so. Der Ort der Varusschlacht ist keineswegs austauschbar. Die Varusschlacht konnte nur an einer ganz bestimmen Stelle stattfinden.
Auch der Ablauf der Schlacht ist bis heute unbekannt. Man weiß nicht, was wirklich passiert ist. Man weiß nur, dass drei Legionen ausgelöscht worden sind. Das ist zu wenig. Wir müssen uns darum kümmern, warum die Person Arminius mit sehr geringem Aufwand drei Legionen hochgerüsteter Soldaten überwältigen konnte.
Irgendwo muss bei grundsätzlich aller Vorsicht in Bezug auf die Quellenlage, in den vielfältigen historischen Überlieferungen ein Schlüssel zur Wahrheitsfindung liegen. Den Schlüssel wollen wir finden.
Es bietet sich an, den älteren Geschichtsschreibern zu vertrauen; denn die älteren Geschichtsschreiber kannten alle Begebenheiten, sie waren aus erster Hand informiert und konnten daher den Ablauf der Varusschlacht wahrheitsgetreu beschreiben.
Damit man die Umstände, die zur Varusschlacht geführt haben, besser versteht, muss man sich zuerst mit der Zeit vor der Varusschlacht, den damals herrschenden Personen, der Infrastruktur des Landes usw. auseinandersetzen.
Augustus in Frankreich
Gaius Julius Caesar, Stiefvater des Kaisers Augustus, hatte 44 v. Chr. Frankreich [Gallien] erobert, das war eine tolle Leistung. Gallien war jetzt eine reiche römische Provinz. Das weckte bei den Germanen Begehrlichkeiten. Der Rhein bildete die Grenze zwischen Gallien und Germanien. Die Grenze war lang und schwierig zu verteidigen. Immer wieder kamen die Germanen über den Rhein und plünderten die römischen Niederlassungen.
Als im Jahre 16 v. Chr. dem Statthalter Marcus Lollius eine Reiterabteilung der 5. Legion samt Adlerstandarte verloren ging, war das Maß voll. Augustus wollte den Plünderungen Einhalt gebieten4.
Kaiser Augustus war zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er reiste im Jahre 16 v. Chr. nach Frankreich und blieb dort drei Jahre lang. Er wollte die dortigen Verhältnisse ordnen, d. h. die Distrikte wurden neu eingeteilt, die Grenzen zwischen den vier gallischen Provinzen Narbonensia, Aquitania, Lugdunensis und Belgica wurden neu geregelt und die Steuern festgesetzt.
Der wichtigste Punkt dieser Reise war jedoch die geplante Eroberung von [Germania Magna], dem rechtsrheinischen Germanien. Es gab schon umfangreiche Aufklärungsarbeiten. Aber Augustus wollte sich selbst ein Bild von der Landschaft machen, die es zu erobern galt. Das germanische Gebiet wurde in Augenschein genommen. Alle germanischen Stämme bis zur Elbe sollten zunächst unterworfen und in das römische Imperium eingegliedert werden. Die Okkupation wurde akribisch vorbereitet. Es wurde nichts dem Zufall überlassen.
Denn die Römer hatten sich ein ausgeklügeltes strategisches System ausgedacht. Sie wollten die weiten Wege in Germanien per Schiff zurücklegen. Augustus war es ein Gräuel, dass seine Soldaten vom Rhein bis zur Elbe laufen sollten. Schiffstransporte waren viel vorteilhafter. Die Römer dachten in großen Dimensionen.
Wir wissen von Plutarch (46-125 n. Chr.), dass schon Caesar darüber nachgedacht hatte, das römische Reich massiv zu erweitern. Es sollte vom nördlichen Ozean (Nordsee/Ostsee) bis zum Parther-Reich (Iran) reichen. Die östliche Grenze sollten die Flüsse Düna und Dnjeper [Borsysthenes] darstellen. Die Wasserscheide zwischen den beiden Flüssen, die mit Pferd und Wagen bewältigt werden müsste, beträgt nur ca. 80 Kilometer. Diese beiden Flüsse bilden ansonsten eine einheitliche Wasserverbindung von Riga in Lettland an der Ostsee [Mare Suebicum] bis zum Schwarzen Meer [Pontos Euxeinos]. Die Halbinsel Krim [Crimea] war zur Zeit des Augustus bereits römisches Gebiet. Auch der Bosporus war römisch.
Lassen wir Florus sprechen:
Epitomae rerum romanorum 2,30,22(1)
„Aber weil er (Kaiser Augustus) wusste, dass sein Vater Gaius Julius Caesar zweimal auf einer Brücke den Rhein überschritten hatte, um Krieg vom Zaume zu brechen, trachtete er danach, es [Germanien] zur Provinz zu machen. Und es wäre gelungen, wenn die Germanen unsere Missgriffe so hätten ertragen können wie unsere Herrschaft.“
Die Römer waren vorsichtig und bauten sich zunächst ihre Basis in sicherer Lage am Rhein.
Die Infrastruktur
Römerlager Nijmegen
Als die Römer begannen, das Gebiet östlich des Rheins zu erschließen, brauchten sie unbedingt Stützpunkte auf der sicheren linken Rheinseite.
Schon während der Anwesenheit des Augustus begannen die Römer mit der Planung und Anlage der ersten Kastelle. Der erste Stützpunkt solle in Nijmegen [Botavodurum] sein. Zu dieser Zeit war das niederrheinische Gebiet nur dünn besiedelt.
Um 15 v. Chr. begannen die Römer, auf dem Hunerberg bei Nijmegen5 ein erstes Standlager [Noviomagus] zu errichten. Das Gelände war ca. 42 ha groß. Das Kastell war von der Größe her so angelegt, dass es zwei Legionen aufnehmen konnte.
Der Platz war ausgezeichnet gewählt. Es lag strategisch vorteilhaft am linken Ufer der Waal, gleich gegenüber der Bataverinsel. Denn an der Bataverinsel Betuwe beginnt das Rheindelta. Der Rhein teilt sich in zwei unterschiedliche Flussarme, in Waal und Niederrijn. Der Niederrijn verändert seinen Namen weiter flussabwärts in Lek.
Nach Fertigstellung dieses Lagers errichteten sie ein weiteres kleineres Lager auf dem Kops-Plateau östlich des Hunerberges, das nur gut 4 ha groß war. In der Umgebung des Plateaus fällten sie fast alle Bäume, so dass eine weite Sicht nach allen Seiten möglich wurde.
Auf dem Kops-Plateau bauten sie ein außergewöhnlich großzügiges und prachtvoll ausgestattetes Prätorium für ihren Statthalter. Die abgeholzten Bäume benutzten sie als Palisaden für die Umwehrung des Lagers. Die Flusslandschaft konnte so wunderbar kontrolliert und verteidigt werden.
Südwestlich des Kops-Plateaus errichteten sie eine umfangreiche Pferdestallanlage. Jetzt waren sie in der Lage, den unteren Rhein zu kontrollieren und mögliche Gefahren rechtzeitig abzuwehren. Sie konnten den feindlichen Germanen Paroli bieten.
Diese beiden Lager hatten eine wichtige Aufgabe. Sie waren Ausgangspunkt für den Bau eines Kanals, der in einem ersten Abschnitt bei Fertigstellung vom Rhein bis an die Elbe reichen sollte. In weiteren Abschnitten sollte er nach Fertigstellung bis an die Flüsse Düna und Dnjepr reichen. Die Römer strebten die Weltherrschaft an.
Lassen wir Tacitus sprechen: Annalen II,6,4(1)
„Denn der Rhein, der sich in einem Bett hält oder kleine Inseln umfließt, teilt sich am Beginn des Bataverlandes in zwei Arme: er behält Namen und gewaltige Strömung bis zum Ozean, wo er an Germanien vorbeifließt; er fließt am gallischen Ufer breiter und ruhiger - die Anwohner nennen ihn mit anderem Namen Waal [Vacalus] - und ändert diesen Namen bald in Maas [Mosa] und fließt in dessen gewaltiger Mündung in den Ozean.“
Römerlager Xanten
Um 13/12 v. Chr. begannen die Römer mit der Errichtung eines weiteren Stützpunktes [Vetera], in Birten6 bei Xanten [Tmiana], der für ca. eine Legion ausgelegt war. Auch der Platz dieses Lagers war strategisch gut gewählt. Er lag auf dem Fürstenberg gegenüber der Mündung der Lippe in den Rhein. Das Umland war sumpfig und moorig, was jedoch für das Lager auf der Anhöhe vorteilhaft war. Dieses Lager wollten sie als Ausgangspunkt für die Feldzüge in das rechtsrheinische Germanien über die Lippe nutzen.
An einem geschützten Seitenarm des Rheins, etwa 2 Kilometer nördlich des Stützpunktes Xanten errichteten die Römer einen Hafen. Dort wurden die enormen Warenströme für den Bedarf des Militärs umgeschlagen. Die Römer ließen 1.000 Schiffe bauen, die die Versorgung sicherstellen sollten.
In Xanten herrschte reges Treiben. Xanten entwickelte sich schnell zu einem der größten und wichtigsten Stützpunkte des ganzen Imperiums. Viele Zivilisten fühlten sich von dem Treiben angezogen. Sie bauten mit ihren Familien eigene Häuser und siedelten sich in der Nachbarschaft an. Die Händler, Kaufleute, Handwerker, Gastwirte und auch Veteranen der Armee wohnten in der Nähe des Hafens, sie gründeten die Vorstadt, die [Canabae]. Der Name ‚Canabae‘ war ursprünglich die Bezeichnung für die Schenken und Buden in der Nähe der römischen Militärlager, später dann für die Siedlungen, die sich daraus entwickelten. In kurzer Zeit wuchs die Siedlung Xanten zu einer respektablen Größe heran. Xanten beherbergte zeitweise bis zu 10.000 Legionäre.
Die Kastelle in Nijmegen und Xanten wurden durch weitere Kastelle ergänzt. Den rechtsrheinischen Flussmündungen wurden Kastelle auf der linken Rheinseite, dem gallischen Ufer, entgegengesetzt. So folgten weitere Kastelle in Moers-Asberg, Neuss, Köln, Bonn, Mainz usw.
Holz-Erde Kastelle
Alle diese Kastelle waren nur aus Holz und Erde erbaut. Ein 2-4 Meter breiter und 2 Meter tiefer Graben schützte das Lager. Die Umwehrung bestand aus einer Holz/Erde-Mauer. Diese dicke Mauer bestand wiederum aus zwei festen hölzernen Wänden, zwischen die Erde eingefüllt wurde.
Die Kastelle hatten vorzugsweise eine rechteckige Form. Die beiden Hauptstraßen kreuzten sich in der Mitte des Lagers. In der Mitte stand das Prätorium für den Statthalter. Auch dieses Haus war aus Holz/Erde erbaut. Die Tore wurden durch Wachtürme gesichert.
Im Lagerinneren gab es Fachwerkbauten, auch aus Holz und Erde erbaut, die als Kasernen oder Vorratsscheunen, Ställe usw. dienten. Man geht davon aus, dass zu dieser frühen Zeit Legionen samt Tross in demselben Lager untergebracht waren.
Bei den Ausgrabungen wurden keinerlei Mauersteine gefunden, weder Natursteine noch Ziegelsteine, die man den Bauwerken zuordnen könnte. Die Spuren, die gefunden wurden, bestehen lediglich aus den Einschnitten, die die Gräben der Umwehrung und die Einbettungen der Pfostenlöcher für die Bauten in dem gewachsenen Boden hinterlassen haben.
Doch solch ein Erdloch ist unvergänglich. Auch wenn es später noch so dicht zugefüllt wurde oder der Pfosten darin stehen geblieben und verfault ist, die Füllung des Lochs ist immer vom anders gefärbten Boden zu unterscheiden7.
Heeresordnung
Um die riesigen Aufgaben bewältigen zu können, brauchte der Kaiser Augustus eine neue Heeresordnung. Er formte zu diesem Zweck aus dem Bürgerheer ein Berufsheer. Die bestehende Heeresordnung wurde entsprechend verändert.
Bisher bestand für alle männlichen, freigeborenen Bürger des römischen Reiches eine allgemeine Wehrpflicht. Das galt zukünftig nur noch theoretisch. Die Bürger wurden ab sofort nur noch bei Bedarf und/oder in Krisenzeiten eingezogen. Die Dienstzeit wurde auf 25 Jahre verlängert.
Das Heer war zweigeteilt in Legionen und Hilfstruppen. Eine Legion war ein römischer Truppenverband, bestehend aus 6.000 bewaffneten Soldaten und 120 Reitern (Alen), gegliedert in Zenturien, Kohorten und Manipel.
Das Heer wurde verstärkt durch Hilfstruppen [Auxiliareinheiten]. Diese Soldaten stammten meist aus den eroberten Gebieten. Dazu gehörten sämtliche Arten des leichten Fußvolks, die Bogenschützen und die Reiterei. Sie wurden in dieser frühen Kaiserzeit in regulären Regimentern zu 500 Mann zusammengefasst. Diese Soldaten leisteten ebenfalls eine 25-jährige Dienstzeit. Am Ende ihrer Dienstzeit wurde ihnen das römische Bürgerrecht verliehen.
Die Auxilien glichen sich den römischen Legionen im Laufe der Zeit immer mehr an. Auch ihre Waffen und ihre Ausrüstung wurden immer mehr der Ausrüstung der Legionen angepasst. Ihre Einheiten übernahmen auch mehr und mehr die Aufgaben der Legionen, so dass eine Vielvölkerarmee entstand, die in einer offenen Feldschlacht kaum besiegt werden konnte8.
Die Römer kämpften mit sehr modernen Methoden und ihre Überlegenheit war überwältigend. Für ihr Schlachtfeld benötigten sie eine Fläche von ca. 600 m Länge und 200 m Breite. Sie entwickelten die größte Kriegsmaschinerie der Antike. Für ihre Feinde gab es kein Entrinnen.
Sie hatten schon Geschütze auf Karren montiert, die darauf ausgerichtet waren, maximalen Schaden anzurichten. Das Ziel wurde durchbohrt, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Mit ihren gefürchteten Waffen konnten sie jeden Feind in die Flucht schlagen.
Wenn das Heer unterwegs war, schafften die Legionen pro Tag eine Strecke von ca. 15 bis 18 Kilometer. Das erscheint uns wenig. Berücksichtigen muss man jedoch, dass jeder Soldat schweres Gewicht zu tragen hatte. Allein die Rüstung aus Eisenhelm und Brustpanzer wog schon 15 Kilogramm.
Dazu kam das lebensnotwendige Gepäck. Bei Geländemärschen wurde es in der Mitte geführt und rechts und links marschierten die Soldaten.
Die Soldaten waren zudem noch schwer bewaffnet. Denn zu Eisenhelm und Brustpanzer kam noch als Hieb- und Stichwaffe das Schwert, das links am Gürtel hing. Der kurze Dolch wurde rechts getragen, passend für den Nahkampf. Der hohe, längliche, etwas gewölbte Schild schützte die linke Körperhälfte. Die rechte Körperhälfte blieb weitgehend ungeschützt.
Die Bewaffnung allein reichte jedoch nicht aus. Die Bedienung der Waffen musste trainiert werden. Eine Ausbildung war unerlässlich. Die Handhabung der Waffen wurde mit Weidenschild und hölzernen Keulen geübt, die doppelt so schwer waren wie die regulären Waffen. Es wurden Speerwurf und Lanzenstich geübt, ebenso das Schleudern und Werfen schwerer Steine, und nicht zu vergessen, das Kämpfen mit Schwertern und Schilden.
Auch das Marschieren wurde trainiert, bei Übungsmärschen über 30 Kilometer mit 30 Kilogramm Gepäck wurde die Ausdauer verbessert. Ihre Spaten hatten die Soldaten immer im Gepäck. Außerdem gehörten zur Ausrüstung Sägen, Beile, Körbe, Taue.
Jeden Abend wurde ein Lager aus Baumstämmen errichtet, die auch mitgeführt werden mussten. Auch die Zelte aus Leder hatten ihr Gewicht. Selbst wenn die schwersten Teile von Maultieren und Wagen transportiert wurden, blieben für die Soldaten noch genügend Lasten übrig. (4)
Versorgung
Die Soldaten hatten sich unterwegs selbst zu versorgen. Sie bekamen dazu alle zwei Wochen 15 Kilogramm Getreide, welches sie selbst zermahlen und zu Brot backen mussten. Für die dazu notwendigen Gerätschaften wie Handmühlen und Vorratsbehälter hatten sie selbst zu sorgen. Fleisch gab es äußerst selten.
Sehr wichtig war reines, gutes Trinkwasser. Die Wasserversorgung war immer das größte Problem. Menschen und Tiere brauchten Unmengen an Wasser. Auf ihren Wegen konnten sie sich deshalb nicht weit von den Flüssen entfernen. Die Wasseranlaufstellen mussten immer in entsprechenden Abständen zur Verfügung stehen und einen genügenden Wasservorrat aufweisen. Frisches Quellwasser war dem Flusswasser immer vorzuziehen.
Die Eroberung Germaniens fand zudem nur im Sommer statt. Im Frühjahr zogen die Römer in das Innere Germaniens. Sie verließen Germanien immer im Herbst vor Beginn des Winters. Es wurde kalt und ungemütlich. Die Zelte boten nicht genügend Schutz. Die Nahrungsmittel waren knapp. Die Versorgung war nicht sichergestellt. Sie zogen sich daher zurück in ihre Kastelle am Rhein.
Standlager - Ein Beispiel
Ein Standlager, das für eine Legion errichtet wurde, war ca. 25 ha (600 m Länge und 460 m Breite) groß. Solch ein Lager zählte in der frühen Kaiserzeit 6.000 Schwerbewaffnete zu Fuß und 120 Reiter. Eine Legion wurde ergänzt durch 2.000 Fußsoldaten sowie 702 Reiter der Auxiliarverbände. Dazu kamen 400 Veteranen, die in ruhigen Zeiten ihren Dienst in den Handwerksstuben verrichteten, in kritischen Lagen aber ebenfalls zu den Waffen griffen.
Außerdem war jeder Zeltgenossenschaft - dem Contubernium, der kleinsten Einheit der Legion - ein Knecht zugeteilt. Jeder Reiter hatte deren zwei, ebenso jeder Centurio. Den elf Stabsoffizieren standen je sechs, dem Legaten zwölf Burschen zur Verfügung.
Da auch die Bundesgenossen, die Auxiliareinheiten, in etwa entsprechender Weise mit ‚Putzern‘ versorgt waren, zählte ein Legionslager nach der Niessenschen Rechnung 2.142 Planstellen für Nichtstreiter. Schließlich aber wollten auch noch 2.460 Pferde und Lasttiere untergebracht werden. Es kamen also auf je einen Hektar im Durchschnitt mindestens ca. 500 Menschen und 100 Tiere.
Selbst wenn man berücksichtigt, dass so ein Lager wohl selten voll belegt war, lässt sich leicht ausrechnen, welch drangvolle, fürchterliche Enge in der Festung herrschte und welches Maß an Zucht, Ordnung und Disziplin den auf derartig knappem Raum zusammengepferchten fast 12.000 Menschen abverlangt wurde.
Die Leidtragenden waren - selbstverständlich - die gemeinen Soldaten, vornehmer ausgedrückt: die Mannschaftsdienstgrade. Eine Zeltgenossenschaft, die in Neuss [Novaesium] in der Regel 8 Mann umfasste, ‚bewohnte‘ einen Raum von 4,50 mal 4,25 Meter. Das sind weniger als 20 Quadratmeter, auf den einzelnen Legionär umgerechnet knapp 2 ½ Quadratmeter.
Vor der gemeinsamen Behausung lag die Waffenkammer des Contuberniums. Das Dach sprang von hier aus vor und bildete nach der Gasse hin einen offenen Raum, wo der Knecht mit den Packtieren kampierte. In der Gasse selbst befand sich die Kochgrube der Gruppe.
Je zwölf solcher Gelasse lagen einander gegenüber, je 96 Mann also oder - wenn man die Chargen dazu zählt, das heißt: den Centurio, den Optio, seinen Stellvertreter, den Tesserarius, der als Ordonanz fungierte, und den Signifer, den Fähnrich, der gleichzeitig die Kassengeschäfte betreute - je eine Centurie, die beide zusammen den Manipel bildeten.
Die Soldaten hatten nur einen gemeinsamen Ausgang, der an den Runen des Centurio sowie einer ständige Wache vorbei führte - ein ebenso simples wie raffiniertes Kontrollsystem, das Tag und Nacht funktionierte.(4)
Straßenbau
Der Plan des Augustus sah vor, dass Germanien zunächst bis zur Elbe unterworfen werden sollte. Die Römer brauchten also Straßen zum Marschieren. Die alten germanischen Heerstraßen benutzte das römische Heer nur bedingt. Als große Heerstraßen waren sie den Römern nicht gut genug.
Sie bauten für ihr Heer große breite Straßen, die schnurgerade die Landschaft durchzogen. Sie wurden möglichst eben, ohne große Steigungen angelegt, tiefe und feuchte Stellen wurden durch Dämme erhöht. Sie mussten bequem und sicher angelegt werden, so dass das Heer ohne Störung marschieren konnte.
Parallel zu den Flüssen (auch den kleineren Flüssen) bauten sie Straßen, die die vielen Windungen, die die Flüsse verursachten, nicht mitmachten, immer darauf bedacht, dass mögliches Hochwasser diese Straßen nicht beschädigen konnte. Heute sind diese Straßen oft Eisenbahnlinien.
Die besten Straßen waren jedoch die Wasserstraßen. Die Römer begradigten Flüsse, um die Wege zu verkürzen, sie beseitigten Untiefen und störendes Strauchwerk. Flussabwärts schwammen die Schiffe mit eigener Kraft, doch bergauf gegen die Strömung wurden sie von Pferden oder Maultieren die Flüsse hochgezogen. Dazu brauchten sie Treidelpfade entlang der Flüsse für ihre Pferde bzw. Maultiere, damit das Gepäck auf dem Wasser transportiert werden konnte.
Beim Treideln werden die Schiffe gezogen, entweder von Tieren oder auch von Menschen.
Flüsse
Die großen Flüsse in Germanien Rhein [Rhenus], Ems [Amisia], Weser [Visurgis] und Elbe [Albis] fließen in die Nordsee. Ihre Richtung verläuft von Süden nach Norden. Sie sind durch Wasserscheiden getrennt.
Es gibt nur den Main [Moenus], der von Osten nach Westen fließt und die Lippe [Lupia], die ebenfalls von Osten nach Westen fließt. Der Main kommt aus dem Fichtelgebirge, durchfließt in weiten Schleifen ein gebirgiges Gelände und mündet bei Mainz in den Rhein.
Die Lippe entspringt am Westhang des Eggegebirges, in Bad Lippspringe. Sie fließt in Richtung Schloß Neuhaus bei Paderborn, wo sie das Wasser der Alme und der Pader aufnimmt. Von dort aus fließt sie weiter in westlicher Richtung. Sie durchfließt das südliche Münsterland und mündet bei Wesel in den Rhein.
Der Main mit seinen weiten Umwegen und mit den Quellen im Fichtelgebirge war für die Eroberung Germaniens bis zur Elbe durch römische Truppen nicht geeignet. Das Gelände war zu bergig. Besser geeignet war da schon die Lippe, die durch das weite ebene Münsterland fließt. Sie hat nur wenig Gefälle und konnte von den Soldaten einfacher mit Schiffen befahren werden. Die Lippe war von ihrer Mündung bei Wesel bis Schloß Neuhaus bei Paderborn schiffbar. Ab Schloß Neuhaus mussten alle Waren auf Wagen oder Tragtiere umgeladen und dann Richtung Osten weitertransportiert werden. Dieser Weg war zwar eine einfache Lösung, um die östlichen Landstriche zu erobern. Sie konnten und würden ihn vorerst nutzen, aber diese Lösung war noch nicht optimal. Denn eigentlich brauchten die Römer von Westen nach Osten quer durch Europa eine Binnen-Wasserstraße.
Es wäre also erforderlich, neue Querverbindungen zwischen den großen Flüssen herzustellen. Die Römer hatten in ihren Reihen sehr gute Baumeister, die durchaus in der Lage waren, schwierige Wasserwege über sehr weite Strecken zu führen. Bestand die Möglichkeit, eine derartige Wasserstraße zu realisieren?
Flüsse mit Nebenflüssen bilden ein Flusssystem. Das von einem Fluss mit allen seinen Nebenflüssen oberirdisch und unterirdisch entwässerte Gebiet nennt man Einzugsgebiet. Alle Flüsse haben ein Einzugsgebiet.
Die Einzugsgebiete der einzelnen Flüsse sind durch Wasserscheiden getrennt. Wasserscheiden sind Berge oder Anhöhen, die zwischen den Einzugsgebieten der Flüsse liegen. Diese Anhöhen müssten überquert werden. Diese Berge bzw. Anhöhen zu überwinden war das größte Problem, das ging nicht so einfach.
Doch für die Binnen-Wasserstraße hatten die Römer bereits erste Pläne. Die großen Flüsse sollten durch Kanäle verbunden werden. Dazu mussten sie die günstigsten und einfachsten Verbindungen herausfinden. Sie brauchten unbedingt Querverbindungen von einem großen Fluss zum anderen. Für diese Querverbindungen mussten sie jeweils einen Nebenfluss rechts und links vom Hauptfluss ausbauen.
Leiermann: Staustufen
Die Wasserscheiden zwischen den einzelnen Flüssen mussten schiffbar gemacht werden. Sie brauchten Kanäle mit Staustufen, um die Wasserscheiden zu überwinden. Auch kleine Bäche mussten sie nutzen, die durch Staustufen schiffbar gemacht werden konnten.
Die Römer trauten sich zu, diese Schwierigkeiten zu meistern. Eine derartige Wasserstraße wäre unabhängig von der gefährlichen Nordsee; denn die Nordsee konnte mit Binnenschiffen nicht befahren werden.
Der Mittellandkanal
Vom Rhein aus wollten sie in das Innere Germaniens vorstoßen. Die Planungen sahen vor, dass als erstes die Wasserscheide zwischen Rhein und Ijssel überwunden werden sollte. Dazu sollte ein Kanal gebaut werden, der den Rhein mit der Ijssel verband. Zwischen Westervoort und Doesburg (Niederlande) sollte er verlaufen. Man könnte nach Fertigstellung vom Rhein über die Ijssel zum Ijsselmeer [Flevomeer] per Schiff fahren und die Nordsee erreichen.
Das war jedoch nicht genug. Man musste unbedingt eine Fahrt über die gefährliche und unberechenbare Nordsee vermeiden.
Mit einer Fahrt über die Vechte käme man der Ems sehr nahe. Man brauchte also einen weiteren Kanal, der die Vechte mit der Ems verband. Es wäre möglich, auch diese Wasserscheide durch einen Kanal so zu verändern, dass Boote für den Warenverkehr eingesetzt werden könnten.
Durch Staustufen wären die Höhenunterschiede überwindbar. Die oberste Staustufe würde gespeist von einem Stausee der Vechte. Das Wasser würde sich dann durch das natürliche Gefälle über sämtliche Staustufen verteilen. Dadurch würde der Schiffstransport von der Vechte bis zur Ems ermöglicht.
Eine weitere Wasserscheide zwischen Ems und Weser an der Bifurkation bei Gesmold (Stadt Melle) sollte ebenfalls durch Staustufen schiffbar gemacht werden. Von den untersten bis zu den obersten Staustufen müssten auch hier die Waren umgeladen werden.
Leiermann: Bifurkation
Die oberste Staustufe würde gespeist von der Hase [Lepia] durch einen Stausee in Höhe der heutigen Sut(t)mühle9 (Bissendorf, Kreis Osnabrück).
Nach Überwindung dieser drei Wasserscheiden könnten weite Strecken in Germanien per Schiff zurückgelegt werden. Das riesige Einzugsgebiet der Weser würde hierdurch erschlossen. Detmold, Hameln, Höxter, Kassel, Minden, Bad Oeynhausen, Nienburg, Bremen, Hannover oder Hildesheim wären dann vom Rhein aus über Binnen-Wasserstraßen erreichbar.
Um die vierte Wasserscheide zwischen Weser und Elbe zu überwinden gab es zwei Möglichkeiten, denn an zwei verschiedenen Stellen könnte diese Wasserscheide zwischen Weser und Elbe durchbrochen werden.
Möglichkeit Nr. 1:
Der Drömling10 ist ein flaches Feuchtgebiet mit einer sehr niedrigen Wasserscheide zwischen Weser und Elbe. Diese fast abflusslose Mulde wird von einem niedrigen Höhenzug umschlossen und ist dadurch ein natürliches Speicherbecken für die Hochwässer von Aller und Ohre. Auch hier besteht die Möglichkeit, mit Staustufen diese Wasserscheide zu überwinden.
Heute durchquert der Mittellandkanal das Sumpf-Gebiet in Ost-West-Richtung. Auch die Bahnstrecken Wolfsburg-Stendal und Hannover-Berlin verlaufen fast parallel zum Mittellandkanal.
Dieses Feuchtgebiet stellt eine Klimagrenze zwischen Ost und West dar und gilt als westlichste Ausdehnung der Sibirischen Taiga.
Die Römer entschieden sich jedoch für Möglichkeit Nr. 2.
Im nördlichen Harzvorland befindet sich ein fast waagerechtes Gewässer, das künstlich hergestellt wurde, wahrscheinlich durch römische Soldaten. Andere Volksgruppen kommen für ein so großes Bauwerk nicht infrage. Es erstreckt sich von Westen nach Osten und speist sich über die seitlichen Zuflüsse und den feuchten Untergrund. Der westliche Teil heißt „Schiffgraben“, der östliche Teil wird „Großer Graben“ genannt11. Das Gewässer ist ca. 46 km lang und hat kaum Gefälle. Der Scheitelpunkt liegt etwa bei 86 m über NN.
Der kleine Steinbach, der an der Steinmühle in den Vorfluter mündet, bildet die Bifurkation aus. Er kann sein Wasser wechselseitig nach Westen (in den Schiffgraben) bzw. Osten (in den Großen Graben) weiterleiten.
Schiffgraben/Großer Graben haben nördlich und südlich je einen Vorfluter, die das Wasser der vielen kleinen Bäche aufnehmen können. Die größten Zuflüsse sind die Schöninger Aue von Norden und die Hessen Aue von Süden.
Im Westen hat der Schiffgraben eine Verbindung über eine Pseudobifurkation mit der Ilse, die bei Börßum61 in die Oker mündet und damit zum Weser-Einzugsgebiet gehört; der „Große Graben“ hat bei Oschersleben12 eine Verbindung mit dem Elbe-Einzugsgebiet, diesmal über eine Pseudobifurkation mit der Bode13, die in die Saale und weiter in die Elbe mündet.
Über die Aller14 (Nebenfluss der Weser) und die Oker (Nebenfluss der Aller) könnte man über die Ilse den Schiffgraben/Großer Graben erreichen und per Schiff weiter bis zur Elbe fahren.
Nach Fertigstellung all dieser Kanäle könnte man durch halb Europa fahren. Man könnte per Schiff von Rom bis Berlin und auch von Hamburg bis Prag fahren. Alles wäre möglich.
Der Kanal war nicht sofort fertig. Die Erstellung eines solchen Bauwerkes dauert viele Jahre. In der Zwischenzeit wollten und mussten die Römer die Lippe nutzen.
Leiermann: Mittellandkanal
II Drususzeit
Die Unterwerfung Germaniens
Wer war Drusus?
Nero Claudius Drusus *14.1.38 v. Chr., † im September 9 v. Chr. war römischer Politiker und Heerführer, Stiefsohn des Kaisers Augustus. Er war ein Sohn der Livia, der Frau des Augustus, aus ihrer ersten Ehe mit Tiberius Claudius Nero. Sein älterer Bruder war der spätere Kaiser Tiberius.
Drusus15





























