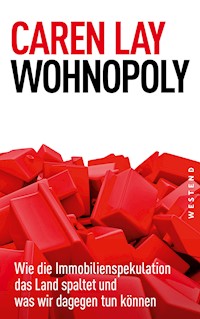
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wohnungsfrage ist die soziale Frage unserer Zeit. Doch statt sie anzugehen, werden Fehlentwicklungen systematisch politisch gefördert. Wohnungen sind zu reinen Spekulationsobjekten verkommen. Hohe Nachfrage und sogenannte Zwangssanierungen lassen die Mieten explodieren und zwar nicht nur in den Großstädten, sondern auch im Umland. Menschen werden aus jahrzehntelang gewachsenen, sozialen Strukturen gerissen, gentrifizierte Viertel zu Soziotopen der Besserverdienenden. Wie konnte es soweit kommen? Warum unternimmt die Politik so wenig, um Mietenwahnsinn und Spekulation endlich zu stoppen? Und was muss getan werden, damit Wohnen endlich wieder bezahlbar wird? Caren Lay nimmt die deutsche Wohnungspolitik der letzten 20 Jahre schonungslos unter die Lupe, zeigt auf, wie und warum Deutschland zum Eldorado für Wohnungsspekulation werde konnte, und liefert provokante Ideen für eine soziale Wohnungspolitik, die wir so dringend brauchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ebook Edition
Caren Lay
Wohnopoly
Wie die Immobilienspekulation das Land spaltet und was wir dagegen tun können
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-873-0
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2022
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Danksagung
Einleitung
Worum es geht
Wohnen wird zum Luxusgut
It’s the economy, stupid! Hinter der Mietenkrise steht das Kapital
1 Das Sündenregister der deutschen Wohnungspolitik
I. Der Markt soll es richten – wie die Mietpreisbindung abgeschafft wurde
II. Wie der Profit über die Gemeinnützigkeit siegte – die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit
III. Rot-grüne Steuergeschenke – wie Fonds und Konzerne den Wohnungsmarkt stürmen konnten
IV. Der Ausverkauf der Stadt – die Massenprivatisierung öffentlicher Wohnungsbestände
V. Privatisierung per Gesetz in Ostdeutschland
VI. Auslaufmodell: Wie der Soziale Wohnungsbau an die Wand gefahren wurde
Fazit: Mieter*innen als Melkkühe der Nation
2 Die Folgen: Deutschland als Eldorado für Spekulation und Paradies für Geldwäsche
Wohnopoly – der Aufstieg der Wohnungskonzerne und ihre Praktiken
Betongold – der deutsche Immobilienmarkt als Eldorado für internationale Immobilienspekulation
Geheime Grundbücher und überforderte Behörden – warum der deutsche Immobilienmarkt ein Paradies für Geldwäsche ist
Das Geschäft mit dem Bauland – warum die Bodenspekulation ungebremst weitergeht
Wohnen als neue Klassenfrage: Wie das Land immer ungerechter wird und welchen Anteil Immobilien daran haben
3 Die Macht der Lobby – warum sich am Mietenwahnsinn nichts ändert
I. Das Sein bestimmt das Bewusstsein
II. Ahnungslos und übertölpelt: Wenn Politiker*innen ihren Aufgaben nicht gewachsen sind
III. Von Mythen, Träumen und Ängsten: Politik mit Pappkameraden und Emotionen
III.1 Mythos: Der Markt wird es richten
III.2 Mythos: »Der Investor« regelt das
III.3 Mythos: Der Traum vom Eigenheim
III.4 Geklaute Arbeitervillen im Tessin. Politik mit der Angst
III.5 Spiel nicht mit den Schmuddelkindern – wie Vorurteile eine soziale Wohnungspolitik verhindern
IV. Wer das Geld hat, hat die Macht – wie eine starke Lobby schwache Politiker*innen um den Finger wickelt
IV.1 Ungleiche Verhältnisse – Immobilienlobby und Mietenlobby im Vergleich
IV.2 Vom gesetzten Abendessen zum parlamentarischen Frühstück – die verführerischen Methoden der Lobby
IV.3 Wes Brot ich ess, des Lied ich sing – vom Sponsoring bis zur großzügigen Parteispende
IV.4 Der Seitenwechsel: Lukrative Anschlussverwendung für Politiker*innen
IV.5 Schwache Lobby: Die Mieter*innen
V. Eigene Fehler und das politische Versagen von Mitte-Links
4 Die Spielregeln ändern – Alternativen für bezahlbare Mieten
Was tun? Zehn Vorschläge, wie es besser laufen kann
I. Deckeln wie Berlin – ein atmender Mietendeckel
II. Bauen wie Wien – gemeinnützig wirtschaften, sozial bauen
III. Wir kaufen uns die Stadt zurück – Rekommunalisierung privatisierter Bestände
IV. Gemeinsam statt einsam – Genossenschaften stärken
V. Anti-Spekulationsgesetz: Spekulation besteuern
VI. Bauen muss bezahlbar sein – Bodenspekulation begrenzen
VII. Regulieren wie die Dänen – Immobilienbesitz beschränken
VIII. Wer darf mitspielen? Fonds und Konzerne gehören nicht auf den Wohnungsmarkt
IX. Task Force Geldwäsche
X. Organisiert euch! Ohne Druck von unten wird es nichts
Das Mieten-Manifest
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Ich bedanke mich bei allen, die mich und meine Wohnungspolitik inspiriert und unterstützt haben. Mein Dank gilt meinem gesamten Team, insbesondere Susanne Bartholmes, Maximilian Becker und Hanno Bruchmann. Es macht Spaß, mit euch zu arbeiten! Ich bedanke mich bei meiner Familie, ihr habt den Grundstein gelegt. Ich bedanke mich bei allen, die nicht aufgeben, sondern für soziale Städte kämpfen.
Dieses Buch ist für euch.
Einleitung
Worum es geht
Millionen Menschen haben ein Problem: Die Mieten steigen rasant, die Wohnungsnot wird immer größer. Menschen werden ihre Wohnungen gekündigt, in denen sie Jahrzehnte gelebt haben, Familien finden kein Zuhause, Geringverdiener*innen arbeiten nur noch für die Miete und die Zahl der Wohnungslosen erreicht Rekordwerte.
In unseren Städten wird Monopoly gespielt. Wo Helgas Eckkneipe war, zieht Starbucks ein, Ahmets Späti muss einem Feinkostladen weichen. Wo früher Menschen in alten Lagerhallen tanzten, stehen nun Büros und Townhouses. Selbst in Kleinstädten kann man inzwischen von der Wohnadresse auf die Einkommensverhältnisse schließen. Hier die armen, dort die reichen Viertel. Die Verdrängung von Menschen mit wenig Einkommen ist schon lange spürbar, jetzt sind Durchschnittsverdiener*innen dran. Die Mietenkrise hat die Mittelschichten erreicht. Menschen, die viele Immobilien besitzen, dürfen sich hingegen freuen, denn sie werden immer reicher, ohne etwas dafür zu tun. Der Immobilienboom spaltet das Land.
Alle sind sich einig: Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Doch diese unselige Entwicklung hält ungebremst an und es gibt wenig Hoffnung, dass sich etwas ändert.
Wie konnte es dazu kommen, dass Menschen in einem der reichsten Länder der Welt Angst haben müssen, ihre Wohnung zu verlieren? Was treibt die Mietpreise nach oben und wer profitiert davon? Warum werden Mieterinnen und Mieter schutzlos Profitsucht und Gier von wenigen ausgeliefert? Und schließlich: Was können wir dagegen tun? Genau diesen Fragen möchte ich in diesem Buch nachgehen und aus dem Inneren der Politik berichten. Kaum ein anderes Thema ist im Bundestag – ja in der Öffentlichkeit – so heftig umstritten wie die Wohnungspolitik. Hinter unterschiedlichen Positionen stehen mächtige Interessen. Schließlich geht es um Geld, um sehr viel Geld. Und ja, auch die Lobby spielt mit.
Im Entstehungsprozess des Buches begann der Krieg in der Ukraine. Auf die damit verbundene Explosion der Energie- und Baupreise, die Ankunft von mehr Geflüchteten und die Inflation konnte ich nicht mehr im Detail eingehen. Dies alles wird die Wohnungskrise weiter verschärfen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, auch in Gebäuden mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Ich bin überzeugt: Wir müssen jetzt handeln! Und wir müssen uns entscheiden: Gehen wir den gleichen Weg wie London und Paris, in denen sich nur noch Besserverdienende eine Wohnung in der Innenstadt leisten können? Oder schaffen wir es, dass unsere Städte sozial gemischte, lebenswerte Städte für alle bleiben? Es geht um viel. Um nicht weniger als um die Zukunft unserer Städte, um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wenn wir nicht bald handeln, ist es zu spät.
Wohnen wird zum Luxusgut
Früher hatte ich ein WG-Zimmer in Berlin Kreuzberg. In einer Nachbarschaft, in der die Mieten jahrzehntelang günstig waren, in der Rentner*innen, Student*innen, Arbeiter*innen und sehr viele Migrant*innen lebten. Kreative aus aller Herren Länder bereicherten die Nachbarschaft: Für wenig Geld in einer Hauptstadt leben, wo geht das sonst? Doch in den Nullerjahren geriet die bunte Mischung unter Druck. Das unsanierte und regelrecht heruntergekommene Haus wechselte in kurzer Zeit mehrfach den Besitzer. Statt einer kaltschnäuzigen, aber immerhin erreichbaren Hausverwaltung im Berliner Westen hatte man es plötzlich mit Briefkastenfirmen zu tun, hinter denen dubiose Adressen standen. Das Haus gammelte weiter vor sich hin, Reparaturen wurden nicht erledigt. Aber Mieterhöhungen wurden versandt, alteingesessene Mieter*innen herausgeklagt, Inkassofirmen klopften an die Haustür. Zuerst waren diejenigen dran, die sich am wenigsten wehren konnten: verarmte Rentner*innen und Migrant*innen. Auf Kiezversammlungen erfuhr ich: Das ist kein Einzelfall. Der ganze Stadtteil war ins Visier internationaler Immobilienspekulation geraten.
Diese Erfahrung war mir eine Lehre und sie ist es bis heute. Als ich in den Bundestag gewählt und Bundesgeschäftsführerin meiner Partei wurde, forderte ich bereits 2011 eine »mietenpolitische Offensive«, um derart aggressive Entmietungspraktiken zu unterbinden und den Sozialen Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Ich stieß damit zunächst auf wenig Gegenliebe, ja fast Unverständnis. Wohnungspolitik war zu dieser Zeit kein Thema. Im Bundestag wurde es bestenfalls im Schutze der Nacht verhandelt, es galt als unwichtiges Nebengleis. Ausschließlich aus den Metropolen Berlin, Hamburg, München und Frankfurt gab es Zuspruch, weil sich dort die Probleme häuften. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Wie ein Lauffeuer breiteten sich Spekulation und Mieterhöhungen in der ganzen Republik aus. Nur wenige Jahre später bekam ich Hilferufe aus Passau und Dinslaken, aus Schwäbisch Gmünd und Greifswald.
Die Mietpreise in den Städten klettern steil nach oben. »Immobilienboom«, frohlockt die Finanzwelt. »Mietenwahnsinn«, sagen Aktivist*innen. Er hat das ganze Land erreicht. Wer sich eine neue Wohnung suchen muss, kann sich auf eine gesalzene Rechnung gefasst machen. In nur sechs Jahren, zwischen 2015 und 2021, stiegen die Preise für neue Mietverträge in Berlin um 44, in Heidelberg um 41 und im ohnehin schon teuren München um 32 Prozent.1Das alles wäre verkraftbar – doch den exorbitanten Mietsteigerungen steht eine Steigerung der Bruttolöhne von grade einmal elf Prozent gegenüber.2Am Ende des Monats zählt, was übrigbleibt. Der rasante Mietenanstieg bedeutet faktisch eine Lohnkürzung, eine schleichende Umverteilung von unten nach oben. Im Ergebnis muss ein immer größerer Teil des Einkommens für Wohnen ausgegeben werden. Wir empören uns heute gerne über die feudale Gesellschaft, in der die Grundstückspächter den Zehnten, also zehn Prozent des Einkommens, an den Fronherren abtreten mussten. Davon können Mieter*innen heute nur träumen.Die halbe Republik gibt bereits über dreißig Prozent des Einkommens fürs Wohnen aus. Es ist heute keine Seltenheit mehr, vierzig oder sogar fünfzig Prozent für das Wohnen zu bezahlen.3
Auch auf dem Wohnungsmarkt gilt: Die Schwächsten beißen die Hunde. Ärmere Haushalte geben heute entweder das ganze Geld für die Miete aus oder sie müssen einer wohlhabenderen Klientel weichen. In vielen Städten hat eine solche Verdrängungswelle schon stattgefunden, ist das innerstädtische Wohnen für Geringverdiener*innen nur noch dann leistbar, wenn sie einen alten Mietvertrag haben oder das Glück, in einer der wenigen Sozialwohnungen zu wohnen. Diejenigen mit mehr Geld verdrängen andere mit weniger Geld. Gentrifizierung wird das genannt. Längst sind auch die Mittelschichten dran: Wo früher Geld übrig war für Urlaub und Anschaffungen, vielleicht sogar ein Eigenheim, bleibt vielen nichts weiter übrig, als das halbe Leben für die Mietkosten zu malochen. Wohnen wird für immer mehr Menschen unbezahlbar. Wohnen ist nicht nur die soziale Frage unserer Zeit. Wohnen ist die neue Klassenfrage.
Auch der Traum vom Eigenheim rückt in weite Ferne: Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen seit 2015 um über 56 Prozent,4 die Preise für Häuser seit dem Jahr 2000 um 84 Prozent.5 Das Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik, dass man sich mit harter Arbeit und bescheidener Lebensführung das eigene Häuschen erarbeiten kann, ist für viele dahin.
Diese Entwicklung schlägt sich im Stadtbild nieder. Sicherlich hat es schon immer Stadtviertel gegeben, in denen Arme, und andere, in denen die besser Betuchten gelebt haben. Tragisch ist, dass die Situation sich verschlechtert. Soziale Durchmischung war gestern. Das Gesicht ganzer Stadtteile wandelt sich, seitdem mit Wohnungen wie mit Waren gehandelt wird.
It’s the economy, stupid! Hinter der Mietenkrise steht das Kapital
Was steht hinter der rasanten Entwicklung der Mietpreise? Das beliebteste Erklärungsmuster ist: Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Ja, das tun sie. Nicht zuletzt, weil Arbeitsplätze und Infrastruktur in vielen ländlichen Regionen systematisch abgebaut wurden. Ein anderer Grund ist sicherlich, dass das Leben in der Großstadt kurze Wege, mehr kulturelle Angebote und mehr Freiheiten verspricht. Die sogenannte »Schwarmstadt-Studie«6, die von der Wohnungswirtschaft in Auftrag gegeben wurde, war Stichwortgeber für eine weitverbreitete Theorie: Sie sieht eine zentrale Ursache für die aktuelle Wohnungsnot darin, dass gerade unter jungen Menschen ein Hype um bestimmte Städte entsteht. Kaum sei die neue Trendstadt ausgerufen, folgen Gleichaltrige wie die Lemminge denjenigen, die forsch vorangelaufen seien. Ein beliebtes Beispiel in diesem Zusammenhang ist immer wieder Leipzig, gerne auch Hype-zig genannt.
Ich leugne nicht den Zuzug vor allem junger Menschen in die Städte, insbesondere aus Ostdeutschland. Bedauerlicherweise wurde der Trend, in die Städte zu ziehen, politisch auch noch befördert. Allein in Sachsen wurden über tausend Schulen geschlossen und viele Hunderte Kilometer Bahnstrecken abgebaut, Jugendclubs, Kitas und Betriebe geschlossen. Der Gedanke, dass Lebensverhältnisse in Stadt und Land gleichwertig sein sollten, wurde in Frage gestellt. Ich unterstütze alle Bemühungen, das Leben im ländlichen Raum wieder attraktiver zu machen. Doch ich finde es geradezu perfide, wenn ausgerechnet diejenigen, die für den Abbau von Infrastruktur im ländlichen Raum verantwortlich waren – die sächsische CDU –, viele Jahre ihre Untätigkeit beim Neubau von Sozialwohnungen in Leipzig und Dresden mit dem hohen Leerstand auf dem Land gerechtfertigt haben.
Doch ist es alleine die Verstädterung, die die Preise in der Stadt ansteigen lässt? Unbestritten ist, dass zu wenig gebaut wurde, um den gestiegenen Zuzug unterzubringen. 2017 bis 2020 wurden im Schnitt weniger als 300 000 Wohnungen im Jahr gebaut,7 nur 50 davon vom Bund.8
Was gebaut wurde, ging häufig am Bedarf vorbei. Neubau ist teuer. Nur ein Bruchteil der Neubauten ist für Durchschnittsverdiener*innen leistbar, die Mieten sind hier besonders hoch. 2014 standen 4,8 Millionen Haushalten mit kleinem Einkommen nur 2,9 Millionen bezahlbare Wohnungen gegenüber9 und seitdem dürfte es nicht besser geworden sein.
Eine größere Rolle spielt jedoch die Tatsache, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt: Die Bevölkerung wuchs in acht Jahren um 1,9, die Anzahl der Haushalte um 8,5 Prozent.10 Auf diese demographische Veränderung hat die Baupolitik bis heute nicht adäquat reagiert. 1,4 Millionen bezahlbare Wohnungen für Alleinstehende fehlen.11
Aber reicht zu geringer und überteuerter Neubau allein als Begründung für den Mietenwahnsinn aus? Wohl kaum. Ich vertrete die These, dass die Spekulation mit Wohnraum die Mietenkrise verursacht. Das Problem entsteht auf den Finanzmärkten, die aus viel Geld noch mehr Geld machen wollen. Dieses Geld von Banken, Fonds und Investor*innen drängt seit Jahrzehnten auf den Immobilienmarkt. Und zwar genau dahin, wo die größtmögliche Rendite mit Wohnungen zu erwarten ist. So mag der Mietenanstieg in Leipzig von 42 Prozent in zehn Jahren nicht nur am Zuzug junger Menschen, sondern auch darin begründet liegen, dass hier viele auf steigende Mieten spekulieren.12 Internationale Investor*innen reichen sich die Klinke in die Hand – und kaufen selbst Schrottimmobilien zu horrenden Preisen.Etwa 15 Prozent der Leipziger Wohnungen gehören inzwischen börsennotierten Wohnungskonzernen oder Fonds, weitere 15 Prozent großen privaten Unternehmen.13 Die Wohnungskrise lässt sich nicht allein auf Modeerscheinungen oder auf Zuwanderung reduzieren. Mindestens ebenso bedeutend ist die Gier der Finanzmärkte nach Profit. Kaum etwas hat sich dafür im letzten Jahrzehnt mehr geeignet als der Kauf von Immobilien. Hinter der Mietenkrise steht das Kapital.
Wie ist es dazu gekommen? Im ersten Kapitel werde ich zunächst die politischen Kardinalfehler der deutschen Wohnungspolitik beleuchten. Denn spätestens seit den 60er-Jahren läuft etwas falsch: Zunächst wurden mieterfreundliche Gesetze geschliffen. Im Zuge einer neoliberalen Wende wurde das Wohnen zunehmend dem Markt überlassen. Der Staat hat die Investitionen in sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau heruntergefahren und ein bewährtes Grundprinzip über Bord geworfen: dass nämlich ein wesentlicher Teil der Wohnungen gemeinnützig bewirtschaftet werden soll, also zum Wohle der Allgemeinheit. Stattdessen wurde der Wohnungsmarkt spätestens durch Schröders Finanzmarktliberalisierung dem Profitstreben der Finanzindustrie ausgeliefert. Wohnungen wurden im großen Maßstab privatisiert, Banken und Fonds entdeckten »Betongold« als lukrative Kapitalanlage.
Das Wohnopoly konnte beginnen. Kapitel zwei beschreibt, wie riesige Wohnungsgiganten mit Wohnungen an der Börse jonglieren – und deren Mieter*innen vor der nächsten Mieterhöhung zittern. Illegales Geld spielt beim Immobilienboom eine große Rolle. Wer hätte es gedacht, gerade in Deutschland. Und die sozialen Folgen der Mietenkrise sind erheblich: Sie treiben das Land auseinander.
In Kapitel drei suche ich nach Gründen dafür, warum die Politik nichts dagegen tut. Welche grundsätzlichen und strukturellen Probleme sorgen dafür, dass sich die Interessen der Mieter*innen nicht durchsetzen, obwohl sie eine Mehrheit in diesem Land bilden? Warum sind die Interessen der Wenigen besser organisiert, wie setzen sie sich durch?
Im vierten und letzten Kapitel möchte ich schließlich einige Ideen formulieren, wie es anders und besser laufen kann.
1Das Sündenregister der deutschen Wohnungspolitik
Mein Uropa soll jeden Abend, wenn er vom Steinbruch kam, in dem er als Pflastersteinschläger arbeitete, mit einer Flasche Bier und mit stolz geschwellter Brust vor seiner Doppelhaushälfte gestanden haben. Er hatte sie mit Unterstützung der gesamten Familie und einer Baugenossenschaft gebaut. Was heute als eher beengte Verhältnisse gelten würde, war damals purer Luxus: Innenklo und fließendes Wasser auf jedem Stockwerk. 30 Jahre zuvor kam er als Waise und als Habenichts ins Dorf. Seine Habseligkeiten sollen in einen Pappkarton gepasst haben. Und jetzt dieser Stolz, es nach zwei Weltkriegen, vielen Entbehrungen, harter körperlicher Arbeit aus den erniedrigenden Umständen heraus »geschafft« zu haben. Er wurde zum Vorsitzenden der Genossenschaft gewählt. Früher war er ein armer Kerl. Jetzt war er ein angesehener Mann.
Meine Uroma hatte noch keinen Feierabend. Doch harte Arbeit war sie gewöhnt. Mit 14 wurde sie in die Stadt geschickt, sie musste bei einer reichen Familie in Köln »dienen«. Ein gutes Zeugnis hatte ihr nichts genutzt. Schulgeld war nicht drin, für ein Mädchen schon gar nicht. Nach der Volksschule war Schluss. Nach dem frühen Tod der Mutter zog sie ihre acht jüngeren Geschwister groß, danach vier eigene Kinder. Jetzt kam ihre Chance: Das neu gebaute Genossenschaftsviertel musste versorgt werden. Sie setzte sich gegen den Widerstand und den Spott ihres Mannes durch: Sie eröffnete im Erdgeschoss einen Tante-Emma-Laden. Mit Anfang 50 verdiente sie endlich ihr eignes Geld. Sie war froh und zuversichtlich: Zehn Jahre später würde sie zum ersten Mal in Urlaub fahren. Ein halbes Jahrhundert später würden die Urenkel*innen ihren Traum verwirklichen: Abitur machen und studieren.
Meine Familie hat vom Genossenschaftswesen profitiert. Bis heute wird diese Geschichte gerne erzählt. Endlich dazugehören. Das kleine Haus, der kleine Laden, das kleine Glück. Das Funkeln in den Augen ist heute noch da. Der Grundstein war gelegt: Den Kindern und Enkelkindern würde es besser gehen.
Was sich heute wie ein Märchen liest, war damals keine Seltenheit: Mitte der 50er-Jahre wurden jährlich über 500 000 solcher Wohnungen gebaut. 500 000-mal kleines Glück. Überall im Land entstanden Siedlungen der Bergleute oder Eisenbahner, bauten die Städte, Arbeiter-Bauvereine, Genossenschaften oder die Betriebe.
Und heute? Solche Aufstiegsgeschichten sind selten geworden. Wer heute Arbeiter oder Haushaltshilfe ist, muss fürchten, aus seiner Wohnung zu fliegen oder an den Stadtrand verdrängt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder Zugang zu höherer Bildung erhalten, ist gering, denn Bildung ist wieder mehr vom Geldbeutel abhängig. Die Enkel werden das Funkeln in den Augen nicht sehen, aber die Erfahrung von Demütigung und Verdrängung. 74 Prozent der Menschen haben heute Angst, ihre Wohnung zu verlieren.1 Statt Aufstiegschancen machen sich Abstiegsängste breit. Warum lassen wir das zu? Was tun wir dieser Gesellschaft an?
Ich will damit die Vergangenheit nicht verklären. Die Wohnungspolitik der Nachkriegsjahre konnte die Stigmatisierung der Armen nicht beenden. Die Plattensiedlungen am Stadtrand, zubetonierte, autogerechte Städte – das würde man so nicht mehr tun.
Dennoch möchte ich mit einer Würdigung beginnen: Das Wirtschaftswunder war auch ein Wohnungswunder. Die Neubauleistung war enorm: 500 000 neue Wohnungen im Jahr. Per Handarbeit wohlgemerkt – mein Opa erzählte, er hätte jeden einzelnen Stein in der Hand gehalten. Von solchen Zahlen können wir heute nur träumen: Die Ampelregierung will jährlich 400 000 Wohnungen bauen. Das gilt trotz technologischem Fortschritt als ehrgeiziges Projekt und viele Expert*innen prophezeien das Scheitern. Die Wohnungs- und Obdachlosigkeit der Nachkriegsjahre wurde schnell gelöst, heute erreicht die Zahl der Wohnungslosen wieder Rekordwerte. Wohnstandard und -qualität machten binnen kürzester Zeit rasante Fortschritte. Heute macht die Modernisierung Wohnungen unbezahlbar. Und das Wichtigste: Eine Wohnung war kein Luxusgut. 1965 mussten nur sechs Prozent der Haushalte mehr als 25 Prozent des Einkommens für die Miete zahlen – das war bereits nach der Liberalisierung des Mietrechts und führte zu großer Empörung.2 Heute zahlen in Hamburg 28 Prozent der Haushalte über 40 Prozent des Einkommens nur für das Wohnen.3 Es blieb also deutlich mehr Geld übrig für Urlaube, Anschaffungen, die Ausbildung der Kinder. Geringe Wohnkosten galten in der Nachkriegszeit als hilfreich. Sie halfen, die Löhne gering zu halten – und damit dem Exportweltmeister Deutschland. Sie trugen auch zum sozialen Frieden bei, denn sie ermöglichten breiten Schichten die gesellschaftliche Teilhabe. Wir haben es schon mal besser hingekriegt.
Dieses »Wunder am Wohnungsmarkt« war »nur zu einem geringen Teil das Ergebnis der Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft. Eine umso größere Rolle hat in den Aufbaujahren die ›sichtbare Hand‹ des Staates gespielt.«4 Es basierte nicht nur auf mehr Neubau, sondern viel mehr auf sozialen Prinzipien, die damals auf dem Wohnungsmarkt gegolten haben. Dazu gehörte eine öffentliche Mietpreisregulierung, eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft, ein großer Anteil öffentlicher Wohnungen und hohe Subventionen in den Sozialen Wohnungsbau. Wie konnte es dazu kommen, dass dieses Erfolgsrezept preisgegeben wurde? In den folgenden Kapiteln möchte ich den Kardinalfehlern der deutschen Wohnungspolitik nachgehen und die Ursachen ergründen. Ich werde mich dabei auf die Instrumente der Bundesrepublik konzentrieren, die also in unserem Rechtssystem schon einmal da waren. Auf die Situation in Ostdeutschland gehe ich bei Gelegenheit ein.
I. Der Markt soll es richten – wie die Mietpreisbindung abgeschafft wurde
»Ich leugne nicht, daß ich manchmal vor dem Mut des Kollegen Lücke doch etwas Angst bekam.« (Konrad Adenauer 1960 bei seiner Rede auf der Großkundgebung der Grundbesitzer)5
Adenauer hatte Angst davor, eine gesetzliche Deckelung der Mietpreise aufzugeben. Sein Bauminister Lücke musste die Abschaffung der Mietenregulierung fast gegen ihn durchsetzen. Nach heutigen Maßstäben wäre Adenauer vermutlich ein Sozialist. Denn »Sozialismus« lautete der Vorwurf, als der Berliner Senat 2020 die Einführung eines sogenannten Mietendeckels beschloss. Die exorbitant gestiegenen Mieten in der Hauptstadt sollten per Gesetz eingefroren und sogar abgesenkt werden können. Vermieterverbände, die Immobilienwirtschaft und ein nicht unerheblicher Teil der Presselandschaft standen Kopf.
Heute halten wir es für normal, dass die Mietpreise sich, wie die Preise von Waren, durch Angebot und Nachfrage am Markt bilden. Doch das war nicht immer so. Die Begrenzung der Mietpreise durch Gesetz reicht lange zurück. Die erste Regulierung der Mietpreise gab es 1918 in Anbetracht der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg. »Mieteinigungsämter« konnten die Mieten herabsetzen. 1922 begrenzte das Reichsmietengesetz dann die Mieten generell auf die so genannte Friedensmiete, also auf die Miete, die 1914 vor Kriegseintritt gegolten hatte. Dieses Prinzip gesetzlich festgelegter Mieten blieb im Prinzip die nächsten Jahrzehnte gültig.6 Flankiert wurde die gesetzliche Mietpreisbegrenzung schließlich durch die wohlklingende »Preistreibereiverordnung« von 1923, die Mietwucher unter Strafe stellte.7
Auch in der Nachkriegszeit wurde daran angeknüpft. Faktisch galt ein Mietenstopp. Die Mieten wurden zunächst auf dem Niveau von 1936 gehalten. Für Neubauten wurde die Mietpreisbindung 1949 aufgehoben und für Altbauten nach und nach allerlei Zuschläge erlaubt.8 Sie galt in der Bundesrepublik grundsätzlich für Altbauten bis Mitte der 60er-Jahre, in Hamburg und München bis Mitte der 70er- und in West-Berlin sogar bis Ende der 80er-Jahre an. Viele Protagonist*innen des Berliner Mietendeckels dürften sich daran noch erinnert haben. In der DDR galt eine gesetzliche Mietpreisbegrenzung auch für Neubauten.
Der Vermieter*innenlobby war die gesetzliche Mietenbegrenzung natürlich ein Dorn im Auge. Ihr Dachverband Haus und Grund drohte Adenauer schon 1954 damit, der CDU nicht mehr ihre Stimmen zu geben. Eine Änderung des Mietrechts zu ihren Gunsten scheiterte allerdings an Adenauer, er wollte nicht den Zorn der Mieter*innenschaft auf sich ziehen.9 Erst sein Bauminister Paul Lücke sah seine Chance gekommen. Mit dem nach ihm benannten »Lücke-Plan« wollte er die freie Marktwirtschaft auch bei Wohnungen durchsetzen. Unter dem Begriff »Wohnungszwangswirtschaft« fasst er die berechtigte Kritik an den Zwangseinweisungen von Menschen in die noch vorhandenen Wohnungen der ausgebombten Städte einerseits mit der gesetzlichen Mietpreisregulierung andererseits zusammen. Nicht nur die Zwangseinweisung, sondern auch die Mietpreisbindung sollte durch das »Abbaugesetz« komplett abgeschafft werden. So wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Der Markt sollte es von jetzt an regeln. Mietpreise sollten nicht mehr reguliert werden, sondern sich frei am Markt entwickeln können. Das klang zu dieser Zeit verheißungsvoll: »Ein solcher Markt hält auf die Dauer den Mietpreis zweifellos am niedrigsten«, frohlockte etwa DIEZEIT in noch ahnungsloser Unkenntnis der heute erheblichen Folgen.10
Der »Lücke-Plan« war eine Art Masterplan, die gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik um zu krempeln. Eigentum und Wohngeld statt gemeinnützigem öffentlichen Wohnungsbau. Markt statt Mietpreisregulierung. Der Lücke-Plan war alles andere als unumstritten: Es wurde gegen den Widerstand der Mieterverbände und zur großen Freude der der Vermieter*innen durchgesetzt. Auch die SPD und auch die Gewerkschaften rebellierten dagegen, selbst der Arbeitnehmerflügel der CDU musste durch Kompromisse auf Linie gebracht werden.11 Die Rache der von Mieterhöhung betroffenen Menschen an der Wahlurne war so gefürchtet, dass die verschiedenen Stufen der Mietenliberalisierung im Gesetz so festgelegt wurden, dass sie die nächsten Wahltermine geschickt umschifften.12
Auch die Länder leisteten über den Bundesrat »zähen Widerstand«.13 Der Kompromiss: Bis Ende 1963 sollte die Mietpreisbindung in 397 Kreisen aufgehoben werden. Sie galten als »Weiße Kreise« – Kreise ohne Wohnungsnot. Schätzungsweise zehn Millionen Menschen waren vom ersten Schritt der Mietenliberalisierung unmittelbar betroffen.14 Hier war eine sofortige Mieterhöhung um 25 Prozent zulässig, unter Umständen sogar bis zu 35 Prozent. Auch in den meisten der übriggebliebenen 168 »schwarzen Kreise« fiel die Mietpreisbindung einige Jahre später.
Bedauerlicherweise wurde im Gesetz keine Vorkehrung für den Fall getroffen, dass der Wohnungsmangel wieder ansteigt – oder die reine Preisbildung am Markt sich doch nicht als Segen herausstellt. Die sozialen Folgen der Mietenliberalisierung waren erheblich. Schneller als erwartet stellte sich heraus, dass der Markt es eben nicht alleine regelt. Es kam »zu stark steigenden Mietkosten und einer wahren Kündigungswelle«15 und in der Folge gar zu »politischen Unruhen«:16 Medien berichten von einer Verdopplung innerhalb von zehn Jahren.17 In jedem Fall war der Mietenanstieg enorm und mit ihm eine größer werdende Belastung mit Wohnkosten.
Hamburg wurde erst 1974 und München 1975 zum »weißen Kreis« gezählt. In der gebeutelten Frontstadt Berlin erfolgte die endgültige Liberalisierung erst 1987.18 Der Widerstand dagegen war so groß, dass eine halbe Million Unterschriften gesammelt wurden. Selbst die CDU beteiligte sich.19
Nach den Gründen für die Abschaffung der Mietpreisbindung muss man nicht lange suchen. Dahinter stand selbstredend der Wunsch der Hausbesitzer*innen auf höhere Einnahmen und das Kalkül der Politik, den Wohnungsmarkt für privates Kapital attraktiver zu machen.
»Die eilige Verabschiedung des Lücke-Plans ist nicht zuletzt auch das Verdienst der kräftig entwickelten Hausbesitzer-Lobby«,20 das erste Paradebeispiel für erfolgreiche Lobbyarbeit in der Wohnungspolitik. Der Eigentümerverband Haus & Grund organisierte während des Gesetzesverfahrens eine Großkundgebung,21 auf der selbst Kanzler Adenauer sprach. Der Vorsitzende des Verbandes Haus & Grund war niemand Geringerer als Lückes Vorgänger im Amt des Bundesbauministers, Dr. Victor-Emmanuel Preusker (FDP). Und der Geschäftsführer des Verbandes, Dr. Carl Hesberg, war zugleich Bundestagsabgeordneter der CDU sowie Vorsitzender des Wohnungsausschusses im Bundestag. An dieser mehr als offensichtlichen Verquickung von politischen Entscheidern und Lobbyinteressen nahm damals offenbar niemand Anstoß. Unverhohlen wurde in den Publikationen von Haus & Grund mehrfach darüber berichtet, dass die Wiederwahl von Dr. Hesberg in den Bundestag mit Hilfe von Wahlkampfspenden an die CDU abgesichert werden sollte.22 Ihm ist zu verdanken, dass das Abbaugesetz im Eilverfahren durch den Bundestag gepeitscht wurde.23 Später erhielt er von Bauminister Paul Lücke das große Verdienstkreuz mit Stern – vermutlich als Dankeschön.
Auch der Ehrgeiz Lückes mag bei der kompletten Aufhebung gesetzlicher Mietpreisregulierung eine Rolle gespielt haben. Der Spiegel mutmaßte, wenn ihm das Kunststück der Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft gelingt, »ohne dass Westdeutschlands CDU-Wähler rebellisch werden, dann rückt der ehemalige Schlossergeselle Lücke auf die Höhe des Wirtschaftsliberators Ludwig Ehrhardt auf«.24 So weit kam es nicht. Anders als Erhard ist Lücke im Alltagsbewusstsein nicht mehr präsent. Aber immerhin gab es 1970 einen Ritterschlag zum Ritter vom Heiligen Grab.
Keinem der in der Folge eingesetzten moderaten Mittel wie etwa der (freiwilligen) Einführung von Mietspiegeln gelang es, den Mietenanstieg wieder zu stoppen. Auch nicht der 2015 beschlossenen »Mietpreisbremse«, die wenigstens die Explosion der Mietpreise bei neuen Mietverträgen abschwächen sollte. Bei der Beschlussfassung zur Mietpreisbremse 2015 kritisierte ich die zahlreichen Ausnahmen: »Dieser Gesetzentwurf ist ausgehöhlt wie ein Schweizer Käse und wird am Ende kaum eine Wirkung entfalten.«25 Leider sollte ich recht behalten. In sechs Jahren Geltung der Mietpreisbremse stiegen die Mieten in Köln um 25, in Stuttgart um 31 und in Berlin um 44 Prozent.26





























