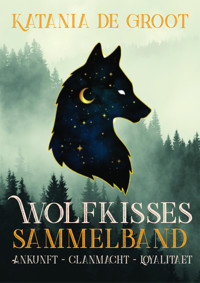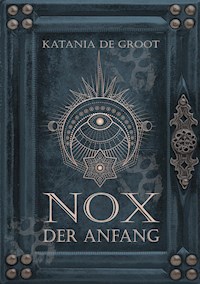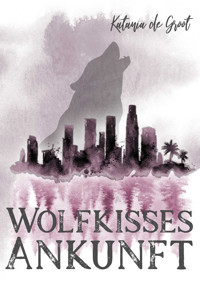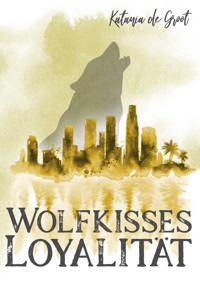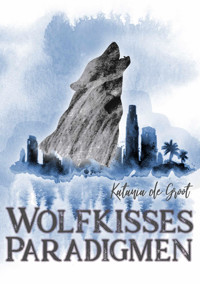
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neon And Moody
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach der Konfrontation zwischen Jägern und Wölfen haben beide Seiten Schwierigkeiten, mit den Verlusten umzugehen. Während Becca von ihrer Rache verschlungen wird, stellt ein unerwarteter Patient Valeries Hilfsbereitschaft auf die Probe. Die Spannung zwischen den Clans erreicht einen neuen Höhepunkt, in dem nicht nur die Wölfe tief in ihre Geschichte eintauchen, sondern auch die Jäger mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolfkisses 4 – Paradigmen
Prolog
»Du schuldest mir ein Leben, Cassidy. Und ich will, dass du es lebst.«
Diese Worte, so wichtig sie waren, kosteten ihn so unendlich viel Kraft. Das Letzte, was er sah, waren ihre bernsteinfarbenen Augen, versteckt hinter einem Schleier aus Tränen, und die Hoffnungslosigkeit, die sich darin spiegelte.
Müde schloss er seine Lider und tat einen weiteren schmerzhaften Atemzug. Selbst ohne sie zu sehen, konnte er sie direkt neben sich spüren. Heiß fielen ihre Tränen auf seine Haut. Ein kleiner Trost, er war nicht allein.
»Ich liebe dich«, wimmerte sie, ihre Stimme gebrochen von dem Schluchzen, das sie zu unterdrücken versuchte.
King verstand ihre Worte kaum. Doch allein sie zu hören, nahm ihm die Furcht. Was auch kommen würde, er war bereit.
Pochend strahlte der Schmerz von der Wunde in seiner Brust aus, lähmte seinen Körper mit jedem Herzschlag immer mehr. Seine Lungen brannten, mit jedem Atemzug taten sie sich schwerer, die Luft zu fassen, die er zum Atmen brauchte. Unerbittlich senkte sich die Dunkelheit auf sein Bewusstsein herab und trennte ihn von seinem Leben.
Cassidys Schluchzen wurde leiser und erstarb schließlich komplett.
King fröstelte. Gerade noch hatte ihre Berührung heiß auf seiner Haut gebrannt, nun hinterließ ihre Abwesenheit bittere Kälte und dann ... war da nichts mehr. Keine Berührung, keine Schmerzen. Nicht einmal der Wolf, der immer Teil seiner Gedanken gewesen war. Selbst der Waldboden, auf dem er gelegen hatte, war verschwunden. Von einem Moment auf den nächsten fühlte er sich leer, fast schwerelos. Dennoch war er nicht so körperlos, wie er erwartet hatte. Oder spielte der Rest seiner Wahrnehmung ihm Streiche? Waren das die letzten verzweifelten Impulse, die durch sein Hirn rasten, aber kein Ziel mehr fanden?
Selbst die Dunkelheit zog sich zurück und hinterließ ein sanftes Dämmerlicht, in dem er vage Schatten wahrzunehmen glaubte.
Eine zaghafte Berührung an seiner Hand ließ ihn abwärts blicken. Ein großer, honigfarbener Wolf stand an seiner Seite. Traurig sah das Tier zu King auf. Blut verklebte das helle Fell und als hätte er es schon tausend Mal getan, kniete King sich hin und ließ seine Hände sanft über den muskulösen Körper gleiten. Doch dort, wo die Schussverletzung hätte sein sollen, war nichts mehr. Er legte dem Wolf seine Arme um den Hals und vergrub sein Gesicht in dem weichen Fell. Er wusste nur zu gut, welche Schmerzen sein Wolf hatte erleiden müssen.
»Es tut mir leid«, flüsterte er. »Es tut mir so verdammt leid.«
Sein Gefährte hatte leiden müssen, wegen seiner Entscheidung, denn mit dem Entschluss, Cassidy zu retten, hatte er ihn unweigerlich mit in den Tod gerissen.
Auch der Wolf schmiegte sich an ihn - für Sekunden? Oder Stunden? King fehlte jedes Zeitgefühl.
Widerwillig löste er sich von seinem Begleiter, dessen grüne Augen ihn musterten. Kein Vorwurf lag in dem Blick, nur Verständnis. Eine leise Mahnung, dass sie jeden Schritt des Weges gemeinsam gegangen waren. Dass es keine Entscheidung gab, die King alleine getroffen hatte. Dass er bereit war, die Konsequenzen ihres gemeinsamen Handelns zusammen zu tragen. Nicht, weil ihm keine Wahl blieb. Sondern weil er sich jeder Zeit wieder gleich entscheiden würde: Die Kugel zu stoppen. Cassidy zu lieben. Alles für sie aufzugeben.
»Ich weiß auch nicht, wie es weiter geht«, wisperte King.
Obwohl das Tier nicht mehr Teil seines Verstandes war, teilte er jedes seiner Gefühle. Sie waren ihr Leben lang eins gewesen, und auch die Trennung durch den Tod konnte das nicht ändern. Der Wolf gehörte unweigerlich zu ihm. Schon immer. Für immer.
King vergrub die Finger in dem weichen Fell, und lehnte seine Stirn gegen die Schulter des Tieres. Zumindest waren sie nicht alleine.
Weitere Ewigkeiten vergingen. Erst eine Bewegung seines Begleiters ließ King aufsehen. Der Wolf hatte die Ohren gespitzt und sah sich um. Verwundert tat er es ihm gleich, doch er konnte keine Formen erkennen, nicht einmal Schatten in dem dämmrigen Licht. Raste sein Herz? Angst kroch ihm den Nacken entlang. Wo war er?
Leises Murmeln jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Er versuchte, zu hören, woher es kam, doch seine Sinne waren eingeschränkt, und ohnehin schien es keine Richtungen mehr zu geben. Oder war das ein Horizont, an dem es heller wurde?
Ein vertrautes Gefühl zog ihn hin zu dem sanften Schimmern.
King schnaubte. Was für ein Klischee.
»Ich schätze, wir sollen ins Licht gehen«, brummelte er, mehr zu sich selbst als zu dem Wolf. Mit einem Seufzen stand er auf, es gab keinen Grund, länger zu verharren. Doch das Winseln seines Begleiters ließ ihn innehalten.
Er wandte sich wieder dem Tier zu.
»Ich weiß«, sagte er sanft. »Ich wünschte, wir wären bei ihr, aber das sind wir nicht. Sie ist in Sicherheit auf der anderen Seite von … was auch immer das hier ist.«
Er schluckte den Kloß herunter, der sich in seinem Hals gebildet hatte. Er musste die Hoffnung loslassen, hier gab es keinen Raum dafür.
Er war tot.
Sie lebte.
Sie würde trauern. Doch er wusste auch, dass sie ihren Weg weiter gehen würde. Sie würde das Rudel nicht im Stich lassen, und irgendwann würde sie wieder jemanden finden, den sie liebte.
»Sie wartet nicht auf uns … Nicht mehr.«
Es fiel ihm schwer, seinen Wolf anzusehen.
Cassidy hatte eine Zukunft - und er? King schluckte. Er wusste nicht, was kam. Ob sie sich in der Ewigkeit wiedersehen würden, oder ob seine Ewigkeit diese Leere war?
»Lass uns gehen.« Wieder sprach er mehr zu sich, als zu dem Tier.
Zögernd machte er den ersten Schritt. Sein Wolf knurrte leise, noch nicht bereit, ihm zu folgen.
Plötzlich: Das Geräusch von splitterndem Glas, und ein warmer Windzug, der die Kälte vertrieb. Etwas hatte sich verändert. King stockte. Plötzlich fühlte er Cassidys Anwesenheit, so klar, als würde die Wölfin direkt neben ihm stehen und sich an ihn klammern.
Hatten seine Gedanken hier so viel Macht?
Wütend flackerte das Licht in der Ferne und Dunkelheit senkte sich wieder auf ihn herab. Der laue Wind wurde eisig und zerrte an King, versuchte, ihn vorwärtszutreiben, während Cassidys Berührung ihn zu sich zog. Ein Kampf hatte begonnen, einer, den King nicht verstand.
Orientierungslos stemmte er sich gegen den Wind, versuchte verzweifelt, Cassidys Ruf zu folgen. Er zitterte vor Anstrengung, kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, doch wieder versagte seine Seele ihm den Dienst. Er wusste nicht einmal, in welche Richtung er sich hätte wenden müssen, um ihr nah zu sein.
Der Wolf jaulte und drängte sich an seine Beine. Er konnte die Angst des Tieres deutlich spüren, denn sie teilten sie. Nie hatte er sich so zerbrechlich gefühlt wie in diesem Moment.
»Cassidy.« Ein einzelnes Wort, an das er sich klammerte. Ein Gedanke, der ihn einhüllte.
Doch wie sehr King ihm auch nachgeben wollte, seine Muskeln waren erstarrt. Er konnte sich nicht bewegen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Zitternd fiel er auf die Knie. Der Wolf neben ihm winselte und King schloss die Augen. Unsichtbare Ketten hielten ihn an Ort und Stelle, gruben sich in seine Haut, drohten, ihn zu zerreißen. Zeitgleich zogen sie ihn in die Dunkelheit und ins Licht.
Kapitel 1
Hastig sah Mila sich um. Hinter jedem knackenden Ast konnte ein Angreifer lauern, bereit, sie ohne Prozess zu richten. Den Blick immer wieder durch das Unterholz wandern lassend, rannte sie weiter. Doch auch auf den nächsten Metern brach kein Wolfspack aus den Büschen. So leise sie konnte, hetzte sie durch den Wald. Es war nicht der gleiche Weg, den sie vorher genommen hatten, aber ihre tierischen Sinne leiteten sie. Ein weiteres Knacken. Erschrocken beschleunigte sie ihren Schritt. Wieder folgte kein Angriff. Die Wölfe hatten genug damit zu tun, den jungen Verletzten zu suchen, der die Klippe hinabgestürzt war. Sein fassungsloser Gesichtsausdruck hatte sich tief in Milas Gedanken gebrannt, würde sie bis in ihre Träume verfolgen. Einmal war der junge Wolf Christoph und ihr entkommen, am Strand mit Hilfe der Meerhexe. Ob er ein zweites Mal Glück hatte?
Sie wünschte es ihm, auch, wenn sie es wohl nie erfahren würde.
Die Schneeleopardin zwang ihre Gedanken wieder auf den unsichtbaren Pfad vor sich. Weg von den Wölfen, deren Klagelaute sie auf ihrer Flucht gehört hatte. Die Verzweiflung im Schrei der Alpha hatte nicht nur sie, sondern sogar ihren Begleiter zusammenzucken lassen. Vielleicht hatte Christoph Tosney am Ende doch ein Herz gehabt?
Ihre Pfoten trugen sie weiter. Weg von dem Mann, der alleine sterbend im Wald lag. Dessen letzte Tat es gewesen war, ihr die Freiheit zu schenken. Eine Freiheit, für die zu viele hatten teuer bezahlen müssen. Christoph, Andrew, die Wölfe, so viele verlorene Seelen, die den Boden des Waldes heute mit ihrem Blut getränkt hatten.
Noch ein Schritt. Weg von ihrem Gewissen, das an ihr nagte, weil sie es zugelassen hatte.
An diesem Tag hatte niemand gesiegt. Die Jäger nicht, die Wölfe nicht. Selbst, wenn es auf den ersten Blick so schien, sie ebenfalls nicht. Frei zu sein bedeutete ihr nichts, nicht zu diesem Preis. Es brachte weder sie noch Irene näher an die Unabhängigkeit, die sie sich erhofft hatten.
Ein letztes Mal beschleunigte sie das Tempo. Durch die Bäume hindurch konnte sie die dunkle Lackierung des Trucks sehen. Sie war am Ziel. Heute Vormittag waren sie zu dritt mit dem Fahrzeug in den Wald gefahren. War das wirklich erst ein paar Stunden her?
Jetzt kehrte sie alleine zurück.
Mila wusste, dass sie sich beeilen musste, selbst wenn die Wölfe sie nicht verfolgten. Was Christoph ihr geboten hatte, war die Wahl zwischen ihrem eigenen Tod durch die Hand der Jäger und einem Leben in Freiheit.
Letzteres war etwas, das sie nicht kannte. Etwas, das sie ängstigte. Trotzdem hätte ihr die Wahl nicht so schwerfallen sollen.
Konnte sie Irene wirklich den Rücken kehren und sie alleine lassen in dieser fürchterlichen Familie, mit diesen Monstern in Menschengestalt? Schon der Gedanke an Imogen und Grace ließ der Leopardin einen Schauer über den Rücken laufen.
Ihr Leben lang hatte sie für Irene gekämpft, schon seit deren Vater sie als Kind in einem heruntergekommenen Heim gefunden und zu sich genommen hatte. Als Jäger hatte er den Schneeleoparden in ihr gesehen, noch bevor sie davon gewusst hatte, und sie von klein auf darauf trainiert, seine Tochter zu beschützen. Es war seine Art gewesen, Irene seine bedingungslose Liebe zu zeigen, vor allem, da ihm von Anfang an bewusst gewesen war, dass sie nicht dem Pfad der Jäger folgen würde. Dass ihr Weg gefährlich sein würde, und sie jede Hilfe brauchen würde, die sie bekommen konnte.
Mila hatte gelernt, für sie einzustehen, wann immer sie es selbst nicht konnte. Und Irene hatte sie gut behandelt. Die Mädchen waren Freundinnen gewesen. Waren es immer noch. Und jetzt sollte Mila gehen, ohne sich umzublicken?
Was würde ein Leben ohne Mila, ohne Christoph für sie bedeuten? Wer würde sie jetzt noch beschützen?
Denn auch, wenn die Verbindung, die Irene und Christoph geschlossen hatten, nicht aus Liebe, sondern nur aus Notwendigkeit heraus entstanden war, hatte auch er sie vor den Furien beschützt. Irene zu beschützen, hatte für sie beide an oberster Stelle gestanden, selbst, wenn es bedeutete, Opfer zu bringen.
Die Narben auf Milas Rücken juckten.
Und doch hatte Christoph recht gehabt. Imogen würde Mila nicht leben lassen, nicht nach dem, was im Wald vorgefallen war. Tot waren sie für Irene beide nutzlos.
Mit diesem Gedanken wandelte sie sich zum Menschen. Sie richtete sich auf und schwankte, die erneute Wandlung kostete sie Kraft. Eine Weitere wäre in ihrem Zustand riskant; sie musste sich ausruhen, etwas essen. Erst nach zwei Schritten hatte sie sich an die unpraktischen Beine gewöhnt. Wie schwach diese Gestalt doch war, wenn man an die Stärke dachte, welche die Raubkatze mit sich brachte.
Hastig suchte sie auf dem Hinterreifen nach dem Schlüssel. Erst, als sie ihn fand und den Wagen aufsperrte, beruhigte sie sich. Es juckte sie in den Fingern, einfach in das Auto zu steigen und davonzufahren, aber es hatte einen Peilsender. Die Tosneys würden sie finden, noch bevor sie die erste Grenze überschritten hatte. Außerdem hätte die Scheibe sie ohnehin nicht vor den Wölfen schützen können. Trotzdem genoss sie für einen Moment die Illusion von Sicherheit, die das Gefährt ausstrahlte.
Sie öffnete die Hintertür und zog die dunkle Sporttasche vom Rücksitz. Dankbar über die Kleidung, schlüpfte sie in ihre Jeans und das ausgeleierte Shirt; mit ein paar Handgriffen band sie sich die Dreads zurück. Hastig öffnete sie einen Müsliriegel und nahm einen großen Bissen. Es gab eine Handvoll mehr in der Tasche, doch lange würde der Vorrat nicht halten. Sie würde als Erstes etwas zu essen kaufen müssen. Dafür brauchte sie Geld.
Sie stopfte den Rest des Riegels in ihren Mund und wandte sich kauend dem Beifahrersitz zu. Für einen Moment hielt ihr Kiefer inne und mit angehaltener Luft tastete sie vorsichtig über den Teppich, mit dem der Fußraum des Wagens ausgestattet war. Keine Erhebung, kein Hinweis darauf, dass irgendwas hier versteckt sein könnte. Mila fühlte, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich. Hatte Christoph sie angelogen? Warf er sie auf den letzten Metern den Jägern zum Fraß vor?
Enttäuscht wollte sie aufgeben, als sie mit dem Handrücken gegen den Henkel eines Jutebeutels stieß, der mit breiten Klebestreifen an der Unterseite des Sitzes befestigt war. Sie lachte leise. Erleichterung durchflutete sie. Natürlich, unter dem Sitz, nicht unter dem Boden. Mit einem Ruck löste sie die Tasche und zog ihre Zukunft ans Licht. Vorsichtig lugte sie hinein. Zwei Bündel mit hundert Dollar Noten lagen darin, und Ausweispapiere. Ihr Foto mit einem fremden Namen. Noel Holliday. Mila verzog das Gesicht. Für den Anfang würde es reichen. Genau wie Christoph es mit Irene vereinbart hatte.
»Danke«, flüsterte sie leise in den Wald, auch wenn er es nicht hören konnte. Sie schloss die Augen und ließ zu, dass Erleichterung sie durchflutete. Freiheit. Nach all den Jahren. Doch nur Sekunden verstrichen, da verschwand das Gefühl. Die Konsequenzen ihrer Freiheit prasselten auf sie ein. Und Angst kroch ihren Rücken entlang.
Kaum, dass sie die Augen wieder öffnete, fiel ihr Blick auf das kompakte Trauma-Kit in der Ablage der Beifahrertür, das alle Jäger für Notfälle mit sich führten. Mila presste die Lippen aufeinander und sah den Weg entlang, den sie gekommen war.
Hatte sie eine Chance, ihm zu helfen? Vielleicht lebte er noch. Vielleicht konnte sie rechtzeitig da sein.
Einen Moment noch zögerte sie, dann stopfte sie das schwarze Päckchen entschlossen in die Sporttasche zu den anderen Sachen und schlüpfte in ihre Sneaker. Es war egal, ob sie früh genug kam, oder ob sie den Wölfen in die Fänge lief. Sie würde es sich nicht verzeihen, hätte sie es nicht zumindest versucht. Wenn es den Hauch einer Hoffnung gab, dass sie mit ihm zu Irene zurückkehren konnte, musste sie es versuchen.
***
Die Reifen quietschten, als Luke das Auto vor dem Haus der Geschichtenwahrerin zum Stehen brachte. Marai wartete nicht ab; sie sprang aus dem Wagen, während er den Motor abwürgte. Die Anspannung in der Luft war fast greifbar.
Vanessa stand in der Eingangstür. Sie war blass, tiefe Sorgenfalten zeichneten sich auf ihrem Gesicht ab. Die sonst immer tadellos gekleidete Frau hatte nicht einmal auf das getrocknete Blut geachtet, das ihr T-Shirt zu einer stillen Mahnung machte. Ihr Anblick unterstrich so den Ernst der Lage.
»Du siehst aus, als könntest du eine Pause gebrauchen«, begrüßte Marai die ältere Frau.
Diese lachte freudlos. »Ich habe keine Zeit für Pausen.«
»Die Clanmacht scheinbar schon«, erwiderte Marai. »Zumindest nach dem, was ich über Cassidys Zustand gehört habe«, fuhr sie fort, als sie Vanessas fragenden Blick sah.
»Die auch nicht«, antworte sie barsch. »Beccas Wolf ist zurückgekehrt und die Clanmacht konzentriert sich gerade ganz auf die wiedergekehrte Alpha.«
Überrascht sah Marai auf. »Wie geht es ihr?«
»Becca ist schwach, aber sie erholt sich. Sie wollte Cassidy nicht allein lassen, darum habe ich sie in mein Bett gelegt.« Vanessas kurzes Lächeln war liebevoll. »Wie ein Kind, das unbedingt wachbleiben wollte, ist sie vor Erschöpfung fast sofort eingeschlafen.«
Marai nickte. »Wo ist Tyson?«
»Wieder im Wald, er sucht nach Sunny. Die Jäger haben ihn getroffen.« Sie schluckte sichtlich. »Er ist in den Fluss gestürzt.«
Der Schock legte sich wie eine kalte Hand um Marais Herz. Fast meinte sie, das Wasser zu spüren, das über dem jungen Wolf zusammenschlug. Er hatte jetzt schon genug erleiden müssen, um mehrere Leben zu füllen, und doch hatte die Meerhexe zwischen den Welten gesehen, dass sein Schicksal noch nicht mit ihm fertig war. Sie versuchte, die Angst um Sunny und die Dunkelheit, die über seiner Zukunft lag, herunterzuschlucken, doch sie klebte an ihr wie Morast.
Einen Moment blinzelte sie, ehe sie ihre Konzentration wieder zu Vanessa zwang, die vor ihr stand.
»Wenn Becca wieder aufwacht, möchte ich sie gerne sehen. Wie geht es den anderen Patienten?«, fragte Marai, während sie mit der Geschichtenwahrerin gemeinsam deren Haus betrat. Die drückende Stimmung der Siedlung setzte sich in den sonst heimeligen Räumen fort.
»Unverändert«, sagte Vanessa leise. »King ist eiskalt, aber sein Herz schlägt. Schwach zwar, aber stetig. Cassidy ist ...« Hilflos sah sie Marai an. »Sie ist wach, aber apathisch. Die Verletzungen der beiden machen mir Sorgen.«
»Erzähl mir genau, was passiert ist, dann werde ich sehen, was ich tun kann.« Sie folgte Vanessa ins Wohnzimmer, ehe sie besorgt hinzufügte: »Aber wenn sie so stark verletzt sind, solltet ihr besser Valerie holen. Ich bin keine Heilerin.«
»Dylan hat sich bereits um die gröbsten Verletzungen gekümmert.« Vanessa blieb stehen, wich aber Marais Blick aus. »Natürlich haben wir versucht, Valerie zu erreichen, aber in der Notaufnahme ist anscheinend die Hölle los. Wir haben ihr über das Krankenhaus eine Nachricht hinterlassen, aber sie hat sie wohl noch nicht erhalten. Du kannst dir sicher sein, dass sie so schnell herkommen wird, wie sie kann.«
Die Meerhexe musterte ihr Gegenüber aufmerksam. »Da ist noch etwas, oder? Dylan ist zwar Tierarzt, aber eine Schusswunde zu versorgen, sollte kein Problem für ihn darstellen.« Marai seufzte. »Du verheimlichst mir schon wieder etwas.«
Die Geschichtenwahrerin presste die Lippen aufeinander, nickte aber schließlich. »Ja, aber ich denke, du wirst es selbst sehen, besser noch als jeder von uns.«
»Ich hasse diese Geheimniskrämerei eurer Rudel.« Marai versuchte, ihre Frustration nicht in ihrer Stimme mitklingen zu lassen.
Vanessa zuckte mit den Schultern. Wie schon früher hatte sie zum Schutz ihre pragmatische Maske aufgesetzt, doch unter der Oberfläche konnte Marai ihre Sorgen spüren. »Es ist kein Geheimnis, ich hätte nur gerne deine ungetrübte Meinung.«
Marai nickte. »Ich tue, was ich kann, aber ich kann nichts versprechen.«
»Das weiß ich. Ich würde dir jederzeit mein Leben anvertrauen.« Der warme Ton, den Vanessa angeschlagen hatte, hätte unter anderen Umständen beruhigend gewirkt, doch Marai wusste zu gut, was auf dem Spiel stand.
»Es geht aber nicht um dein Leben, sondern um das deiner Enkelin«, erwiderte Marai. Ihre Maske war besser. Hoffte sie zumindest. Selbst in dieser für die Wölfe bedrohlichen Situation war sie nicht bereit, in ihrer Achtsamkeit nachzulassen.
Ertappt zuckte Vanessa zusammen. Die erste ehrliche Regung.
Schmunzelnd schüttelte Marai den Kopf. »Schau nicht so überrascht, ich kann die Bänder sehen, die Familienmitglieder verbinden. Davon abgesehen drängt dieses Geheimnis an die Oberfläche. Ihr werdet es nicht mehr lange verbergen können.« Abrupt wechselte sie das Thema wieder. »Zeig mir, wo die beiden sind.«
»Die drei, Jonah ist auch da.«
Vanessa deutete auf Cassidys Zimmer und gemeinsam durchquerten sie das Wohnzimmer. Der Raum war gerade einmal groß genug für das Nötigste. Das breite Bett in der Ecke nahm den meisten Platz ein. Ein kleiner Kleiderschrank, ein Schreibtisch und ein Sessel, auf dem Cassidy gerade kauerte, vervollständigten die Einrichtung.
Marai nahm sich einen Moment, den Anblick auf sich wirken zu lassen.
Der Warith der Nekare lag auf dem Bett, so bleich wie das Laken, das ihn von der Hüfte abwärts bedeckte. Ein großer, strahlend weißer Verband verdeckte die Wunde am Brustkorb, was die Meerhexe als gutes Zeichen nahm. Zumindest die Blutung schien gestillt zu sein.
Von dem, was Marai wusste, hatte Cassidy das Gegenstück dazu auf ihrer Brust. Sie war auf der Bettkante zusammengesunken und hielt die Hand des Bewusstlosen. Das arme Ding war vor Erschöpfung eingeschlafen. Kein Wunder, bei dem, was sie erlebt hatte.
Neben ihr stand Jonah an das geschlossene Fenster gelehnt und hielt stoisch Wache. Er hatte aufgesehen, als die beiden Frauen den Raum betreten hatten, war jedoch stumm geblieben. Seine Blicke verfolgten aufmerksam jede von Marais Bewegungen.
Erst beim Nähertreten bemerkte Marai das Band. Unsichtbar für die Meisten spannte es sich zwischen den beiden Verliebten. Silbern umwickelte es ihre Hände und verband ihre Körper. Deutlich sah Marai die Energie, die von Cassidy aus zu King floss. Ihre Seele tröpfelte durch diese Verbindung, doch auf seiner Seite war nichts, was sie empfangen konnte. Das, was King ausgemacht hatte, war verschwunden und Cassidys Lebensenergie verrann wie Wasser im Sand.
Für den Moment wünschte Marai, dass sie es nicht sehen konnte, weder das Band noch die schwarzen Adern, die sich, für die anderen unsichtbar, über Kings Haut zogen. Der Griff der Nekare. Sie vergifteten seinen Körper und beeinträchtigten die Heilung, als wollte die Clanmacht seines Vaters sicherstellen, dass keine Seele in dieser Hülle Platz finden konnte.
Ein unerbittlicher Kampf und Cassidy kämpfte ihn alleine, von der Daichin abgeschnitten, gegen die uralte Macht eines ganzen Clans.
Leise trat Marai an die Schlafende heran und berührte sie leicht an der Schulter. Erschrocken zuckte die junge Frau zusammen. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie auf, Panik im Blick, und es dauerte einige Sekunden, bis sie sich beruhigt hatte. Hastig sah sie sich um, als wüsste sie nicht, wo sie war.
»Du musst dich ausruhen«, bestimmte Marai mit leiser Stimme. »Richtig ausruhen, nicht auf einem Stuhl schlafen.« Sie wandte sich an Vanessa. »Gibt es einen anderen Raum, in dem sie sich für einige Zeit hinlegen könnte? Und wenn es das Wohnzimmer ist.«
Cassidys Körper versteifte sich sichtlich. Ihre Finger schlossen sich fester um Kings regungslose Hand. »Ich gehe hier nicht weg«, fauchte sie.
Marai seufzte. Nichts anderes hatte sie erwartet. »Während ich ihn untersuche, wirst du den Raum verlassen«, bestimmte sie streng. »Deine Energien würden mich ablenken und es könnte sein, dass ich etwas Wichtiges übersehe. Etwas, das ihn retten könnte.« Auffordernd sah sie zu Jonah.
Der hatte sich von der Wand abgestoßen und stand nun neben dem Sessel. »Cass, komm mit«, sagte er sanft.
Unsicher sah die junge Wölfin von Marai zu Vanessa.
»Komm schon, Cass, es ist für King«, wiederholte Jonah, etwas bestimmter dieses Mal. Er streckte die Hand nach ihr aus.
Schließlich gab Cassidy sich geschlagen. »Aber nur so lang wie nötig«, murmelte sie.
»Als würde man mich länger von ihm fernhalten können«, erwiderte Jonah. Es war unmöglich, zu erraten, ob er wirklich einverstanden war, oder nur gut darin, Befehle zu befolgen.
Schwankend erhob sich Cassidy und küsste King auf die Stirn. »Ich bin gleich wieder da«, flüsterte sie. Dann nahm sie Jonahs Hand und ließ sich wie ein Kind von ihm nach draußen führen. Vanessa folgte ihnen, und die Tür fiel mit einem leisen Klicken ins Schloss.
Marai war dankbar für die Ruhe.
Interessiert beobachtete die Meerhexe, wie das Band sich verhielt. Es streckte sich. Hatte es vorher den Durchmesser eines Bleistiftes gehabt, war es nun deutlich dünner geworden. Schon der geringe Abstand zwischen den beiden schien es zu beeinflussen. Die Energie hatte es schwerer hindurchzufließen, und es schillerte nicht mehr so, wie noch vor Sekunden. Zufrieden nickte sie und setzte sich neben den bewusstlosen Körper auf die Bettkante.
»Wo bist du?«, flüsterte sie, während sie ihre Finger sanft an seine Schläfen legte, auf der Suche nach einem Widerhall seines Geistes. Sie fühlte die Magie unter ihrer Haut erwachen. Sie brachte ihre Tätowierungen zum Glimmern.
Sie erwartete keine Antwort auf eine Frage, die sie in den Kosmos stellte. Es gab dort draußen zu viele Möglichkeiten. Für das Mädchen würde sie tun, was sie konnte, doch wenn sie keine Lösung fand ... Sie stockte. Es fiel ihr schwer, den Gedanken zu Ende zu denken. Wenn sie keine Lösung fand, würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als das Band zwischen den beiden zu zerstören. Nur so würde sie zumindest eines der Wolfskinder retten können. Hoffentlich zumindest.
Ob Cassidy sich dieses Versagen jemals würde verzeihen können?
Kapitel 2
Privatfahrzeug. Bisswunde. Männlich, Mitte dreißig, Bewusstseinslage fluktuierend.
Mehr hatte Valerie nicht über den neuen Patienten erfahren.
Sie seufzte. Gerade war sie aus dem OP gekommen, nur um in der Notaufnahme sofort mit dem nächsten Fall betraut zu werden. Dabei hatte sie noch nicht mal zu Mittag gegessen.
So, wie es klang, würde sie auch hier wieder einige Stunden beschäftigt sein. Aber vielleicht hatte sie Glück und die Ranger, die den Mann im Wald aufgelesen hatten, hatten nur mal wieder übertrieben. Eine Bisswunde, das konnte alles bedeuten: von einem leicht blutigen Finger, weil man sich mit einem Chihuahua angelegt hatte, bis hin zum Fehlen eines halben Armes. Immerhin war das hier Los Angeles, und nicht nur auf gut gesicherten Filmsets gab es Raubtiere – von den netten Wölfen aus der Nachbarschaft mal abgesehen. Aber ein so schwerer Angriff auf einen Menschen war äußerst selten. Zumindest, wenn die Leute nicht dämlich genug waren, sich Jungtieren zu nähern.
Wahrscheinlich hatte den Armen einfach nur ein Eichhörnchen gebissen und er war in Ohnmacht gefallen, weil er kein Blut sehen konnte.
Oder, sie fühlte, wie Adrenalin ihren nächsten Herzschlag beschleunigte, es war wirklich einer der Wölfe gewesen? Was, wenn jemand aus dem Rudel sich hatte verteidigen müssen, und der Mann, der gleich hier auftauchen würde, ein Jäger war? Nervös begann sie, auf und ab zu gehen, und schickte ein stilles Gebet an die Aleashira, dass – sollte es wirklich so sein – der Gegner des Mannes niemand gewesen war, den sie kannte. Wenn einer der Wölfe oder der Bären verletzt war, dann wurde sie vielleicht zuhause gebraucht - und zwar dringend.
Ihre Unruhe wuchs mit jedem Moment. Wie lange konnte es dauern, die letzten paar Meter zur Notaufnahme zu fahren?
Noch einmal versicherte sie sich, dass die Trage bereitstand, und dass ihre Handschuhe richtig saßen. Ihr Team war anwesend. Der Schockraum war frei und Lydia hatte für den schlimmsten Fall Blutkonserven reservieren lassen. Alles, was fehlte, war der Patient.
Das Handy in Valeries Tasche vibrierte, doch ehe sie danach greifen konnte, bog ein dunkelgrüner Truck um die Ecke und schlitterte mit quietschenden Reifen die Einfahrt der Notaufnahme entlang. Valerie wäre am liebsten gleich losgesprintet, zwang sich jedoch abzuwarten, bis das Fahrzeug zum Stehen gekommen war, ehe sie vorsprang. Vorsicht war besser, als noch ein weiteres Team für die behandelnde Ärztin anfordern zu müssen.
Sobald der Fahrer aus dem Wagen sprang und die Klappe des Pick-ups öffnete, trat Valeries Angst um die Wölfe in den Hintergrund. Nun war sie ganz bei der Sache.
Endlich wurde die Sicht frei. Eine zierliche Frau kniete auf der Ladefläche, über eine regungslose Gestalt gebeugt. Ihre Hände hatte sie an die Halsbeuge des Patienten gepresst, blutdurchtränkte Stofffetzen ragten zwischen ihren Fingern hervor. Ihre Jeans hatte sich mit der roten Flüssigkeit vollgesogen und auch die Rückfläche des Wagens erinnerte eher an ein Schlachthaus, als an ein Auto. Panik stand der Unbekannten in den Augen, ihre Bewegungen wirkten mechanisch. Sie stand ganz offensichtlich unter Schock. Es klang wie einstudiert, als sie Valerie mit präzisen Sätzen sagte, was sie wusste: »Sein Atem geht flach, manchmal ist er bei Bewusstsein, aber nie lange. Wir haben ihn im Wald gefunden, vermutlich ein Tierangriff.« Die Rangerin deutete mit dem Kinn auf den Patienten, dabei fiel Valerie auf, wie sehr sie zitterte. »Er hat auch eine Bisswunde am Arm, da haben wir einen Verband angelegt. Aber die Verletzung am Hals ist schlimmer. Selbst mit dem Druck meiner Hände blutet sie noch immer.« Sie stockte. »Er hat so viel Blut verloren ... Da ist so viel Blut, er müsste längst tot sein!« Sie klang, als würde sie gleich die Nerven verlieren.
»Sie haben das großartig gemacht«, erwiderte Valerie, bevor sie sich grimmig an ihr Team wandte. »Das Labor soll uns das 0 Negativ schicken und ich brauch einen Schnelltest zur Blutgruppenbestimmung, falls wir mehr brauchen«, kommandierte sie, während sie mit einem Helfer und der Nottrage auf die Ladefläche kletterte. »Und besorgt der Frau einen Psychologen und frische Kleidung.«
Der Helfer breitete die Trage neben dem Verletzten auf der Ladefläche aus und kümmerte sich um die Vitalparameter, während Valerie eine schnelle Ersteinschätzung vornahm. Das Auffälligste war mit Sicherheit die Wunde am Hals, auf die die Rangerin noch immer ihre Finger presste und aus der trotzdem noch Blut zu sickern schien. Die Verletzung am Arm wirkte dagegen wie ein einfacher Kratzer, hier schien die Blutung stillzustehen. Weitere Verletzungen konnte sie auf die Schnelle nicht ausmachen, doch es war schwer, zu sagen, was sich unter der Kleidung verbarg. Seine Haut wirkte fahl, fast wie bei einer Leiche, aber sein Brustkorb hob und senkte sich in schnellen, rhythmischen Abständen. Trotzdem ging sein Atem flach.
»Vitalparameter?«
»Blutdruck 90 zu 60, Sauerstoffsättigung 78 %.« Ihr Kollege, der gerade einen Zugang legte, sah auf den Monitor. »Puls bei 154.«
»Können Sie mich hören?«, fragte sie, auch, wenn sie keine Antwort erwartete. Als der Patient nicht reagierte, rieb sie ihm einmal kräftig mit der Faust über das Brustbein; ein dumpfes Stöhnen erklang. Vorsichtig öffnete sie beide Augenlider und leuchtete mit der kleinen Taschenlampe hinein. Seine Pupillen waren etwas größer, als es normal gewesen wäre, verengten sich jedoch, kaum dass das Licht auf sie traf.
»Intubationsbesteck bereithalten. Fünf Liter Sauerstoff, zwei Liter Emi. Ketamin und Midazolam - was meint ihr, wie viel er wiegt? 90 Kilo?«, rief sie über die Schulter. »Und sie sollen einen OP frei machen.«
Valerie steckte die Lampe wieder in ihren Kasack und sah die Frau an. »Jetzt nicht loslassen, für einen Moment brauchen wir den Druck auf seinen Hals noch.«
Mit geübten Griffen rollten sie den Körper des Bewusstlosen auf die Seite und schoben das starre Plastik unter den Verletzten.
Valerie schloss die Gurte, ehe sie sich wieder an die Frau wandte: »Ich übernehme jetzt, in Ordnung? Auf drei.«
Die Ärztin legte ihre Hände rechts und links neben die der Rangerin, eine Kompresse fest in Händen, und begann mit ruhiger Stimme zu zählen. »Eins. Zwei ...« Die Augenlider des Verletzten flackerten. »Drei.«
Ein Prickeln in ihrem Nacken drohte kurz, sie abzulenken; ihr Wolf jaulte in ihren Gedanken, als würde Gefahr sich nähern. Ihre Hände aber führten instinktiv die richtigen Bewegungen aus und im nächsten Moment war das Gefühl auch schon wieder verschwunden, zusammen mit dem Bewusstsein des Patienten.
Valerie nickte ihrem Team zu. »Wir bringen ihn in Trauma eins.«
Ein weiterer Helfer kam auf die Ladefläche und während Valerie weiter mit den Händen die Wunde verschloss, hoben die Männer ihren Patienten von dem Truck auf die bereitstehende Rollliege.
Lydia tauchte neben ihr auf und streifte dem Patienten im Gehen eine Sauerstoffmaske über das Gesicht, hängte die Flüssigkeit an, injizierte die Medikamente.
»Ich hab den Psychologen für die Rangerin angefordert«, teilte sie ihr mit. »Intubationsbesteck ist bereit, OP drei ist frei.«
Valerie nickte dankbar. Das Team in der Notaufnahme funktionierte perfekt.
Sie schoben den Bewusstlosen in den Schockraum und machten sich daran, seine Werte zu erfassen, während Lydia die erste Blutkonserve anhängte.
Eine der Schwestern schnitt das ohnehin schon zerrissene Shirt auf und eine weitere wischte eilig über den Brustkorb, damit die EKG-Elektroden besser haften würden. Lydia, die inzwischen fertig war, übernahm es, den Druck auf die Wunde aufrecht zu halten.
Valerie schüttelte sich die Finger aus.
Während die Schwestern nun routiniert die Elektroden klebten, untersuchte sie mit raschen Handgriffen den Patienten auf weitere Wunden, konnte aber nichts finden.
Sie griff nach dem Ultraschallkopf, um sich einen Überblick über den Brust- und Bauchraum zu verschaffen.
»Immerhin kann er sich nicht darüber beschweren, dass das Gel zu kalt ist«, meinte Lydia grinsend und Valerie verdrehte die Augen.
Trotzdem gab er ein leises Stöhnen von sich, als sie den Schallkopf gegen seine Rippen drückte. Kurz flackerten seine Augenlider und das beklemmende Gefühl, das Valerie schon auf der Ladefläche gespürt hatte, legte sich ein weiteres Mal um sie. Ihr Blick zuckte zu seiner rechten Hand, wo ein schmaler Silberreif im grellen Licht funkelte.
»Ein Ehering«, kommentierte Lydia, die Valeries Blick gefolgt war. »Das heißt, wenn wir Scheiße bauen, wird jemand ihn vermissen.«
Als hätte sie es heraufbeschworen, ließ im nächsten Moment ein lautes Piepen ihre Köpfe zum Monitor herumschnellen.
»Scheiße, Kammerflimmern«, fluchte Valerie. »Puls bei 210. Blutdruck 54 zu 30. Er stirbt.« Eilig stopfte sie den Schallkopf zurück in die Halterung.
»Defi!«, bellte Lydia, während Valerie auf die Liege kletterte, um mit der Reanimation zu beginnen. »Ambu-Beutel!«
Valerie begann zu drücken.
Lydia, deren Kopf dicht neben ihrem war, hob vorsichtig die Kompresse an. Kein Blut sprudelte mehr aus der Wunde hervor, nur noch ein schmales Rinnsal, das sich rasch verlieren würde. »Fuck.«
Der Kollege mit dem Beatmungsbeutel kam angerannt und Lydia rief ihn zu sich. »Du versorgst die Wunde, so gut es eben geht. Ich übernehme die Beatmung«, ordnete sie an.
Endlich war auch der Defi da, eilige Hände arbeiteten um Lydia und Valerie herum, schoben ein Reanimationsbrett unter den Patienten, klebten die Pads, schlossen Kabel an. Mit einem Piepsen erwachte das Gerät zum Leben.
»Stopp! Rhythmusanalyse!«, rief Lydia und alle hielten für einen Moment still. »Herzstillstand. Val, runter mit dir. Sind alle Hände weg? Dann Schockabgabe in drei … zwei … eins.«
Inzwischen hatten Lydia und Valerie Plätze getauscht, die Anästhesistin übernahm nun das Pumpen, Valerie drückte auf den Beatmungsbeutel.
»Dreißig, neunundzwanzig -«
Lydias Pager piepte.
»- achtundzwanzig -«
Jetzt piepte auch der von Valerie.
»- siebenundzwanzig, sechsundzwanzig -«
Noch mehr Pager begannen zu piepen.
»Schwerer Verkehrsunfall auf dem Harbour Freeway«, rief eine der Schwestern. »In der Ambulanz ist gleich die Hölle los.«
»-vier, drei, zwei, eins. Rhythmus?« Lydia ignorierte die Frau und kletterte von der Liege.
Valerie sah auf den Monitor und schüttelte den Kopf.
Das Gerät wurde erneut geladen, schon zuckte der nächste Stromstoß durch den Patienten.
Wieder nichts.
»Alle, die hier nicht unmittelbar gebraucht werden, sollen sofort in die Ambulanz kommen«, bellte jemand vom Eingang her. »Befehl von oben.«
Valerie und Lydia sahen sich an. Dann eben nur noch sie beide.
Verbissen nahmen sie ihre Arbeit wieder auf, doch nach dem nächsten erfolglosen Zyklus begann Lydias Pager schließlich ohne Unterbrechung zu piepsen. Völlig entnervt warf sie einen Blick darauf. Als sie den Kopf wieder hob, war ihr Gesicht totenbleich geworden. »Sie brauchen mich sofort in Trauma drei.«
»Spinnst du?« Valerie warf ihr einen verständnislosen Blick zu, ohne jedoch die Herzdruckmassage zu unterbrechen. »Ich brauche dich, und zwar genau hier.«
Lydia schien hin und her gerissen. »Es geht um ein Kind, Val.«
»Und hier geht es um einen jungen Mann. Der Typ ist vielleicht dreißig, Lydia. So alt wie wir.«
»Drei erfolglose Zyklen.« Die Anästhesistin schüttelte den Kopf, legte aber bereits den Beatmungsbeutel zur Seite. »Und nebenan ein Unfall, an dem Kinder beteiligt sind. Du weißt, was das bedeutet.«
Valerie schwieg, doch ihre Bewegungen wurden langsamer.
»Tut mir leid, Val. Triage schwarz, der Typ ist ein hoffnungsloser Fall.« Lydia lief bereits zur Tür. »Helfen wir lieber denen, bei denen es sich noch lohnt.«
***
Die Tätowierungen an Marais Armen flackerten und das Glimmern erlosch, als sie erschöpft ihre Hände von Kings Schläfen nahm. Ihre Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Bis auf einen spärlichen Widerhall seines Bewusstseins und die Fragmente der Clanmacht konnte sie den Wolf nicht spüren. Auch seine menschliche Seele war nicht mehr in dem Gebilde aus Fleisch und Knochen. Marai wusste nicht, welche Macht dafür sorgte, dass Cassidy seinen Körper am Leben erhielt, aber es war klar, dass es nicht reichte, um King in diese Welt zurückzuholen. Zwei Schwüre banden ihn an unterschiedliche Ziele. Im schlimmsten Fall würde Kings Seele, alles, was ihn ausmachte, daran zerbrechen. Zumindest, wenn nicht eine der Mächte nachgab. Solange sie beide unermüdlich auf ihr Recht bestanden, gab es keinen Frieden für ihn.
Nicht auszudenken, was das für seine Ewigkeit bedeutete.
Die Meerhexe hatte von den gesplitterten Seelen gehört, die ziellos durch die Welten wanderten. Sie kamen nicht zur Ruhe, sondern wurden wiedergeboren, auf der Suche nach Teilen ihrer selbst, dazu verdammt zu wissen, dass etwas fehlte, ohne es jemals zu finden.
Mit einer fahrigen Bewegung wischte sie sich den Schweiß von der Stirn.
Um King herum tobte ein Sturm. War er heftig genug, um Cassidy mit sich mitzureißen?
Wenn sie nur gewusst hätte, was das für ein Band zwischen den beiden war, dann hätte sie sie vielleicht schützen können. Aber etwas Derartiges, eine so starke Verbindung hatte Marai noch nie gesehen. Das Band mochte sich dehnen, wenn sie nicht im gleichen Raum waren, doch die Brücke war fest verankert. Reißfest. Undurchdringbar. Es war keine einseitige Verbindung, das sah Marai auf einen Blick. Sie hatten sich beiderseits zu etwas verpflichtet, doch im Moment sah es aus, als würden sie sich mit diesem Versprechen gegenseitig vernichten.
Marai seufzte. Es fühlte sich an, als wäre sie mit diesem Wissen um Jahrzehnte gealtert. Sie musste eine Lösung finden. Immerhin, solange Cassidy sich nicht direkt neben King aufhielt, schien sich der Energietransfer in Grenzen zu halten. Vorerst zumindest. Doch das Chaos war nie lange genügsam. Von Cassidys Energie abgeschirmt kühlte Kings Haut schnell aus; eine kurze Erholungspause für die Alpha. Aber vermutlich schrie alles in ihr danach, an seine Seite zurückzukehren. Marai stockte. Erst in diesem Moment fiel ihr auf, was sie sofort hätte bemerken müssen.
Cassidy war nicht mehr die Alpha. Sie hatte ihren Alphastatus verloren. Lag es an Becca? An der Rückkehr ihres Wolfes?
Sie sackte auf dem Sessel zusammen. Wie sollte das Mädchen das Trennen des Bandes überstehen?
Traurig sah sie auf den regungslosen Mann, presste die Lippen aufeinander. Sie musste mit Vanessa sprechen, und mit Valerie. Mit den Clanmächten der Wölfe kannte sie sich zu wenig aus. Ihre Magie bediente sich anderer Quellen und die anstehende Entscheidung war nicht ihre.
Als Marai die Tür zum Wohnzimmer öffnete, sprang Cassidy sofort auf. Sie wartete nicht ab, was die Meerhexe zu sagen hatte, sondern drängte an ihr vorbei, zurück zu King. Ihre Hand glitt in die des Bewusstlosen und Marai konnte sehen, wie der Strom an Energie wieder zunahm. Wie eine lebendige Fessel wand sich das Band um die Wölfe, tröpfchenweise rann die Lebensenergie weiter aus Cassidy und es gab nichts, was die Meerhexe in diesem Moment dagegen hätte tun können.
Marai wandte sich der Geschichtenwahrerin zu. »Vanessa.«
Das erste Mal, seit Marai sie kannte, wirkte Vanessa zerbrechlich. Tiefe Sorgenfalten hatten sich in ihre Stirn gegraben. »Ich kann deinem Gesicht ansehen, dass du wenig Hoffnung hast.«
Marai nickte, sie schloss die Tür zum Krankenzimmer, damit Cassidy ihre nächsten Worte nicht hörte. »Es sieht aus, als würde das Band sie töten. Nicht sofort, aber mit der Zeit. Die Wunde wird diesen Prozess beschleunigen, wir haben also nicht viel Zeit, sie zu trennen.«
»Sie trennen? Das Band ist selten und heilig.« Vanessas Stimme war tonlos.
»Und mächtig, und vielleicht werden ihre Seelen für immer verbunden sein, aber die Körper müssen wir trennen. Auf der anderen Seite des Bandes ist nichts. Ich finde nicht einmal einen Anhaltspunkt, wo Kings Seele sein könnte. Ich bin keine Nekromantin, ich kann sie nicht greifen.« Voller Mitleid sah sie Vanessa an. »Wenn nicht ein Wunder geschieht, können wir nur Cassidy retten. Vielleicht nicht einmal das. So oder so läuft die Zeit gegen uns.«
»Wie lange, Marai? Wie viel Zeit haben wir, bis wir ihr das Leben zerstören?« Die Verbitterung in Vanessas Stimme erschreckte die Meerhexe.
Ihre Antwort machte die Sache nicht besser. »Nicht mal einen Viertel-Mond, wenn es hochkommt. Vielleicht fünf Tage, danach wird es jeden Tag riskanter. Irgendwann wird sie zu schwach sein.«
»Können wir die Zeit irgendwie verlängern?« Jonah war an die Frauen herangetreten und sah Marai eindringlich an. Er sah aus, als würde er keine weitere schlechte Nachricht dulden.
Marai zuckte die Schultern. »Sie kämpft ohne Clanmacht, ohne Rückhalt. Sie ist alleine. Vielleicht wenn wir eine Energiequelle finden, auf die sie zugreifen kann …«
Bei dieser Einschätzung nahm Vanessas Gesicht einen entschlossenen Zug an. »Ich werde heute und morgen telefonieren, ich setze alle Hebel in Bewegung und in zwei Tagen reden wir weiter, dann entscheiden wir, wie wir weiter vorgehen.« Sie schluckte. »Und wie wir es Cassidy sagen.«
»Wir können es ihr nicht verheimlichen.« Jonahs Stimme war leise, doch bestimmt. »Sie hat ein Recht darauf, es zu wissen. Und zwar gleich.«
»Das Wissen ändert nichts«, widersprach Vanessa mit harscher Stimme. »Nimm ihr die Hoffnung nicht, bevor es nötig ist.«
»Es gibt keine Hoffnung.« Jonah presste die Lippen zusammen, ehe er mit bitterer Stimme weitersprach: »Die Clanmächte helfen ihr nicht. Sie kann nicht auf eine Energiequelle zugreifen, die nicht wölfisch ist, also haben wir fünf Tage, um eine Lösung für ein Rätsel zu finden, das wir noch nicht einmal kennen.«
Vanessa schüttelte trotzig den Kopf. »Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Sie ist meine Enkelin und ich bin bereit, jeden Preis für sie zu zahlen.« Der Blick der Geschichtenwahrerin wanderte zu der Tür, hinter der Becca schlief. »Und ich bin mir sicher, dass ihre Eltern das genauso sehen.«
Diese Worte, die einer Kriegserklärung glichen, jagten Marai einen Schauer über den Rücken. Die Entschlossenheit in den Augen der Geschichtenwahrerin verhieß etwas Schreckliches. Wie weit würden die Wölfe gehen, um King und Cassidy zu retten? Und wie weit würde sie sich mit hineinziehen lassen?
»Zwei Tage«, sie nickte langsam. »Dann sehen wir, was wir an Lösungen gefunden haben.«
Kapitel 3
Valerie drückte noch ein paar Mal verzweifelt auf den Brustkorb, dann verließ sie allmählich die Kraft. Was hatte es für einen Sinn, alleine um ein verlorenes Leben zu kämpfen? Wahrscheinlich hatte Lydia recht, wahrscheinlich gab es gar nichts mehr zu retten und sie verschwendete hier ihre Energie. Ein letztes Mal sah sie in das Gesicht des Mannes, das sogar im Tod noch angespannt wirkte, und ließ sich erschöpft von der Liege gleiten. Mit geschlossenen Augen lehnte sie sich gegen den Bettrahmen und nahm sich ein paar Momente, um zu Atem zu kommen. Im Vergleich zur hektischen Betriebsamkeit, die noch Momente zuvor geherrscht hatte, war es nun fast angenehm still. Nur der gleichmäßige Piepton, der ihr Versagen verkündete, war noch zu hören.
Wenigstens hatten sie dem Unbekannten genügend Schmerzmittel verabreicht, um ihn schmerzlos auf die andere Seite zu bringen.
Sie öffnete die Augen, stieß sich von der Liege ab, zog die Handschuhe aus und machte sich daran, Infusionen abzudrehen und Geräte abzuschalten. Sie griff nach dem Schalter, als der Monitor wieder sein regelmäßiges Piepsen aufnahm. Ungläubig wandte Valerie sich zu dem Gerät um. Es zeigte einen Rhythmus. Die Herzfrequenz stieg an. Sie sah auf, zum Gesicht des Fremden. Er hatte die Augen geöffnet, Panik in seinem Blick. Ihr Wolf heulte auf.
Das Tier, das sich normal während ihrer Arbeit nicht rührte, drängte darauf, zu flüchten. Es wollte rennen. So schnell es konnte, soweit es konnte. Raus aus dem Zimmer, besser noch aus dem Gebäude. Hauptsache weg von dem Mann vor ihr.
Valerie wagte kaum, zu atmen. Seine Panik griff auf sie über, voller Angst starrte sie in die grünen Augen, die sich auf sie richteten.
Sie spürte, wie sich auf ihren Handflächen ein Schweißfilm bildete. Schon früh hatte Valerie gelernt, auf ihren Wolf zu hören, und das Verhalten des Tieres konnte nur eines bedeuten: Der Verletzte aus dem Wald war tatsächlich ein Jäger. Einer von ihnen hatte sich gegen diesen Mann verteidigt, vor noch nicht allzu langer Zeit.
Ihr ganzer Körper begann zu zittern.
Obwohl es sich anfühlte, als würden sie sich seit Minuten schweigend anstarren, waren nicht einmal Sekunden vergangen. Sie zwang sich, durchzuatmen. Sich daran zu erinnern, wer sie war. Was sie hier tat. Noch immer weigerte sich ihr Körper, sich zu rühren. Trotzdem. Selbst wenn der Fremde zu den Jägern gehörte: Jetzt und hier war er ein Patient, und sie hatte einen Eid geschworen. Egal, was er draußen machte, es war ihre Aufgabe, ihm hier drinnen zu helfen. Ohne nachzudenken streifte sie sich frische Handschuhe über die Hände.
»Es ist alles in Ordnung.« Ihre Stimme klang heiser und drohte zu versagen. »Du bist in Sicherheit. Das hier ist ein öffentliches Krankenhaus.«
Die Worte brachen den Bann, der sie bewegungslos zurückgelassen hatte. Die Ärztin in ihr erinnerte sich wieder an ihre Rolle.
Instinktiv legte sie dem Unbekannten die Hand auf den Oberarm, eine Geste, die sie schon viele Male, bei unzähligen Patienten gemacht hatte. Sie war ihr so in die Routine übergegangen, dass sie nicht einmal einen Moment darüber nachgedacht hatte, dass sie gerade versuchte, einen Jäger mit Körperkontakt zu beruhigen. »Kannst du mir sagen, wer du bist?«
Plötzlich schnellte seine Hand vor und umgriff ihr Handgelenk. Wie Schraubstöcke legten sich seine Finger um sie. Selbst durch die dünne Schicht Latex ihrer Handschuhe konnte sie spüren, dass seine Haut eiskalt war.
Erschrocken sog sie die Luft zwischen ihren Zähnen ein und versuchte, ihm nicht zu zeigen, dass er ihr weh tat.
»Tosney.« Seine Stimme war rau, er hatte sichtliche Schwierigkeiten beim Sprechen. »Christoph Tosney«, setzt er nach.
Ein kalter Schauer lief ihr den Rücken hinab. Sie wäre zurückgewichen, doch für jemanden, der gerade von den Toten zurückgekehrt war, war er erstaunlich kräftig. Sein Griff hielt sie an Ort und Stelle.
Ausgerechnet Christoph Tosney. Vermutlich der Grausamste unter den Jägern. Derjenige, der Becca gefoltert, und ihren Wolf getötet hatte. Mit einer Wunde am Hals und enormem Blutverlust, und lauter Zeugen, die gesehen hatten, wie er vor wenigen Minuten gestorben war. Es wäre ein Einfaches gewesen, es an dieser Stelle zu beenden. Sie senkte den Blick, als der Gedanke aufblitzte. Nein. Sie war keine Mörderin. Sie hatte einen Eid geschworen und so sehr sie ihn, und alles, wofür er stand, verachtete: Er war ihr Patient und es lag nicht an ihr, über ihn zu richten. Nicht in diesem Krankenhaus. Nicht, wenn er Hilfe brauchte.
»Du bist ein Werwolf«, krächzte er. Eine kurze Pause folgte, ehe er schnaubte. »Und du weißt, was ich bin. Wer ich bin.«
Damit riss er sie endgültig auch aus dieser Erstarrung. Sie sah auf, wich ihm nicht länger aus.
»Wolf«, verbesserte Valerie ihn automatisch. »Und du bist mein Patient«, fügte sie gereizt hinzu. »Ich habe einen Eid geschworen. Egal, was für ein Monster du bist: Mein Eid wird dich hier schützen.«
Das Geräusch, das er machte, konnte sie nicht einordnen. War es ein weiteres Schnauben oder lachte er?
Seine Finger lösten sich langsam von ihrem Handgelenk. Sie rutschten von dem Latex des Handschuhes, und als er seine Hand wieder sinken ließ, streiften seine Fingerspitzen ihre Haut. Seine Berührung hinterließ ein leichtes Prickeln.
Hatte er beschlossen, ihr zu vertrauen? Oder wusste er, dass er keine andere Wahl hatte? Wachsam musterte er sie. Es fühlte sich an, als würde er ihr direkt in die Seele sehen.
Fast verlegen wich sie seinem Blick aus und sah wieder auf ihre Hände.
»Die Ranger haben dich im Wald gefunden, mit Bisswunden in der Halsbeuge und am Arm«, begann sie möglichst ruhig zu erklären. Das Letzte, was sie brauchte, war, dass der Jäger aus Angst vor ihr Amok lief und ihre Kollegen dabei verletzte. »Du hast eine große Menge Blut verloren. Genau genommen warst du die letzten fünf Minuten tot.« Sie sah auf die Wunde. Frisches Blut lief nun, wo sein Herz wieder schlug, neben der Kompresse seinen Hals entlang. »Der Biss blutet wieder, wir sollten dich dringend im OP versorgen, unter Narkose. Du wirst mehr Schmerzmittel brauchen und auch Antibiotika.«
»Wirkt nicht«, erwiderte er knapp, durch zusammengebissene Zähne.
»Was wirkt nicht?« Die Frage war reiner Reflex gewesen. Sie konnte die Schmerzen in seiner Stimme hören, die von dem Medikamentencocktail, den Lydia ihm gespritzt hatte, nach wie vor hätten unterdrückt sein sollen.
Er verdrehte genervt die Augen.
Valerie zwang sich, ihn nicht wieder gereizt anzufahren. Seine Anwesenheit brachte sie aus dem Konzept, normal würde kein Patient sie so unter Spannung bringen. »Ist es das Schmerzmittel, das nicht wirkt?«
Ein leichtes Nicken. »Und Antibiotika.« Seine Augenlider flackerten, als würde er jeden Moment wieder das Bewusstsein verlieren. »Und die Narkose wird auch nicht wirken.«
»Du hast Heilkräfte«, murmelte sie, eher zu sich, als zu ihm. »Wenn nicht einmal die Narkose wirkt, mindestens so stark wie ein ranghoher Wolf.«
Sie hob die Kompresse an, die den Blutfluss eindämmen sollte. Die Wunde sah frisch aus, als wäre sie gerade erst entstanden.
»Sicher, dass du Heilkräfte hast? Die Wunde sieht nicht aus, als würde sie heilen«, stellte sie leicht frustriert fest. Im Gegenteil, der Blutfluss wurde schon wieder stärker. Was sollte sie mit ihm machen? Ohne Narkose würde sie ihn nicht in den OP bekommen, die Anästhesisten würden sie für verrückt erklären. Abgesehen davon, dass eine OP ohne Narkose Folter war.
Er lachte kehlig. »Alphagift.«
Valerie zuckte zusammen. Diese Aussage schränkte die Möglichkeit, auf wen er getroffen war, deutlich ein. Sie wollte ihn fragen, wollte Gewissheit. Doch es gehörte nicht in diesen Raum.
»Ich wasche es mit Kochsalzlösung aus. Das sollte so viel wie möglich von dem Gift aus der Wunde spülen«, erklärte sie stattdessen und griff nach frischen Handschuhen. »Wenn das Alphagift verhindert, dass du heilst, heißt das, es gibt hier zwei mögliche Behandlungen.« Nachdenklich sah sie ihn an, während sie die klare Flüssigkeit über und in der Wunde verteilte. »Ich könnte den Biss ausschneiden, dann wäre es keine Alphaverletzung mehr. Oder ich versorge nur das verletzte Gefäß und nähe den Rest wie eine gewöhnliche Wunde. Dann wird das Abheilen allerdings länger dauern.« Ihr Blick war voller Mitleid. »Beides wird ohne Narkosemöglichkeit höllisch weh tun, aber es ist deine Entscheidung.«
Er musterte sie, schien abzuwägen, ob er ihr mit einer Nadel oder einem Skalpell mehr traute.
»Dann nähen.« Seine Stimme klang weiterhin rau, aber wesentlich fester. Jetzt, wo das Gift langsam nachließ, konnte sein Körper anscheinend mehr tun, als nur den Blutverlust auszugleichen. Sogar die Blutung war weniger geworden.
»Okay.« Sie bereitete das Nähbesteck vor, deckte die Wunde steril ab und setzte sich auf einen Schemel neben den Jäger. Seine Halsmuskeln spannten sich an, als er die Zähne zusammenbiss.
»Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich weiß, es ist eine wirklich beschissene Situation, aber du solltest dich so gut es geht entspannen.« Verdammt, so viel Mitgefühl hatte sie nicht in ihre Stimme legen wollen. »Soll ich jemanden anrufen und Bescheid geben, dass du noch lebst? Das Tierheim? Deine Frau? Deine Mutter?«, setzte sie nach. Besser er hielt sie für patzig, als für weich.
Er zog spöttisch eine Augenbraue hoch. »Dann hättest du mich gar nicht erst retten brauchen.«
Valerie konnte seinen Tonfall nicht deuten, fragend sah sie ihn an.
Ihr Blick musste ihn amüsiert haben, denn seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. »Meine Mutter ist in direkter Linie mit einem Dämon verwandt, und meine Frau würde mich wohl zurück ins Jenseits befördern, wenn du ihr die Gelegenheit dazu gibst. Tierheim klingt erstaunlich gut, aber das ist ja eher eure Anlaufstelle, nicht wahr?«
Valerie sah ihn skeptisch an, konnte sich ein Grinsen dann aber doch nicht verkneifen. War das ein Scherz gewesen, oder hatte der Jäger lediglich Galgenhumor?
Sie wandte sich der Wunde zu. »Stillhalten jetzt«, forderte sie ihn auf, spreizte die Wundränder an der Stelle, aus der es am meisten blutete, und suchte nach dem verletzten Gefäß. Wie vermutet war es die Halsschlagader. Ungläubig schüttelte Valerie den Kopf. Er hätte schon hundert Mal tot sein müssen, bis er das Krankenhaus überhaupt erreicht hatte.
Sie warf einen besorgten Blick auf sein Gesicht, aber er sah nur stoisch zur Decke und versuchte, sich möglichst nicht zu bewegen. Auch, als sie die Wundränder des Gefäßes anfrischte und mit einer Klemme fixierte, blieb er gespenstisch still, genauso, als sie mit der Naht begann. Lediglich das leichte Zucken, wann immer die Nadel die Muskeln oder die Haut punktierte, verriet ihn, und Valerie konnte nicht anders, als mit ihrem Patienten zu leiden.
Erst, als das umgebende Gewebe versorgt war und sie es nicht länger hinauszögern konnte, öffnete sie vorsichtig die Klemme. Nichts. Kein Blut, kein Hinweis darauf, dass diese Arterie vor kurzem noch lebensbedrohlich verletzt gewesen war. Es war eine Sache, über die Stärke seiner Heilkräfte zu spekulieren, aber sie mit eigenen Augen zu sehen ... sie konnte nicht anders, als beeindruckt zu sein. Er war wirklich ein würdiger Gegner für einen Alpha.
Trotzdem.
»Du hattest unfassbares Glück«, sagte sie und machte sich daran, auch diesen Bereich der Wunde zu verschließen.
Der Jäger sah sie nicht an. »Glück braucht man nur, wenn man nicht weiß, was man tut.«
»Dann bist du erstaunlich schlecht in dem, was du tust, sonst wärst du ja nicht hier«, konterte sie ungerührt.
Nun musterte er sie doch. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, erheiterte sie ihn, und Valerie wusste nicht, was sie davon halten sollte.
Sie zog die letzte Naht zusammen und kürzte die Fäden, ehe sie das Ganze mit einer Mullbinde und einem sterilen Verband abdeckte.
Als Nächstes wechselte sie die Handschuhe und wandte sich seinem Arm zu. »An dieser Stelle können wir klammern. Das geht schneller, aber einen Schönheitswettbewerb werden wir damit nicht gewinnen.«
Er nickte nur, also machte sie sich daran, die Wunde zu säubern.
Schweigend versorgte sie auch diese Wunde, bevor sie sie sorgfältig abdeckte, ihre Handschuhe auszog und sich daran machte, auch hier einen sauberen Verband anzulegen. »Du solltest mindestens eine Nacht hierbleiben. Eigentlich länger, wenn man bedenkt, dass du gerade gestorben bist.«
Er sah müde aus. »Hierbleiben – damit du mich im Schlaf töten kannst?«
Sie schnaubte. »Damit meine ganze Arbeit umsonst war? Nein, Unschuldige zu töten ist deine Aufgabe.«
»Ich bleibe die Nacht.« Er tastete nach der Tasche seiner Hose und zog eine schwarze Plastikkarte heraus. »Ein Einzelzimmer, bitte.«
»Wir haben keine Einzelzimmer. Es wäre Verschwendung von Platz.« Eine Lüge. Nur weil sie sich dazu verpflichtet sah, dem Schlächter zu helfen, schien es nicht zu heißen, dass sie es ihm komfortabel machen würde.
»Das war’s.« Sie hatte die Wunde fertig verbunden und richtete sich auf. »Morgen wird sich ein Arzt das bei der Visite ansehen und dich dann entlassen. Ich werde mir bis dahin eine Geschichte ausdenken, die das Ganze hier glaubwürdig macht.« Sie gab die Daten in das Tablet ein. »Du wirst gleich abgeholt. Und wir sollen wirklich niemandem Bescheid geben?« Sie sah auf.
Der Jäger schüttelte den Kopf. »Ich komme klar.«
»Das bezweifle ich nicht.«
Sie griff in ihre Tasche und riskierte einen Blick auf ihren Pager, dann auf ihr Handy, das während der Behandlung ebenfalls fast ohne Unterlass vibriert hatte. Sie glaubte zwar, auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, wurde aber trotzdem blass, kaum dass das Display aufleuchtete. Sowohl Vanessa als auch Becca hatten mehrfach versucht, sie zu erreichen, ehe sie ihr eine Textnachricht hinterlassen hatten.
»Notfall, Jägerangriff mit Verletzten, komm so schnell du kannst.«
Sie sah auf, Christoph musterte sie weiterhin mit unbewegter Miene. Er hatte ihre Reaktion auf die Nachrichten beobachtet.
»Ich muss los«, presste sie hervor. »Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder«, fügte sie noch hinzu, ehe sie aus dem Raum stürmte. Auf dem Gang fing sie Lydia ab. »Der Patient in Trauma 1 hat überlebt, er wird gleich auf die Station verlegt. Ich weiß, hier geht gerade die Welt unter, aber kannst du mir einen Gefallen tun und mir den Rücken freihalten? Ich muss sofort los, es gab einen Notfall in der Familie.«
Lydia sah sie erstaunt an, nickte aber, ohne Fragen zu stellen. Wahrscheinlich war Valeries Gesichtsausdruck Antwort genug.
»Danke, du bist die Beste!« Wenn ihr Kasak nicht nach wie vor über und über mit Blut beschmiert gewesen wäre, hätte sie ihre Freundin kurz an sich gedrückt. So sah sie nur zu, dass sie ihr Tablet loswurde und schnell nach Hause kam.
Lydia würde alles regeln, und jetzt, da sie den Jäger verarztet hatte, war es Zeit, sich um seine Opfer zu kümmern.
***
Es war Stunden her, dass Christoph angerufen hatte. Am Vormittag hatte er Mila abgeholt und war mit ihr in den Wald gefahren. Er hatte es nicht ausgesprochen, aber sie wusste auch so, dass eine Jagd anstand. Jemand hatte die Wölfe verraten und es würde mit Tod enden.
Die Dämmerung hatte schon vor Stunden den Tag vertrieben und mit Einbruch der Nacht wuchsen Irenes Sorgen. Und obwohl sie peinlich darauf bedacht war, Imogen, der Hausherrin, nicht zu begegnen, führten ihre Schritte immer wieder am Eingang der Villa vorbei, einer schweren Tür aus dunklem Holz, die genauso gut als Gefängnistür hätte dienen können. Zum gefühlt hundertsten Mal sah sie auf ihr Handy. Abgesehen davon, dass die Uhr einige verstrichene Minuten anzeigte, gab es keine Neuigkeiten.
Irene versuchte, sich einzureden, dass es schlicht länger gedauert hatte, die Fährte der Wölfe aufzunehmen, doch sie war immer schon schlecht darin gewesen, sich selbst zu täuschen. Tatsache war, dass Christoph wusste, dass der Wald bei Nacht ein gefährlicher Ort war. Die Sinne der Jäger mochten geschärft sein, aber die der Wölfe waren auf die dunkle Tageszeit ausgelegt.
Ein weiteres Mal rief sie ihren Mann an, doch sein Handy leitete sofort auf die Mailbox um.
Die Angst hielt ihre erbarmungslosen Klauen in Irene geschlagen.
Mila hatte kein eigenes Telefon. Die Matriarchin des Hauses hatte es verboten, da die Leopardin ohnehin das Grundstück nicht alleine verlassen durfte, also blieb Irene nur zu warten.
Sie vergrub die Hände im Stoff ihres Pullovers. Trotz der Hitze waren ihre Finger eiskalt und zitterten. Nicht auszudenken, wenn einer der verbliebenen Tosneys ihre Schwäche sah.
Die Untätigkeit war das Schlimmste.
Sie wünschte den Wölfen, dass sie entkamen. Immer. Trotzdem wollte sie weder ihre Kindheitsfreundin noch ihren Ehemann verlieren. Sie schluckte. Die Aussicht darauf, in Zukunft allein zu sein, verstärkte die aufkeimende Panik. Sie wusste nur zu gut, wie es war, einsam zu sein. Nach dem Tod ihres Vaters hatte ihre eigene Familie sie verstoßen, denn während er immer versucht hatte, einen Weg zwischen den Erwartungen zu finden, war ihre Mutter seit jeher Traditionalistin. Ihr Vater war kaum bestattet gewesen, als sie das Ultimatum gestellt hatte. Entweder sie tötete Mila eigenhändig und beteiligte sich an der Jagd, oder sie würde sie an eines der unzivilisierteren Häuser verkaufen. Eine Zukunft, in der ihre einzige Aufgabe darin bestand, so viele Jägernachkommen zu gebären wie möglich, damit ihr Blut zumindest nicht ganz verschwendet war. Irene hatte sich noch in der gleichen Nacht mit Mila davongeschlichen. Aber was wäre die Alternative gewesen? Mila einen Kopfschuss zu verpassen? Dazu war sie nicht fähig, dazu wollte sie nicht fähig sein. Dass sie ausgerechnet bei den Tosneys Hilfe gefunden hatte, entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Sie wusste, Christoph war alles, was sie vor den Jägern ihrer Familie schützte, die in ihr eine Verräterin sahen. Wenn er nicht zurückkam, blieb ihr nur die erneute Flucht. Immerhin hatte sie mittlerweile einen Ozean zwischen sich und ihre eigene Familie gebracht und Amerika war groß.
Sie schlug einen Weg ein, den sie an diesem Tag schon mehrfach entlanggeschlichen war. Hinein in den Flügel, in dem Alex sein Schlafzimmer und Büro hatte. Sie hoffte, Eliza zu finden. Auch wenn die Jägerin nicht Irenes Ansichten und Hoffnungen teilte, verurteilte sie sie zumindest nicht und im Moment sehnte Irene sich nach Gesellschaft. Sie war das, was, abgesehen von Mila, einer Freundin am nächsten kam.
Die Dunkelheit des Flures wurde von einem schwachen Lichtschein aus einem der Zimmer unterbrochen, die Tür zu Alex’ Büro stand einen Spalt offen. Seitdem er am Nachmittag zurückgekommen war, hatte er kein Wort mit den anderen Bewohnern des Hauses gewechselt. Stattdessen telefonierte er ununterbrochen, manchmal kürzer, manchmal länger. Jedes Mal, wenn sie an seiner Tür vorbeigekommen war, hatte sein Ton etwas frustrierter geklungen.
Auch dieses Mal schien das Ergebnis ihn nicht zufriedenzustellen. Er knallte das Handy auf den Tisch und hob resigniert den Blick.
Irene zuckte zusammen, als ihr klar wurde, dass Alex sie durch den Türspalt direkt ansah.
»Du musst dich nicht im Schatten verstecken.« Seine Stimme wirkte belegt. Es war deutlich, dass er ebenso angespannt war wie Irene selbst.
Sie öffnete die Tür und trat ein.
»Ich warte auf Christoph.« Sie lächelte gequält. »Hast du heute schon etwas von ihm gehört?«