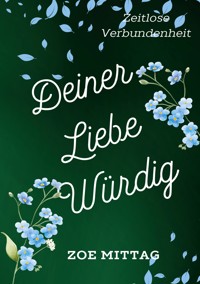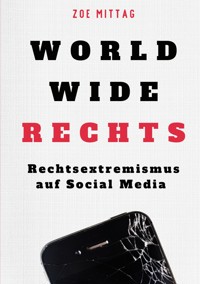
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, in der soziale Medien die politische Landschaft radikal verändern, beleuchtet dieses Buch die beunruhigende Rolle von Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Telegram in der Verbreitung rechtsextremistischer Ideologien. Die "Neue Rechte" hat Social Media zu einer mächtigen Waffe gemacht, um Desinformation zu verbreiten, Ängste zu schüren und politische Gegner zu diskreditieren. Das Buch analysiert, wie gezielte Mobilisierungsstrategien, emotionale Manipulation und subtile Influencer-Kommunikation genutzt werden, um extremistische Ideologien zu normalisieren. Es erklärt die psychologischen Mechanismen hinter der Anziehungskraft solcher Ideologien und zeigt auf, wie Algorithmen und Filterblasen diese Dynamik verstärken. Neben der umfassenden Analyse der Problematik bietet das Buch Handlungsempfehlungen: von der Förderung von Medienkompetenz über die Regulierung von Social-Media-Plattformen bis hin zur Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Technologieunternehmen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die die Herausforderungen der digitalen Meinungsbildung verstehen und aktiv Lösungen finden möchten - ob in der politischen Bildung, Medienwissenschaft oder im persönlichen Engagement gegen Extremismus. Perfekt für Leser:innen, die sich für politische Kommunikation, digitale Medien und die Gefahren von Desinformation interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND HINTERGRÜNDE
Die Rolle von Social Media in der politischen Kommunikation
Einfluss auf die Öffentlichkeit und die Meinungsbildung
Politische Bildung durch Social Media
Entwicklung der Neuen Rechten
Radikal oder extrem?
Warum Menschen sich von rechtsextremen Ideologien angezogen fühlen
STRATEGIEN DER NEUEN RECHTEN AUF SOCIAL MEDIA
Nutzung von Social Media als Mobilisierungsinstrument
Zielgerichtete Kommunikation und Nutzung von Influencern
Die Rolle von Frauen in der rechten Szene auf Social Media
Emotionalisierung und Manipulation
Psychologische und emotionale Manipulation zur Anhängergewinnung
Verbreitung von Desinformationen
Whataboutism als Ablenkungsmanöver
Diskreditierung und Angriffe auf politische Gegner
Tarnung als „bürgerliche Stimmen“
Verzerrung und Instrumentalisierung wissenschaftlicher Inhalte
Vernetzung und Gründung von Parallelgesellschaften
Musik, Mode und Lifestyle als Anwerbungsmethoden
Idealisierte Gewaltästhetik durch Gaming und Livestreams
Taktiken zur Zensurumgehung und Selbstzensur
Symbole und Codes der Neuen Rechten
Alternative Netzwerke und Plattformen
Online-Foren als virtuelle Gemeinschaften
Dogwhistling
Die Nutzung von Angst und Unsicherheit
Jugendliche und Social Media-Nutzung
Erfolgreiche Kampagnen und Mobilisierungsmaßnahmen
CHANCEN UND RISIKEN VON SOCIAL MEDIA IM POLITISCHEN KONTEXT
Chancen
Risiken
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND GEGENSTRATEGIEN
Förderung von Medienkompetenz
Regulierung von Social Media-Plattformen
Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Social Media-Plattformen
Technologische Entwicklungen und Zukunftsperspektiven
FAZIT
QUELLENVERZEICHNIS
Einleitung
In einer Zeit, in der die politische Landschaft von extremen Strömungen erschüttert wird, hat sich die „Neue Rechte“ von einer marginalen Bewegung zu einer der mächtigsten und gefährlichsten Kräfte im globalen Diskurs entwickelt. Was vor wenigen Jahren noch als Randphänomen galt, ist heute ein weltweit agierendes Netzwerk, das die digitale Revolution für seine eigenen, teils zerstörerischen Zwecke nutzt. Inmitten einer Ära, in der Social Media die Art und Weise, wie wir kommunizieren, denken und handeln, revolutioniert hat, hat die „Neue Rechte“ dieses Terrain nicht nur erobert, sondern es zur entscheidenden Waffe in ihrem Kampf gegen die liberale Demokratie gemacht. Social Media – einst als Plattform für Unterhaltung und sozialen Austausch gedacht – ist längst zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem Ideologien mit atemberaubender Geschwindigkeit verbreitet und Gesellschaften polarisiert werden. Plattformen wie Meta (ehemals Facebook), X (ehemals Twitter), YouTube, Telegram und TikTok sind für die Neue Rechte nicht nur Kanäle zur Verbreitung ihrer Botschaften, sondern die Werkzeugkiste, mit der sie die öffentliche Meinung manipulieren, Hass schüren und radikale Visionen einer „wahren Gesellschaft“ durchsetzen. Sie nutzen gezielte Werbung, gezielte Desinformation und die emotionale Kraft viraler Memes, um weltweit Millionen von Menschen zu erreichen und sie in den Bann ihrer Ideologie zu ziehen. Die Nutzung von Algorithmen und Datenanalysen hat es ihnen ermöglicht, Inhalte zu verbreiten, die wie Brandstiftung wirken, ganze Bevölkerungsgruppen zu spalten und politische Landschaften zu verändern. Ein gefährlicher Aspekt dieser digitalen Revolution ist, wie leicht es für ahnungslose Nutzer:innen wird, in die „Rechten Algorithmen“ einzutauchen. Was mit dem Ansehen eines harmlosen Videos beginnt, kann schnell dazu führen, dass der Nutzer:innen unbewusst immer weiter in den Strudel rechtsextremer Inhalte gezogen wird. Diese Videos nutzen unterschwellige Botschaften und psychologische Taktiken, um Gedanken und Überzeugungen zu beeinflussen, ohne dass der Nutzer:innen es sofort merkt. So werden Jugendliche und junge Erwachsene Stück für Stück mit einer Ideologie konfrontiert, die von Anfang an harmlos erscheint, sich aber immer tiefer in ihre Denkmuster eingräbt. Social Media wird so zu einem Werkzeug der Manipulation, das ganze Zielgruppen ohne ihr Wissen in die Nähe extremistischer Ansichten rückt. Das Scheitern der Ampel-Koalition und die politische Unsicherheit in Deutschland bieten der Neuen Rechten zusätzlichen Raum zur Mobilisierung. Die Unsicherheit und Unzufriedenheit vieler Bürger mit der derzeitigen politischen Führung, besonders in Bezug auf die Themen Migration, Klimapolitik und Wirtschaft, werden gezielt ausgenutzt. Dies zeigt sich auch in der Reaktion der AfD auf politische Entwicklungen, wie beispielsweise der Verwendung des Jugendworts „Talahon“ im Bundestag. Die AfD nutzt dieses Wort, das in den sozialen Medien eine Bedeutung erlangt hat, als Teil ihrer Strategie, die Jugend und vor allem deren unbewusste Zustimmung zu ihren Ideologien zu gewinnen. Sie schafft ein Feindbild, indem sie die angeblich „ideologische Verwirrung“ der jungen Generation thematisiert und gleichzeitig ihre eigene Bewegung als Rettung vor dieser kulturellen und politischen Verwirrung darstellt. Die „Neue Rechte“ agiert nicht mehr nur lokal, sondern überwindet nationale Grenzen, um ihre rassistischen, nationalistischen und antidemokratischen Botschaften zu verbreiten. Sie ist keine Bewegung, die sich auf ein einzelnes Land oder eine Region beschränkt. Sie ist global vernetzt und hat sich von den europäischen Grenzen bis in die USA ausgebreitet, wo sie strategische Allianzen schmiedet und gemeinsame Feindbilder formuliert. Ihre transnationale Vernetzung macht sie zu einer gut organisierten und gefährlichen Kraft, die in der Lage ist, den globalen Diskurs über Migration, Souveränität und Identität zu dominieren und sich gegen alles zu stellen, was sie als Bedrohung für ihre Vision einer „wahren“ Gesellschaft ansieht. Die digitale Revolution hat die politische Kommunikation verändert und neue Möglichkeiten für politische Mobilisierung geschaffen. Gleichzeitig hat sie aber auch die Tür geöffnet für die Verbreitung von extremistischen Ideologien, die in der traditionellen Medienlandschaft nur schwer Gehör finden würden. Die „Neue Rechte“ hat diese Lücke erkannt und ihre Kampagnen meisterhaft auf den digitalen Raum ausgeweitet. Plattformen wie TikTok, Instagram und Meta sind zu Kanälen geworden, auf denen junge Menschen mit politisch manipulativen Inhalten konfrontiert werden, die in gewiefter Weise als „normale“ politische Thesen verpackt sind. Soziale Netzwerke, die einst zur Unterhaltung und zum Austausch dienten, haben sich in ein gefährliches Werkzeug verwandelt, das es extremistischen Gruppen ermöglicht, die Gesellschaft zu beeinflussen, junge Anhänger:innen zu gewinnen und die politische Agenda zu verändern. Was zunächst wie ein unsichtbarer Krieg hinter den Bildschirmen begann, hat sich nun in die realen politischen Auseinandersetzungen der westlichen Welt übertragen. In Deutschland haben Bewegungen wie Pegida und die AfD gezeigt, wie Social Media nicht nur zur Verbreitung von Ideen genutzt werden kann, sondern als Plattform für die Organisation von Protesten, der Rekrutierung neuer Anhänger:innen und der Schaffung eines öffentlichen Drucks. Internationale Ereignisse wie der Brexit und die Wahl von Donald Trump haben die schlagkräftige Wirkung von Social Media in der politischen Mobilisierung noch einmal verdeutlicht – und die politische Diskussion auf eine neue, oft radikale Ebene gehoben.
Wie wurde Social Media zur zentralen Waffe der rechten Szene?
Theoretische Grundlagen und Hintergründe
Die Einleitung hat die zunehmende Bedeutung der Neuen Rechten im digitalen Raum und die Rolle von Social Media als Werkzeug für politische Kommunikation skizziert. Social Media bezeichnet digitale Plattformen, die es Nutzer:innen ermöglichen, Inhalte zu erstellen, zu teilen und miteinander zu interagieren. Beispiele hierfür sind Meta (ehemals Facebook), X (ehemals Twitter), Instagram, YouTube, TikTok und Telegram. Diese Plattformen spielen eine zentrale Rolle in der modernen politischen Kommunikation, da sie nicht nur als Kanäle zur Informationsverbreitung, sondern auch als Werkzeuge zur politischen Mobilisierung und zur Schaffung von Diskursen dienen. Um ein tieferes Verständnis für diese Entwicklung zu gewinnen, ist es nun notwendig, die theoretischen Grundlagen zu betrachten, die diese Prozesse unterstützen. Das folgende Kapitel untersucht, wie Social Media als Plattform für politische Kommunikation funktioniert und welche Auswirkungen diese Plattformen auf die Gesellschaft und die politische Landschaft haben. Dabei wird besonders beleuchtet, wie Social Media die Art und Weise verändert hat, wie politische Akteure ihre Botschaften verbreiten und welche Dynamiken dadurch entstehen.
Die Rolle von Social Media in der politischen Kommunikation
Social Media hat sich in den letzten Jahren als bedeutende Plattform für politische Kommunikation etabliert. Diese Plattformen bieten nicht nur die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und zu konsumieren, sondern fördern auch eine aktive Teilnahme der Nutzer:innen, was ihnen eine enorme Bedeutung in der politischen Landschaft verleiht. Die Fähigkeit, Inhalte schnell zu verbreiten und direkte Interaktionen zwischen politischen Akteur:innen und Wähler:innen zu ermöglichen, hat Social Media zu einem wichtigen Instrument für Bewegungen und Kampagnen gemacht, die nicht auf traditionelle Medien angewiesen sind. In einer Ära, in der die digitale Kommunikation eine zunehmend dominierende Rolle spielt, ermöglicht Social Media den Zugang zu einer breiten Öffentlichkeit und erleichtert die Mobilisierung von Unterstützern auf globaler Ebene. Ein entscheidender Vorteil ist, dass die Plattformen eine direkte Ansprache des Publikums ermöglichen, ohne dass Zwischenhändler wie Journalisten oder politische Institutionen erforderlich sind (vgl.Boulianne, 2015).
Ein herausragendes Beispiel für die positive Nutzung von Social Media ist die „Fridays for Future“-Bewegung. Diese globale Jugendbewegung, die 2018 ins Leben gerufen wurde, nutzt Social Media gezielt, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu erhöhen und eine Generation zur politischen Teilhabe zu ermutigen. Mithilfe von Hashtags wie #FridaysForFuture und #ClimateStrike gelang es, weltweit Millionen von Menschen zu mobilisieren, die in unzähligen Städten auf der ganzen Welt für den Klimaschutz demonstrierten (vgl.Thunberg, 2019). Social Media war es, dass es diesen Jugendlichen ermöglichte, ihre Botschaften ohne die Vermittlung durch traditionelle Medien zu verbreiten, und gleichzeitig eine weltweite Protestbewegung ins Leben zu rufen. Die Plattformen boten nicht nur eine breite Reichweite, sondern auch die Möglichkeit, schnelle und effektive Aktionen zu koordinieren – vom Teilen von Event-Informationen bis hin zur Verbreitung von Aufrufen zu politischen Forderungen.
Darüber hinaus haben Plattformen wie Change.org und Avaaz das Potential von Social Media in politischer Hinsicht weiter vergrößert, indem sie es den Nutzer:innen ermöglichen, mit wenigen Klicks Petitionen zu erstellen und viral zu verbreiten. Diese Plattformen bieten eine direkte Möglichkeit, öffentliche Aufmerksamkeit auf wichtige gesellschaftliche und politische Themen zu lenken. Ein herausragendes Beispiel für die Wirkung von Social Media in diesem Bereich war die Petition zur Rettung des Hambacher Forsts, die binnen kürzester Zeit hunderttausende Unterschriften sammelte und somit erheblichen politischen Druck auf Entscheidungsträger ausübte (vgl. Boulianne, 2019). Solche Petitionen sind oft der erste Schritt, um Diskussionen anzuregen und politische Entscheidungen zu beeinflussen, da sie eine breite, öffentliche Unterstützung für bestimmte Anliegen mobilisieren können.
Social Media hat die politische Landschaft insgesamt verändert, indem es eine Demokratisierung der Kommunikation ermöglichte. Es hat marginalisierten Gruppen und Bewegungen, die in traditionellen Medien keine Plattform gefunden hätten, die Möglichkeit gegeben, ihre Stimme zu erheben und Einfluss auf die politische Agenda zu nehmen. Ob es nun um den Klimawandel, soziale Gerechtigkeit oder den Widerstand gegen politische Ungerechtigkeiten geht, Social Media hat es Aktivisten und Bürgern ermöglicht, sich direkt an ihre Zielgruppen zu wenden und politische Veränderungen voranzutreiben. Diese Demokratisierung des politischen Diskurses hat das Potenzial, das politische Engagement zu fördern und den öffentlichen Dialog zu bereichern, da auch weniger etablierte Akteure und Ideen Gehör finden.
Doch diese Demokratisierung birgt auch Herausforderungen. Während Bewegungen wie „Fridays for Future“ Social Media erfolgreich zur Förderung ihrer Ziele eingesetzt haben, wird dieselbe Plattform von extremistischen Gruppen wie der „Neuen Rechten“ genutzt, um ihre radikalen Ideologien zu verbreiten und die Gesellschaft zu spalten. Social Media ist sowohl ein Werkzeug der ermächtigten Teilhabe als auch der Manipulation. Diese Plattformen bieten nicht nur die Chance, Gesellschaften zu stärken, sondern auch die Gefahr, Fehlinformationen und Hass zu verbreiten, die die politische Kommunikation destabilisieren.
Die Follower:innenzahlen der Bundestagsparteien auf Social Media zeigen deutliche Unterschiede in Reichweite und Plattformstrategien. Mit insgesamt 2,66 Millionen Follower:innen führt die AfD das Ranking deutlich an. Die Partei ist besonders stark auf Meta (ehemals Facebook) und Telegram vertreten, wo sie Hashtags wie #AfDwirkt und #MutzurWahrheit einsetzt, um ihre Reichweite zu erhöhen und gezielt Anhänger:innen zu mobilisieren.
Auf dem zweiten Platz liegt Bündnis 90/Die Grünen mit 1,43 Millionen Follower:innen. Die Grünen konzentrieren sich auf Instagram und X (ehemals Twitter) und thematisieren dort vor allem Klimapolitik und gesellschaftliche Vielfalt. Trotz ihrer aktiven Social-Media-Präsenz bleiben sie deutlich hinter der AfD zurück.
Die SPD kommt mit rund 1 Million Follower:innen auf den dritten Platz. Obwohl sie eine historische Volkspartei mit großer Mitgliederbasis ist, erreicht sie online weniger Menschen als die Grünen oder die AfD. Ihre Aktivität auf Plattformen wie Meta und X zeigt dennoch eine konstante Präsenz.
Die CDU verzeichnet etwa 900.000 Follower:innen und hat eine hohe Aktivität auf Social Media. Allerdings bleibt ihre Reichweite insbesondere auf X hinter den anderen Parteien zurück.
Die FDP folgt mit ungefähr 800.000 Follower:innen und nutzt Social Media gezielt, um Themen wie Digitalisierung und Wirtschaft zu promoten. Trotz ihrer vergleichsweisen kleineren Reichweite erzielt die Partei hohe Engagement-Raten, was auf eine effektive Nutzung der Plattformen hinweist.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Parteien unterschiedliche Strategien und Schwerpunkte bei der Ansprache ihrer Zielgruppen auf Social Media verfolgen, was sich direkt in ihrer Reichweite und dem Engagement ihrer Follower:innen widerspiegelt.
Die Rolle von Social Media in der politischen Kommunikation zeigt, wie mächtig diese Plattformen als Werkzeuge zur Verbreitung politischer Inhalte sind. Die Möglichkeit, direkt mit einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, hat das politische Engagement revolutioniert. Allerdings bringt die schnelle Verbreitung von Inhalten auch die Gefahr mit sich, dass Meinungen manipuliert und gesellschaftliche Diskurse verzerrt werden. Im nächsten Abschnitt wird der Einfluss von Social Media auf die Meinungsbildung der Öffentlichkeit untersucht. Es wird erörtert, wie diese Plattformen die politische Landschaft verändern und welche Folgen dies für die demokratische Auseinandersetzung hat.
Einfluss auf die Öffentlichkeit und die Meinungsbildung
Eine der wichtigsten Aspekte, die Social Media bietet, ist der Einfluss auf die Meinungsbildung. Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Meta (ehemals Facebook) ermöglichen es Nutzer:innen, Informationen in Echtzeit zu verbreiten und auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Dies fördert einen breiten Diskurs und ermöglicht es einer Vielzahl von Stimmen, Gehör zu finden (vgl. Sunstein, 2001). In vielen Fällen können Themen, die in traditionellen Medien unterrepräsentiert sind, durch Social Media an Sichtbarkeit gewinnen. Beispielsweise hat die #MeToo-Bewegung durch Social Media weltweit Aufmerksamkeit erregt und Diskussionen über sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch angestoßen. Diese Plattformen haben es ermöglicht, persönliche Geschichten zu teilen und eine kollektive Stimme gegen solche Missstände zu bilden (vgl. Miller, 2019).
Die Rolle von Social Media im Medienumfeld hat sich stark verändert, da diese Plattformen es Nutzer:innen ermöglichen, selbst zu Produzenten von Inhalten zu werden. Die Demokratisierung der Medienproduktion bedeutet, dass Nachrichten und Informationen nicht mehr ausschließlich von traditionellen Medienanstalten verbreitet werden. Nutzer:innen können ihre eigenen Inhalte erstellen und teilen, wodurch eine Vielzahl von Perspektiven und Meinungen sichtbar wird (vgl. Sunstein, 2001). Dies kann Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Meinungsbildung haben, indem es alternative Sichtweisen präsentiert und die Reichweite von Themen erhöht, die möglicherweise in traditionellen Medien unterrepräsentiert sind. Ein Beispiel ist die Berichterstattung über soziale Bewegungen, die oft durch traditionelle Medien vernachlässigt wird, während sie auf Social Media große Aufmerksamkeit finden (vgl. Tufekci, 2017). Social Media hat die Struktur der öffentlichen Meinungsbildung revolutioniert. Nutzer:innen können nun selbst zu Produzenten von Inhalten werden, wodurch eine Vielzahl von Perspektiven und Meinungen sichtbar wird (vgl. Castells, 2012). Diese Demokratisierung der Medienproduktion ermöglicht es, dass alternative Sichtweisen präsentiert werden, die möglicherweise in traditionellen Medien nicht ausreichend Beachtung finden. Dies kann zu einer breiteren und ausgewogeneren öffentlichen Debatte führen. Ein Beispiel ist die Berichterstattung über den Klimawandel, die durch Social Media an Dynamik gewonnen hat. Aktivisten und Wissenschaftler können ihre Botschaften direkt an die Öffentlichkeit richten und so das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Themas schärfen (vgl. Thunberg, 2019).
Interaktivität
Ein weiteres zentrales Merkmal von Social Media ist die Interaktivität. Die direkte Kommunikation zwischen Nutzer:innen fördert den Austausch von Ideen und Meinungen. Laut Karpf (2012) führt diese Interaktivität zu einem dynamischen Umfeld, in dem Diskussionen kontinuierlich stattfinden. Nutzer:innen können nicht nur Inhalte konsumieren, sondern auch aktiv an der Diskussion teilnehmen, indem sie Kommentare abgeben, Beiträge teilen und direkt miteinander kommunizieren. Diese Form der Interaktivität schafft ein Gefühl von Gemeinschaft und Engagement. Sie ermöglicht es Nutzer:innen, ihre Perspektiven einzubringen und sich in sozialen Bewegungen zu engagieren. Interaktive Kampagnen, wie sie beispielsweise von Aktivisten in verschiedenen sozialen Bewegungen eingesetzt werden, können so eine breite Unterstützung gewinnen (vgl. Boulianne, 2015).
Reichweite und Sichtbarkeit
Social Media ermöglicht politischen Akteur:innen, ihre Botschaften einem weitreichenden Publikum zu präsentieren, ohne auf traditionelle Medien angewiesen zu sein. Durch Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und TikTok können Politiker:innen und politische Organisationen eine breite Öffentlichkeit erreichen und direkt ansprechbar sein. Diese Reichweite ist besonders wertvoll in Wahlkämpfen oder bei der Förderung von politischen Initiativen, da sie die Möglichkeit bietet, Informationen schnell und effizient zu verbreiten und gezielte Kampagnen zu führen.
Gezielte Ansprache
Durch präzises Targeting können politische Akteure bestimmte Wähler:innengruppen gezielt ansprechen, was die Effektivität ihrer Kommunikationsstrategien erhöht.
Kosteneffizienz
Social Media-Kampagnen können kostengünstiger sein als traditionelle Werbung, was insbesondere für weniger finanzstarke Kampagnen von Vorteil ist.
Direkte Interaktion mit Wähler:innen
Social Media ermöglicht eine direkte und unmittelbare Interaktion zwischen politischen Akteur:innen und Wähler:innen. Dies kann durch verschiedene Formen der Kommunikation geschehen:
Feedback und Diskussionen
Politiker:innen können Fragen beantworten, Diskussionen moderieren und direktes Feedback von Bürgern erhalten. Diese direkte Kommunikation fördert ein höheres Engagement und stärkt die Bindung zwischen politischen Akteur:innen und der Öffentlichkeit.
Transparenz und Zugänglichkeit
Durch regelmäßige Interaktionen und das Teilen von Informationen können politische Akteure Transparenz zeigen und für mehr Zugänglichkeit sorgen, was das Vertrauen in ihre Arbeit stärken kann.
Spenden und Petitionen
Politische Akteure können Spendenaktionen starten, Petitionen organisieren und Unterstützung für ihre Anliegen gewinnen. Die schnelle Verbreitung von Aufrufen und die Möglichkeit zur direkten Teilnahme erleichtern die Mobilisierung von Ressourcen und Unterstützung.
Veranstaltungen und Aktionen
Social Media ermöglicht die Promotion und Organisation von Veranstaltungen, Demonstrationen und Kampagnen auf eine Weise, die eine große Anzahl von Menschen erreichen kann.
Echtzeit-Analyse und Anpassung
Social-Media-Daten bieten wertvolle Einblicke in die Meinungen und Vorlieben der Wähler:innen:
Meinungsforschung
Analysen von Social-Media-Daten helfen dabei, Trends und Stimmungen in der Bevölkerung zu erkennen. Dies ermöglicht es politischen Akteur:innen, ihre Botschaften und Strategien in Echtzeit anzupassen.
Feedback-Loop
Durch kontinuierliches Monitoring können politische Kampagnen sofort auf Entwicklungen und Reaktionen reagieren, was die Effektivität ihrer Kommunikation erhöht.
Verzerrung des Diskurses
Falsche oder irreführende Informationen können den politischen Diskurs verzerren und die öffentliche Meinung manipulieren. Politische Akteure müssen sich gegen solche Taktiken wappnen und Transparenz sowie Richtigkeit ihrer eigenen Informationen sicherstellen.
Schwierigkeiten bei der Faktenprüfung
Die Schnelligkeit und Verbreitung von Informationen auf Social Media erschwert es, Falschmeldungen schnell zu erkennen und zu korrigieren.
Spaltung der Gesellschaft
Die verstärkte Polarisierung kann zu einer gespaltenen Gesellschaft führen, in der der Dialog zwischen verschiedenen politischen oder gesellschaftlichen Gruppen schwieriger wird.
Sammeln und Nutzung von Daten
Politische Akteure müssen sicherstellen, dass sie verantwortungsvoll mit den Daten ihrer Anhänger:innen umgehen. Der Missbrauch von persönlichen Daten für gezielte Werbung oder andere Zwecke kann das Vertrauen der Wähler:innen untergraben.
Algorithmische Kontrolle
Die Algorithmen, die den Inhalt auf Social Media steuern, können die Sichtbarkeit von politischen Botschaften beeinflussen und zu einer ungleichen Verbreitung führen. Dies kann die Effektivität von Kampagnen und die Fairness des politischen Diskurses beeinträchtigen.
Zensur
Einige Plattformen haben Richtlinien zur Inhaltsmoderation, die möglicherweise zu einer Zensur von politischen Inhalten führen können, was Fragen zur Meinungsfreiheit aufwirft.
Der Einfluss von Social Media auf die öffentliche Meinungsbildung ist ein entscheidender Aspekt der digitalen Kommunikation. Diese Plattformen sind jedoch nicht nur für die Verbreitung von Informationen verantwortlich, sondern auch für die politische Bildung, insbesondere bei jüngeren Generationen, die zunehmend auf digitale Kanäle angewiesen sind. Im folgenden Kapitel wird untersucht, inwiefern Social Media als Werkzeug der politischen Bildung fungiert und welche Verantwortung diese Plattformen in der Vermittlung politischer Inhalte tragen. Es stellt sich die Frage, ob Social Media tatsächlich die politische Bildung fördert oder ob sie die Gefahr birgt, eine verzerrte und oberflächliche Informationsvermittlung zu verstärken.
Politische Bildung durch Social Media
Ein zunehmend interessanter Aspekt im Zusammenhang mit der "Neuen Rechten" ist die Rolle von Social Media in der politischen Bildung und Informationsvermittlung, insbesondere bei Jugendlichen. Die 24. Shell Jugendstudie (2024) zeigt, dass Jugendliche heute politisch bewusster sind und digitale Plattformen eine zentrale Rolle in ihrer Meinungsbildung einnehmen. Etwa 46 % der Jugendlichen geben an, politisch interessiert oder stark interessiert zu sein, ein leichter Anstieg im Vergleich zu früheren Studien (vgl. Shell, 2024). Dieses Interesse wird jedoch weiterhin stark durch Faktoren wie Bildungsniveau, Geschlecht und die genutzten Informationsquellen beeinflusst.
Bildungsniveau und politisches Interesse
Die Studie zeigt signifikante Unterschiede im politischen Interesse nach Bildungsniveaus. So bezeichnen sich 53 Prozent der Jugendlichen mit Abitur oder in der Abiturvorbereitung als politisch interessiert. Im Gegensatz dazu sind es nur 25 Prozent derjenigen, die einen Hauptschulabschluss anstreben oder erreicht haben. Studierende zeigen das größte politische Interesse, wobei 65 Prozent dieser Gruppe angeben, politisch interessiert zu sein.
Das Geschlechterverhältnis zeigt ebenfalls Unterschiede: 49 Prozent der männlichen Jugendlichen bezeichnen sich als politisch interessiert, während dies bei weiblichen Jugendlichen nur 42 Prozent beträgt. Die Einschätzung zur Wichtigkeit des eigenen politischen Interesses unterscheidet sich jedoch nicht zwischen den Geschlechtern. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Bildung eine entscheidende Rolle bei der politischen Bildung von Jugendlichen spielt und dass höhere Bildungsniveaus tendenziell mit einem stärkeren politischen Engagement einhergehen.
Internet als Informationsquelle
Ein besonders markantes Ergebnis der Shell-Studie ist die Feststellung, dass das Internet zur wichtigsten Informationsquelle für politische Themen bei Kindern und Jugendlichen geworden ist. 60 Prozent der Befragten informieren sich mittlerweile mehrheitlich online über politische Themen. Obwohl Printmedien nach wie vor eine gewisse Bedeutung haben, ziehen es Jugendliche zunehmend vor, soziale Medien für die gezielte Informationssuche zu nutzen (vgl. Shell Deutschland Holding, 2024).
Diese Verschiebung hin zu digitalen Plattformen hat weitreichende Implikationen für die politische Bildung und den politischen Diskurs. Die Popularität von sozialen Medien bietet Politiker:innen und anderen öffentlichen Personen die Möglichkeit, ihre Botschaften direkt an die Jugend zu kommunizieren, oft ohne die Filterung oder Kritik traditioneller Medien. Dadurch können Politiker:innen sich in einem Licht präsentieren, das sie favorisieren, ohne dass dies von einer kritischen Öffentlichkeit hinterfragt wird. Themen wie Migration, Sicherheit und „Kulturverfall“ werden emotionalisiert, um Ängste zu schüren und die Zustimmung zu rechtsextremen Positionen zu fördern. Begriffe wie „Altparteien“ oder „Systemmedien“ werden verwendet, um die Legitimität demokratischer Institutionen zu untergraben. Die "Neue Rechte" hat diese Veränderungen erkannt und versucht, die Affinität der Jugendlichen zu Social Media für sich zu nutzen. Die Plattformen bieten nicht nur die Möglichkeit, ihre Ideologien zu verbreiten, sondern auch eine Plattform, um ein junges Publikum zu erreichen, das zunehmend digitale Medien konsumiert. Soziale Medien ermöglichen es den Akteur:innen der Neuen Rechten, ihre Botschaften subtiler und über ansprechende Inhalte zu vermitteln, die oft als weniger konfrontativ wahrgenommen werden.