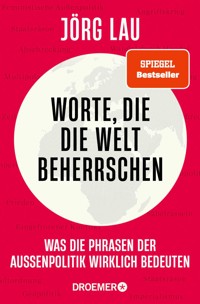
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprechen Sie außenpolitisch? Zwei-Staaten-Lösung, multipolare Welt, regelbasierte Weltordnung, Flächenbrand, Eskalationsspirale, feministische Außenpolitik, Zeitenwende, Verhandlungslösung: Wer diese Schlagworte hört, ist mittendrin im geopolitischen Diskurs. Aber was verbirgt sich dahinter? Jörg Lau, Außenpolitik-Experte der ZEIT, rückt den 80 beliebtesten Formeln auf dem internationalen Parkett zu Leibe und betreibt Sprachkritik. So zeigt er, dass die »Eskalationsspirale« oft nur ein rhetorischer Trick der Aggressoren ist, den Bruch internationalen Rechts zu legitimieren. Und er legt offen, welches antiliberale Narrativ hinter dem Begriff der »multipolaren Welt« steckt. Wer Jörg Laus außenpolitisches Wörterbuch zur Hand hat, kann besser mitreden und versteht die Hintergründe der deutschen Außenpolitik. »In diesem Buch will ich die Grundzüge der deutschen Außenpolitik vom Diplomatischen in Klartext übersetzen« Jörg Lau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jörg Lau
Worte, die die Welt beherrschen
Was die Phrasen der Außenpolitik wirklich bedeuten
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sprechen Sie außenpolitisch?
Zwei-Staaten-Lösung, multipolare Welt, regelbasierte Weltordnung, Flächenbrand, Eskalationsspirale, feministische Außenpolitik, Zeitenwende, Verhandlungslösung: Wer diese Schlagworte hört, ist mittendrin im geopolitischen Diskurs. Aber was verbirgt sich dahinter? Jörg Lau, Außenpolitik-Experte der ZEIT, rückt den 80 beliebtesten Formeln auf dem internationalen Parkett zu Leibe und betreibt Sprachkritik. So zeigt er, dass die »Eskalationsspirale« oft nur ein rhetorischer Trick der Aggressoren ist, den Bruch internationalen Rechts zu legitimieren. Und er legt offen, welches antiliberale Narrativ hinter dem Begriff der »multipolaren Welt« steckt. Wer Jörg Laus außenpolitisches Wörterbuch zur Hand hat, kann besser mitreden und versteht die Hintergründe der deutschen Außenpolitik.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Abnutzungskrieg
Abschreckung
Alleingänge
Angriffskrieg
Appeasement
Arabische Straße
Artikel 5
Augenhöhe
Autokratie gegen Demokratie
Bellizismus
Besonnenheit
De-Risking
Der Westen
Deutsch-französischer Motor
Diktatfrieden
Diplomatie
Ein-China-Politik
Eindämmungspolitik
Einflusszone
Eingefrorener Konflikt
Entkopplung
Entspannungspolitik
Erhobener Zeigefinger
Eskalation
Europäische Lösung
Feindbilder
Feministische Außenpolitik
Flächenbrand
Frieden
Friedensdividende
Gamechanger
Genozid
Geopolitik
Gesichtswahrende Lösung
Gesprächsfaden
Gewaltspirale
Globaler Süden
Hybrider Krieg
Imperialismus
Instrumentenkasten
Internationale Gemeinschaft
(Neuer) Kalter Krieg
Killerdrohnen
Kriegspartei
Kriegstüchtigkeit
Kritischer Dialog
Modernisierungspartnerschaft
Multilateralismus
Multipolare Weltordnung
Nationale Interessen
NATO-Osterweiterung
Neue Ostpolitik
Nukleare Teilhabe
Nuklearschirm
Polykrise
Postkolonialismus
Realismus
Regelbasierte Weltordnung
Resilienz
Rote Linien
Säbelrasseln
Schlafwandler
Schuldenbremse
Schwieriger Partner
Sicherheitsgarantie
Staatsräson
Stabilitätsanker
Stellvertreterkrieg
Strategische Autonomie
Symbolpolitik
Systemischer Rivale
Transatlantiker
Verantwortung übernehmen
Wandel durch Handel
Weckruf
Wertegeleitete Außenpolitik
Westbindung
Zeitenwende
Zwei-Prozent-Ziel
Zweistaatenlösung
Vorwort
Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wann sich zum ersten Mal dieses Gefühl einstellte: Etwas stimmt nicht mit der Sprache, in der wir in Deutschland über die großen Fragen der Außenpolitik streiten – über Krieg und Frieden, Freiheit und Tyrannei, Werte und Interessen. Ich weiß nur, dass mich diese Verstörung schon lange umtreibt.
Seit der Invasion Russlands in der Ukraine reden wir in Deutschland so viel und so heftig über Außenpolitik wie noch nie. Es kommen härtere Tage: Die USA wollen nicht mehr Schutzmacht sein; Deutschlands wichtigster Handelpartner China stellt sich an die Seite Russlands; Europa treibt plan- und führungslos in eine Welt neuer Großmachtkonflikte. Der Kollaps der ersten Ampel-Regierung und die Wiederwahl Donald Trumps verstärken den Druck, neu zu bestimmen, wofür sich Deutschland mit welchen Partnern in der Welt einsetzen soll und welche Mittel es dazu braucht.
Gut so! Aber die deutsche Debatte ist voller Floskeln, die Gegensätze verschleiern und Interessen verbergen – und oft ungeheuer voraussetzungsvoll sind. So reden wir hierzulande nicht nur aneinander, sondern oft auch an der weltpolitischen Wirklichkeit vorbei.
Man konnte das zum Beispiel während der letzten Wahlkämpfe beobachten, in denen Wettbewerber aus allen Lagern beanspruchten, für »Friedenspolitik« zu stehen. Die einen wollten »Frieden sichern« (SPD), die anderen »Frieden schützen« (AfD), die nächsten gar dem »Frieden wieder eine Heimat« geben (BSW). Gemeint war mit diesen sehr ähnlichen Parolen Gegensätzliches: Die einen waren für Waffenlieferungen an die Ukraine, die anderen wollten diese sofort beenden. »Frieden« ist, so paradox es klingt, ein Kampfbegriff, hinter dem sich bei genauerem Hinsehen unvereinbare außenpolitische Wertvorstellungen verbergen.
Seit fast zwanzig Jahren berichte ich für DIE ZEIT über Außenpolitik. Zunächst habe ich als Berliner Korrespondent Außenminister und Diplomaten begleitet, porträtiert und interviewt, dann war ich ein paar Jahre als Ressortleiter in unserer Hamburger Zentrale für unsere Korrespondenten in aller Welt zuständig, jetzt arbeite ich selbst als Internationaler Korrespondent wieder von Berlin aus.
Ich erinnere mich an einen Moment, in dem mir die Sprache der Außenpolitik, mit der ich täglich hantierte, fremd wurde. Er liegt schon lange zurück, aber was in diesen Tagen im Frühsommer 2008 geschah, wirkt bis in die Gegenwart nach.
Ich war als Berichterstatter dabei, als der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier am 13. Mai in Jekaterinburg im Ural eine große Rede an die russische Nation hielt. Steinmeier bot Russland eine umfassende »Modernisierungspartnerschaft« an, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Wortungetüm hatte Steinmeier für den Zweck extra von seinem Redenschreiber-Team erfinden lassen, es sollte eine neue Ära der deutsch-russischen Freundschaft einläuten. »Wir brauchen Ihr Land als Partner«, warb Steinmeier. Es könne in Europa »keine Sicherheit ohne oder gar gegen Russland geben«.
Zwölf Wochen später, am frühen Morgen des 8. August 2008, fielen russische Truppen in Georgien ein. Moskau hatte eigene Ideen, wie es künftig seine Nachbarschaft sichern würde. Der fünf Tage währende Georgienkrieg wurde von Außenminister Steinmeier als »Kaukasuskrise« abgehakt, ohne jede Konsequenz für die deutsche Russlandpolitik. Im Rückblick war dies der Beginn der neoimperialistischen Wende Russlands, die wenige Jahre später im ersten Überfall auf die Ukraine münden würde, als russische Truppen 2014 die Krim besetzten.
Natürlich ahnte auch ich das damals nicht. Aber ich begann damals zu zweifeln: Wussten die Russlandpolitiker um Steinmeier mit ihren Wohlfühlfloskeln eigentlich, wovon sie redeten? Oder projizierten sie bloß deutsche Wunschvorstellungen auf den Kreml? Im März 2010 brachte die SPD einen Antrag in den Bundestag ein: »Modernisierungspartnerschaft mit Russland – Gemeinsame Sicherheit in Europa durch stärkere Kooperation und Verflechtung«.
Um nicht missverstanden zu werden: Nicht schon das Angebot der Kooperation per se war verfehlt, wohl aber die Unfähigkeit (oder der Unwillen?), aus seinem Scheitern Konsequenzen zu ziehen. Steinmeier hielt immer weiter an seinem Kurs fest, als wäre nichts passiert.
Die Sprache der Außenpolitik, um die es in diesem Buch geht, ist mein Handwerkszeug. Ich habe ein berufliches Interesse daran, dass Begriffe, die ich verwende, die ohnehin unübersichtliche Weltlage nicht weiter vernebeln, sondern sie ordnen und verständlich machen. Darum habe ich vor einigen Jahren begonnen, das Vokabular der deutschen Außenpolitik, das Politiker, Diplomaten und Experten (aber auch wir Journalisten) verwenden, neu anzuschauen. Das ist ein Versuch der Selbstaufklärung, ja der Selbstkritik – denn viele der hier kritisierten abgedroschenen Phrasen habe auch ich schon verwendet.
Dem Team der Zeitschrift Internationale Politik, besonders Martin Bialecki und Joachim Staron, danke ich dafür, dass sie mir dafür eine Kolumne zur Verfügung gestellt haben. Dort analysiere ich regelmäßig die deutsche Außenpolitik unter dem Motto »In 80 Phrasen um die Welt«. Einige Texte dieses Buches sind dort zuerst in früheren Fassungen erschienen. Die meisten habe ich für diesen Band neu verfasst.
Ich hoffe, dass das Ergebnis für alle interessant ist, die Zeitung lesen, Talkshows anschauen oder in den sozialen Medien mitdebattieren. Denn wir alle werden heute von interessierter Seite andauernd mit Parolen bombardiert: Zeitenwende, Besonnenheit, Kriegsfähigkeit, Zwei-Prozent-Ziel, feministische Außenpolitik, Globaler Süden, eingefrorener Konflikt, internationale Gemeinschaft, regelbasierte Weltordnung, wertegeleitete Außenpolitik, nationales Interesse, Realismus, Eskalation, Appeasement, Abschreckung – die Liste ist lang, und sie wächst stetig weiter.
Die Sprache der Außenpolitik spiegelt eine zunehmende Verunsicherung über die Weltlage wider, die ich in meinen Jahren als Außenpolitikchef der ZEIT seit 2013 beobachten konnte. Die russische Annexion der Krim 2014, dann der IS-Terror in Europa, die große Migrationswelle aus dem Syrienkrieg, der Brexit und die Wahl Trumps im Jahr 2016, dazu noch die sich stetig verschärfende Klimakrise – alle diese Entwicklungen führten zu einem Gefühl der Verwundbarkeit. Die Rückkehr eines großen Landkrieges nach Europa, mit Panzerschlachten, Fliegerbomben und Grabenkämpfen wie in den Weltkriegen des letzten Jahrhunderts, hat die Verstörung zweifellos auf die Spitze getrieben.
Das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl kommt noch hinzu: Donald Trumps zweiter Wahlerfolg bedeutet einen noch tieferen Einschnitt als sein Überraschungssieg 2016. Diesmal wussten die Wählerinnen und Wähler ja, was sie bekommen würden. Bei seiner ersten Amtsübernahme war Trump kaum vorbereitet und mit den Washingtoner Institutionen nicht vertraut gewesen. Teile des republikanischen Establishments konnten ihn damals lange einhegen. Die Partei hat er unterdessen vollständig auf Linie gebracht. Und so startet er mit einem loyalen Team, einem ausgearbeiteten Plan und der offen bekundeten Absicht, die Institutionen der amerikanischen Demokratie seinem Willen zu beugen. Ein Chaos-Agent im mächtigsten Amt der Welt – was kann schon schiefgehen?
Die Krisen lösen heute einander nicht mehr ab, sondern befeuern sich wechselseitig. Doch mit der Verunsicherung wächst erfreulicherweise auch das Interesse an der internationalen Politik. Außen- und Sicherheitspolitik ist nach der proklamierten Zeitenwende aus den Denkfabriken, Fachkonferenzen und Ausschusssitzungen ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt. Selbst Landtagswahlen drehen sich heute um den deutschen Kurs in der Welt. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2024 stand zwar für viele Menschen die Frage im Zentrum, wie die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs gebracht werden kann. Doch an einer Neuausrichtung der deutschen (und europäischen) Außenpolitik im Verhältnis zu Trumps Amerika, Putins Russland und Xi Jinpings China führt kein Weg vorbei, wer auch immer (in welcher Konstellation auch immer) das Land anführt.
Darum gehören die Leitideen der Außenpolitik auf den Prüfstand. Manche Klischees, die ich mir in diesem Buch vornehme, schwirren schon seit Jahren herum. Sie bilden eine Art Grundbestand geopolitischer Bauernregeln, die sowohl Politiker als auch Leitartikler gerne verwenden: »Es droht eine Eskalation«; »die Gewaltspirale in Nahost dreht sich wieder«; »es gibt keine militärische Lösung«; »wir brauchen eine diplomatische Lösung«; »es gilt, die Gesprächskanäle offenzuhalten«; »Säbelrasseln ist zu unterlassen«; »wir leben in einer multipolaren Welt«.
Andere Phrasen arbeiten mit heimlichen Unterstellungen, an denen Zweifel angebracht sind: Droht Deutschland durch diese oder jene Waffenlieferung tatsächlich »Kriegspartei« zu werden? Ist der Konflikt um die Ukraine ein »Stellvertreterkrieg« zwischen der NATO und Russland? Liegt die Lösung, wie einige vorschlagen, im »Einfrieren« des Krieges? Hinter manchem Plädoyer für eine »diplomatische Lösung« (manchmal auch: »gesichtswahrende Lösung«) zwischen Russland und der Ukraine verbirgt sich eine Aufforderung zur Kapitulation.
Es geht hier um mehr als Sprachkritik: Gedankenlos verwendete Formeln können zu folgenreichen Fehlsteuerungen führen. Das lässt sich etwa an der Parole »Wandel durch Handel« erkennen, die jahrzehntelang die Politik gegenüber Russland bestimmte.
Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, und gleichlautend die Regierungen von Kohl über Schröder bis Merkel, folgten der Maxime. Das Versprechen lautete: Die wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit Russland würde dort Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Liberalisierung befördern, auf jeden Fall aber Stabilität bringen.
Bekanntlich ist es anders gekommen. Der Handel brachte zwar Wandel in Russland, allerdings ganz anders als geplant. Das Putin-Regime verwandte die Öl- und Gasprofite für Repression im Inneren und Aggression nach außen. Deutschland aber machte munter weiter Geschäfte und setzte auf deutsch-russischen Dialog, als Putin längst dabei war, seine Nachbarschaft zu destabilisieren. »Wandel durch Handel« war zum Feigenblatt für profitable Deals mit einer Diktatur verkommen, mit fatalen Folgen für die nationale Sicherheit. Deutschland steckte in einer gefährlichen Rohstoffabhängigkeit vom Putin-Regime, die kostspielig korrigiert werden musste.
Nun sollen aus dem Scheitern dieser zentralen Idee der Russlandpolitik Konsequenzen für die deutsche Chinapolitik gezogen werden, die lange der gleichen Parole gefolgt ist. Ein neues Schlagwort, das die Regierung ins Zentrum ihrer China-Strategie stellt, gibt die Richtung vor: »De-Risking« (Risikominderung). Schaut man sich an, wie dieses Konzept umgesetzt wird, bleibt Skepsis angezeigt, ob das Umdenken weit genug geht.
Im Umgang mit sogenannten schwierigen Partnern (noch so eine Phrase) finden sich auffällig viele Wiesel-Worte, unter denen sich jede Seite etwas anderes vorstellen kann. Die Gespräche mit dem Iran zum Beispiel hatte Deutschland jahrelang unter das Motto des »kritischen Dialogs« gestellt.
Als schließlich herauskam, dass das islamistische Regime auf dem Weg zur Atombombe schon weit fortgeschritten war, ließen deutsche Diplomaten die Parole stillschweigend fallen. Man war von den Dialogpartnern in Teheran vorgeführt worden. Vom kritischen Dialog spricht heute zwar niemand mehr, doch die deutsche Iran-Politik reagiert immer noch merkwürdig gehemmt, wenn das Regime Israel angreift, Russland Drohnen und Raketen zum Angriff auf die Ukraine bereitstellt oder seine aufbegehrende Bevölkerung brutal unterdrückt. Ich glaube, das kommt daher, dass man sich über das Scheitern der Dialogpolitik nie Rechenschaft abgelegt hat. Ein Partner, der nie Gespräche abbricht, auch wenn er so betrogen wurde wie Deutschland vom iranischen Regime, der wird nicht ernst genommen.
Darum ist ein offenes Gespräch über die Ideen so notwendig, an denen sich die deutsche Außenpolitik orientiert. Ich nehme mir hier auch diejenigen vor, mit denen ich selbst sympathisiere – weil ich glaube, dass wir einüben müssen (den Autor explizit eingeschlossen), über die Grenzen und über die unerwünschten Effekte auch der besten Absichten zu debattieren.
Jüngst wurde zum Beispiel die »feministische Außenpolitik« zur Regierungslinie erklärt. Ich begrüße das: Es ist richtig, dass sich die Politik weltweit die gerechte Behandlung von Frauen und Mädchen zum Maßstab setzt, und übrigens auch die Förderung von Frauen als deutsche Repräsentantinnen im Auswärtigen Dienst. Es geht nicht nur um Geschlechtergerechtigkeit: Gesellschaften, die Frauen unterdrücken, sind eine Gefahr für den Weltfrieden.
Die feministische Wende der deutschen Außenpolitik, forciert von der Grünen Außenministerin Annalena Baerbock, machte innere Widersprüche sichtbar. Deutschland hatte sich kurz zuvor gerade schmählich aus Afghanistan zurückziehen müssen. Die afghanischen Frauen, mit deren Schutz der Militäreinsatz immer wieder begründet worden war, hatte man in der Hand der Taliban zurückgelassen. Mag sein, dass es keine Alternative gab, aber feministisch war nichts an diesem Rückzug.
Und während die Debatte über die feministischen Leitlinien noch lief, begannen im Iran die Proteste gegen das Regime unter dem Motto »Frau – Leben – Freiheit«. Berlin weigerte sich jedoch, die Revolutionsgarden – das schärfste Schwert des islamischen Regimes – als Terrororganisation zu listen. Dafür wurden rechtliche Schwierigkeiten geltend gemacht, doch offenbar spielte auch die Abwägung eine Rolle, mit dem Regime irgendwann wieder über das Atomprogramm verhandeln zu wollen.
Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit der deutschen Außenpolitik ist auch im Verhältnis zu unseren engsten Partnern immer wieder spürbar. Selten wurde die »transatlantische Wertegemeinschaft« mit den USA so fromm beschworen wie nach der schockierenden Wahl Donald Trumps, die doch gezeigt hatte, wie sehr die Werte der Europäer und der Amerikaner in Wahrheit auseinanderdrifteten. Was wird nun aus dem Transatlantizismus, da man Trump nicht mehr als einen Betriebsunfall der amerikanischen Demokratie abtun kann?
Und was eigentlich folgt daraus, dass »Israels Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson« ist, wie Politiker aller Parteien der Mitte eifrig bekennen? Bedeutet Staatsräson die Unterstützung jeder israelischen Regierung und Zurückhaltung bei öffentlicher Kritik? Oder müsste, wem an der Sicherheit Israels gelegen ist, Benjamin Netanjahus Regierung und seine Kriegführung in Gaza nicht viel schärfer kritisieren? Die »Staatsräson« ist zu einer Floskel geworden, die jede Diskussion über eine zeitgemäße Nahostpolitik abwürgt. Diese Formel, mit der Angela Merkel ursprünglich Deutschlands besondere historische Verantwortung für Israel ausdrücken wollte, hat Deutschland Israel gegenüber politikunfähig gemacht.
Ich fürchte, das gilt auch für die viel beschworene »Zwei-Staaten-Lösung«, an der deutsche Politiker festhalten, obwohl sie weder in Israel noch bei den Palästinensern mehr glaubwürdige Fürsprecher hat. Darum wird auch diese beliebte Phrase hier gewürdigt. Ein Besuch im Jahr 2012 im Westjordanland, bei nationalreligiösen jüdischen Siedlern in Hebron, hat mir den Glauben genommen, dass die vollkommen einleuchtende Idee »Zwei Staaten für zwei Völker« umsetzbar sei. Es ist bitter, denn diese Formel führt den überkomplexen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern auf einen schlichten menschlichen Kern zurück: Die anderen werden nicht verschwinden, sie bleiben da und haben das Recht, nach eigenem Gusto zu leben. Und das geht nun mal am besten in zwei Staaten.
Die politische Herausforderung: Was tun, wenn das nicht funktioniert, weil beide Seiten es nicht wollen; weil das Vertrauen fehlt; weil die Gegner des Ausgleichs auf beiden Seiten am Ruder sind? »Wir halten an der Zwei-Staaten-Lösung fest«, diese immer wieder repetierte Formel der Bundesregierung ist keine Antwort auf diese Fragen.
In Zeiten wie diesen, in denen alte Konzepte nicht mehr tragen, kommt es auf die Sprache an, in der um die künftige Ausrichtung der deutschen Außenpolitik gefochten wird. Denn was Deutschland sich in dieser unsteten Welt vornehmen muss, was wir mit welchen Mitteln erreichen können und wovon wir lieber die Finger lassen sollten, das ist von Grund auf neu zu besprechen. Die Texte dieses Buches wollen dazu Denkräume öffnen – und zum Mitstreiten animieren.
Abnutzungskrieg
Hinter der Renaissance des nüchternen Wortes »Abnutzungskrieg« verbirgt sich einer der nachhaltigsten Schocks der letzten Jahre. Der Begriff hat sich in die aktuelle deutsche Debatte geschlichen, nachdem die erste Erleichterung über die erfolgreiche ukrainische Gegenwehr verflogen war. Es handelt sich hier um eine alte Art der Kriegführung, die von deutschen Militärs im Ersten Weltkrieg mit fürchterlichen Ergebnissen radikalisiert worden war.
In Frankreich, wo die Erinnerung an diesen Krieg präsenter ist als in Deutschland, ist er unter eigenem Namen bekannt, als guerre d’usure, wegen der bis dato unvergleichlich verlustreichen Schlachten an der Somme und Marne.
Der Krieg zwischen Israel und Ägypten von 1968 bis 1970 war zwar nicht nach den Opferzahlen, wohl aber vom Prinzip her vergleichbar und trägt in den Geschichtsbüchern daher den Namen war of attrition.
Materialschlachten, wie sie im letzten Jahrhundert rund um Verdun und dann noch einmal in kleinerem Maßstab auf der Sinaihalbinsel stattgefunden hatten, schienen einer militärstrategischen Vorzeit anzugehören – so die Überzeugung vieler Militärexperten vor dem russischen Angriff auf die Ukraine.
Die westlichen Geheimdienste hatten vermutet, die Ukraine werde einem russischen Angriff nur wenige Tage oder höchstens Wochen widerstehen können. Doch es gelang den ukrainischen Streitkräften mit Nachschub aus dem Westen, die russische Armee zurückzuwerfen und in einen Stellungskrieg zu verwickeln. Und damit tauchte das vergessene Wort immer öfter in den Analysen der Experten, in Politikerreden und in journalistischen Texten auf: Dieser Krieg, so heißt es seit dem Sommer 2022, ist ein Abnutzungskrieg.
In einem solchen Krieg geht es entscheidend um die wechselseitige Zerstörung der Ressourcen. Keine der beteiligten Seiten ist in der Lage, der anderen eine entscheidende Niederlage beizubringen – sei es durch besonders ausgeklügelte Überraschungsangriffe oder durch die Wirkung einer neuartigen Waffe, über die der Gegner nicht verfügt und die er nicht abzuwehren vermag. Dem deutschen Generalstabschef Erich von Falkenhayn kam es 1916 beim Angriff auf Verdun nicht darauf an, die Stadt einzunehmen. Es ging ihm darum, die Franzosen bei deren Verteidigung »auszubluten«.
Wer den russischen Krieg als Abnutzungskrieg deutet, neigt oft dazu, Russland gegenüber der Ukraine im Vorteil zu sehen, ein Land mit 140 Millionen Einwohnern und vielen Ressourcen gegen eine Nation von 40 Millionen. So evident, wie das klingt, ist es nicht. Bis Ende 2024 ließ sich auf russischer Seite der Verlust von mindestens 3000 Panzern nachweisen. Jährlich kann Russland trotz »Kriegswirtschaft« etwas mehr als 200 Panzer neu produzieren. Panzer sind nur ein Indikator, aber es zeigt sich, dass eine statistische Überlegenheit nicht entscheidend sein muss. General Falkenhayns Versuch, Frankreich mit der überlegenen deutschen Artillerie bei Verdun abzunutzen, stellte sich als eine der folgenreichsten Fehlkalkulationen der Militärgeschichte heraus.
Für Deutschland ist die Wiederkehr des Abnutzungskrieges eine verstörende Botschaft, denn die bisherigen russischen Panzerverluste belaufen sich auf das Zehnfache des gesamten deutschen Bestands (rund 300). Und die deutsche Verteidigungsindustrie ist auf Verfeinerung, nicht auf Massenproduktion angelegt. Der Leopard ist unbestritten einer der besten Panzer der Welt, doch nach heutigem Stand können in Europa pro Jahr lediglich 24 Stück produziert werden.
Abschreckung
Seit dem Beginn der russischen Totalinvasion in die Ukraine ist in Deutschland erneut von Abschreckung die Rede. Die Tatsache, dass Deutschland Feinde hat und diese abschrecken muss, indem es ihnen glaubhaft tödliche Konsequenzen androht, war über Jahrzehnte beiseitegeschoben worden. Psychoanalytiker haben ein passendes Wort für diesen Vorgang: die Wiederkehr des Verdrängten.
Nach dem Ende des Kalten Krieges hatten Verteidigungsminister sozialdemokratischer ebenso wie konservativer Provenienz die Bundeswehr sukzessive ab- und umgebaut – zu einer Interventionsarmee für ferne Kriege außerhalb des NATO-Gebietes (out of area). Nun wurde, so glaubte man, »unsere Sicherheit nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt« (so Peter Struck 2004).
Der ursprüngliche Zweck der Bundeswehr – die Bündnis- und Landesverteidigung – schien zusehends überholt, was sich am deutlichsten in der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 ausdrückte. Der systematische Bruch des 2014 erneuerten Versprechens, sich bei den Verteidigungsausgaben der Zwei-Prozent-Marke (sprich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts) anzunähern, unterstrich den Wandel. Die Bundeswehr wurde durch Sparrunden und Strukturveränderungen in einen Zustand der Dysfunktionalität versetzt. Das war eine Folge der Abkehr vom Prinzip Abschreckung. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schockte der Inspekteur des Heeres, General Alfons Mais, Politik und Öffentlichkeit mit der Aussage, die Bundeswehr stehe »blank« da.
Das Land hatte sich nach der Wiedervereinigung »von Freunden umgeben« (Helmut Kohl) gefühlt. Gegner wie Russland glaubte es durch beiderseits profitable Arrangements – Nord Stream ist nur das prominenteste Beispiel – in »Modernisierungspartner« verwandeln zu können.
Die im Hintergrund weiter bestehende Abschreckung durch den Bündnispartner USA konnte man ausblenden. Die »nukleare Teilhabe« – die Lagerung einer geringen Zahl an US-Bomben älteren Typs in der Eifel, die im Ernstfall von deutschen Kampfflugzeugen ins Ziel gebracht werden müssten – war unbeliebt. Liberale und sozialdemokratische Politiker machten regelmäßig Wahlkampf gegen die US-Atombomben. Deutschland stieg aus der Atomenergie aus und in den Atomwaffenverbotsvertrag ein – als Beobachter, nicht als Mitglied. Ein bequemes Arrangement, dabei sein und dagegen sein zugleich: Die Deutschen genossen den Schutz des amerikanischen Nuklearschirms, den sie zugleich in immer neuen Wellen der Antiatombewegung kritisieren konnten.
Das erklärt den Schock durch Wladimir Putins Atomdrohungen, der nirgends so tief empfunden wird wie in Deutschland. Die von Donald Trump gezielt geschürte Furcht vor der Abwendung der Schutzmacht USA trägt dazu bei. Er werde säumige NATO-Mitglieder nicht nur nicht verteidigen, so Trump zu Beginn seines erneuten Wahlkampfes, sondern Putin sogar ermuntern, mit ihnen »zu tun, was immer zur Hölle er mag«.
Olaf Scholz nahm das auf, ohne Trump zu erwähnen. Im Februar 2024 begann der Bundeskanzler für eine Rückkehr zur Politik der Abschreckung zu werben. Wir müssten »zusammen mit unseren Verbündeten so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen«.
Ob Abschreckung funktioniert, lässt sich nur im Nachhinein beurteilen. Ein ausbleibender Angriff kann ein Indiz sein, dass die Truppenkonzentration des Gegners tatsächlich nur eine Übung ist – und sich nicht intensive Vorbereitungen und äußerste Entschlossenheit dahinter verbergen, wie die Ukraine feststellen musste. Selbst massive Überlegenheit nach Zahlen ist keine Garantie für Effektivität. Sie kann zu Selbstgefälligkeit und mangelnder Fantasie führen, wie die Israelis am 7. Oktober 2023 erfahren mussten.
Das Konzept der Abschreckung ist seiner Natur nach schillernd; es ist kein Zufall, dass der Begriff oft mit dem Adjektiv »glaubhaft« versehen wird. Abschreckung bezeichnet eine Beziehung, in der es beide Seiten darauf anlegen, dass der je andere ihr das Schlimmste zutraut, bis hin zu selbstschädigendem Verhalten in Konsequenz der »wechselseitig garantierten Vernichtung«. Es ist passend, dass dieses Prinzip der Nuklearstrategie auf Englisch – mutually assured destruction – mit dem Akronym MAD (»verrückt«) bezeichnet wird. Abschreckung ist der paradoxe und prekäre Versuch der bis an die Zähne bewaffneten Menschheit, rationales Verhalten aus der wechselseitigen Bereitschaft zur Irrationalität zu generieren.
Alleingänge
Die Ablehnung eines Alleingangs war der Kern der Außenpolitik der ersten Ampelregierung. Es war das ceterum censeo nahezu aller Einlassungen von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Unterstützung der Ukraine. Kein Interview, keine Rede, kein Namensbeitrag zum Thema kam ohne diesen Refrain aus: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Alleingänge zu vermeiden seien.
Dass Scholz dabei oft den Plural verwendete, unterstrich, wie wichtig diese Gedankenfigur ihm war: Nicht nur der Alleingang in einer einzelnen Frage (Kampfpanzer) war abzulehnen. Alleingänge gehörten sich grundsätzlich nicht für Deutschland.
Die Distanzierung des Bundeskanzlers vom Alleingang rief ein altes Trauma wach: Deutschland habe einen verhängnisvollen Sonderweg in die Moderne beschritten, der in den Weltkrieg und schließlich in den Untergang geführt habe. Die Nachkriegszeit wird dementsprechend als Zurückfinden auf die Hauptstraße der westlichen Moderne gesehen, als Heimkehr eines irregeleiteten Deutschlands unter die Völker, über die es sich erhoben hatte.
Historiker halten die Sonderwegthese zwar mittlerweile für überholt, aber darauf kommt es hier nicht an. Dass Deutschland außen- und sicherheitspolitisch »nie wieder allein« handeln sollte, bleibt eine richtige Konsequenz.
Das Problem liegt darin, dass auch die erste Ampelregierung (wie schon sämtliche Merkel- und Schröder-Kabinette) sich daran nur sehr selektiv hielt. Scholz’ Ankündigung eines 200 Milliarden Euro schweren Entlastungspakets (»Doppel-Wumms«) für geplagte deutsche Verbraucher und die Industrie wurde rings um Deutschland herum sehr wohl als Alleingang wahrgenommen, als ein unfreundlicher Akt der Wettbewerbsverzerrung. Das reiche Land in der Mitte sei sich wieder einmal selbst das nächste. Länder wie Italien und Spanien, die sich vergleichbare Entlastungen nicht leisten können, forderten Solidarität.
Es war nicht das erste Mal, dass Berliner Entscheidungen als egoistisch, unilateralistisch und rücksichtslos kritisiert wurden. So war es schon in der Eurokrise, beim plötzlichen deutschen Atomausstieg, bei der Flüchtlingskrise, bei der Durchsetzung der Nord-Stream-Pipelines gegen den Willen der Polen und Balten. Selbstbild und Fremdbild klaffen in der internationalen Politik genauso oft auseinander wie im privaten Leben. Berlin sieht sich stets als wohlwollender Teamplayer. Die Nachbarn haben den Verdacht, im Zweifel gelte eben doch Germany first. Deutschland könne sich die permanenten Alleingänge dank seiner ökonomischen Macht leisten. Weil das Land nun mal schlicht too big to fail sei, müssen am Ende immer alle mitziehen.
Zurück zum Anwendungsfall Waffenhilfe für die Ukraine. Auch hier stieß das Alleingangmotiv zusehends an seine Grenzen. Unsere Partner sahen darin ein klassisches Strohmann-Argument: Niemand hatte je von Deutschland gefordert, ganz allein schwere Waffen, Kampfpanzer, Flugzeuge oder Marschflugkörper zu liefern. Das wäre schon aus logistischen Gründen blanker Unsinn.
Gefordert war aber Initiative. Wie sonst sollte Deutschland sich als »Führungsmacht« (Lars Klingbeil) in dieser europäischen Krise bewähren? Es gab früh einen Plan für ein europäisches Konsortium, das die Lieferung von Leopard-Panzern organisieren sollte. Berlin ignorierte dies und drängte auf eine Entscheidung der USA. Viele Monate – und vermutlich Menschenleben – gingen so verloren. Auch bei den Marschflugkörpern des Typs Taurus wäre eine Koordination mit Frankreich und Großbritannien möglich gewesen, die ähnliche Waffen lieferten. Immer wieder zauderte Berlin. Das mächtigste Land Europas entzog sich seiner Rolle als Initiator gemeinsamer Sicherheitspolitik. War das nicht auch ein Alleingang?
Angriffskrieg
Schnell hat sich dieser Begriff als Bezeichnung für das durchgesetzt, was Wladimir Putin lange als »Spezialoperation« verharmloste: »russischer Angriff«, »russischer Angriffskrieg«, manchmal gesteigert zum »schrecklichen imperialistischen Angriffskrieg« (Olaf Scholz). Im zweiten Satz seiner Zeitenwende-Rede, drei Tage nach Kriegsbeginn, stellte Scholz klar: »Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen.«
Seither ist dies allgemeiner Sprachgebrauch geworden. Das hat politisch-strategische und völkerrechtliche Gründe. Die Verurteilung des Angriffskrieges legitimiert die Unterstützung der Ukraine als Hilfe zur legitimen Selbstverteidigung. Artikel 51 der UN-Charta erkennt allen Mitgliedstaaten das »naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung« gegen einen »bewaffneten Angriff« zu, ohne dass diese dadurch selbst Kriegspartei würden. Die Definition als Angriff begründet die Ausnahme vom generellen Gewaltverbot zwischen Staaten.
Nicht jede kleine Grenzverletzung, nicht jedes Scharmützel erfüllt dieses Kriterium, wohl aber die massive Invasion der russischen Truppen. Die Rede vom Angriffskrieg durchkreuzt also die russische Propaganda, es handele sich um eine Präventivaktion. Und sie legitimiert die ukrainische Gegengewalt samt westlicher Unterstützung, auch mit letalen Waffen.





























