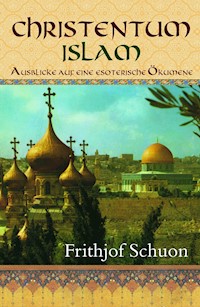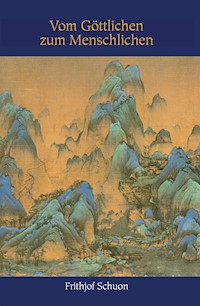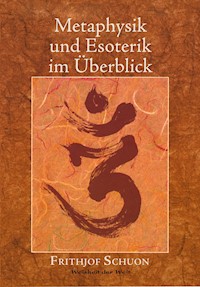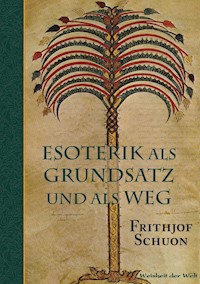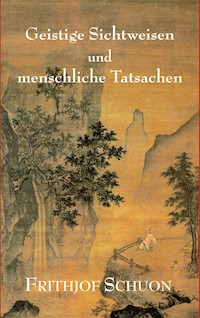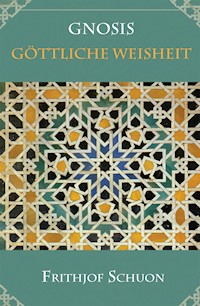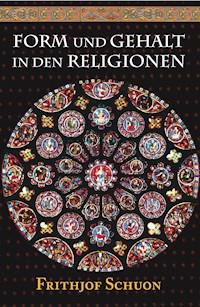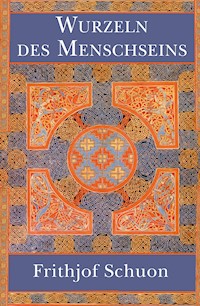
9,99 €
Mehr erfahren.
»Es ist notwendig, eine geistige Verwurzelung zu verwirklichen, die dem Äußeren seine zugleich zerstreuende und verengende Willkürherrschaft nimmt und die uns stattdessen ermöglicht, ›Gott überall zu sehen‹, das heißt, in den sinnenhaften Dingen die Sinnbilder, die Urbilder und die Wesenheiten wahrzunehmen; denn die von einer verinnerlichten Seele wahrgenommenen Schönheiten werden Faktoren der Verinnerlichung.« Frithjof Schuon (1907-1998) wird in weiten Teilen der Welt als einer der bedeutendsten religionsphilosophischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Er gilt als führender Vertreter jener Denkrichtung, die Sophia perennis (»immerwährende Weisheit«) genannt wird, und welche die zeitlosen und überall gültigen Grundsätze enthält, die den verschiedenen Lehren, den Sinnbildern, der heiligen Kunst und den geistigen Übungen der Weltreligionen zugrunde liegen. Dieses Buch handelt von den Grundsätzen der Metaphysik und ihren Anwendungen auf die religiöse und geistige Ebene. Es enthält drei Teile: Der erste hat erkenntnistheoretische, metaphysische und kosmologische Fragen zum Gegenstand, der zweite das esoterische Verständnis verschiedener religiöser Überlieferungen, der dritte das geistige Leben. So werden im Licht der metaphysischen Grundsätze die innere Bedeutung der religiösen Formen sowie deren Umsetzung im Dasein des Menschen erkennbar. Das Buch wendet sich an Menschen, die auf der Suche nach einem geistig fundierten Verständnis der Welt und ihres eigenen Lebens sind, einem Verständnis, das über die Antworten hinausgeht, welche die modernen Wissenschaften geben können. Es vermag zu befreienden Einsichten und tiefer Gewissheit zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Deutschsprachige Bücher von Frithjof Schuon
Philosophische Werke
Leitgedanken zur Urbesinnung. Zürich 1935; Freiburg 1989, 2009
Das Ewige im Vergänglichen. Weilheim 1970; München 1984
Von der inneren Einheit der Religionen. Interlaken 1981; Freiburg 2007
Den Islam verstehen. München 1988, 1991, 2002. Freiburg 1993
Schätze des Buddhismus. Norderstedt 2007
Esoterik als Grundsatz und als Weg. Hamburg 2012
Metaphysik und Esoterik im Überblick. Hamburg 2012
Logik und Transzendenz. Hamburg 2013
Geistige Sichtweisen und menschliche Tatsachen. Hamburg 2013
Gedichte
Sulamith. Bern 1947
Tage- und Nächtebuch. Bern 1947
Glück. Freiburg 1997
Leben. Freiburg 1997
Liebe. Freiburg 1997
Sinn. Freiburg 1997
Perlen des Pilgers. Düsseldorf 2000
Sinngedichte. Bd. 1 – 10. Sottens 2001 – 2005
Frithjof Schuon
Wurzeln des Menschseins
Übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von
Wolf Burbat
WEISHEIT DER WELT
© World Wisdom Books
Titel des französischen Originales: Racines de la condition humain La Table Ronde, Paris 1990
Aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von Wolf Burbat
Umschlagbild: Lindisfarne Gospels, um 700 n. Chr.
WEISHEIT DER WELT ist das deutschsprachige Imprint von
World Wisdom, Inc.,
P.O. Box 2682, Bloomington, Indiana 47402-2682
www.worldwisdom.com
Verlag: tredition GmbH
ISBN
978-3-7323-0292-5 (Paperback)
978-3-7323-0804-0 (e-Book)
www.tredition.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Inhalt
Vorbemerkung des Übersetzers
Vorwort
GRUNDSÄTZE UND WURZELN
Von der Intelligenz
Der Schleier der Isis
Probleme von Raum und Zeit
Mahâshakti
Das Rätsel der vielgestaltigen Subjektivität
Spuren des Seins, Beweise Gottes
Heilbringende Dimensionen
GRUNDLEGENDE SICHTWEISEN
Der Mensch im Angesicht des Höchsten Gutes
Grundmuster der christlichen Botschaft
Grundmuster der islamischen Botschaft
Säulen der Weisheit
Die zweifache Unterscheidung
SITTLICHE UND GEISTIGE DIMENSIONEN
Kosmische Schatten und Gelassenheit
Tugend und Weg
Von der Liebe
ANHANG
Anmerkungen des Übersetzers
Glossar
Index
Vorbemerkung des Übersetzers
Wir freuen uns, mit diesem Buch die fünfte einer Reihe von geplanten Übersetzungen von Werken Frithjof Schuons in deutscher Sprache vorlegen zu können. Der in Deutschland noch wenig bekannte Schuon (1907–1998) wird in weiten Teilen der Welt als einer der bedeutendsten religionsphilosophischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Er besaß einen außerordentlichen Überblick über die religiösen Überlieferungen der Menschheit, konnte die Vielfalt der Erscheinungen bis in ihre Tiefe durchdringen und seine Erkenntnisse in meisterhafter, oft dichterischer Sprache ausdrücken. Er gilt als führender Vertreter jener Denkrichtung, die Sophia perennis, Philosophia perennis oder Religio perennis – also immerwährende Weisheit, immerwährende Philosophie oder immerwährende Religion – genannt wird, welche die zeitlosen und überall gültigen Grundsätze enthält, die den verschiedenen Lehren, den Sinnbildern, der heiligen Kunst und den geistigen Übungen der Weltreligionen zugrundeliegen.
Das vorliegende Buch gehört zu Schuons in Amerika entstandenen Werken; die französische Originalausgabe erschien zuerst 1990.
Die Wurzeln des Menschseins liegen – wie die aller Erscheinungen – Schuon zufolge nicht »unten«, sondern »oben«, im Bereich der himmlischen Urbilder, letztlich im Einen, dem göttlichen Selbst. Man mag hier an den Ashvattha-Baum aus der Bhagavad-Gîtâ (XV,1) denken, der seine Wurzeln oben und seine Zweige unten hat.
Schuon benutzt wichtige Schlüsselbegriffe in ihrem ursprünglichen Sinn und nicht so, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. So wird heute beispielsweise der Begriff Intelligenz, dem in diesem Buch ein Kapitel gewidmet ist, mit der Fähigkeit des Menschen gleichgesetzt, seinen schlussfolgernden Verstand zu gebrauchen. Für den Verfasser gründet die Intelligenz aber nicht nur auf dem Verstand, sondern auch auf dem Intellekt, dem »reinen Geist«, der zur unmittelbaren Schau, zur »Einsicht« fähig ist. Dadurch besitzt die Intelligenz eine größere Reichweite; letztlich ist sie in der Lage und dazu bestimmt, das Absolute zu erkennen. Der Intellekt enthält in seiner Spitze das Göttliche im Menschen, mit den von Schuon immer wieder angeführten Worten Meister Eckharts: Aliquid quod est increatum et increabile … et hoc est intellectus (»etwas, was unerschaffen und unerschaffbar ist … und das ist der Intellekt«). Bedeutsam ist hier, dass der Intellekt als göttlich angesehen wird, er ist überpersönlich und überrational; er gehört nicht dem einzelnen Menschen, vielmehr hat dieser grundsätzlich Zugang zu ihm.
Der Mensch ist aber nicht nur umfassendes Erkenntnisvermögen, sondern auch freier Wille und selbstlose Seele. Sinn des menschlichen Daseins ist es demzufolge, das Wahre zu erkennen, das Gute zu wollen, das Schöne zu lieben.
Obwohl Deutsch seine erste Muttersprache war, hat Schuon seine metaphysischen Werke auf Französisch verfasst, einer Sprache, die sich aufgrund ihres lateinischen Ursprungs und ihres unzweideutigen Wortschatzes hierfür besonders gut eignet. Schuon liebte die deutsche Sprache sehr und bestand darauf, sie weitgehend von Fremdwörtern freizuhalten. Dem haben wir in der vorliegenden Übersetzung Rechnung zu tragen versucht; so wird der Leser einige mittlerweile selten gewordene Wörter wie »Geistigkeit« statt »Spiritualität«, »Anblick« oder »Gesichtspunkt« statt »Aspekt«, »Sammlung« statt »Konzentration« und dergleichen mehr finden. Als Muster hat uns hierbei Schuons eigene Übertragung seines ersten Hauptwerkes De lunité transcendante des religions (1948) ins Deutsche gedient.1
Andererseits war es unumgänglich, eine Reihe von Fremdwörtern zu benutzen, seien es philosophische Fachausdrücke oder Begriffe aus einer Vielzahl von Überlieferungen; diese Begriffe aus dem Sanskrit, dem Griechischen, dem Lateinischen und dem Arabischen wurden in einem Glossar im Anhang des Buches zusammengestellt, übersetzt und erklärt.
Weiterhin haben wir im Anhang nach Seitenzahl geordnete »Anmerkungen des Übersetzers« zusammengestellt, in denen Textstellen erläutert werden, die auf überlieferte theologische Lehren, wichtige Philosophen oder geistige Meister sowie heilige Schriften der Weltreligionen anspielen.
1 Deutsch: Von der inneren Einheit der Religionen. Freiburg i. Br. 2007.
[1]Vorwort
Wurzeln des Menschseins: Dieser Titel deutet auf eine Sichtweise hin, die um das Wesentliche bedacht ist, und die sich somit der Grundsätze, der Urbilder, und der Daseinsgründe bewusst ist; bewusst kraft reingeistiger Schau und nicht des schlussfolgernden Denkens. Ohne Zweifel lohnt es sich, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die Metaphysik keine auf Erfahrung beruhende Wissenschaft ist: Die Erkenntnis von Grundsätzen kann nicht auf irgendeine Erfahrung zurückgehen, auch wenn – wissenschaftliche oder andere – Erfahrungen gelegentlich Ursachen für Intuitionen des reinen Geistes sein können. Die Quellen unserer transzendenten Gewissheiten sind die uns angeborenen Gaben, die eines Wesens mit der reinen Intelligenz, aber de facto seit dem »verlorenen Paradies« »vergessen« sind; überdies ist die Erkenntnis von Grundsätzen, nach Platon, nichts anderes als eine »Wiedererinnerung«, und diese ist eine Gabe, die meistens durch intellektuelle und spirituelle Übungen wachgerufen wird, Deo juvante.
Der Rationalismus im weitesten Sinne des Wortes ist geradezu die Leugnung der platonischen Wiedererinnerung; er besteht darin, die Faktoren der Gewissheit in den Erscheinungen zu suchen und nicht in unserem Sein. Die Griechen waren, abgesehen von den Sophisten, keine Rationalisten im eigentlichen Sinne; zwar hat Sokrates den Intellekt dadurch rationalisiert, dass er die Argumentationskunst und mithin die Logik betont hat, man könnte aber auch sagen, dass er die Ratio intellektualisiert hat; darin liegt die Doppeldeutigkeit der griechischen Philosophie, wobei – annäherungsweise gesprochen – deren eine Seite durch Aristoteles vertreten wird und die andere durch Platon. Die Ratio intellektualisieren: das ist ein unvermeidliches und ganz spontanes Verfahren, sobald man geistige [2]Einsichten ausdrücken möchte, welche die bloße Ratio nicht erreichen kann; der Unterschied zwischen den Griechen und den Hindus ist hier eine Frage des Maßes in dem Sinne, dass das hinduistische Denken »konkreter« ist als das griechische und mehr Gebrauch von Sinnbildern macht. Im Grunde ist es nicht immer möglich, auf den ersten Blick einen Rationalisten, der zufällig Intuitionen hat, von einem intuitiven Menschen zu unterscheiden, der argumentieren muss, um sich ausdrücken zu können, doch ist dies in der Praxis keine Schwierigkeit, vorausgesetzt, die Wahrheit bleibt unangetastet.
Der Rationalismus ist das Denken des kartesianischen »deshalb«, welches ein Beweis sein will; dies hat nichts mit dem »deshalb« zu tun, das uns die Sprache auferlegt, wenn wir einen logisch-ontologischen Zusammenhang ausdrücken wollen. Anstelle von cogito ergo sum müsste man sagen: sum quia est esse, »ich bin, weil das Sein ist«; »weil« und nicht »deshalb«. Unsere Gewissheit, da zu sein, wäre unmöglich ohne das absolute und somit notwendige Sein, das unser Dasein und unsere Gewissheit gleichermaßen hervorbringt; das Sein und das Bewusstsein, dies sind die beiden Wurzeln unserer Wirklichkeit. Der Vedânta fügt die Glückseligkeit hinzu, die der allerletzte Gehalt sowohl des Bewusstseins als auch des Seins ist.
Erkennen, Wollen, Lieben: Das ist die ganze Natur des Menschen, und das ist folglich seine ganze Berufung und seine ganze Pflicht. Umfassendes Erkennen, freies Wollen, edles Lieben; oder, anders gesagt: das Unbedingte und ipso facto seine Zusammenhänge mit dem Bedingten erkennen; das, was für uns in Abhängigkeit von dieser Erkenntnis zwingend geboten ist, wollen; und das Wahre und das Gute und das, was dies hienieden bekundet, lieben; also das Schöne lieben, das dorthin führt. Die Erkenntnis ist in dem Maße umfassend oder ganzheitlich, wie sie das Wesentlichste und mithin das Wirklichste zum Gegenstand hat; der Wille ist in dem Maße frei, wie er das[3] anstrebt, was uns, als das Wirklichste, befreit; und die Liebe ist edel durch die Tiefe des Subjekts ebenso wie durch die Erhabenheit des Objekts; der Adel hängt von unserem Sinn für das Heilige ab. Amore e‘l cuor gentil sono una cosa: Das Mysterium der Liebe und das der Erkenntnis sind ein und dasselbe.
[4][5]ERSTER TEIL
GRUNDSÄTZE UND WURZELN
[6][7]Von der Intelligenz
Intelligenz ist die Wahrnehmung einer Wirklichkeit und a fortiori die Wahrnehmung des Wirklichen an sich; sie ist ipso facto die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen – oder dem weniger Wirklichen –, und das zuerst im grundsätzlichen, unbedingten oder »senkrechten« Sinn, und dann im daseinsmäßigen, verhältnismäßigen oder »waagerechten« Sinn. Genauer gesagt ist die »waagerechte« oder kosmische Dimension der Bereich des Verstandes und der Versuchung des Rationalismus, während die »senkrechte« oder metakosmische Dimension der Bereich des Intellekts und der einenden Beschauung ist; es sei daran erinnert, dass unter allen irdischen Geschöpfen allein der Mensch den aufrechten Gang besitzt, was auf die »senkrechte« Möglichkeit des Geistes und damit auf den Daseinsgrund des Menschen hindeutet.1
Man muss im menschlichen Geist zwischen Funktionen und Fähigkeiten unterscheiden: In der ersten Gruppe, welche die grundlegendere ist, differenzieren wir zunächst zwischen Unterscheidung und Beschauung2 und dann zwischen Analyse und Synthese;3 in der zweiten Gruppe zwischen einer [8] theoretischen und einer praktischen Intelligenz,4 dann zwischen einer spontanen und einer reagierenden, oder auch zwischen einer konstruktiven und einer kritischen Intelligenz.5 Von einem ganz anderen Standpunkt aus muss man zwischen einer Erkenntnisfähigkeit unterscheiden, die nur der theoretischen Möglichkeit nach, und einer anderen, die keimhaft vorhanden und einer dritten, die tatsächlich wirksam ist: Die erste betrifft alle Menschen, also auch die beschränktesten; die zweite bezieht sich auf nicht unterrichtete Menschen, die aber die Fähigkeit zu verstehen besitzen; die dritte schließlich stimmt mit der Erkenntnis überein.
✵
Es ist nur allzu offensichtlich, dass gedankliche Bemühung nicht von selbst zur Wahrnehmung des Wirklichen führt; der schärfste Geist kann der Träger für den gröbsten Irrtum sein. Die paradoxe Erscheinung einer Intelligenz – sogar einer »blendenden« –, die Träger für den Irrtum ist, erklärt sich zuallererst durch die Möglichkeit eines ausschließlich »waagerechten« Vorgehens, dem jegliches Bewusstsein »senkrechter« Bezüge fehlt; die Begriffsbestimmung »Intelligenz« [9] besteht fort, da es ja immer noch eine Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Zweitrangigem oder zwischen Ursache und Wirkung gibt. Ein entscheidender Faktor bei der Erscheinung des »intelligenten Irrtums« ist ganz offensichtlich das Eingreifen eines nicht geistigen Elements wie der Gefühlsbetontheit oder der Leidenschaft; die ausschließliche Beschränkung auf das »Waagerechte« erzeugt eine Leere, die das Irrationale notwendigerweise ausfüllt. Es muss hervorgehoben werden, dass die Beschränkung auf das »Waagerechte« nicht immer eine Verneinung des Übernatürlichen ist; es kann sich um einen Gläubigen handeln, dessen geistige Intuition in einem verborgenen Zustand bleibt, was das »dunkle Verdienst des Glaubens« ausmacht; in diesem Fall kann man ohne Sinnwidrigkeit von einer frommen und sittlichen »Senkrechtheit« sprechen.
Die evolutionistische These von der Verwandlung der Arten bietet auf der Ebene der Naturwissenschaften ein offenkundiges Beispiel für die Beschränkung auf das »Waagerechte«, aufgrund der Tatsache, dass sie an die Stelle der kosmogonischen Emanation in »absteigenden« Stufen eine biologische Evolution in »aufsteigenden« Stufen setzt;6 genauso ersetzen moderne Philosophen – mutatis mutandis – die metaphysische Kausalität durch »physikalische« und empirische Kausalitäten; was ohne Zweifel Intelligenz erfordert, aber eine sozusagen enthauptete Intelligenz.
Es muss an dieser Stelle auf die paradoxe Tatsache hingewiesen werden, dass ein Verständnis, das auf der Höhe »senkrechter« Wahrheiten ist, nicht immer eine Gewähr für die Vollständigkeit der »waagerechten« Intelligenz oder für [10] die entsprechenden sittlichen Eigenschaften bietet; wir stehen dann aber entweder einer einseitigen Entwicklung spekulativer Begabungen zum Nachteil praktischer Begabungen gegenüber oder einer Anomalie, die aus einer Art gespaltener Persönlichkeit besteht; dies sind aber Nebensachen, die angesichts des Wunders des Intellekts und dem der Wahrheit nichts Absolutes an sich haben. Dennoch ist die metaphysische Intelligenz nur unter der Bedingung vollständig und wirksam, dass die spekulativen und praktischen Dimensionen sich im Gleichgewicht befinden.
✵
Vielleicht lohnt es sich, an dieser Stelle die mehrdeutige Erscheinung der Naivität aufzuhellen: Diese besteht vor allem aus einem Mangel an Erfahrung, verbunden mit Leichtgläubigkeit, wie es das Beispiel der Kinder zeigt, sogar der intelligentesten. Leichtgläubigkeit kann einen positiven Grund haben: Sie kann in der Haltung des wahrhaftigen Menschen bestehen, der ganz selbstverständlich glaubt, dass die ganze Welt so wie er selbst ist; es gibt Völker, die leichtgläubig sind, weil sie die Lüge nicht kennen. Es versteht sich daher von selbst, dass Naivität etwas ganz Verhältnismäßiges sein kann: Jemand, der nichts von der Psychologie Geistesgestörter versteht, ist naiv in den Augen von Psychiatern, selbst wenn er weit davon entfernt ist, dumm zu sein. Wenn man »klug wie die Schlangen« sein soll – unter der Voraussetzung, »arglos wie die Tauben« zu sein –,7 dann [11] vor allem deshalb, weil die Umgebung Fallstricke auslegt und man sich zu verteidigen wissen muss, das heißt, dass unser Vorstellungsvermögen ein Bewusstsein von den Launen der irdischen Mâyâ haben muss.
Wie dem auch sei, wenn wir uns an den geläufigen Wortsinn halten, dann bedeutet naiv sein, bei dem vereinfachenden und die Dinge wörtlich nehmenden Blickwinkel der Kindheit stehen zu bleiben, ohne dabei den Instinkt für das »Eine Notwendige« verlieren zu müssen, wozu es weder irgendeiner vielschichtigen Erfahrung noch einer Begabung für abstrakte Spekulation bedarf.
Wir würden an dieser Stelle gern die folgende Frage beantworten: Ist jemand, der von einem verhängnisvollen Irrtum befreit ist, deswegen intelligenter geworden? Vom Standpunkt der möglichen Intelligenz, nein; vom Standpunkt der wirksamen Intelligenz aber, ja; denn in dieser Hinsicht gleicht die Wahrheit der Intelligenz. Der Beweis dafür ist, dass die Anerkennung einer Schlüsselwahrheit die Fähigkeit nach sich zieht, andere Wahrheiten von gleicher Ordnung sowie eine Vielzahl untergeordneter Anwendungen – wie bei einer Kettenreaktion – zu verstehen; jedes Verstehen erleuchtet, jedes Nichtverstehen verdunkelt.
Das Gegenteil der Naivität ist die luziferische, forschende, erfinderische Intelligenz, die leidenschaftlich und blind ins Unbekannte und Unbestimmte vordringt; es ist die Geschichte von Prometheus und von Ikarus, und es ist selbstmörderische Neugier.
✵
Die Intelligenz bringt nicht nur die Unterscheidung hervor, sondern auch – ipso facto – das Bewusstsein unserer Überlegenheit hinsichtlich derer, die nicht zu unterscheiden wissen; im Gegensatz zu dem, was viele Moralisten denken, ist dieses [12]Bewusstsein kein Fehler an sich, denn wir können nicht verhindern, uns einer Sache bewusst zu sein, die da ist und die für uns wahrnehmbar ist eben durch unsere Intelligenz. Nicht ohne Grund ist die Objektivität ein Vorrecht des Menschen.
Dieselbe Intelligenz aber, die uns unsere Überlegenheit bewusst macht, macht uns auch die Verhältnismäßigkeit dieser Überlegenheit bewusst und, mehr als das: Sie macht uns all unsere Begrenzungen bewusst. Das heißt, dass eine wesentliche Aufgabe der Intelligenz in der Selbsterkenntnis besteht: somit in der – je nach betrachtetem Blickpunkt positiven oder negativen – Erkenntnis unserer eigentlichen Natur.
Gott erkennen, das Wirkliche an sich, das höchste Verstehbare, dann die Dinge erkennen in Abhängigkeit von dieser Erkenntnis, und folglich auch uns selbst erkennen: Dies sind die Dimensionen der echten und vollständigen Intelligenz; der einzigen, die, streng genommen, diesen Namen verdient, denn sie allein ist im eigentlichen Sinne menschlich.
Wir haben gesagt, dass die Intelligenz von ihrem Wesen her die Selbsterkenntnis hervorbringt, zusammen mit den Tugenden der Demut und der uneigennützigen Liebe; sie kann aber auch am Rande ihres Wesens oder ihrer Natur und im Gefolge einer luziferischen Verderbnis jenes Laster schlechthin hervorbringen, welches der Hochmut ist. Daher die Mehrdeutigkeit des Begriffs der »Intelligenz« in den religiösen Moralvorstellungen und die Betonung einer ausdrücklich außerintellektuellen und dadurch ihrerseits mehrdeutigen und gefährlichen Demut, denn »es gibt kein größeres Recht als das der Wahrheit«.
✵
Auf die Frage, ob es besser sei, Intelligenz zu besitzen oder einen guten Charakter, antworten wir: einen guten Charakter. Warum? Weil man, wenn man diese Frage stellt, nie an die[13] vollständige Intelligenz denkt, welche ihrem Wesen nach die Selbsterkenntnis mit einschließt; umgekehrt schließt ein guter Charakter immer ein Element der Intelligenz mit ein, selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass die Tugend echt und nicht durch einen tiefer liegenden Hochmut beeinträchtigt ist, wie dies beim »Eifer der Bitternis« der Fall ist. Der gute Charakter öffnet sich der Wahrheit,8 genauso wie die ihrem Wesenskern treue Intelligenz in die Tugend einmündet; wir könnten auch sagen, dass die sittliche Vollkommenheit mit dem Glauben übereinstimmt, dass sie deshalb kein sozialer Perfektionismus ohne geistigen Gehalt sein kann.
Wenn das Erkenntnisvermögen darin besteht, zwischen dem Wesentlichen und dem Zweitrangigen zu unterscheiden, und wenn es infolgedessen die Fähigkeit mit sich bringt, Umstände zu erfassen und sich ihnen anzupassen, dann wird derjenige Mensch konkret intelligent sein, der den Sinn des Lebens und dadurch auch den des Todes erfasst; das heißt, dass das Bewusstsein des Todes das Gebaren des Lebens bestimmen muss, genauso wie, a priori, das Bewusstsein ewiger Werte Vorrang vor zeitlichen Werten hat. Wenn man uns fragt: Was beweist die Wirklichkeit ewiger Werte? – und wir schweifen hier von unserem Hauptgegenstand ab –, dann antworten wir: Unter anderem ist es das Phänomen der Intelligenz selbst, das tatsächlich unerklärbar – weil ohne zureichenden Grund – wäre ohne seine tiefsten oder erhabensten Inhalte. Wir haben hier das ganze Mysterium des Phänomens der Subjektivität vor uns liegen, das so merkwürdig unverstanden ist von der Moderne, [14] wohingegen es doch gerade ein unwiderlegbares Zeichen für die nicht-materielle Wirklichkeit und die Transzendenz ist.
✵
Die evolutionistischen Rationalisten sind der Meinung, dass Aristoteles als Vater der Logik ipso facto Vater der schlussendlich reif und wirksam gewordenen Intelligenz sei; sie beachten offensichtlich nicht, dass dieses Aufblühen einer Disziplin des Denkens, so verdienstvoll sie auch sein mag, mehr oder weniger mit einem Abnehmen, ja sogar einer Verkümmerung der geistigen Intuition Hand in Hand geht. Die Engel, so sagt man, besitzen keinen Verstand, denn sie bedürfen des schlussfolgernden Denkens nicht; dieses Bedürfen setzt nämlich voraus, dass der Geist, der nicht mehr »sieht«, gezwungen ist »herumzutasten«.
Man könnte einwenden, dass die größten Metaphysiker, somit die größten intuitiven Intellektuellen, vom schlussfolgernden Denken Gebrauch gemacht haben; zweifellos, aber dies betraf nur ihre – für andere bestimmte – Argumentationsweise und nicht ihre reingeistige Schau an sich. Man muss hier allerdings einen Vorbehalt machen: Da die intellektuelle Intuition nicht a priori alle Seiten des Wirklichen umfasst, kann das schlussfolgernde Denken die Aufgabe haben, mittelbar eine »Schau« einer bestimmten Seite hervorzurufen; in diesem Fall wirkt das schlussfolgernde Denken aber nur als Gelegenheitsursache, es ist kein wesentlicher Bestandteil der Erkenntnis. Man wird uns vielleicht sagen, dass das schlussfolgernde Denken bei jedem beliebigen Denker eine überrationale Intuition bewirken kann; das trifft grundsätzlich zu, tatsächlich aber ist es viel wahrscheinlicher, dass sich eine derartige Intuition nicht ereignet, gibt es doch in der weltlichen Denkweise nichts, was dafür empfänglich wäre, um es vorsichtig auszudrücken.
[15]Bei den vorhergehenden Betrachtungen zielen wir nicht auf Aristoteles ab, wir tadeln nur diejenigen, welche glauben, dass er die Intelligenz für sich gepachtet habe, und welche die einfache Logik mit der Intelligenz an sich verwechseln, etwas, woran Aristoteles niemals gedacht hätte.9 Dass die Logik für den irdischen Menschen nützlich oder notwendig sein kann, ist ganz offensichtlich, es ist aber auch offensichtlich, dass nicht sie es ist, die unmittelbar und zwangsläufig zur Erkenntnis führt; was nicht heißen kann, dass das Unlogische berechtigt sei oder dass das Überrationale mit dem Sinnwidrigen übereinstimme. Wenn man einwenden würde, dass es in der Mystik und sogar in der Theologie eine fromme Sinnwidrigkeit gebe, würden wir antworten, dass diese hier nur »funktionell« ist – etwa so wie beim Kôan im Zen –, und dass man die tieferliegenden Absichten eingehend untersuchen muss, um den argumentativen Mitteln gerecht zu werden; auf dieser Ebene kann man wohl sagen: »Der Zweck heiligt die Mittel«.
Sonderbar ist, dass der religiöse Dogmatismus zwar durch seine im Kern allgültigen Wahrheiten auf die Intelligenz anregend wirkt, dass er sie aber trotzdem durch seine Begrenztheiten lähmt; die anthropomorphistischen Theologien können sich nämlich Sackgassen und Widersprüchen nicht entziehen, und zwar deshalb, weil sie gezwungen sind, die Vielschichtigkeit der metaphysischen Wirklichkeit mit einem persönlichen Gott zu verbinden, also einer alleinigen Subjektivität, die als solche diese Vielschichtigkeit nicht übernehmen kann.
[16]✵
Einige Worte über die Gnosis drängen sich hier auf, da wir über die Intelligenz sprechen und da die Gnosis der Weg des Intellekts ist. Wir sagen »Gnosis« und nicht »Gnostizismus«, weil dieser ein weitgehend heterodoxer mythologischer Dogmatismus ist, während die echte Gnosis nichts anderes ist als das, was die Hindus unter Jñâna und Advaita-Vedânta verstehen; zu behaupten, die gesamte Gnosis sei falsch wegen des Gnostizismus, hieße dementsprechend mit anderen Worten, dass alle Propheten falsch seien, weil es falsche Propheten gibt.
Für allzu viele Menschen ist der Gnostiker derjenige, der sich, weil er sich durch das Innere und nicht durch die Offenbarung erleuchtet fühlt, für einen Übermenschen hält und glaubt, ihm sei alles erlaubt; man wird jedwedes politische Monster der Gnosis bezichtigen, das abergläubisch ist oder das verschwommene okkultistische Interessen hat und dabei glaubt, von einer Mission im Namen irgendeiner abwegigen Philosophie erfüllt zu sein. Mit einem Wort: Die Gnosis gleicht in der allgemeinen Meinung dem »intellektuellen Hochmut«, als wäre das kein Widerspruch in sich, stimmt doch die reine Intelligenz gerade mit der Objektivität überein, und schließt doch diese vom Wortsinn her jeglichen Subjektivismus aus, somit insbesondere den Hochmut, der dessen unintelligenteste und gröbste Form ist.
Wenn es einen »gnostizistischen« oder pseudognostischen Satanismus gibt, dann gibt es auch einen antignostischen Satanismus, und dieser besteht in dem bequemen und unredlichen Vorurteil, überall die Gnosis zu sehen, wo der Teufel ist; es ist diese Manie – die streng genommen der »Sünde wider den Heiligen Geist« gleichkommt –, für die der Befehl Christi gilt, nicht »Perlen vor die Säue zu werfen und das Heilige den Hunden zu geben«. Denn wenn es im menschlichen Bereich [17]Perlen und Heiliges gibt, dann sicher seitens des Intellekts, welcher nach Meister Eckhartaliquid increatum et increabile ist, somit etwas Göttliches, was gerade die Vorkämpfer der frommen Oberflächlichkeit und des militanten Fanatismus ärgert und stört.
Die vorangehenden Überlegungen ermöglichen es uns, zu einem spezielleren Thema überzugehen, das sich aber gleichwohl auf ähnliche Vorstellungen bezieht. Die Esoterik, die mit der Gnosis übereinstimmt, sieht sich de facto drei gegnerischen Kräften gegenübergestellt: ganz offensichtlich dem Teufel, da er ja gegen alles ist, was geistig ist, aber auch, in ganz anderer Weise, der Exoterik, die, wiewohl sie ihre Daseinsberechtigung besitzt, eine begrenzte Sichtweise darstellt; und schließlich, was besonders schwerwiegend ist, einer Verbindung der beiden erwähnten Faktoren. Im letzten Fall geht der Angriff auf die Gnosis einher mit der Entwertung der Religion; nun wäre dieses ungeheuerliche stillschweigende Einvernehmen nicht möglich, wenn es nicht eine gewisse Unvollkommenheit im konfessionellen Standpunkt selbst gäbe, was im Übrigen auf ihre Weise die Torheiten und die Verbrechen beweisen, die im Namen der Religion begangen werden; die Konfessionen sind unvermeidlicherweise – oder der Vorsehung entsprechend, wenn man so will – an der Unvollkommenheit der menschlichen Gemeinschaften beteiligt, an die sie sich in diesem »finsteren Zeitalter« richten.10
Einerseits kann die Esoterik die Religion weiterführen, wenn man sie hinsichtlich ihrer metaphysischen und mystischen Sinnbildlichkeit ins Auge fasst, andererseits aber muss sie der Religion widersprechen, insofern diese nur eine einschränkende Anpassung ist, denn »es gibt kein größeres Recht als das der Wahrheit«. Es ist unmöglich, das Verhältnis [18] der exoterischen und der esoterischen Seite der Überlieferung ganz zu verstehen, ohne sich dieser beiden einander widersprechenden, aber in der Natur der Dinge verankerten und folglich einander ergänzenden Punkte11 bewusst zu sein.
All diese Betrachtungen sind in unserem allgemeinen Zusammenhang dadurch gerechtfertigt, dass die volle Esoterik der Weg der intellektuellen Erkenntnis ist, also der der Intelligenz, während die Exoterik der Weg der »schlichten Zustimmung zu Glaubenssätzen« oder der des »tiefen Glaubens« ist, was nicht ohne Auswirkung auf die metaphysischen Spekulationen in einem derartigen Umfeld bleiben kann. Der Glaube, der vor allem durch die Semiten vertreten wird, schreibt uns vor, »an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde« zu glauben; die intellektuelle Erkenntnis dagegen, vertreten vor allem durch die Arier, enthüllt uns, dass »allein Brahma wirklich ist, dass die Welt nur äußerer Schein ist und dass die Seele nichts anderes ist als Brahma allein«. Dieser Unterschied der Sichtweisen kann nicht verhindern, dass der Glaube notwendigerweise ein Element intellektueller Erkenntnis enthält, während die intellektuelle Erkenntnis ihrerseits notwendigerweise ebenfalls ein Element des Glaubens enthält.
✵
Doch kehren wir nun zum Abschluss zur Frage der Intelligenz im Allgemeinen zurück. Man darf nicht den Missbrauch der Intelligenz mit dieser selbst verwechseln, einen [19]Missbrauch, wie er im klassischen Griechenland, in der Renaissance, im Zeitalter der Aufklärung, im neunzehnten und, mit neuen und wenig erfreulichen Begleiterscheinungen, im zwanzigsten Jahrhundert aufgetreten ist; der menschliche Geist hat das Recht, schöpferisch zu sein nur in dem Maße, wie er beschaulich ist, und wenn er diese Eigenschaft hat, wird er das zur Kenntnis nehmen, was »ist«, bevor er sich mit dem beschäftigt, was »sein kann«.