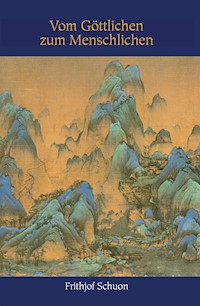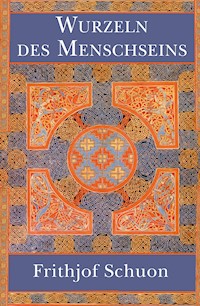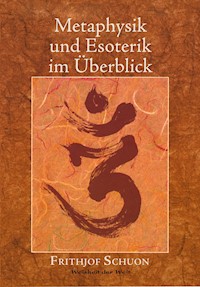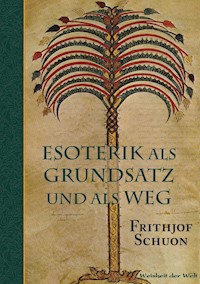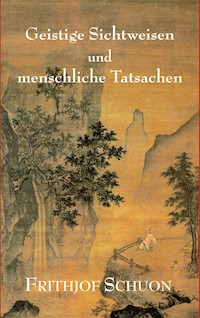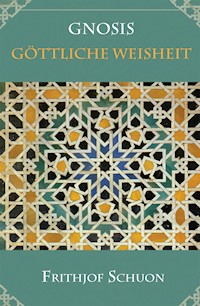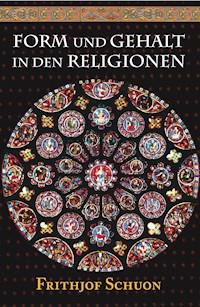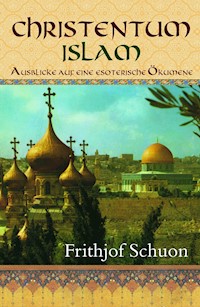
21,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Als Mutter aller Propheten und als Quellgrund aller heiligen Formen hat die Heilige Jungfrau ihren Ehrenplatz im Islam, auch wenn sie a priori zum Christentum gehört; deshalb bildet sie eine Art Bindeglied zwischen diesen beiden Religionen, denen gemeinsam ist, dass sie dem Monotheismus Israels Allgemeingültigkeit verleihen wollen.« - Frithjof Schuon (1907-1998) wird in weiten Teilen der Welt als einer der bedeutendsten religionsphilosophischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Er gilt als führender Vertreter jener Denkrichtung, die Sophia perennis (»immerwährende Weisheit«) genannt wird, und welche die zeitlosen und überall gültigen Grundsätze enthält, die den verschiedenen Lehren, den Sinnbildern, der heiligen Kunst und den geistigen Übungen der Weltreligionen zugrunde liegen. In diesem Werk vergleicht Frithjof Schuon das Christentum und den Islam und betrachtet auch Bekenntnisse innerhalb dieser Weltreligionen: den Protestantismus, die Orthodoxie und den Schiismus. Dabei vermeidet er oberflächliche Gleichsetzungen im Bereich der Exoterik; innere Einheit kann es nur im Herzen der Religionen geben, in deren Esoterik. Das Buch wendet sich an Menschen, die auf der Suche nach einem geistig fundierten Verständnis der Welt und ihres eigenen Lebens sind, einem Verständnis, das über die Antworten hinausgeht, welche die modernen Wissenschaften oder die nur exoterisch verstandenen Religionen geben können. Es vermag zu befreienden Einsichten und tiefer Gewissheit zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Deutschsprachige Bücher von Frithjof Schuon
Philosophische Werke
Leitgedanken zur Urbesinnung. Zürich 1935; Freiburg 1989, 2009
Das Ewige im Vergänglichen. Weilheim 1970; München 1984
Von der inneren Einheit der Religionen. Interlaken 1981; Freiburg 2007
Den Islam verstehen. München 1988, 1991, 2002. Freiburg 1993
Schätze des Buddhismus. Norderstedt 2007
Esoterik als Grundsatz und als Weg. Hamburg 2012
Metaphysik und Esoterik im Überblick. Hamburg 2012
Logik und Transzendenz. Hamburg 2013
Geistige Sichtweisen und menschliche Tatsachen. Hamburg 2013
Wurzeln des Menschseins. Hamburg 2014
Gnosis – Göttliche Weisheit. Hamburg 2015
Vom Göttlichen zum Menschlichen. Hamburg 2015
Form und Gehalt in den Religionen. Hamburg 2017
Das Spiel der Masken. Hamburg 2018
Gedichte
Sulamith. Bern 1947
Tage- und Nächtebuch. Bern 1947
Glück. Freiburg 1997
Leben. Freiburg 1997
Liebe. Freiburg 1997
Sinn. Freiburg 1997
Perlen des Pilgers. Düsseldorf 2000
Sinngedichte. Bd. 1 – 10. Sottens 2001 – 2005
Frithjof Schuon
Christentum – Islam
Ausblicke auf eine esoterische Ökumene
Übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von
Wolf Burbat
WEISHEIT DER WELT
© World Wisdom Books
Titel des französischen Originales: Christianisme/Islam: Visions d’Œcuménisme ésotérique
Milano, Archè, 1981
Aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von Wolf Burbat
Umschlagbild: Maria-Magdalena-Kirche und Felsendom in Jerusalem
WEISHEIT DER WELT ist das deutschsprachige Imprint von
World Wisdom, Inc.,P.O. Box 2682, Bloomington, Indiana 47402-2682www.worldwisdom.com
Verlag & Druck: tredition GmbH
ISBN 978-3-7469-5731-9 (Paperback)
978-3-7469-5732-6 (e-Book)
www.tredition.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorbemerkung des Übersetzers
CHRISTENTUM
Am Rande liturgischer Improvisationen
Das Rätsel der Epiklese
Die Frage des Protestantismus
Die geistigen Tugenden nach dem heiligen Franz von Assisi
PROBLEME IM ZWISCHENBEREICH
Das Problem verschiedenartiger Moralvorstellungen
Die Aufeinanderfolge der drei semitischen Religionen
ISLAM
Die Vorstellung des »Besten« in den Religionen
Bilder des Islam
Dilemmas der muslimischen Scholastik
Das Paradies als Theophanie
Atomismus und Schöpfung
Über das göttliche Wollen
ANHANG
Anmerkungen des Übersetzers
Glossar
Index
Frithjof Schuon
Vorbemerkung des Übersetzers
Wir freuen uns, mit diesem Buch die zehnte Übersetzung eines Werkes von Frithjof Schuon in deutscher Sprache vorlegen zu können. Schuon (1907–1998) wird in weiten Teilen der Welt als einer der bedeutendsten religionsphilosophischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Er besaß einen außerordentlichen Überblick über die religiösen Überlieferungen der Menschheit, konnte die Vielfalt der Erscheinungen bis in ihre Tiefe durchdringen und seine Erkenntnisse in meisterhafter, oft dichterischer Sprache ausdrücken. Er gilt als führender Vertreter jener Denkrichtung, die Sophia perennis, Philosophia perennis oder Religio perennis – also immerwährende Weisheit, immerwährende Philosophie oder immerwährende Religion – genannt wird, welche die zeitlosen und überall gültigen Grundsätze enthält, die den verschiedenen Lehren, den Sinnbildern, der heiligen Kunst und den geistigen Übungen der Weltreligionen zugrundeliegen.
Die französische Originalausgabe des vorliegenden Buches erschien 1981 unter dem Titel Christianisme/Islam: Visions d’Œcuménisme ésotérique; im gleichen Jahr wurde unter dem Titel Christianity/Islam: Essays on Esoteric Ecumenism eine Übersetzung ins Englische veröffentlicht, 2008 folgte eine neue amerikanische Übersetzung unter dem Titel Christianity/Islam: Perspectives on Esoteric Ecumenism.
Frithjof Schuon, dessen erstes Buch den Titel Von der inneren Einheit der Religionen trägt, wird oft als Vertreter dieser Einheit angesehen; er hat aber immer wieder auch auf die – notwendige – Verschiedenheit der Religionen hingewiesen. Im vorliegenden Werk widmet sich der Verfasser insbesondere dem Vergleich von Christentum und Islam sowie unterschiedlicher Bekenntnisse innerhalb dieser Religionen.
In seinen Büchern geht es Schuon nicht darum, für den Islam oder für irgendeine andere Religion zu werben; wofür er eintritt, ist die Sophia perennis. Er sah es aber als notwendig an, insbesondere jenen seiner Leser, die sich für die islamische Esoterik interessierten, auch solche Seiten der islamischen Exoterik verständlich zu machen, die für westliche Menschen schwerer zu verstehen sind. Die den Islam betreffenden Kapitel sagen aber nicht nur etwas über den Islam selbst aus, sondern auch ganz allgemein etwas über den möglichen Umgang der Esoterik mit einer Exoterik.
Hinsichtlich der im Untertitel genannten »esoterischen Ökumene« sei darauf hingewiesen, dass sich Schuon bezüglich des »interreligiösen Dialogs« zurückhaltend verhielt, weil dieser sich oft auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner ethischer Vorstellungen beschränke. In einem Brief schreibt er: »Die Unterschiede zwischen den Religionen beruhen nicht nur auf dem mangelnden Verständnis der Menschen, sondern auch auf den Offenbarungen, somit auf dem göttlichen Willen. […] Doch wenn Gott die heiligen Schriften offenbart, offenbart er gleichzeitig auch die Schlüssel für die ihnen zugrunde liegende Einheit. […] Das große Übel besteht nicht darin, dass Angehörige unterschiedlicher Religionen einander nicht verstehen, sondern darin, dass – aufgrund des Einflusses des Denkens der Moderne – zu viele Menschen nicht mehr gläubig sind. Es ist daher vordringlich, 1. dass die Menschen zu ihrem Glauben zurückkehren, ganz gleich, welcher Religion sie angehören, wenn diese nur in ihrem Kern lehrrichtig ist, und ganz unabhängig von der Ächtung der Religionen untereinander; und 2. dass diejenigen, welche die Fähigkeit besitzen, die reine Metaphysik, die Esoterik und die innere Einheit der Religionen zu verstehen, diese Wahrheiten finden und die notwendigen inneren und äußeren Schlüsse ziehen. Und deshalb schreibe ich Bücher.«
Obwohl Deutsch seine erste Muttersprache war, hat Schuon seine metaphysischen Werke auf Französisch verfasst, einer Sprache, die sich aufgrund ihres lateinischen Ursprungs und ihres unzweideutigen Wortschatzes hierfür besonders gut eignet. Schuon liebte die deutsche Sprache sehr und bestand darauf, sie weitgehend von Fremdwörtern freizuhalten. Dem haben wir in der vorliegenden Übersetzung Rechnung zu tragen versucht; so wird der Leser einige mittlerweile selten gewordene Wörter wie »Geistigkeit« statt »Spiritualität«, »Anblick« oder »Gesichtspunkt« statt »Aspekt«, »Sammlung« statt »Konzentration« und dergleichen mehr finden. Als Muster hat uns hierbei Schuons eigene Übertragung seines ersten Hauptwerkes De l’unité transcendante des religions (1948) ins Deutsche gedient.
Andererseits war es unumgänglich, eine Reihe von Fremdwörtern zu benutzen, seien es philosophische Fachausdrücke oder Begriffe aus einer Vielzahl von Überlieferungen; diese Begriffe aus dem Sanskrit, dem Griechischen, dem Lateinischen und dem Arabischen wurden in einem Glossar im Anhang des Buches zusammengestellt, übersetzt und erklärt.
Weiterhin haben wir im Anhang nach Seitenzahl geordnete »Anmerkungen des Übersetzers« zusammengestellt, in denen Textstellen erläutert werden, die auf überlieferte theologische Lehren, wichtige Philosophen oder geistige Meister sowie heilige Schriften der Weltreligionen anspielen.
ERSTER TEIL
CHRISTENTUM
Am Rande liturgischer Improvisationen
Man kann die Liturgie auf zweierlei Weise betrachten: Entweder glaubt man, die ursprüngliche Einfachheit der Riten vor jeglicher störenden Hinzufügung bewahren zu müssen, oder man ist im Gegenteil der Ansicht, die liturgische Ausschmückung sei ein Gewinn, zumindest für die Ausstrahlung der Riten, wenn nicht sogar für deren Wirksamkeit, und sie sei aufgrund dessen eine Gabe Gottes. Der Standpunkt der Einfachheit kann – nicht zu Unrecht – geltend machen, dass die rabbinische Überlieferung außerordentlich viele Praktiken und Gebete zur mosaischen Religion hinzugefügt hatte und dass Christus, der Wortführer der Innerlichkeit, all diese Vorschriften abgeschafft und lange und komplizierte mündliche Gebete untersagt hat, denn er wollte, dass man sich Gott »im Geist und in der Wahrheit« zuwende. Die Apostel fuhren auf diese Weise fort, genauso wie die Wüstenväter; nach und nach aber musste die Anbetung »im Geist und in der Wahrheit« immer zahlreicher werdenden Vorschriften weichen, ohne dass eine Möglichkeit die andere ausgeschlossen hätte;1 so kam es zur Geburt der Liturgie. In der Frühzeit war diese Liturgie recht einfach und wurde nur in Domen in der Umgebung des Bischofs und allein am Vorabend großer Feste gefeiert, »weil man die Gläubigen beschäftigen musste, die gekommen waren, um Stunden in der Kirche zu verbringen, die aber nicht mehr wussten, wie man beten sollte«, wie uns ein Ordensgeistlicher gesagt hat, der etwas davon zu verstehen schien. Die Liturgie wurde dann von Mönchen übernommen, die sie aus Eifer täglich feierten; die Liturgie des heiligen Benedikt war noch recht einfach, sie wurde aber im Lauf der Zeit durch ständige Ergänzungen komplizierter und immer überladener.
Um eine zugleich genaue und differenzierte Vorstellung von der Liturgie zu haben, muss man den folgenden wesentlichen Gegebenheiten Rechnung tragen: Wenn die Entwicklung der Liturgie teilweise das Ergebnis von negativen Faktoren wie der Verschlechterung der Geistigkeit einer immer zahlreicher werdenden Gemeinschaft ist, dann ist sie vor allem durch die ganz unvermeidliche Sorge um die Anpassung an neue Bedingungen bestimmt; und diese Anpassung – oder dieses Aufblühen einer spürbaren Sinnbildlichkeit – ist an sich etwas durchaus Positives und steht der reinsten Beschaulichkeit in keiner Weise im Wege. Es gibt indessen zwei Elemente, die unterschieden werden müssen, nämlich einerseits die Sinnbildlichkeit von Formen und Handlungen und andererseits gewisse sprachliche Erweiterungen: Zweifellos ist beides sinnvoll, es liegt jedoch in der Natur der Sinnbildlichkeit von Formen, die Mitwirkung des Heiligen Geistes auf unmittelbarere und unanfechtbarere Weise zu offenbaren, unterliegt doch die Lehre eines reinen Sinnbildes nicht den Begrenzungen des sprachlichen Ausdrucks im Allgemeinen noch der frommen Weitschweifigkeit im Besonderen.2 Was die Zweckdienlichkeit sprachlicher Hinzufügungen betrifft, so muss man auch die zunehmende Notwendigkeit bedenken, den immer zahlreicheren oder wahrscheinlicher werdenden Irrlehren entgegenzutreten oder ihnen vorzubeugen.
Die ersten Christen nannten sich selbst »Heilige«, und das aus gutem Grund: Es gab in der ursprünglichen Kirche eine Atmosphäre der Heiligkeit, die zweifellos gewisse Ungeordnetheiten nicht verhindern konnte, die aber in jedem Fall bei der Mehrheit überwog; der Sinn für das Heilige lag gewissermaßen in der Luft. Jene gleichsam gemeinschaftliche Heiligkeit verschwand recht schnell – und ganz natürlicherweise, denn der Mensch des »dunklen Zeitalters« ist, was er nun einmal ist –, vor allem wegen der zunehmenden Zahl der Gläubigen; es wurde dann notwendig, die Gegenwart des Heiligen spürbarer zu machen, einesteils damit die Menschen von immer weltlicherer Gesinnung die Erhabenheit der Riten nicht aus dem Blick verlören und andernteils damit der Zugang zu diesen Riten nicht allzu abstrakt würde, wenn man so sagen darf. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es etwas derartiges im Islam nicht gibt, in dem das Mysterium nicht auf gleichsam materielle Weise in den exoterischen Bereich eindringt;3 der Mahâyâna-Buddhismus weist dagegen eine liturgische Entwicklung auf, die derjenigen des Christentums ähnelt; in diesen beiden Fällen beschränkt sich die Liturgie nicht auf ein schlichtes Zugeständnis an die Schwachheit des Menschen, sie hat zugleich, und im Übrigen durch die Natur der Dinge, den inneren Wert einer spürbaren Kristallisierung des Übernatürlichen.
Der erste der beiden Gesichtspunkte, die wir miteinander verglichen haben, jener der ursprünglichen Einfachheit, ist in dem Sinne berechtigt, als der Beschauliche und der Asket ohne irgendeinen liturgischen Rahmen auskommen können – auch wenn sie dies nicht immer wollen – und als sie ganz offensichtlich lieber die Heiligkeit von Menschen sehen würden als die von rituellen Formen, insoweit diese Alternative sich überhaupt stellt; dagegen ist der zweite Gesichtspunkt, jener der liturgischen Ausdifferenzierung, deshalb berechtigt, weil die Sinnbildlichkeit berechtigt ist und auch aufgrund von Erfordernissen neuer Umstände.
Einer der größten Irrtümer unserer Zeit, zumindest auf religiösem Gebiet, ist es zu glauben, man könne eine Liturgie erfinden, die alten Liturgien seien Erfindungen oder die in frommer Gesinnung hinzugefügten Elemente seien dies; das heißt, Eingebung mit Erfindung zu verwechseln,4 das Heilige mit dem Profanen, heiligmäßige Seelen mit Amtsstuben und Ausschüssen. Ein weiterer nicht minder gefährlicher Irrtum ist es zu glauben, man könne ein oder zwei Jahrtausende überspringen und man könne wieder zur Einfachheit – und zur Heiligkeit – der ursprünglichen Kirche zurückkommen; nun ist hier aber ein Grundsatz des Wachstums oder der Struktur zu beachten, denn ein Zweig kann nicht wieder zur Wurzel werden. Man muss die ursprüngliche Einfachheit anstreben und dabei ihre Unvergleichbarkeit anerkennen und nicht glauben, man könne durch äußerliche Maßnahmen und oberflächliche Einstellungen wieder zu ihr zurückkehren; man muss versuchen, die ursprüngliche Reinheit auf der Grundlage der vorsehungsmäßig ausgearbeiteten Formen zu verwirklichen, und nicht auf jener einer unwissenden und respektlosen Bilderstürmerei; und man muss sich vor allem davor hüten, in die Riten eine schulmeisterhafte und platte Verstehbarkeit einzuführen, die eine Beleidigung für die Intelligenz der Gläubigen ist.
✵
Bezüglich der Frage der liturgischen Sprachen wären die folgenden Bemerkungen zu machen. Der Wert dieser Sprachen ist objektiv und keine Angelegenheit subjektiver Einschätzung, das heißt, es gibt Sprachen von sakralem Charakter, und sie haben diesen Charakter entweder von Natur aus oder durch Adoption: Der erste Fall ist der von Sprachen, in denen der Himmel gesprochen hat, und von Schriften – Alphabeten oder Ideogrammen –, die er eingegeben oder bestätigt hat; der zweite Fall ist der von immer noch edlen Sprachen, die dem Gottesdienst geweiht worden sind, wie das Armenische oder das Slawische. Heutzutage möchte man uns glauben machen, dass die liturgischen Sprachen veraltet seien, dass sie durch profane und moderne Idiome ersetzt werden müssten, weil die Leute offensichtlich die liturgische Sprache nicht mehr verstünden und sie folglich nicht mehr wünschten; nun ist aber, abgesehen davon, dass dieser Schluss falsch ist – und die Leute im Übrigen nie gefragt worden sind –, das Wenigste, was man von Gläubigen verlangen kann, ein Mindestmaß an Interesse und Achtung, das notwendig ist, um die gebräuchlichen liturgischen Formeln zu erlernen und die, welche sie nicht verstehen, klaglos hinzunehmen; eine Zustimmung zu einer Religion, die eine Popularisierung, übertriebene Einfachheit und damit Plattheit zur Bedingung macht, ist jedenfalls ganz ohne Wert.5
Alle alten Sprachen sind zwangsläufig edel oder aristokratisch: Nichts an ihnen kann banal sein,6 ist Banalität doch das Ergebnis von Individualismus, Weltlichkeit und demokratischer Gesinnung. Die modernen Sprachen sind wohlgemerkt nicht ungeeignet, höhere Wahrheiten auszudrücken, sie sind aber aufgrund ihres zu analytischen Charakters und ihrer in gewisser Hinsicht zu geschwätzigen und auch zu gefühlsbetonten Art ungeeignet zum sakralen Gebrauch;7 für den sakralen Gebrauch ist ein synthetischeres und unpersönlicheres Idiom erforderlich. Um gewissen Einwänden vorzubeugen, möchten wir darauf hinweisen, dass das nichtklassische Latein, auch wenn es nicht mehr die Sprache von Cäsar ist, dennoch keine Umgangssprache ist wie die verschiedenen von ihr abgeleiteten Idiome; es ist letztendlich eine Sprache, die, auch wenn sie nicht gänzlich durch die Formkraft des Christentums umgestaltet wurde, doch zumindest an es angepasst und durch es stabilisiert und möglicherweise durch die deutsche Seele beeinflusst wurde, die bildmächtiger und weniger kühl als die romanische Seele ist. Im Übrigen ist das klassische Latein Ciceros nicht frei von willkürlichen Beschränkungen im Vergleich mit der alten Sprache, von der gewisse Werte in der Volkssprache überdauert haben, sodass das aus der Verschmelzung zweier Sprachen hervorgegangene nichtklassische Latein nicht einfach eine durch einen Mangel geprägte Erscheinung ist.
Im Mittelalter wurde die europäische Geistigkeit im Rahmen des Lateinischen ausgeübt;8 mit der Abschaffung des Lateinischen prägte das Geistesleben mehr und mehr die Dialekte, sodass die aus ihm hervorgegangenen modernen Sprachen einerseits anpassungsfähiger und intellektualistischer und andererseits abgestumpfter und profanisierter sind als die mittelalterlichen Sprachen. Nun ist aber vom Standpunkt des sakralen Gebrauchs das Entscheidende nicht philosophische Anpassungsfähigkeit und auch nicht psychologische Komplexität – beides im Übrigen ganz relative Faktoren –, sondern jener Charakter der Einfachheit und Nüchternheit, der allen nicht-modernen Sprachen eigen ist; und es bedarf der ganzen mangelnden Sensibilität und des ganzen Narzissmus des zwanzigsten Jahrhunderts, um zu meinen, dass die heutigen Sprachen des Westens, oder irgendeine unter ihnen, in ihrem Wesen und geistig älteren Sprachen überlegen seien, oder dass ein liturgischer Text praktisch dasselbe sei wie eine Doktorarbeit oder ein Roman.
Das heißt nicht, dass nur die modernen europäischen Sprachen ungeeignet für den sakralen Gebrauch sind: Der sich seit mehreren Jahrhunderten beschleunigende allgemeine Verfall der Menschheit hat außerhalb des Westens die Wirkung gehabt, bestimmte Idiome am Rande heiliger Sprachen, die sie begleiten, zu verderben; der Grund dafür ist nicht eine Trivialisierung auf ideologischer und literarischer Grundlage, wie es in den westlichen Ländern der Fall ist, sondern einfach ein naiver Materialismus auf der Ebene der Tatsachen, der nicht philosophisch ist, aber trotzdem der Dumpfheit und der Verflachung, möglicherweise sogar der Vulgarität Vorschub leistet. Dieses Phänomen tritt zweifellos nicht überall auf, aber es gibt es, und wir müssen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen; was gesprochene Sprachen anlangt, die nicht einem derartigen Verderb unterworfen waren, so haben sie zumindest viel von ihrem alten Reichtum verloren, ohne aber damit zwangsläufig für den liturgischen Gebrauch ungeeignet geworden zu sein.
Die Ausdifferenzierung der Liturgie hängt einesteils vom Genius der Religion ab und andernteils von den Völkern, für die sie bestimmt ist; sie ist von der Vorsehung bestimmt wie die Lage und die Form von Zweigen an einem Baum, und es ist zumindest unangemessen, sie mit einer kurzsichtigen rückwärtsgewandten Logik9 zu kritisieren und sie richtig stellen zu wollen, als wäre sie nur eine Aufeinanderfolge von Zufälligkeiten. Wenn die lateinische Kirche eine Daseinsberechtigung hat, dann ist die lateinische Sprache ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer Natur oder ihres Genius.
✵
In Verbindung mit der Liturgie wie auch sonst beruft man sich heute gerne auf das zumindest fragliche Recht »unserer Zeit«; dieser Tabubegriff bedeutet, dass Dinge, denen das Unglück geschieht, sich in dem zu befinden, was uns heute als »Vergangenheit« erscheint, ipso facto »veraltet« und »überholt« sind; und dass dagegen Dinge, die sich in dem befinden, was uns subjektiv als »Gegenwart« erscheint – oder genauer, Dinge, die man willkürlich mit »unserer Zeit« gleichsetzt, als würde es andere zeitgenössische Erscheinungen nicht geben oder als würden sie sich in einem anderen Zeitalter befinden –, dass diese ganze willkürlich begrenzte Aktualität als ein »kategorischer Imperativ« dargeboten wird, dessen Bewegung »unumkehrbar« sei. Was unserer Zeit in Wirklichkeit eine Bedeutung gibt, ist die Gesamtheit der folgenden Gegebenheiten: erstens, der fortschreitende Niedergang der menschlichen Art, entsprechend dem Gesetz der Weltzeitalter; zweitens, die fortschreitende Anpassung der Religion an die Gemeinschaft als solche; drittens, die Anpassung an betroffene ethnische Gruppen; viertens, die qualitativen Schwankungen der überlieferungsmäßigen Gemeinschaft, die sich mit den Zeitläuften auseinandersetzen muss. All das, was man als Erklärung über »die Zeit« sagen kann, bezieht sich auf einen dieser Faktoren oder auf ihre verschiedenen Verbindungen.
Was die Anpassung einer noch jungen Religion an eine gesamte Gesellschaft betrifft, meinen wir damit ihren Übergang vom Zustand der »Katakomben« zu dem einer Staatsreligion; es ist völlig falsch zu behaupten, allein der erste sei normal und der zweite – der »konstantinische«, wenn man so will – sei lediglich eine unrechtmäßige, heuchlerische, ungläubige Versteinerung; denn eine Religion kann nicht für immer in der Wiege bleiben, sie ist wesensgemäß dazu bestimmt, eine Staatsreligion zu werden und folglich die – keineswegs heuchlerischen, sondern einfach wirklichkeitsgemäßen – Anpassungen hinzunehmen, die diese neue Lage erforderlich macht. Sie kann nicht umhin, ein Bündnis einzugehen mit der Macht, natürlich unter der Bedingung, dass die Macht sich ihr unterwirft; in diesem Fall ist es angebracht, zwischen zwei Kirchen zu unterscheiden: der institutionellen Kirche, die als göttliche Institution unwandelbar ist, und der menschlichen Kirche, die zwangsläufig politisch ist, da sie mit der Gemeinschaft insgesamt verbunden ist, sonst besäße sie keine irdische Daseinsberechtigung als große Religion. Auch wenn man einräumt, dass diese Staatskirche schlecht sein mag – und sie ist dies zwangsläufig in dem Maße, wie die Menschen es sind –, bedarf die heilige Kirche ihrer, um in Raum und Zeit überleben zu können; aus dieser an die Menschen und an den Kaiser gebundenen Kirche geht jene qualitative Fortsetzung der Urkirche hervor, welche die Kirche der Heiligen ist. Und diesem Übergang von der »Katakombenkirche« zur »konstantinischen« Kirche entspricht unweigerlich eine liturgische und theologische Neuanpassung, denn man kann die Gesamtgesellschaft nicht so ansprechen wie eine Handvoll Mystiker.
Wir haben auch die Anpassung an vorsehungsmäßige Volksgruppen erwähnt, welche im Falle des Christentums grosso modo – nach den Juden – die Griechen, die romanischen Völker, die Germanen, die Kelten, die Slawen und eine kleine Minderheit im Nahen Osten sind. Auch hier ist es falsch, von »Zeit« zu sprechen, geht es doch um Faktoren, die nicht von einem Zeitalter als solchem abhängen, sondern von einer natürlichen Entwicklung, die in verschiedenen Zeitaltern verlaufen kann. Theologische und liturgische Formen sind offensichtlich durch Mentalitäten von Völkern bedingt, insofern sich die Frage einer Verschiedenartigkeit in diesem Bereich überhaupt stellen kann.
Es gibt dann noch das paradoxe Problem der in gewissem Sinne fortschreitenden Bekundung des religiösen Genius. Einerseits bietet die Religion ihr Höchstmaß an Heiligkeit in ihren Anfängen; andererseits muss sie Zeit haben, um sich dauerhaft im menschlichen Boden zu verwurzeln, wo sie eine Menschheit nach ihrem Bilde schaffen muss, wenn sie zu einer größtmöglichen Blüte der geistigen und künstlerischen Werte führen soll, die mit einer Blüte der Heiligkeit übereinstimmt; dies mag einen an eine Entwicklung glauben lassen, und fraglos findet eine Art Entwicklung statt, allerdings nur in bestimmter menschlicher Hinsicht, nicht auf der Ebene der eigentlichen Geistigkeit. Man muss in jedem religiösen Zyklus vier Zeitabschnitte unterscheiden: die »apostolische« Zeit, dann die Zeit der vollen Entfaltung, danach die Zeit des Niedergangs und schließlich die abschließende Zeit des Zerfalls; im Katholizismus hat es jene Anomalie gegeben, dass die Zeit der Blüte jäh abgebrochen wurde durch einen Einfluss, der dem christlichen Genius ganz fremd ist, nämlich durch die Renaissance, sodass in diesem Fall die Zeit des Verfalls ihren Platz in einer völlig neuen Dimension einnahm.
Das Wort »Zeit« ist für die Neuerer praktisch mit der relativistischen Vorstellung der Entwicklung gleichgesetzt, und alles »Vergangene« wird von diesem falschen Blickwinkel aus gesehen, der letztlich alle Erscheinungen auf entwicklungsmäßige oder zeitliche Unabwendbarkeiten zurückführt, wo doch tatsächlich alles Wesentliche in der ewigen Gegenwart ist und in der Qualität der Unbedingtheit, da es ja um Werte des Geistes geht.
✵
Wenn man von dem Gedanken ausgeht, dass die Liturgie das Gewand des Geistigen ist und dass in einer religiösen und damit normalen Kultur nichts ganz unabhängig vom Heiligen ist, wird man zugestehen, dass die Liturgie im weitesten Sinne alle Formen der Kunst oder des Handwerks umfasst, insofern sie sich auf das Heilige beziehen, und dass sie aufgrund dessen nicht irgendetwas Beliebiges sein können. Nun muss aber an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Liturgie – oder die Kunst als Liturgie – seit mehreren Jahrhunderten grundlegend verkehrt ist, als gäbe es keinen Zusammenhang mehr zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren; es wäre widersinnig zu behaupten, diese Sachlage hätte hinsichtlich der allgemeinen Bedingungen der Umwelt und der Entfaltung keinen Einfluss auf das Geistige. Ein bestimmter Heiliger mag kein Bedürfnis nach bilderreicher und ästhetischer Sinnbildlichkeit verspüren, haben wir gesagt, die Gemeinschaft aber bedarf ihrer, und sie muss Heilige hervorbringen können; ob man nun will oder nicht, die großen Dinge sind hier, auf dieser Erde, mit kleinen verbunden, zumindest äußerlich, und es wäre abwegig, in den sinnenfälligen Ausdrucksweisen einer Überlieferung nur eine Sache der Ausschmückung zu sehen.
Doch kehren wir zurück zur Liturgie im eigentlichen Sinne oder genauer, zur Frage ihrer möglichen Neuanpassung. Es gibt keine Form der Nächstenliebe, die eine Entwürdigung erlauben oder verlangen würde; sich auf die Ebene der Kindheit und der Einfalt zu begeben, ist Eines, sich auf die Ebene der Gewöhnlichkeit und des Hochmuts herabzuwürdigen, ist etwas Anderes. Man drängt den Gläubigen die Vorstellung des »Volkes Gottes« oder sogar des »heiligen Volkes« auf, und man redet ihnen ein priesterliches Amt ein, das sie sich nie haben träumen lassen, und das in einer Zeit, in der das Volk so unheilig wie nur irgend denkbar ist, so unheilig, dass man das Bedürfnis verspürt, zu seinem Gebrauch die Liturgie und sogar die ganze Religion zu verflachen. Dies ist umso widersinniger, als das Volk viel besser ist als die Verflachung, die man ihm im Namen einer völlig wirklichkeitsfremden Ideologie aufdrängen will; unter dem Vorwand, eine Liturgie einzuführen, die sich auf dem Niveau des Volkes befinde, will man das Volk dazu zwingen, sich auf das Niveau dieser Ersatzliturgie zu begeben. Man täte jedenfalls gut daran, sich an diesen Leitsatz des heiligen Irenäus zu erinnern: »Man besiegt nie den Irrtum, wenn man irgendeinen Anspruch der Wahrheit opfert.«
Zu behaupten, die alte und normale oder priesterliche und aufgrund dessen aristokratische Liturgie sei einfach nur ein Ausdruck der »Zeit«, ist aus zwei Gründen völlig falsch: erstens, weil eine »Zeit« nichts ist und nichts erklärt, zumindest im Bereich der Werte, um die es hier geht, und zweitens, weil die Botschaft der Liturgie oder ihr zureichender Grund sich gerade außerhalb und jenseits zeitlicher Kontingenzen befindet. Wenn man ein Heiligtum betritt, dann deshalb, um der Zeit zu entfliehen; um eine Atmosphäre des »himmlischen Jerusalem« zu finden, die uns aus unserer irdischen Zeit befreit. Das Verdienst der alten Liturgien besteht nicht darin, ein Ausdruck ihres geschichtlichen Augenblicks gewesen zu sein, sondern Ausdruck von etwas, was darüber hinausgeht; und wenn dieses Etwas ein Zeitalter geprägt hat, dann deshalb, weil dieses Zeitalter so beschaffen war, dass es eine nicht-zeitliche Seite besaß, sodass wir allen Grund haben, es in dem Maße zu lieben, wie es solcherweise beschaffen war. Wenn die »Sehnsucht nach dem Vergangenen« mit der Sehnsucht nach dem Heiligen übereinstimmt, ist sie eine Tugend, nicht weil sie die Vergangenheit an sich anstrebte, was völlig sinnlos wäre, sondern weil sie das Heilige anstrebt, das alle Dauer in ewige Gegenwart verwandelt, und das sich nirgendwo sonst befinden kann als in dem befreienden »Jetzt« Gottes.
1 Dieser Grundsatz »im Geist und in der Wahrheit« in Verbindung mit der Zurückweisung von »Menschensatzungen« ist im Übrigen ein zweischneidiges Schwert; der Protestantismus hat ihn sich zu Eigen gemacht, und es lässt sich nicht leugnen, dass alles Wertvolle und Biblische in der Frömmigkeit der besten Protestanten auf der Berechtigung dieses Grundsatzes beruht; dies ist auch eine Erklärung dafür, dass der Protestantismus gewissen esoterischen Strömungen Zuflucht gewähren konnte. Wie dem auch sei, um dem lutherischen Paradoxon zuvorzukommen, wäre es nötig gewesen, dass der mittelalterliche Katholizismus in seinem Geist und seiner Struktur realistischer, vielschichtiger und anpassungsfähiger gewesen wäre; wir werden in einem anderen Kapitel dieses Buches darauf zurückkommen.
2 Es gibt namentlich die äußerste Kompliziertheit der Rubriken. Diese gehen auf das Rituale Romanum, auf das Zeremoniell der Bischöfe und auf die Verordnungen der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zurück; sie regeln, was innerhalb der Messe geschehen soll und was außerhalb von ihr geschehen soll, um nicht die Kasuistik zu vergessen, die damit zusammenhängt. In Verbindung mit dem liturgischen Kalender führen die Rubriken zu einer ausgesprochen komplizierten und differenzierten Wissenschaft, die Gefahr läuft, das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren oder es in gewisser Weise herabzusetzen, was auf dasselbe hinausläuft; denn es gibt kein gemeinsames Maß zwischen der inneren Wirklichkeit der Eucharistie und den zahllosen Kategorien von Messen: »gewöhnliche«, »feierliche«, »Pontifikalämter« und so weiter, um nicht von besonderen und manchmal banalen Messintentionen zu sprechen, die mit diesem allerheiligsten Sakrament verknüpft werden.
3 Das heißt, dass das äußerst nüchterne liturgische Element in der Sunna selbst enthalten und nicht hinzugefügt ist; sein Hauptinhalt ist die Koranrezitation. Im Judentum liefert uns die Thora ein Beispiel für eine Liturgie, die gleichzeitig sehr reich und in vollem Umfang offenbart, aber nach der Zerstörung des Tempels unwirksam geworden ist.
4 Ein Theologe hat sich unterfangen zu schreiben, der heilige Paulus »habe erfinden müssen«, um die himmlische Botschaft umzusetzen, was der offenkundigste und auch der ruinöseste Irrtum ist, den man sich in diesem Bereich vorstellen kann.
5 Vielfach laufen die Volkssprachen Gefahr, zu Werkzeugen von Entfremdung und kultureller Tyrannei zu werden: Unterdrückte Völker hören die Messe fortan in der Sprache des Unterdrückers, welche die ihre sein soll, und Völkerstämme, die archaische Sprachen sprechen – Sprachen, die mithin grundsätzlich zum liturgischen Gebrauch geeignet, wenn auch tatsächlich wenig verbreitet sind –, erleben, dass das Lateinische durch eine andere fremde Sprache ersetzt wird, die liturgisch ihrer eigenen Sprache unterlegen und darüber hinaus für sie mit Gedankenverbindungen beladen ist, die vom Bereich des Heiligen weit entfernt sind. Die Sioux hören die Messe nicht in ihrer edlen Lakota-Sprache, sondern in modernem Englisch; zweifellos kann man die Messe nicht in alle Indianersprachen übersetzen, aber darum geht es hier nicht, da es ja nun einmal die lateinische Messe gibt.
6 Früher besaß das »Volk« in hohem Maße einen auf natürliche Weise aristokratischen Charakter, der von der Religion herrührt; was die »Plebs« betrifft – die aus Menschen zusammengesetzt ist, die sich weder zu beherrschen noch a fortiori sich zu übersteigen suchen –, so konnte sie nicht für die Sprache insgesamt maßgebend sein. Nur die Demokratie versucht einerseits, die Plebs mit dem Volk gleichzusetzen und andererseits, dieses auf jene herabzumindern; sie adelt, was minderwertig ist, und entwürdigt, was edel ist.
7 Halten wir fest, dass diese feinen Abstufungen auch vielen Orthodoxen zu entgehen scheinen; da das Slawische, das nicht das Griechische ist, des liturgischen Gebrauchs würdig ist – so argumentieren sie –, ist das moderne Französisch, das genauso wenig Griechisch ist, ebenfalls dieses Gebrauchs würdig. Wenn man empfänglich ist für geistige Andeutungen oder für die mystischen Schwingungen von Formen, kann man nur mit Bedauern diese falschen Zugeständnisse sehen, die sich im Übrigen nicht auf den Bereich der Sprache beschränken und die den so ausdrucksvollen Glanz des priesterlichen Genius, welcher der morgenländischen Kirche eignet, verkümmern lassen und entstellen.
8 Das Lateinische ist indessen nicht in jeder Hinsicht überlegen. Das Italienisch Dantes besitzt eine größere Musikalität und einen besonderen Bilderreichtum; das Deutsch eines Meister Eckhart hat ein Mehr an Formbarkeit, an intuitiver und beschwörender Kraft und an Sinnbildlichkeit als das Latein. Letzteres hat aber gleichwohl insgesamt eine offensichtliche allgemeine Vorrangstellung hinsichtlich seiner Ableitungen und der späteren deutschen Dialekte; es ist überdies die Sprache des Römischen Reiches und drängt sich eben dadurch auf, zumal es keinen Grund für eine Vielzahl liturgischer Sprachen in diesem sprachlich und kulturell allzu aufgespaltenen Gebiet gibt.
9 Es versteht sich von selbst, dass Logik nur unter der Bedingung wirksam ist, dass sie über hinreichendes Ausgangsmaterial verfügt und daraus die richtigen Schlüsse zieht. Es geht hier aber auch um das Vorstellungsvermögen und nicht um Logik allein: Ein Vorstellungsvermögen, das sich rundum wohl fühlt in einer Welt des Lärms und der Vulgarität, in der als abnormal und lächerlich bewertet wird, was nicht zu ihr passt, verwirkt jegliches Recht auf Stellungnahme im Bereich des Heiligen.
Das Rätsel der Epiklese
Das Wort »Epiklese«, das nur allmählich in den christlichen Wortschatz aufgenommen worden ist und nicht in der Bibel vorkommt, bedeutet eine Anrufung (ἐπίκλησις) des Heiligen Geistes, vor allem in Verbindung mit den eucharistischen Gebeten. In der griechischen Kirche ist die Epiklese ausschlaggebend für die Wandlung1 – wobei die Einsetzungsworte einfach zum Bericht des Evangeliums gehören –, wohingegen es in der lateinischen Kirche die Worte Christi sind, die das Sakrament bewirken, entsprechend den Thesen des heiligen Ambrosius, des heiligen Johannes Chrysostomos und des heiligen Augustinus. Für die abendländische Kirche bewirkt das Wort Christi – und des in persona Christi sprechenden Priesters – die Wandlung, weil Gott durch sein Wort schafft; für die morgenländische Kirche ist es dagegen der Heilige Geist, der die Wandlung bewirkt, weil er die Fleischwerdung in der Heiligen Jungfrau bewirkt hatte.2 Allerdings erkennen manche Orthodoxe jetzt die Gültigkeit der lateinischen Messe an, da sie grundsätzlich die bekenntnisübergreifende Kommunion gelten lassen; der Grund dafür liegt zweifellos darin, dass sie im römischen Messkanon, dessen Gebete in ihrer Gesamtheit auf das fünfte Jahrhundert zurückgehen, die aber keine Epiklese enthalten, ein Element finden, das diese in ihren Augen ersetzen kann. Für die Katholiken stellt die orthodoxe Liturgie kaum ein Problem dar, da sie, unabhängig von der Lehre über die Wandlungsformel, die Einsetzungsworte enthält; es gibt sogar Theologen, katholische und orthodoxe gleichermaßen, welche die Meinung vertreten, dass man den genauen Zeitpunkt der Wandlung nicht mit Sicherheit bestimmen kann, was angesichts des Gewichts des Problems ziemlich seltsam wäre. Wie dem auch sei, die morgenländischen Kirchen haben sich viel später mit der Frage des Zeitpunktes der Wandlung beschäftigt als die lateinische Kirche; lange Zeit hindurch haben sie sich zu diesem Thema nur unscharf geäußert: Brot und Wein werden »im Verlauf der Anaphora«, das heißt im Verlauf des allgemeinen eucharistischen Hochgebets, dem im Abendland der römische Kanon entspricht, zu Leib und Blut Christi.3
Es ist an dieser Stelle geboten, darauf hinzuweisen, dass wir unter dem »römischen Kanon« den vom heiligen Pius V. verkündeten – aber nicht geschaffenen – tridentinischen Kanon verstehen. Pius V. nahm das, was zu seiner Zeit in der Kirche von Rom in Gebrauch war, und ließ einige andere Liturgien bestehen, die durch den Gebrauch sanktioniert waren; er hätte nicht im Traum ein zuverlässig überliefertes eucharistisches Hochgebet verboten oder einen dem Wortlaut nach genaueren oder umfassenderen ähnlichen Text für überflüssig erklärt. Das Werk des heiligen Pius V. war folglich nur rückblickend und bewahrend, wodurch es eben maßgeblich sein konnte; sogar wenn man annimmt, dass dieser Papst nicht alle Handschriften kannte, die es gab, genügten ihm ganz offensichtlich die, über die er verfügte, sowohl theologisch als auch liturgisch, sonst gäbe es im Übrigen keinen Grund für die Kirche, von Vorsehung oder vom Heiligen Geist zu sprechen.
✵
In der Epiklese »bittet« der Priester Gottvater und »fleht« ihn an, seinen Heiligen Geist auf die eucharistischen Gaben herabzusenden und sie – »nach dem Wohlgefallen deiner Güte«, sagt der heilige Basilius – in den Leib und das Blut Christi zu verwandeln. Der heilige Johannes Chrysostomos, der eine der meistverbreiteten Epiklesen verfasst hat, sagt ausdrücklich, dass es die Einsetzungsworte sind, welche die sakramentale Wandlung bewirken, er fügt indes hinzu, dass dies durch den Heiligen Geist geschieht, da durch sein Tun der Leib Jesu in Marias Schoß geformt worden ist; er hat jedenfalls seiner Epiklese eine die Wandlung vollziehende Gestalt verliehen, welche die spätere orthodoxe Deutung vorwegnimmt.
Nun kann aber von den beiden folgenden Aussagen nur eine gelten, wenn wir logisch sein wollen: Entweder ist die Transsubstantiation ex opere operato und kraft der göttlichen Anordnung (hoc facite in meam commemorationem) gesichert, und dann ist die Bitte unnötig; oder die Bitte ist nötig, und dann ist die Transsubstantiation nicht gesichert; sie ist dann nur möglich oder wahrscheinlich, denn man betet nicht für etwas, dessen Verwirklichung keinem Zweifel unterliegt – da sie sich ja aus einem göttlichen Versprechen ergibt –, es sei denn, um sich dafür zu bereiten oder um dem Himmel zu danken. »Das ist mein Leib, das ist mein Blut«, hat Christus gesagt und nicht: Dies wird womöglich mein Leib und mein Blut sein, wenn ihr darum bittet oder mit hinlänglicher Inbrunst darum bittet – quod absit; er hat vor allem nicht den Vater darum gebeten, den Heiligen Geist zu senden, um das Wunder zu wirken, sodass seine Anweisung, »dies zu meinem Gedächtnis zu tun« keinerlei die Wandlung bewirkende Bitte mit einschließen kann; oder auch: Er hat nicht eine Bitte seitens der Apostel erhört, als er die Eucharistie einsetzte. Die Gabe war frei gewährt, es war um nichts gebeten worden.4
Wortwörtlich genommen ist die die Wandlung bewirkende Epiklese eine Art Tautologie; man muss aber die ihr zugrunde liegende Absicht verstehen, die vor allem moralisch ist und die darin besteht, unser Bewusstsein des ungeheuren Missverhältnisses zwischen der göttlichen Gnade und der menschlichen Ohnmacht zu stärken. Gott darum zu bitten, uns eine bereits versprochene Gunst zu gewähren, läuft darauf hinaus, dass die Gabe unverdient ist, dass sich der Abstand zwischen der Gabe und uns selbst jeden Vergleichs entzieht; das heißt, es gibt in der Epiklese oder im eucharistischen Hochgebet zwei Elemente, nämlich das Zeugnis unserer Unwürdigkeit und die Anrufung des Heiligen Geistes, damit er uns auf den Empfang der Gabe bereite. Denn die eucharistische Gabe ist dem heiligen Paulus zufolge tödlich für die Unwürdigen, was die Epiklesen des heiligen Basilius und des heiligen Johannes Chrysostomos zu berücksichtigen nicht versäumen.5
Dieser allgemeinen Erklärung kann eine weitere, besondere hinzugefügt werden. Wir haben weiter oben darauf hingewiesen, dass die Epiklese vom Standpunkt der verwandelnden Wirksamkeit unnötig ist, da sie ja um etwas bittet, das bereits gewährt worden ist, und zwar nicht als Antwort auf ein Gebet, sondern aufgrund einer Anordnung; dies ist alles in allem der Einwand der Lateiner gegen die Griechen. Nikolaos Kabasilas bezieht sich in seinem »Kommentar zur Göttlichen Liturgie« auf diesen Einwand, und er versucht, ihn zu widerlegen; indes sind die Argumente, die er vorbringt, so schwach, dass es uns unnötig erscheint, darauf einzugehen.6 Wir sehen dagegen unschwer, welche Aufgabe die Epiklese für das orthodoxe Empfinden erfüllt: Da dieses Empfinden sich gegen die Vorstellung einer Wandlung ex opere operato sträubt, die dem Priester – und damit dem Menschen – eine Art magischer Macht zu verleihen scheint, welche Gott zwingt, das Wunder zu wirken, beseitigt die an sich tautologische Bitte dieses Empfinden und verhilft dem Menschen zum Bewusstsein vollkommener Demut und völliger Abhängigkeit von Gott. Da die lateinische Mentalität derartige Skrupel nicht – oder nicht in diesem Ausmaß – kennt, haben die Gebete, welche die katholische Wandlung begleiten, nicht die gleiche Aufgabe wie die Epiklese; sie spielen nichtsdestoweniger eine ähnliche Rolle, nämlich die, im Menschen das Gefühl seiner Unwürdigkeit zu erneuern.
Wenn der Daseinsgrund für die Epiklese die »tätige Mitwirkung der eucharistischen Gemeinde« ist, worauf uns ein orthodoxer Theologe hingewiesen hat, dann kann man sich die wortwörtliche Bedeutung dieser Formulierung nicht erklären, denn diese Mitwirkung könnte sich grundsätzlich auf ganz andere Weise äußern. Sie könnte die Form eines Domine non sum dignus oder einer Danksagung annehmen oder auch eines Gebetes für den die Messe lesenden Priester oder für die ganze Gemeinde, und all das, ohne von einer Bitte begleitet zu sein, die logisch die Wirksamkeit des Ritus beträfe; da dies nicht so ist, dürfen wir annehmen, dass zu dieser genauen Funktion der Mitwirkung noch ein psychologisches oder mystisches Element hinzukommt, das davon mehr oder weniger unabhängig ist, auch wenn es diese Mitwirkung auf seine Weise färbt. Wir haben gesehen, dass die katholische Messe in ihren eucharistischen Gebeten ebenfalls ein derartiges Element der Frömmigkeit enthält, allerdings ohne irgendeine gleichsam priesterliche Mitwirkung der Gemeinde, die dem echten Katholizismus fremd wäre; so sehr, dass der Priester im Gegensatz zu dem, was in der morgenländischen Kirche geschieht, die Messe ohne die Anwesenheit der Gemeinde feiern kann.
Man könnte vielleicht geltend machen, dass die an den Heiligen Geist gerichtete Bitte nicht ein für das Sakrament notwendiges Ersuchen ausdrückt, sondern einfach einen Wunsch, ein Verlangen, eine Hoffnung: den Wunsch, dass das erlösende Wunder geschehe, das Verlangen nach der Gnade des Heiligen Geistes, die Hoffnung auf Erbarmen und Erlösung. In diesem Fall wäre der Gehalt des Gebetes eher subjektiv als objektiv; dies wäre nicht eine Teilnahme am Ritus im eigentlichen Sinne, sondern an der Haltung des Priesters vor Gott, und dies würde dem Gebet eine mittelbar priesterliche Funktion verleihen.
Was die problematische Seite der Epiklese – in Bezug auf die Logik, worauf wir hingewiesen haben – betrifft, wird mancher zweifellos die Unangemessenheit der Logik auf dem Gebiet der Theologie und der Sakramente geltend machen. Nun sind wir aber der Ansicht, dass sich die Rechte der Logik auf alles erstrecken, was ausdrückbar ist: Ein logischer Einwand verdient nicht den Affront einer Verdammung der Logik an sich; er verlangt im Gegenteil eine Antwort, die den Einwand auf ihrer eigenen Ebene ausräumt; eine derartige Antwort mag nach Lage der Dinge schwierig sein, sie ist aber grundsätzlich immer möglich. Wir möchten hinzufügen – und dies ist sogar das Wichtigste –, dass die Gesetze der Logik ihre Wurzeln in der göttlichen Natur haben: Sie bekunden im menschlichen Geist seinsmäßige Beziehungen; die Abgrenzung der Logik ist sogar äußerlich etwas Logisches, sonst wäre sie beliebig. Dass die Logik beim Fehlen von unverzichtbaren objektiven Gegebenheiten und von nicht minder notwendigen subjektiven Befähigungen unwirksam ist, liegt auf der Hand, und dies macht die luziferischen Gedankengebäude der Rationalisten und auch, auf einer ganz anderen Ebene, die gefühlsbestimmten und übereilten, wenn auch formal logischen, Spekulationen gewisser Theologen zunichte.7
✵
Bis zum dritten Jahrhundert gab es kein festgelegtes eucharistisches Hochgebet: Jeder Bischof stellte sich das seine zusammen oder improvisierte es, was ein Hinweis auf die Unwahrscheinlichkeit einer alleinigen Wandlungskraft der Epiklese ist; es ist nämlich kaum vorstellbar, dass die Wirksamkeit eines Ritus und damit seine Gültigkeit von einem improvisierten Gebet oder von einer zweit- oder drittrangigen Inspiration abhängt.8
Wie dem auch sei, die Tatsache, dass die Bischöfe des frühen Christentums Gebete geschaffen haben, bedeutet keinesfalls, dass man heute dasselbe tun kann, denn die Möglichkeiten der Eingebung in der Urkirche können nicht in eine spätere und mithin vom Ursprung weiter entfernte Zeit übertragen werden. Die irdische oder geschichtliche Kirche ist wie ein Baum, dessen Wachstumsverlauf unumkehrbar ist; man kann nicht unter dem Vorwand der Rückkehr zum Ursprung – das heißt, indem man sich auf die Möglichkeiten der Urkirche bezieht – einen Kanon durch einen anderen ersetzen, genauso wenig wie der Ast eines Baumes wieder zum Stamm oder der Stamm wieder zur Wurzel werden kann. Es gibt eine Eingebung auf der apostolischen Stufe, dann eine auf der patristischen Stufe; es gibt auch, auf verschiedenen Stufen, die Eingebung der Heiligen, es gibt aber sicher keine Eingebung der Ausschüsse und der Amtsstuben, um es vorsichtig auszudrücken. Zwar »weht der Geist, wo er will«, das kann aber nicht heißen, dass er überall oder überall auf die gleiche Weise wehen will.
✵
Um diese Frage einer Berufung auf den Heiligen Geist richtig einzuordnen, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass jedes Sakrament drei Elemente enthält: die Materie, die Form und die Absicht. Im Fall der Eucharistie bilden Brot und Wein die Materie, das heißt die Gesamtheit der sinnenhaften Träger; die Wandlungsworte bilden die Form, die »auf die Materie einwirkt, sodass sie die Wirkung hervorbringt und sie klar ausdrückt«; der Kanon – die Anaphora der Griechen – übermittelt die Absicht, wobei die Epiklese ein Teil der Anaphora ist, der für die Griechen wesentlich und für die Lateiner ohne Bedeutung ist. Nun besteht die Absicht inhaltlich aber ganz offensichtlich nicht nur in der Lehre von der Eucharistie in Verbindung mit ihrem unverzichtbaren Bezug zur Ehrfurcht, sondern auch in dem Bemühen – oder der Verpflichtung –, das zu tun, was die Kirche tut, sonst gäbe es keine Gewähr für die Lehrrichtigkeit und die Einheitlichkeit.
Das tun, was die Kirche tut: Für die Orthodoxen ist die Kirche da, wo ein Bischof in Verbundenheit mit allen anderen orthodoxen Bischöfen ist; in anderer Hinsicht kann man sagen, dass sie dort ist, wo sich ein Gläubiger in Verbundenheit mit allen anderen Gläubigen befindet, in diesem Fall ist der Kirchenbegriff allerdings zugleich weiter und enger in dem Sinne, dass er sich dann nur auf die »Kirche als Gemeinschaft« bezieht und nicht auf die Macht der »Amtskirche«. Für die katholische Kirche drückt man die erste der beiden Betrachtungsweisen dadurch aus, dass man sagt, dass die Kirche da ist, wo der Papst ist, was zur wesentlichen Voraussetzung hat, dass der Papst Sprecher und Instrument dessen ist, was immer und überall in der abendländischen Kirche gelehrt und ausgeübt worden ist, und dass keine seiner Unternehmungen dieser Lehrrichtigkeit zuwiderläuft; die Richtigkeit der Lehre und der Institution unterliegt nämlich nicht dem Papst, sondern dieser unterliegt jener, andernfalls genügt er nicht der Beschreibung seines Amtes. Wenn die Kirche da ist, wo der Papst ist, dann deshalb, weil der Papst – oder der Grundsatz des Papsttums – da ist, wo katholische Lehrrichtigkeit ist; man glaubt nicht an den Katechismus, weil der Papst es so will, sondern man glaubt an den Papst, weil der Katechismus es verlangt und in dem Maße, wie er es verlangt. Der Gehorsam dem Papst gegenüber hängt vollständig vom Gehorsam gegenüber der Überlieferung ab, so wie die Güte des Papsttums von der Übereinstimmung des Papstes mit überlieferungsmäßigen Konstanten abhängt.9
Diese Überlegungen rufen die Erinnerung an die Meinungsverschiedenheit zwischen den Lateinern und den Griechen bezüglich des Papsttums wach: Während der Papst für die Lateiner das alleinige und absolute, mit nicht nur priesterlicher, sondern faktisch auch kaiserlicher und prophetischer Macht ausgestattete Oberhaupt der Kirche ist, ist er für die Griechen Bischof von Rom und darüber hinaus Vorsitzender der Versammlung aller Bischöfe, also primus inter pares, das heißt, wie im Evangelium, Sprecher seiner Mitbrüder; dass er als solcher vom Heiligen Geist inspiriert ist, wenn er ex cathedra spricht, ist offensichtlich und erfordert kein besonderes Charisma. Die an Petrus gerichteten Worte Christi sind weder die Weihe eines irdischen Monarchen noch eines gesetzgebenden Propheten, und sie müssen im Zusammenhang mit den Worten Christi an die anderen Apostel verstanden werden und vor allem auch im Zusammenhang mit der außerordentlichen Rolle, die der heilige Paulus gespielt hat; wenn die katholische Behauptung ganz wahr und die orthodoxe Behauptung ganz falsch wäre, hätte es des heiligen Paulus nicht bedurft, da man ja Petrus hatte; dieser hätte dann die Sendung Pauli erfüllt. Das Papsttum ist eine jener überlieferungsmäßigen Einrichtungen, die problematisch, aber unvermeidlich sind, das heißt, sie sind von der Vorsehung zugleich hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit und hinsichtlich ihrer Zweideutigkeit bestimmt, denn das Schicksal der Erde muss sich erfüllen gleichermaßen mithilfe von Unvollkommenheiten und Unklarheiten wie mithilfe von Vollkommenheiten und Klarheiten.
✵
Aus dem Grundsatz der Absicht ergibt sich, dass die Wirksamkeit der Einsetzungsworte, wenn diese das einzige verwandelnde Element sind, von der hinreichenden Formulierung der Absicht abhängt, ist doch die Absicht eines der drei unverzichtbaren Elemente eines Sakramentes. Man kann daher sagen, dass der Kanon oder die Anaphora unmittelbar unverzichtbar für das Sakrament als solches ist, und mittelbar unverzichtbar für die Wirksamkeit der Wandlung ex opere operato, etwa so, wie die priesterliche Qualität eine wesentliche, aber gleichwohl bezüglich der »Form« äußerliche Bedingung ist; ohne Priestertum bliebe die »Form« praktisch unwirksam. In ihrer Lehre von der Epiklese haben die Griechen anscheinend den verbindlichen Charakter der »Absicht« einem besonderen Element von dieser zugeordnet, nämlich der Anrufung des Heiligen Geistes, und haben dieser dann den verbindlichen oder sogar grundlegenden Charakter der »Form« selbst zugewiesen; die Absicht – oder ein als besonders hervorstechend empfundener Teil der Absicht – ist so zur »Form« des Ritus geworden. Der Kanon kann sicherlich eine reinigende und vorbereitende – nicht wirksam verwandelnde – Anrufung des Heiligen Geistes enthalten; eine derartige Anrufung mit ihrer verwandelnden Form kann aber nur eine mittelbare und gewissermaßen sinnbildliche, wenn auch geistig konkrete Bedeutung haben, wie wir oben gezeigt haben.
Dem heiligen Basilius zufolge »begnügen wir uns nicht mit den Worten, die vom Apostel und vom Evangelium berichtet worden sind, sondern wir fügen ihnen davor und danach andere hinzu, da sie über viel Kraft für die Mysterien verfügen«. Die Tragweite dieser hinzugefügten Worte kann nur das menschliche Gefäß betreffen und nicht den göttlichen Inhalt – außer als äußere Bedingung –, denn es versteht sich von selbst, dass menschliche und mehr oder weniger veränderliche, wenn auch auf der zweiten oder dritten Stufe inspirierte Worte, nichts zur sakramentalen Wirksamkeit der göttlichen Worte hinzufügen können; dieselbe Bemerkung gilt erst recht für die Eindringlichkeit des menschlichen Gebetes, die durch Worte wie »bitten« und »anflehen« ausgedrückt wird.
Es gibt ein Element, das logisch ein Teil der Form des Sakramentes ist, allerdings auf zweitrangige und nicht-verwandelnde Weise, und dies sind die einführenden Gebete, die von Christus gesprochen wurden, deren genauer Wortlaut aber unbekannt ist: Christus sagte Dank für das Brot und den Wein, dann segnete er sie. Diese beiden Elemente, die Danksagung und das Segnen, müssen sich also im Kanon wiederfinden lassen als unmittelbarer Zusammenhang, der die Voraussetzung für die verwandelnde Form ist; und man könnte sagen, dass die Epiklese mit ihrem Ton der inständigen und sakramental paradoxen Bitte in der Sprache des Sünders das wiedergibt, was Christus in der Sprache des Gottmenschen gesagt hat, und dass sie so einen Teil des Elements »Absicht« in das Element »Form« einführt.
Es muss festgehalten werden, dass Christus den älteren Theologen zufolge – unter ihnen die Päpste Innozenz III. und Innozenz IV. – die beiden Gestalten (Brot und Wein) durch den in den Evangelien erwähnten Segen geweiht hat, also vor dem Aussprechen der Wandlungsworte; das Tridentinische Konzil sprach darüber, verschob die Frage dann aber auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Man kann gegen diese Auffassung zur Geltung bringen, dass die Evangelisten – die immerhin vom Heiligen Geist inspiriert waren – es nicht für notwendig gehalten haben, uns den genauen Wortlaut der Segnung mitzuteilen; dann, dass es keinen Grund für die Annahme gibt, der Segen sei etwas anderes als das, was das Wort oder der Begriff beinhaltet; schließlich, dass es unmöglich ist, dass das Wesen eines Sakraments zweifelhaft wäre und damit Vermutungen unterliegen würde.
Meister Eckhart hat in der ihm eigenen Kühnheit nicht gezögert zu sagen: »Wenn jemand so gut auf gewöhnliche Speise vorbereitet wäre wie auf das heilige Sakrament, dann würde er Gott in dieser Speise so vollkommen empfangen wie in dem Sakrament selbst.« Was er sagen will, ist, dass die Sakramente und andere Riten nur notwendig sind aufgrund unseres gefallenen Zustandes; sie erneuern in uns eine Empfänglichkeit, die der ursprüngliche Mensch auf »übernatürlich-natürliche« Weise besaß; sie übermitteln sicherlich positive Gnaden, indem sie Hindernisse beseitigen, diese Gnaden sind aber in unserem daseinsmäßigen und gewissermaßen transpersonalen Wesenskern immer gegenwärtig.
Doch kehren wir zur Frage der Absicht als unverzichtbarer Einführung in das Sakrament zurück. Die Absicht muss verbindlich die folgenden Teile enthalten und somit auch ausdrücken: zunächst das Bewusstsein des objektiven Mysteriums; dann, subjektiv, den Glauben an das Mysterium, zusammen mit den entscheidenden Tugenden der Demut und der Hoffnung. Demut – deren Gegensatz Hochmut ist – ist das Bewusstsein unserer Ohnmacht und auch unserer Unwürdigkeit, beides Folgen des Falls; und Hoffnung – deren Gegensatz Verzweiflung ist – ist das Vertrauen in das erlösende Erbarmen, also in den Willen Gottes, uns zu retten, der sich im Mysterium der Eucharistie äußert. Die Kirche macht sich im Kanon diese verschiedenen Begriffe und Haltungen zu Eigen, damit sie und alle Zelebranten durch sie und in ihr vor Gott bezeugen können: Wir tun dies voll und ganz im Gedenken an Dich.
1 Genauer gesagt hat dieser Ausdruck (im Griechischen μετουσίωσις) für die Orthodoxen nicht ganz die gleiche, wenn man so will fast magische Bedeutung wie für die Katholiken.
2 Der erste morgenländische Theologe, der behauptet, dass die Wandlung durch die Epiklese und nicht durch die Einsetzungsworte bewirkt wird, ist Theodor, Bischof von Andide, im zwölften Jahrhundert; dieselbe These wurde im vierzehnten Jahrhundert von Theodor von Melitene und vor allem von Nikolaos Kabasilas verfochten. Damals begann in der griechischen Kirche eine Kontroverse über diese Frage; die Lehre von Kabasilas gewann jedoch an Boden und wurde im Morgenland etwa im sechzehnten Jahrhundert allgemein anerkannt, mit Ausnahme der russischen Kirche, die sie erst im achtzehnten Jahrhundert übernahm.
3 Die syrische Liturgie scheint ein Beweis dafür zu sein – was uns aber selbstverständlich erscheint –, dass man im Morgenland in früheren Zeiten den Einsetzungsworten eine größere Bedeutung zumaß als der Epiklese; die ganze Anaphora, einschließlich der Epiklese, wurde vom Griechischen ins Syrische übersetzt, die Wandlungsworte aber wurden aufgrund ihrer Bedeutung für die Wandlung auf Griechisch belassen.
4 Auch im Katholizismus gibt es ein eucharistisches Gebet, in dem der Priester zu Gott fleht, das Opfer anzunehmen, das er ihm darbietet; nun handelt der Priester aber in persona Christi, und es ist zudem unmöglich, dass Gott ein Opfer nicht annimmt, das er selbst eingesetzt hat, vorausgesetzt, dass das Opfer entsprechend den Regeln vollzogen wird.
5 Halten wir fest, dass, wenn der römische Kanon auch keine Epiklese hat, die Mehrzahl der anderen lateinischen Hochgebete – das gallische und das mozarabische zum Beispiel – eine Epiklese enthalten. Diese Epiklesen besitzen jedoch nie verwandelnde Kraft; sie ersuchen den himmlischen Vater, den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen zu senden.
6 Indem Gott sagte: »Seid fruchtbar und mehret euch«, schuf er die geschlechtliche Vereinigung und die erzeugende Wirksamkeit, die sie beinhaltet; nun führten aber die Lateiner dieses göttliche Wort als Beispiel für die Wandlungsworte Christi an, in Anbetracht der Tatsache, dass das Wort Gottes im Buch Genesis schöpferisch war und nicht gesetzgebend, sonst wäre die Keuschheit ja Ungehorsam. Falsch, wendet Kabasilas ein: Denn genauso wie der Mensch dem göttlichen Befehl den Geschlechtsakt hinzufügen muss, um ihn wirksam werden zu lassen, muss auch der Priester den Worten Christi die Epiklese hinzufügen; als wäre diese es – und nicht der Vollzug des durch Jesus eingesetzten Ritus –, die der geschlechtlichen Handlung des Menschen entspräche.
7 Die »Weisheit der Welt« oder »nach dem Fleisch« kann einen anmaßenden und wissenschaftsgläubigen Aristotelismus einschließen, der die Weltlichkeit fördert und zum luziferischen Abenteuer einlädt; sie kann ganz offensichtlich die platonische Strömung nicht enthalten, die dem heiligen Justin dem Märtyrer zufolge den Logos und folglich Christus bezeugt.
8 Anscheinend hat es im siebten Jahrhundert eine syrische Liturgie gegeben, die weder eine die Wandlung bewirkende Epiklese noch Einsetzungsworte enthielt; dieser letzte Punkt erscheint uns nicht nachprüfbar, denn diese Liturgie könnte durchaus die Wandlung bewirkende Elemente enthalten haben, die in den schriftlichen Dokumenten nicht vorhanden sind: Der Zelebrant könnte sehr wohl die Einsetzungsworte »im Herzen« gesprochen haben, auf eine Weise, die in den Augen Gottes gültig ist und sich im Einklang befindet mit bestimmten objektiven und subjektiven Bedingungen der Zeit und des Ortes; in jedem Fall könnte sich ein nicht hörbares oder gedankliches Sprechen der Wandlungsworte auf den Grundsatz nolite dare sanctum canibus beziehen.
9 Man scheint heute vergessen zu haben, dass bereits im sechzehnten Jahrhundert ein Cajetan es für notwendig erachtet hat festzuhalten, dass Kirche da ist, wo der Papst ist, nur unter der ausdrücklichen Bedingung, dass der Papst sich seinem Amt entsprechend verhält, sonst »ist weder die Kirche in ihm noch er in der Kirche«.
Die Frage des Protestantismus