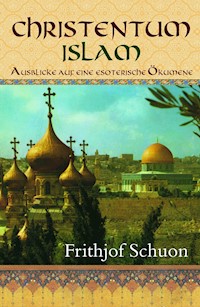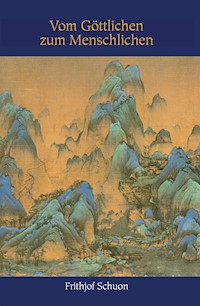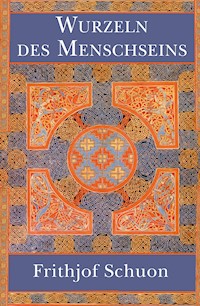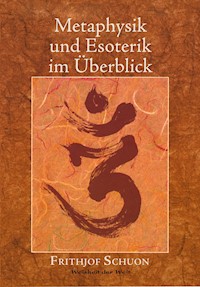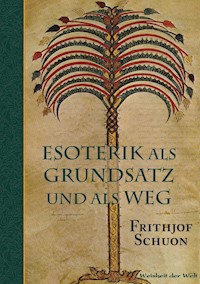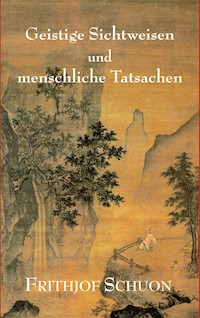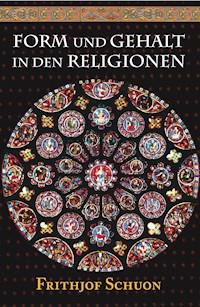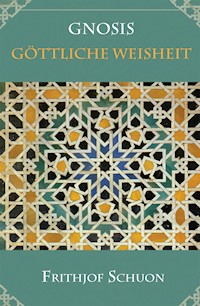
11,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Gott ist ›Licht‹, ›bevor‹ er ›Wärme‹ ist, wenn man so sagen darf; die Gnosis ›hat Vorrang‹ vor der Liebe, oder besser, diese ›folgt‹ jener, denn die Gnosis umfasst die Liebe auf ihre Weise, wohingegen die Liebe nichts anderes ist als die aus der Gnosis ›hervorgegangene‹ Seligkeit. Man kann das Falsche lieben, ohne dass die Liebe aufhörte, das zu sein, was sie ist; man kann jedoch nicht in gleicher Weise das Falsche ›erkennen‹, das heißt, die Erkenntnis kann sich nicht über ihren Gegenstand täuschen, ohne aufzuhören, das zu sein, was sie ist; der Irrtum schließt immer einen Mangel an Erkenntnis ein, wohingegen die Sünde keinen Mangel an Willen mit einschließt.« Frithjof Schuon (1907-1998) wird in weiten Teilen der Welt als einer der bedeutendsten religionsphilosophischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Er gilt als führender Vertreter jener Denkrichtung, die Sophia perennis (»immerwährende Weisheit«) genannt wird, und welche die zeitlosen und überall gültigen Grundsätze enthält, die den verschiedenen Lehren, den Sinnbildern, der heiligen Kunst und den geistigen Übungen der Weltreligionen zugrunde liegen. »Gnosis« ist für Schuon tiefe, den Menschen verwandelnde Erkenntnis und darf nicht mit den zur Zeit des frühen Christentums aufkommenden Irrlehren verwechselt werden, die heute oft unter dem Begriff »Gnostizismus« zusammengefasst werden. Der erste Teil des Buches behandelt Fragen, die mit der Unterschiedlichkeit der religiösen Überlieferungen zusammenhängen; der zweite metaphysische und anthropologische Themen, darunter den aufschlussreichen Aufsatz »Gott überall sehen«; der dritte widmet mich sich aus Sicht der Gnosis in drei Kapitel dem Christentum. Das Buch wendet sich an Menschen, die auf der Suche nach einem geistig fundierten Verständnis der Welt und ihres eigenen Lebens sind, einem Verständnis, das über die Antworten hinausgeht, welche die modernen Wissenschaften geben können. Es vermag zu befreienden Einsichten und tiefer Gewissheit zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Deutschsprachige Bücher von Frithjof Schuon
Philosophische Werke
Leitgedanken zur Urbesinnung. Zürich 1935; Freiburg 1989, 2009
Das Ewige im Vergänglichen. Weilheim 1970; München 1984
Von der inneren Einheit der Religionen. Interlaken 1981; Freiburg 2007
Den Islam verstehen. München 1988, 1991, 2002. Freiburg 1993
Schätze des Buddhismus. Norderstedt 2007
Esoterik als Grundsatz und als Weg. Hamburg 2012
Metaphysik und Esoterik im Überblick. Hamburg 2012
Logik und Transzendenz. Hamburg 2013
Geistige Sichtweisen und menschliche Tatsachen. Hamburg 2013 Wurzeln des Menschseins. Hamburg 2014
Gedichte
Sulamith. Bern 1947
Tage- und Nächtebuch. Bern 1947
Glück. Freiburg 1997
Leben. Freiburg 1997
Liebe. Freiburg 1997
Sinn. Freiburg 1997
Perlen des Pilgers. Düsseldorf 2000
Sinngedichte. Bd. 1 – 10. Sottens 2001 – 2005
Frithjof Schuon
Gnosis – Göttliche Weisheit
Übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von
Wolf Burbat
WEISHEIT DER WELT
© World Wisdom Books
Titel des französischen Originales: Sentiers de gnose Place royale, Paris 1996
Aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen von Wolf Burbat
Umschlagbild: Fliesenmuster aus der Alhambra in Granada.
WEISHEIT DER WELT ist das deutschsprachige Imprint von
World Wisdom, Inc., P.O. Box 2682, Bloomington, Indiana 47402-2682www.worldwisdom.com
Verlag: tredition GmbH
ISBN
978-3-7323-3471-1 (Paperback)
978-3-7323-3472-8 (e-Book)
www.tredition.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
Inhalt
Vorbemerkung des Übersetzers
KONTROVERSEN
Das Gefühl für das Absolute in den Religionen
Die Verschiedenartigkeit der Offenbarung
Gibt es eine natürliche Mystik?
Das Wechselspiel geistiger Veranlagungen
Über die Lehre von der Täuschung
GNOSIS
Gnosis, Sprache des Selbst
Der dreifache Anblick des menschlichen Mikrokosmos
Liebe Gottes, Bewusstsein des Wirklichen
Gott überall sehen
CHRISTENTUM
Einige Einblicke
Mysterien Christi und der Heiligen Jungfrau
Vom Kreuz
ANHANG
Anmerkungen des Übersetzers
Glossar
Index
Frithjof Schuon
Vorbemerkung des Übersetzers
Wir freuen uns, mit diesem Buch die sechste einer Reihe von geplanten Übersetzungen von Werken Frithjof Schuons in deutscher Sprache vorlegen zu können. Der in Deutschland noch wenig bekannte Schuon (1907-1998) wird in weiten Teilen der Welt als einer der bedeutendsten religionsphilosophischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts angesehen. Er besaß einen außerordentlichen Überblick über die religiösen Überlieferungen der Menschheit, konnte die Vielfalt der Erscheinungen bis in ihre Tiefe durchdringen und seine Erkenntnisse in meisterhafter, oft dichterischer Sprache ausdrücken. Er gilt als führender Vertreter jener Denkrichtung, die Sophia perennis, Philosophia perennis oder Religio perennis – also immerwährende Weisheit, immerwährende Philosophie oder immerwährende Religion – genannt wird, welche die zeitlosen und überall gültigen Grundsätze enthält, die den verschiedenen Lehren, den Sinnbildern, der heiligen Kunst und den geistigen Übungen der Weltreligionen zugrundeliegen.
Das vorliegende Buch ist Schuons viertes Hauptwerk; die französische Originalausgabe erschien zuerst 1957 unter dem Titel Sentiers de gnose; zwei weitere Auflagen folgten 1987 und 1996; auf der Letzteren basiert diese Übersetzung.
Schuon benutzt wichtige Schlüsselbegriffe oft in ihrem ursprünglichen Sinn und nicht so, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. So will er beispielsweise den im Buchtitel vorkommenden Begriff Gnosis im Wortsinn verstanden wissen, also als »Erkenntnis«; in diesem Sinne kommt das griechische Wort γνῶσις 29-mal im Neuen Testament vor. Auch die frühen Kirchenväter des Christentums benutzten dieses Wort in diesem Sinne. Aber schon Paulus warnt vor »sogenannter Erkenntnis« (1Tim 6,20). Apologeten wie Irenäus und Tertullian setzten sich in ihren Schriften von »Gnostikern« ab, die fürsich eine besondere Form der Erkenntnis beanspruchen, deren Lehren aber nicht mit der des Christentums übereinstimmen. Diese häretischen Lehren wurden später – trotz ihrer Uneinheitlichkeit – unter dem Begriff »Gnosis« oder »Gnostizismus« zusammengefasst.
Der Mensch kann Schuon zufolge zur Erkenntnis gelangen durch den Intellekt, den »reinen Geist«, der zur unmittelbaren Schau, zur »Einsicht« fähig ist. Der Intellekt enthält in seiner Spitze das Göttliche im Menschen, mit den von Schuon immer wieder angeführten Worten Meister Eckharts: Aliquid quod est increatum et increabile … et hoc est intellectus (»etwas, was unerschaffen und unerschaffbar ist … und das ist der Intellekt«). Bedeutsam ist hier, dass der Intellekt als göttlich angesehen wird, er ist überpersönlich und überrational; er darf nicht mit dem Verstand verwechselt werden; er gehört nicht dem einzelnen Menschen, vielmehr hat dieser grundsätzlich Zugang zu ihm.
Der Mensch ist aber nicht nur umfassendes Erkenntnisvermögen, sondern auch freier Wille und selbstlose Seele. Sinn des menschlichen Daseins ist es demzufolge, das Wahre zu erkennen, das Gute zu wollen, das Schöne zu lieben.
Obwohl Deutsch seine erste Muttersprache war, hat Schuon seine metaphysischen Werke auf Französisch verfasst, einer Sprache, die sich aufgrund ihres lateinischen Ursprungs und ihres unzweideutigen Wortschatzes hierfür besonders gut eignet. Schuon liebte die deutsche Sprache sehr und bestand darauf, sie weitgehend von Fremdwörtern freizuhalten. Dem haben wir in der vorliegenden Übersetzung Rechnung zu tragen versucht; so wird der Leser einige mittlerweile selten gewordene Wörter wie »Geistigkeit« statt »Spiritualität«, »Anblick« oder »Gesichtspunkt« statt »Aspekt«, »Sammlung« statt »Konzentration« und dergleichen mehr finden. Als Muster hat uns hierbei Schuons eigene Übertragung seines ersten Hauptwerkes De l’unité transcendante des religions (1948) ins Deutsche gedient.1
Andererseits war es unumgänglich, eine Reihe von Fremdwörtern zu benutzen, seien es philosophische Fachausdrücke oder Begriffe aus einer Vielzahl von Überlieferungen; diese Begriffe aus dem Sanskrit, dem Griechischen, dem Lateinischen und dem Arabischen wurden in einem Glossar im Anhang des Buches zusammengestellt, übersetzt und erklärt.
Weiterhin haben wir im Anhang nach Seitenzahl geordnete »Anmerkungen des Übersetzers« zusammengestellt, in denen Textstellen erläutert werden, die auf überlieferte theologische Lehren, wichtige Philosophen oder geistige Meister sowie heilige Schriften der Weltreligionen anspielen.
1 Deutsch: Von der inneren Einheit der Religionen. Freiburg i. Br. 2007.
[1]ERSTER TEIL KONTROVERSEN
[2][3]Das Gefühl für das Absolute in den Religionen
Einer der Hauptgründe für das gegenseitige Unverständnis, das sich wie eine unüberwindliche Schranke zwischen die Religionen stellt, scheint uns darin zu bestehen, dass das Gefühl für das Absolute jeweils auf einer anderen Ebene liegt, sodass sich Vergleichspunkte meistens als trügerisch erweisen. Formal ähnliche Elemente fügen sich in dermaßen verschiedenartige Zusammenhänge ein, dass sich ihre Funktion – und in der Folge auch ihre Natur, zumindest in einem gewissen Maße – von einem zum anderen Fall ändert; das ist so, weil die Unendlichkeit des Möglichen jede genaue Wiederholung ausschließt. Der zureichende Grund für eine »neue« Erscheinung ist, vom Standpunkt der Kundgabe von Möglichkeiten, letztlich ihre Unterschiedlichkeit in Bezug auf »vorhergehende« Erscheinungen; anders gesagt: Welten sind nicht füreinander gemacht, und die Ursache für ihre Besonderheiten ist auch diejenige für ihre Verschiedenheiten und somit für ihren wechselseitigen Ausschluss. Wir könnten dieser Lage Rechnung tragen, indem wir jeder Welt ihre eigene Sprache ließen, und wir nicht versuchen zu zeigen, dass diese Sprache nur eine Sprache unter anderen ist; wir leben aber in einer Zeit, in der die gegenseitige Durchdringung der Kulturen zu vielen – zwar nicht neuen, aber ungemein »aktuellen« und »drängenden« – Problemen führt, und in der die Verschiedenartigkeit der überlieferten Sichtweisen denen einen billigen Vorwand liefert, die jegliche Vorstellung des Absoluten und alle damit zusammenhängenden Werte zunichtemachen wollen. Angesichts eines immer mehr überhandnehmenden Relativismus muss der Intelligenz der Sinn für das Absolute zurückgegeben werden, selbst auf die[4] Gefahr hin, dabei die Relativität hervorheben zu müssen, in welche die unwandelbaren Dinge gekleidet sind.
Es scheint für den Menschen ganz natürlich zu sein, die »Struktur« seiner religiösen Überzeugung zu verallgemeinern: So ergibt sich die Überzeugung des Christen aus der Göttlichkeit Christi und folglich aus den Zeichen, die diese Göttlichkeit bekunden, dann aus deren erlösender Kraft und schließlich aus der Geschichtlichkeit all dieser Faktoren; da sich der Christ ausschließlich auf diese Maßstäbe stützt und da er nirgendwo das ihnen genau Entsprechende findet, wird er außerhalb seines geistigen Kosmos nur Ungereimtheit sehen. Der Muslim hat dasselbe Gefühl, allerdings zugunsten des Islam und aus einem gleichsam umgekehrten Grund: Während im Christentum das »fleischgewordene Wort« den Mittelpunkt der Religion bildet, sodass die Kirche nur dessen »mystischer Leib« ist, ist es im muslimischen Umfeld der Islam als solcher – das göttliche Gesetz, das den Menschen und die gesamte Gesellschaft umfasst –, der an erster Stelle von Bedeutung ist; es geht hier also um eine »Gesamtheit« und nicht um einen »Mittelpunkt«, der Prophet ist nämlich nicht der bestimmende Mittelpunkt, von dem sich alles ableiten lässt, sondern die Verkörperung dieser Gesamtheit; die Betonung liegt auf dieser und nicht auf dem Wortführer, und es ist die göttliche Qualität dieser Gesamtheit – dieser irdischen Kristallisation des himmlischen Willens1 – und dann die sich aus der Ausübung der Religion ergebende innere Erfahrung, die dem Muslim seine tiefe Überzeugung zuteil werden lässt; fügen wir noch hinzu, dass der Koran, auch wenn er der »Mittelpunkt« oder das »christliche« Element der Religion ist, zu deren unwiderstehlichem Element nur durch[5] seine Entfaltung – den Islam eben – wird, welche wie ein System von Kanälen erscheint, die von Gott dafür bereitet sind, den Fluss des menschlichen Willens aufzunehmen und zu lenken. Während für den Christen das Glück darin besteht, sich an die erlösende Göttlichkeit Christi zu klammern, selbst wenn das bedeutet, an seinem Kreuz teilzuhaben, wird demgegenüber für den Muslim das Glück darin bestehen, sich in einer Gesamtheit zu entfalten, Gott seinen Willen »hinzugeben« (aslama, daher das Wort Islâm), ihn in die Form eines göttlichen Wollens zu »übergeben«, das die ganze menschliche Person umfasst, vom Leib bis zum Geist, und von der Geburt bis zur Begegnung mit Gott. Wenn das Christentum »Gott in den Menschen versetzt« durch das Mysterium der Fleischwerdung, versetzt das Judentum seinerseits »den Menschen in Gott« durch das Mysterium des »auserwählten Volkes«; unmöglich ist es, den jüdischen Gott von seinem Volk zu trennen: Wer Jahwe sagt, sagt Israel, und umgekehrt. Die große Offenbarung des Monotheismus – oder die große persönliche Kundgabe Gottes – kommt aus Israel, und diese »Tatsache«, das Mysterium vom Sinai, verleiht, in Verbindung mit der Erwählung dieses Volkes, dem gläubigen Juden seine unerschütterliche Überzeugung und bildet für ihn jenes »Element des Absoluten«, ohne das kein religiöser Glaube möglich ist.
Für den Christen ist das überwältigende Argument die Göttlichkeit Christi und, im Zusammenhang damit, die Tatsache, dass es einen Mittler zwischen Gott und Mensch gibt, in der Gestalt des menschgewordenen Gottes, ganz abgesehen von einer anderen Vermittlerin, der Gottesmutter; wenn das Argument der Göttlichkeit aber voraussetzt, dass man von ihr den Wert der Botschaft abhängig macht, dann setzt das Argument der Nähe voraus, dass Gott entfernt ist, was offensichtlich zutrifft, aber nicht in jeder Hinsicht; der Islam geht ja davon aus, dass Gott unendlich transzendent und gleichzeitig unendlich[6] nahe ist – »näher als eure Halsschlagader« –, sodass er uns in der religiösen Erfahrung umgibt und uns durchdringt, wie eine Art leuchtenden Äthers, wenn es erlaubt ist, sich einer so bildhaften Ausdrucksweise zu bedienen; der einzig notwendige Mittler ist unsere rechte Haltung, al-islâm, deren wichtigstes Element das Gebet in all seinen Formen ist. Der jüdische Gott war »fern«, aber er wohnte inmitten seines Volkes, und er sprach zuweilen zu ihm; der christliche Gott – der Gottmensch – ist der »Mittler« zwischen diesem fernen Gott und dem Menschen, diesem von nun an schweigenden und barmherzigen Gott; und was den Gott des Islam betrifft, so ist er seinerseits »nahe« (al-Qarîb), ohne »menschlich« zu sein. Es gibt natürlich keine verschiedenen Götter; es geht lediglich um verschiedene Sichtweisen und die ihnen jeweils entsprechenden »göttlichen Haltungen«. Gott ist immer und überall Gott, und deshalb findet sich jede dieser Haltungen auf ihre Weise im Schoß der beiden anderen wieder; es gibt immer, auf die eine oder andere Weise, »Ferne« und »Nähe«, so wie es immer ein »vermittelndes« Element gibt.
Die Tatsache, dass das »Gefühl für das Absolute« von einer zur anderen Religion nicht auf genau dasselbe organische Element übertragen wird – daher auch die Unmöglichkeit von außen vorgenommener Vergleiche religiöser Elemente –, ergibt sich aus dem jeweiligen Charakter des Übertritts zum Christentum oder zum Islam: Während der Übertritt zum Christentum sich in gewisser Hinsicht wie der Beginn einer großen Liebe darstellt, die das ganze vergangene Leben unnütz und banal erscheinen lässt – es ist eine »Wiedergeburt« nach einem »Tod« –, ist der Übertritt zum Islam demgegenüber wie das Erwachen aus einer unglücklichen Liebe oder wie die Nüchternheit nach einem Rausch oder auch wie die Morgenfrische nach einer qualvollen Nacht; im Christentum ist die Seele in ihrer angeborenen Ichbezogenheit »zu Tode erkaltet«, und Christus ist[7] das zentrale Feuer, das sie wieder erwärmt und zum Leben erweckt; im Islam dagegen »erstickt« die Seele in der Enge derselben Ichbezogenheit, und der Islam erscheint wie die kühle Unermesslichkeit des Raums, die ihr ermöglicht, »wieder zu atmen« und sich zum Unbegrenzten hin »zu entfalten«. Das »zentrale Feuer« wird durch das Kreuz dargestellt; die »Unermesslichkeit des Raumes« durch die Kaaba, den Gebetsteppich, das abstrakte Flechtwerk der Kunst.
Mit einem Wort, der Glaube des Christen ist eine »Sammlung« und der des Muslims eine »Weitung« (bast, inshirâh), wie es übrigens der Koran zum Ausdruck bringt;2 jede dieser »Weisen« findet sich zwangsläufig wieder im Bereich der »entgegengesetzten« Sichtweise. Die »Sammlung« oder die »Wärme« kehrt in der sufischen Liebe (mahabbah) wieder, während die »Weitung« oder die »Frische« in der christlichen Gnosis zum Vorschein kommt und, allgemeiner, im »Frieden« Christi als Grundlage der »Reinheit des Herzens« und der Beschauung.
Der Übergang von einer asiatischen Überlieferung – Hinduismus, Buddhismus oder Taoismus – zu einer anderen ist möglicherweise eine Kleinigkeit in Anbetracht dessen, dass der metaphysische Gehalt überall offen zutage liegt und sogar die Verhältnismäßigkeit der »mythologischen« Verschiedenartigkeiten hervorhebt; diese Religionen nehmen sogar – aufgrund ihrer geistigen Durchsichtigkeit – bereitwillig Elemente aus fremden Überlieferungen auf; die Gottheit des Shintoismus wird ein Bodhisattva, ohne dabei ihr Wesen zu verändern, da die Namen nur allgemeingültige Wirklichkeiten verdecken.[8]Im Rahmen der drei semitischen Überlieferungen aber ist der Wechsel der Religion gleichsam ein Wechsel des Planeten, denn hier müssen sich die unterschiedlichen »alchemischen Standpunkte« auf den gleichen prophetischen und messianischen Monotheismus stützen, sodass die jeweilige Form den ganzen Menschen mit Beschlag belegt; die geistigen »Schlüssel« stellen sich gerne als ausschließlich der eigenen Überlieferung vorbehaltene »Tatsachen« dar, die sonst unwirksam würden: Allein die Gnosis hat das Recht zu erkennen, dass ein Schlüssel ein Schlüssel ist.3 Metaphysische Offenkundigkeit hat Vorrang[9] vor »physischer« oder auf »Erscheinungen« beruhender Gewissheit, dort, wo sich die Frage stellen mag; dagegen vermag diese Gewissheit nie die Offenkundigkeit der Grundsätze, den ewigen »Gedanken« Gottes, zu entkräften oder aufzuheben
Die religiösen Unterschiede spiegeln sich ganz deutlich in den unterschiedlichen Arten heiliger Kunst wider. Verglichen mit gotischer Kunst, vor allem dem Flamboyantstil, ist die muslimische Kunst eher beschaulich als willensmäßig: Sie ist »intellektuell« und nicht »dramatisch«, und sie setzt dem mystischen Heroismus der Kathedralen die kühle Schönheit der Geometrie entgegen. Der Islam ist die Sichtweise der »Allgegenwart« (»Gott ist überall«), welche mit jener der »Gleichzeitigkeit« (»die Wahrheit ist immer schon dagewesen«) übereinstimmt; er möchte jegliche »Sonderung« oder »Verdichtung« vermeiden, jegliche »einzigartige Tatsache« in Zeit und Raum, auch wenn er als Religion zwangsläufig etwas von einer »einzigartigen Tatsache« enthält, sonst wäre er unwirksam oder gar sinnwidrig. Anders gesagt, zielt der Islam auf das ab, was »überall Mitte« ist, und deshalb ersetzt er, sinnbildlich gesprochen, das Kreuz durch den Würfel oder durch das Gewebe: Er »dezentralisiert« und »universalisiert« so weit wie möglich, im Bereich der Kunst ebenso wie in dem der Lehre; er stellt sich jeglichem individualistischen Knoten entgegen und somit jeglicher »personalistischen« Mystik.
Um uns in der Sprache der Geometrie auszudrücken, würden wir sagen, dass ein Punkt, der einzigartig sein möchte und der so ein absoluter Mittelpunkt wird, dem Islam – in der Kunst so wie in der Theologie – wie eine widerrechtliche Aneignung der göttlichen Absolutheit und damit wie eine »Beigesellung« (Shirk) erscheint; es gibt nur einen Mittelpunkt, Gott, daher das Verbot von »zentralisierenden« Bildnissen, vor[10] allem von Statuen; sogar der Prophet, der menschliche Mittelpunkt der Überlieferung, hat kein Recht auf eine »christusartige Einzigkeit« und wird »dezentralisiert« durch die Reihe der anderen Propheten; dasselbe gilt für den Islam – oder den Koran –, der ebenfalls Teil eines allheitlichen »Gewebes« und eines kosmischen »Rhythmus« ist, da ihm ja andere Religionen – oder andere »Bücher« – vorausgegangen sind, die er lediglich erneuert. Die Kaaba, der Mittelpunkt der muslimischen Welt, wird zum Raum, sobald man sich im Inneren des Gebäudes befindet: Die rituelle Gebetsrichtung richtet sich dann auf die vier Kardinalpunkte. Wenn das Christentum wie ein zentrales Feuer ist, stellt sich der Islam demgegenüber wie eine zugleich einende und einebnende Schneedecke dar, deren Mittelpunkt überall ist.
Es gibt in jeder Religion nicht nur eine willensmäßige Wahl zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, sondern auch eine intellekthafte Wahl zwischen der Wahrheit und dem Irrtum; es gibt jedoch Unterschiede des wechselseitigen Bezugs in dem Sinne, dass Christus wahr ist, weil er der Erlöser ist – daher die Bedeutung, die hier dem Element des Phänomens eingeräumt wird –, wohingegen der Islam zu erlösen beabsichtigt, indem er von einer letzten Endes metaphysischen Unterscheidung (lâ ilaha illâh ’Llâh) ausgeht, welche die rettende Wahrheit ist; ob es sich um das Christentum oder um den Islam oder um jede andere überlieferungsmäßige Form handelt, es ist jedenfalls die metaphysische Wahrheit, die, dank ihrer Allgemeingültigkeit, den Wert der Dinge bestimmt. Und so wie diese Wahrheit alles umfasst und durchdringt, gibt es in ihr weder »diesseits« noch »jenseits« und auch keine willensmäßige Wahl; allein die allheitlichen Wesenheiten zählen, und diese sind »überall und nirgends«; es ist auf dieser Ebene keine willensmäßige[11] Wahl zu treffen, denn »die Seele ist alles, was sie erkennt«, wie Aristoteles gesagt hat. Diese beschauliche Seelenruhe scheint auf in der abstrakten Frische von Moscheen und auch in vielen romanischen Kirchen und in gewissen Elementen der besten gotischen Kirchen, namentlich in den Rosetten, die in diesen Heiligtümern der Liebe wie der »Spiegel der Gnosis« sind.
Auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen, kehren wir noch zu einigen Parallelen zurück: Wenn das Christentum sich zumindest teilweise mithilfe der Worte »Wunder«, »Liebe«, »Leiden« kennzeichnen lässt, entspricht der Islam seinerseits der Dreiheit »Wahrheit«, »Kraft«, »Armut«; die muslimische Frömmigkeit lässt weniger an einen von süßer und belebender Wärme erfüllten »Mittelpunkt« denken – das ist die christliche Barakah –, als an ein in weißem und frischem Licht erscheinendes »Geschenk«; die geistigen Mittel sind eher dynamisch als gefühlsmäßig, auch wenn die Unterschiede in diesem Bereich zweifellos nichts Absolutes an sich haben. Die muslimische Askese hat etwas Trockenes an sich, etwas von der Wüste, sie kennt nicht das dramatische Gebaren der Askese des Abendlandes; es gibt aber in ihrer Atmosphäre der patriarchalischen Armut ein musikalisches und lyrisches Element, das auf einer anderen Grundlage die christliche Atmosphäre neu erschafft.
Wir haben weiter oben gesagt, dass der Islam sich auf das Element »Wahrheit« gründet – das heißt, er legt die Betonung dorthin entsprechend seinem eigenen Standpunkt und seiner Absicht –, und dass es das »Unpersönliche« dieses Elements ist, das die islamische »Mythologie« »dezentralisiert«. Im Christentum denkt man zweifellos, dass die – durch Christus kundgegebene – »göttliche Wirklichkeit« den Vorrang habe vor der »Wahrheit«, da die »Wirklichkeit« »konkret« und die »Wahrheit« »abstrakt« sei, und dies ist genau dann der Fall, wenn man die »Wahrheit« auf das Denken beschränkt; man sollte jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass wir a[12] priori keinerlei Erkenntnis des Wirklichen haben ohne metaphysische Wahrheit, unabhängig von dem Grad unseres Verständnisses; andererseits wird das Wort »Wahrheit« oftmals als Synonym für die »Wirklichkeit« genommen – »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben« –, und so versteht es der Islam. Gerade deshalb, weil wir zunächst keine Erkenntnis über die »Wahrheit« hinaus haben, nennen wir zu Recht das »wahr«, was »wirklich« ist, eine Terminologie, die in keiner Weise die – möglicherweise »konkrete« – Wirksamkeit unserer, wie es scheint, »abstrakten« Erkenntnis beeinträchtigt. In jedem Fall ist die »subjektive« Kundgabe des Absoluten nicht weniger wirklich als seine »objektive« Kundgabe; die Gewissheit ist nicht weniger als das Wunder.
Eine Frage, die hier unbedingt zur Sprache gebracht werden muss, ist die nach der Geschichtlichkeit der großen religiösen Phänomene: Muss man nicht in diejenige Überlieferung sein Vertrauen setzen, welche die größtmögliche Geschichtlichkeit bietet? Hierauf ist zu antworten, dass es keinen metaphysischen oder geistigen Unterschied gibt zwischen einer durch zeitliche Tatsachen bekundeten Wahrheit und einer durch andere Sinnbilder ausgedrückten Wahrheit, in mythologischer Form beispielsweise; die Art und Weise der Bekundung entspricht jeweils den geistigen Erfordernissen der menschlichen Gruppierungen. Wenn gewisse Mentalitäten das Wunderbare bevorzugen, das für die geschichtliche »Wirklichkeit« erfahrungsmäßig »unwahrscheinlich« ist, dann gerade deshalb, weil das Wunderbare – ohne das im Übrigen keine Religion auskommen kann – auf die Transzendenz in Bezug auf irdische Tatsachen hinweist; wir sind beinahe versucht zu sagen, dass das Unwahrscheinliche der zureichende Grund für das Wunderbare ist, und es ist dieses unbewusste Bedürfnis,[13] das Wesen der Dinge zu spüren, das die Neigung zur Übertreibung bei manchen Völkern erklärt; es ist wie eine Spur der Sehnsucht nach dem Unendlichen. Die Wunder sind ein Zeichen für einen Eingriff des Wunderbaren in den Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren; wer Wunder gelten lässt, muss auch den Grundsatz des Wunderbaren als solchen gelten lassen und sogar, auf einer bestimmten Ebene, fromme Übertreibung zulassen. Die Zweckdienlichkeit des »mythologischen« Wunderbaren einerseits und das Vorhandensein von Widersprüchen zwischen den Religionen andererseits – die nicht auf eine echte Sinnwidrigkeit innerhalb einer bestimmten Religion schließen lassen, genauso wenig wie die in jeder Religion vorhandenen inneren Widersprüche sinnwidrig sind –, diese Faktoren, sagen wir, zeigen auf ihre Weise, dass für Gott die Wahrheit vor allem in der erleuchtenden Wirksamkeit des Sinnbildes besteht und nicht in dessen buchstäblicher Bedeutung; und dies gilt umso mehr, als Gott, dessen Weisheit über Worte hinausgeht, vielfache Bedeutungen in einen einzigen Ausdruck legt.4 Eine – elliptische oder antinomische – Dunkelheit im Ausdruck weist auf einen Reichtum oder eine Tiefe der Bedeutung hin, und das erklärt die scheinbaren Zusammenhanglosigkeiten, denen wir in heiligen Schriften begegnen. Gott offenbart auf diese Weise seine Transzendenz bezüglich der Grenzen der menschlichen Logik. Die menschliche Sprache kann nur auf mittelbare Weise göttlich sein, sodass sich weder unsere Worte noch unsere Logik auf der Höhe der göttlichen Absicht befinden. Das ungeschaffene göttliche Wort zerbricht die geschaffene Rede und lenkt sie gleichzeitig auf die konkrete und erlösende Wahrheit.
Muss man – unter dem Vorwand, Grundsätze hätten Vorrang vor Erscheinungen – aus all dem schließen, dass aus[14] geistiger Sicht eine geschichtliche Grundlage in sich weniger annehmbar ist als eine mythologische oder rein metaphysische Grundlage? Sicher nicht, sofern es um Sinnbildlichkeit geht; weniger annehmbar ist es, dieser geschichtlichen Grundlage eine Tragweite beizumessen, die sie nicht haben kann, sie an die Stelle der sinnbildlichen Wahrheit und der metaphysischen Wirklichkeit zu setzen, welche sie ausdrückt; die Bedeutung der geschichtlichen Tatsache bleibt unberührt hinsichtlich heiliger Einrichtungen. Von einem anderen Standpunkt aus sollte man festhalten, dass eine überlieferte Erzählung immer wahr ist: Die mehr oder weniger mythischen Züge, die das geschichtliche Leben des Buddha überlagern, sind alles Weisen, geistige Wirklichkeiten auszudrücken, die schwerlich anders zu vermitteln wären.5 Da, wo die Offenbarung ganz ausdrücklich auf der Geschichte gründet, und in dem Maße, wie sie das tut, ist diese geschichtliche Weise zweifellos notwendig: In einer Welt, die Erbe des jüdischen »Historismus« und des aristotelischen Empirismus war, konnte die Offenbarung nicht umhin, die Form eines irdischen Ereignisses anzunehmen, dem keinerlei nicht-geschichtliche Sinnbildlichkeit hinzugefügt wurde; wir müssen aber feststellen, dass eine zu große Betonung der Geschichtlichkeit – nicht die Geschichtlichkeit als solche – eine Beeinträchtigung des metaphysischen Gehalts heiliger Tatsachen oder ihrer geistigen »Durchsichtigkeit« bewirkt und sogar – in Form einer missbräuchlichen Kritik – damit endet,[15] dass die Geschichte »ausgehöhlt« wird und das herabgesetzt wird, dessen Größe man nicht versteht.6
Man wird zweifellos zugunsten der strengen Geschichtlichkeit und gegen die Mythologien Asiens einwenden, dass die Geschichte Beweise für die Gültigkeit der Gnadenmittel liefert: Diesbezüglich muss man zunächst darauf aufmerksam machen, dass geschichtliche Beweise in diesem Bereich eben nicht völlig streng sein können, und dann, dass die Überlieferung als solche, mit allem, was sie an Sinnbildlichkeit, Lehre und Heiligkeit umfasst – um nicht von anderen, mehr oder weniger unbestimmten Prüfsteinen zu sprechen –, viel mehr unanfechtbare Beweise für den göttlichen Ursprung und die Gültigkeit der Riten liefert; in gewissem Sinne ist die Annahme eines Gnadenmittels durch die Überlieferung – und dessen Wirksamwerden in der Heiligkeit – ein viel überzeugenderes Kriterium als die Geschichtlichkeit, um nicht von dem inneren Wert der heiligen Schriften zu sprechen. Die Geschichte ist oft nicht nachprüfbar; die Überlieferung ist es, die für sie bürgt, nicht die historische Kritik; gleichzeitig verbürgt aber die Überlieferung die Gültigkeit nicht-geschichtlicher Sinnbildlichkeiten. Es ist das gegenwärtige und andauernde Wunder der Überlieferung, das den Einwand zunichtemacht, dass kein lebender Mensch Zeuge der[16] heiligen Geschichte gewesen ist; die Heiligen sind dafür sehr viel bessere Zeugen als die Historiker; die Überlieferung als Gewähr für die Wahrheit zu leugnen, läuft letzten Endes darauf hinaus, dass es Wirkungen ohne Ursachen gibt.
Es gibt zweifellos keine »genauere« Wahrheit als die der Geschichte; es muss aber gesagt werden, dass es eine »wirklichere« Wahrheit gibt als die der Tatsachen; die höhere Wirklichkeit schließt die »Genauigkeit« ein, diese ist dagegen aber weit davon entfernt, jene vorauszusetzen. Die geschichtliche Wirklichkeit ist weniger »wirklich« als die tiefe Wahrheit, welche sie ausdrückt und welche auch die Mythen ausdrücken; eine mythische Sinnbildlichkeit ist also unendlich viel »wahrer« als eine Tatsache ohne Sinnbildlichkeit. Und das bringt uns wieder darauf, was wir weiter oben gesagt haben, nämlich, dass die mythologische oder geschichtliche Zweckdienlichkeit des Wunderbaren, genauso wie das Vorhandensein dogmatischer Antinomien, zeigt, dass für Gott die Wahrheit vor allem in der Wirksamkeit des Sinnbildes besteht und nicht in der »nackten Tatsache«.
Vom Standpunkt der Geschichtlichkeit oder ihrer Abwesenheit muss man drei Stufen unterscheiden: Mythologie, eingeschränkte Geschichtlichkeit, genaue Geschichtlichkeit. Wir finden die erste Stufe in jeder Mythologie im eigentlichen Sinne und auch in den monotheistischen Schöpfungsberichten, die zweite Stufe in anderen »prähistorischen« Erzählungen, sei es die von Noah oder die von Jonas oder die von den menschlichen Avatâras von Vishnu.7 Im Judentum beginnt die strenge[17] Geschichtlichkeit vielleicht am Sinai; im Christentum erscheint sie im ganzen Neuen Testament,8 aber nicht in den Apokryphen und auch nicht in der Legenda aurea, Schriften, die im Übrigen nicht kanonisch sind, wodurch sie in unverdiente Missachtung gerieten, ist doch die Sinnbildlichkeit ein wesentlicher Träger der Wahrheit; im Islam schließlich kommt genaue Geschichtlichkeit dem Leben des Propheten und seiner Gefährten zu, sowie deren durch die Überlieferung anerkannten Aussprüchen (Ahâdîth),9 nicht aber Geschichten, welche die[18] vorislamischen Propheten und Ereignisse betreffen, welche gewiss aus »genauen«, aber mehr oder weniger »mythischen« Sinnbildern gewoben sind; sie wortwörtlich zu nehmen, heißt jedoch immer, sich in Ermangelung eines wirklichen Verständnisses von ihrer »alchemischen« Kraft anregen zu lassen.10
Die geschichtliche Sichtweise – so wichtig sie für eine gewisse Ebene der christlichen Lehre ist – ist jedoch nur insofern gerechtfertigt, als sie sich in die platonische Nicht-Geschichtlichkeit einfügt. Der christliche »Personalismus« rührt von der Fleischwerdung her, und dann vom »bhaktischen« Charakter des Christentums, einem Charakter, der durchaus nicht verhindert, dass diese Religion die Metaphysik und die Gnosis »enthält«, denn Christus ist »das Licht der Welt«; die Gnosis ist aber nicht für jeden, und eine Religion kann nicht metaphysisch in ihrer Form sein; der Platonismus dagegen, der keine Religion ist, kann es. Der christliche »Historismus«, der mit dem jüdischen »Historismus« verbunden ist, schließt also keinerlei Überlegenheit hinsichtlich anderer Sichtweisen in sich, und auch keinerlei Unterlegenheit, wenn das betreffende[19] Merkmal seinen Platz auf der Ebene hat, die ihm rechtmäßig zukommt.
Hat der Gegenstand des Glaubens Vorrang vor dem Glauben selbst, oder hat der Glaube Vorrang vor seinem Gegenstand? Normalerweise hat der Gegenstand Vorrang vor dem Glauben, da er ja die Bestimmung des Glaubens und dessen zureichender Grund ist; von einem bestimmten Standpunkt aus und in bestimmten Fällen kann der Glaube aber die Oberhand über seinen Inhalt gewinnen und die Türen des Himmels »aufbrechen«, ungeachtet der Unzulänglichkeit eines bestimmten unmittelbaren Glaubensgegenstandes. Der Glaube besteht aus zwei »Polen«, einem objektiv-dogmatischen und einem subjektiv-mystischen; ideal ist ein vollkommener Glaube an eine orthodoxe Wahrheit. Die Idee erzeugt den Glauben, und die Qualität der Idee bestimmt die Qualität des Glaubens; das oftmals paradoxe und unvorhersehbare Spiel der Allmöglichkeit kann allerdings die Vorherrschaft des Pols »Glauben« über den Pol »Idee« zulassen, sodass die Tibeter sagen konnten, dass der irrtümlicherweise für eine Reliquie gehaltene Zahn eines Hundes schließlich doch strahlt, wenn er Gegenstand eines aufrichtigen und inbrünstigen Glaubens ist.11 Es gibt nämlich einen Glauben, der in seinem Wesensgehalt von einer Wahrheit geprägt ist, die dem Alltagsbewusstsein mehr oder weniger unbekannt ist, vorausgesetzt, dass kein wesentlicher Irrtum die Qualität dieser Inbrunst gefährdet; sie muss von einer solchen Reinheit und einem solchen Adel sein, dass sie dadurch vor einschneidenden Irrtümern geschützt ist; ein derartiger Glaube ist wie eine »daseinsmäßige« Intuition seines »geistigen«[20] Gegenstandes. Diese Möglichkeit eines Glaubens, der Vorrang hat vor dem »ideenhaften« Element und der es gewissermaßen »dazu zwingt«, schließlich die Wahrheit hervorzubringen, setzt eine besonders beschauliche und von vielen Hindernissen freie Mentalität voraus; mehr noch, wenn die Qualität des Glaubens auf diese Weise die Ungewissheit der Idee auszugleichen vermag, dann muss diese Idee wie ein – wenn auch noch so schwaches – Licht in Erscheinung treten und nicht wie eine Dunkelheit; es gibt auf dieser Ebene viele Unwägbarkeiten.
Man wird die geringe Beachtung verstehen, welche die Bhaktas, oder manche von ihnen, dem Gegenstand, oder eher dem »Wort-für-Wort« des Glaubens oder des Kultes schenken, wenn man ihren »Subjektivismus« bedenkt – wir sagen nicht »Individualismus« –, der alle Maßstäbe für die Wahrheit in der Intensität des Glaubens und in der Verneinung des Ich findet; es ist richtig, dass sich eine derartige Haltung in keiner überlieferungsmäßigen Atmosphäre leicht verwirklichen lässt, es sei denn, man denkt – einmal abgesehen von jeglicher Frage der Lehre – an jene einfachen Seelen, die einem bestimmten frommen Bild einen rührenden und wirksamen Kult weihen, und denen man sub omni caelo begegnet. Wir wollen gewiss nicht die Naivität mit echter, wenn auch nur passiver, Häresie verwechseln, wenngleich jede begrenzte Auffassung vom Standpunkt der reinen Wahrheit aus zunächst einmal etwas Häretisches an sich hat; alles, was wir hier sagen wollen, ist nicht, dass der Irrtum als solcher berechtigt sein kann, sondern dass es de facto, als »Ausnahme, die die Regel bestätigt«, eine Vorherrschaft der Magie der Seele über die Richtigkeit des Sinnbildes gibt, und dass man dem Rechnung tragen muss, wenn man alle Seiten des ewigen Hin und Her zwischen Mensch und Gott begreifen will. Es geht hier um eine Möglichkeit, die vielleicht weniger die Menschen selbst betrifft als die Art und Weise, wie Gott sie betrachtet und beurteilt. Das ist das ganze[21] Mysterium des »Glaubens, der Berge versetzt« und der »rettet«, wie unwissend wir auch sein mögen.
Eine gewisse Umkehrung der normalen Polarität des Glaubens ist im Übrigen in jedem echten Glauben anzutreffen, in dem Sinne, dass der Gegenstand des Glaubens sich a priori als »Buchstabe, der tötet« zeigt; in diesem Fall sind aber die normalen Beziehungen der Dinge nicht berührt, denn das geistig zu erfassende Sinnbild behält seinen ganzen Wert.
Die Gnosis oder die Philosophia perennis ist das Bindeglied zwischen den verschiedenen religiösen Sprachen. Die Weise, wie sich die Gnosis bekundet, ist »senkrecht« und mehr oder weniger »nicht-zusammenhängend«, sie ähnelt dem Feuer und nicht dem Wasser, in dem Sinne, dass das Feuer aus dem Unsichtbaren ausbricht und dorthin verschwinden kann,12 wohingegen das Wasser eine zusammenhängende Daseinsform besitzt; die heiligen Schriften bleiben aber die notwendige und unwandelbare Grundlage, die Quelle der Inspiration und der Prüfstein jeglicher Gnosis.13 Die unmittelbare und übergedankliche Schau durch den Intellekt ist in Wirklichkeit eine »Erinnerung« und keine »Erwerbung«: Das Erkenntnisvermögen nimmt in[22] diesem Bereich nicht von etwas grundsätzlich außerhalb von ihm Liegenden Kenntnis, vielmehr ist jede mögliche Erkenntnis im Gegenteil in der leuchtenden Substanz des Intellekts enthalten – die mit dem Logos durch »wesenhaften Zusammenhang« gleichgesetzt wird –, sodass die »Erinnerung« nichts anderes ist als eine durch eine äußere Gelegenheitsursache oder eine innere Inspiration verursachte Aktualisierung einer bestimmten ewigen Möglichkeit der intellekthaften Substanz. Eine Unterscheidung gibt es nur in Bezug auf das Verhältnismäßige, selbst wenn sich dieses Verhältnismäßige jenseits der Schöpfung und sogar auf der Ebene des Seins befindet, und das erklärt, warum der Intellekt mit einem tiefen – aber außerordentlich nicht-passiven und über-bewussten – Schlaf verglichen worden ist, der durch keinerlei Traum gestört wird; der Intellekt stimmt in seiner innersten Natur mit dem Sein der Dinge überein;14 und deshalb zeigt die Gnosis den tiefen Zusammenhang auf zwischen den verschiedenen Formen des Bewusstseins des Absoluten.
Und warum dieses Bewusstsein, wird mancher fragen? Weil allein die Wahrheit frei macht; oder, noch besser: weil es kein »Warum« bezüglich der Wahrheit gibt, denn sie ist unsere Intelligenz, unsere Freiheit und unser Sein; wenn sie nicht ist, sind wir nicht.
1 Dieser Wille wird hier zugleich als »göttliches Wort« und als »ungeschaffenes Buch« verstanden.
2 »Haben Wir (Gott) nicht deine Brust erweitert (oder »geöffnet«), (o Mohammed), und dir die Bürde genommen, die auf deinem Rücken lastete?« (Sure »Das Weiten« [94],1-3). Und genauso: »Wen Gott rechtleiten will, dem weitet Er die Brust für den Islam, und wen Er irreführen will, dem macht er die Brust eng und bedrückt ihn« (Sure »Das Vieh« [6], 125).
3 Wenn man die Absichten, die sich hinter sprachlichen Ausdrucksweisen verbergen, genau untersucht, bemerkt man, dass die scheinbare Ablehnung der Göttlichkeit Christi durch den Islam nicht bedeutet, dass der Standpunkt der Einheit eine bestimmte grundlegende Wirklichkeit leugnet, sondern dass seine geistige Struktur die christliche Ausdrucksweise ausschließt; anders gesagt, zerlegt der Islam die Person des Gottmenschen in zwei Teile, entsprechend der Ebenen, auf die sich die beiden Naturen beziehen, und er tut das, weil er das Sein nur in seiner außerkosmischen Göttlichkeit ins Auge fasst. Diese Sichtweise, die nicht umhin kann, eine dogmatische Gestalt anzunehmen, beabsichtigt gleichzeitig, die Gefahr der praktischen »Vergöttlichung« des menschlichen Individuums abzuwenden, das heißt die des individualistischen »Humanismus« und all seiner Folgeerscheinungen; es gibt nämlich so etwas wie eine gegenteilige Rückwirkung der »Vergöttlichung«. – Vom muslimischen Standpunkt aus bedeutet das Wort Christi: »Ehe Abraham ward, bin ich«, dass der Logos, das ungeschaffene »Wort« Gottes, und folglich der Intellekt als solcher, grundsätzlich jeder zeitlichen Kundgabe »vorausgeht«, selbst wenn sie prophetisch und uranfänglich ist. – Was die scheinbare Leugnung der Kreuzigung durch den Koran betrifft, haben wir immer die Auffassung vertreten, dass es sich hier um Theologie handelt und nicht um Geschichte, und wir sind derselben Ansicht in einer Arbeit von Massignon begegnet (Le Christ dans les Évangiles selon Al-Ghazâli): »… Abû Hâtim erklärt auf der Grundlage der Ansicht eines seiner Meister (der nicht genannt wird), dass der Beginn des Koranverses (Sure »Die Frauen« [4],157) die Kreuzigung in keiner Weise leugnet, und dass er von seinem Ende her gedeutet werden muss: ›Und sie töteten ihn nicht wirklich (yaqînâ), Gott erhob ihn zu sich‹, und da Jesus als Märtyrer starb, müsse man diesen Vers auch in Verbindung mit den Versen über den Tod der Märtyrer sehen (Sure »Die Kuh« [2],154; vgl. Sure »Das Haus ‘Imrâns« [3],169): ›Und sagt nicht von denen, die auf dem Pfad Gottes getötet wurden, sie seien tot, sondern dass sie lebendig sind; doch ihr versteht es nicht‹«.
4 Genauso wie der Schlag eines Hammers eine Vielzahl von Funken hervorbringt, genauso – sagen die Kabbalisten – enthält ein Wort der Thora vielfache Bedeutungen.
5