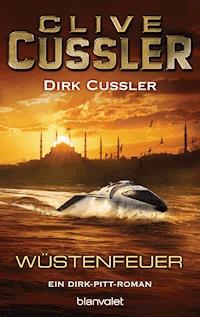
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Dirk Pitt wollte in Istanbul eigentlich nur Urlaub machen – und gerät in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen, Geheimdienstverschwörungen und Verrat. Denn der skrupellose Politiker Battal hat Terroristen angeheuert, die Schrecken und Panik in der Türkei verbreiten, damit er mit seinen Hassparolen die nächsten Wahlen für sich entscheiden kann. Nur Dirk Pitt kann Battals mörderischen Plan noch stoppen, bevor der die ganze Welt in Brand steckt. Doch zunächst muss er ein Rätsel aus fernster Vergangenheit lösen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Dirk Cussler
Wüstenfeuer
Ein Dirk-Pitt-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Crescent Dawn« bei Putnam’s Sons, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2010 by Sandecker, RLLLP
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Joern Rauser
HK · Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-15207-9
www.blanvalet.de
PROLOG GEFÄHRLICHE HORIZONTE
327 n. CHR. MITTELMEER
Der Trommelschlag brach sich an den Holzwänden und wurde als rhythmisches Stakkato mit makelloser Präzision zurückgeworfen. Der celeusta bearbeitete methodisch, geschmeidig und dennoch mit rein mechanischen Bewegungen seine Ziegenfelltrommel. Er konnte sie stundenlang schlagen, ohne aus dem Takt zu geraten – seine musikalische Ausbildung war weniger auf Harmonie denn auf Ausdauer ausgerichtet gewesen. Obwohl seinem stetigen Rhythmus anerkanntermaßen eine leistungssteigernde Wirkung beizumessen war, hoffte sein Publikum, das aus Galeerenruderern bestand, zurzeit nichts anderes, als dass diese monotone Darbietung möglichst bald ein Ende finden möge.
Lucius Arcelian wischte eine verschwitzte Handfläche an seiner Kniehose ab, dann packte er das schwere Eichenruder etwas fester. Indem er das Blatt in einer fließenden Bewegung durchs Wasser zog, passte er sich dem Rudertakt der anderen Männer um ihn herum schnell an. Als gebürtiger Kreter war er sechs Jahre zuvor in die römische Marine eingetreten, angelockt von guter Bezahlung und der Möglichkeit, die römischen Bürgerrechte zu erlangen, sobald er sich zur Ruhe setzte. In den Jahren seither war er härtester physischer Arbeit ausgesetzt gewesen – und hoffte jetzt, an Bord der kaiserlichen Galeere in eine weniger anstrengende Position zu gelangen, bevor seine Arme völlig versagten.
Im Gegensatz zum Hollywood-Mythos kamen im Altertum auf römischen Galeeren keinerlei Sklaven zum Einsatz. Bezahlte Freiwillige trieben die Schiffe an, gewöhnlich aus seefahrenden Ländern rekrutiert, die unter der Herrschaft des Kaiserreichs standen. Wie ihre Legionärskollegen in der römischen Armee mussten die Kandidaten eine wochenlange strapaziöse Ausbildung absolvieren, ehe sie auf See eingesetzt wurden. Die Ruderer waren schlank, stark und durchaus fähig, zwölf Stunden am Tag zu rudern, wenn es nötig sein sollte. Aber auf der nach liburnischem Vorbild erbauten Diere, einem kleinen und leichten Kriegsschiff, das jeweils zwei Reihen Ruder auf beiden Seiten hatte, waren die Ruderer ein zusätzlicher Antrieb zu einem großen Segel, das an Deck aufgeriggt war.
Arcelian richtete den Blick auf den celeusta, einen winzigen kahlköpfigen Mann, der neben sich einen kleinen Affen angebunden hatte, während er trommelte. Er konnte nicht umhin, die frappierende Ähnlichkeit zwischen dem Mann und dem Affen zu registrieren. Beide hatten große Ohren und runde, fröhliche Gesichter. Ein Ausdruck ständiger Heiterkeit lag auf der Miene des Trommlers, während er die Mannschaft mit funkelnden Augen und schartigen gelben Zähnen angrinste. Sein Anblick schien das Rudern irgendwie einfacher zu machen, und Arcelian erkannte, dass der Kapitän der Galeere eine weise Entscheidung getroffen hatte, als er diesen Mann ausgewählt hatte.
»Celeusta«, rief einer der Ruderer, ein dunkelhäutiger Mann aus Syrien. »Der Wind bläst heftig, und das Meer schäumt. Warum müssen wir rudern?«
Die Augen des Trommlers leuchteten auf. »Es fällt mir nicht im Traum ein, die Weisheit meiner Offiziere anzuzweifeln. Wenn ich es täte, würde am Ende auch ich ein Ruder ziehen«, erwiderte er und lachte herzlich.
»Ich möchte fast wetten, dass der Affe schneller rudern kann«, entgegnete der Syrer.
Der celeusta betrachtete den Affen, der neben ihm hockte. »Wirklich ein kräftiger kleiner Bursche«, ging er gut gelaunt auf den harmlosen Spott ein. »Aber was deine Frage betrifft, ich kenne die Antwort nicht. Vielleicht möchte der Kapitän seine geschwätzige Mannschaft ein wenig in Atem halten. Oder er hat den Wunsch, schneller als der Wind zu sein.«
Ein paar Meter über ihnen blickte der Kapitän der Galeere auf dem oberen Deck unruhig nach achtern zum Horizont. Ein Paar ferner blau-grauer Punkte tanzte auf der turbulenten See und wurde mit jeder Minute größer. Der Kapitän wandte sich um, blickte auf die vom Wind geblähten Segel und wünschte sich, er könne noch viel, viel schneller sein als der Wind.
Eine tiefe Baritonstimme störte plötzlich seine Konzentration.
»Ist es die Geisel der Meere, die deine Knie weich werden lässt, Vitellus?«
Der Kapitän fuhr herum und sah einen stämmigen Mann mit Brustpanzer, der ihn spöttisch musterte. Er war ein römischer Centurio namens Plautus, der das Kommando über eine Truppe von dreißig Legionären hatte, die an Bord stationiert waren.
»Zwei Schiffe nähern sich von Süden«, erwiderte Vitellus. »Ich bin mir fast sicher, dass es Piraten sind.«
Der Centurio schenkte den fernen Schiffen einen flüchtigen Blick, dann zuckte er die Achseln.
»Lästiges Ungeziefer«, meinte er unbesorgt.
Vitellus wusste es besser. Piraten waren schon seit Jahrhunderten die Erzfeinde der römischen Schifffahrt. Obgleich das organisierte Piratenunwesen auf dem Mittelmeer vor einigen hundert Jahren von Pompeius dem Großen schon einmal ausgemerzt worden war, gingen vereinzelt noch immer nicht organisierte Räuberbanden auf dem offenen Meer ihrem Gewerbe nach. Die gewöhnlichen Ziele waren einzelne Handelsschiffe, aber die Piraten wussten, dass die Dieren oftmals wertvolle Fracht an Bord hatten. Als er an die Ladung seines eigenen Schiffes dachte, fragte sich Vitellus, ob die Barbaren, die ihn verfolgten, möglicherweise einen Tipp bekommen hatten, nachdem er aus dem Hafen ausgelaufen war.
»Plautius, ich brauche dich wohl nicht an die Bedeutung unserer Fracht zu erinnern«, sagte er.
»Natürlich nicht«, erwiderte der Centurio. »Was meinst du denn, weshalb ich mich auf diesem armseligen Schiff befinde? Schließlich bin ich es doch, der mit der Aufgabe betraut wurde, für ihre Sicherheit zu sorgen, bis sie dem Kaiser von Byzanz übergeben wird.«
»Dabei zu versagen würde ernste Konsequenzen für uns und unsere Familien nach sich ziehen«, sagte Vitellus und dachte dabei an seine Frau und seinen Sohn in Neapel. Er suchte das Meer vor dem Bug der Galeere ab und sah nur rollende Wellen und schiefergraues Wasser.
»Von unserer Eskorte ist noch immer nichts zu sehen.«
Drei Tage zuvor war die Galeere in Judäa mit einer Trireme als Geleitschutz in See gestochen. Aber die Schiffe waren während der vorangegangenen Nacht durch eine heftige Sturmböe voneinander getrennt worden, und seitdem war die Eskorte nicht mehr zu sehen.
»Fürchte dich nicht vor den Barbaren«, sagte Plautius abfällig. »Wir werden das Meer mit ihrem Blut rot färben.«
Das übertrieben forsche Auftreten des Centurio trug dazu bei, dass Vitellus auf Anhieb eine gewisse Abneigung gegen ihn entwickelt hatte. An seinen kämpferischen Fähigkeiten war jedoch nicht zu zweifeln, daher war der Kapitän durchaus dankbar, ihn in seiner Nähe zu haben.
Plautius und seine Legionärstruppe gehörten zu den Scholae Palatinae, einer militärischen Eliteeinheit, deren Aufgabe im persönlichen Schutz des Kaisers bestand. Die meisten waren schlachterprobte Veteranen, die mit Constantin dem Großen an der Grenze und während seines Feldzugs gegen Maxentius gekämpft hatten, einem rivalisierenden Cäsaren, dessen Niederwerfung zur Vereinigung des zersplitterten Imperiums führte. Plautius selbst hatte eine hässliche Narbe an seinem linken Oberarm, die ihn an ein heftiges Duell mit einem westgotischen Schwertkämpfer erinnerte, das ihn beinahe seinen Arm gekostet hätte. Er trug diese Narbe als sichtbares Symbol seiner Tapferkeit und Unerschrockenheit, die niemand, der ihn kannte, in Frage zu stellen wagte.
Während sich die beiden Piratenschiffe näherten, stellte Plautius seine Männer, verstärkt durch Mannschaftsmitglieder der Galeere, auf dem offenen Deck bereit. Jeder war mit den neuesten römischen Waffen ausgerüstet – einem Kurzschwert, dem sogenannten gladius, einem runden mehrschichtigen Schild und einer Wurflanze, dem pilum. Der Centurio teilte seine Soldaten in kleine Kampfgruppen auf, um beide Seiten des Schiffes verteidigen zu können.
Vitellus behielt ihre Verfolger, die mittlerweile deutlich zu erkennen waren, ständig im Auge. Es waren kleinere mit Segeln und Rudern ausgerüstete Schiffe von zwanzig Metern Länge – und damit kaum halb so groß wie die römische Galeere. Eins hatte hellblaue Rahsegel und das andere graue, während beide Schiffsrümpfe in Zinngrau gehalten waren, eine alte und wirkungsvolle Tarnmethode, die von kilikischen Piraten bevorzugt wurde. Jedes Schiff trug zwei Segelmasten, die ihnen bei frischem Wind zu einem Geschwindigkeitsvorteil verhalfen. Und der Wind blies zurzeit wirklich recht kräftig und ließ den Römern kaum eine Chance zur Flucht.
Ein Hoffnungsschimmer zeichnete sich ab, als der vordere Ausguck »Land in Sicht!« meldete. Vitellus blickte zum Bug und entdeckte im Norden die vagen Umrisse einer felsigen Küste. Der Kapitän konnte nur raten, welches Land er da vor sich sah. Die jeweilige Position der Galeere wurde hauptsächlich durch Koppelnavigation bestimmt, war während des Sturms kurz zuvor jedoch vom Kurs abgebracht worden. Vitellus hoffte inständig, dass sie sich in der Nähe der anatolischen Küste befanden, wo sie vielleicht auf andere Schiffe der römischen Flotte trafen.
Der Kapitän wandte sich an den bulligen Mann, der die schwere Ruderpinne der Galeere bediente.
»Gubernator, bring uns in Landnähe und möglichst in windgeschützte Gewässer. Wenn wir ihnen den Wind aus den Segeln nehmen können, dürften wir diesen Teufeln entkommen.«
Unter Deck erhielt der celeusta den Befehl, einen Schnellfeuer-Rhythmus zu trommeln. Jegliche Gespräche zwischen Arcelian und den anderen Ruderern erstarben, und so war nur noch das dumpfe Schnaufen heftiger Atemzüge zu hören. Die Nachricht von den verfolgenden Piratenschiffen war bis zu den Ruderbänken hinab gedrungen. Jeder Mann konzentrierte sich darauf, sein Ruder so schnell und wirkungsvoll wie möglich durchs Wasser zu ziehen, wusste er doch, dass wahrscheinlich auch sein eigenes Leben auf dem Spiel stand.
Für fast eine halbe Stunde hielt die Galeere den Abstand zu den Verfolgerschiffen. Mit Hilfe von Segel und Ruder schob sich das römische Schiff mit fast sieben Knoten durch die Wellen. Aber die kleineren und besser besegelten Piratenschiffe holten allmählich auf. Nahezu bis zur vollständigen Erschöpfung gefordert, durften die Ruderer der Galeere ihren Rhythmus ein wenig drosseln, um Kraft zu sparen. Während die braune, dunstige Landmasse vor ihnen beinahe verlockend aus dem Meer wuchs, kamen die Piraten allmählich näher und griffen schließlich an.
Während sich sein Begleiter hinter der Galeere hielt, arbeitete sich das Schiff mit dem blauen Segel bis auf die gleiche Höhe vor und überholte dann seltsamerweise das römische Schiff. Während des Passierens drängte sich die bunt gewürfelte Horde bewaffneter Barbaren an Deck und beschimpfte und verhöhnte die Römer lautstark. Vitellus ignorierte die Rufe und starrte auf die Küstenlinie voraus. Die drei Schiffe waren nur noch wenige Kilometer vom Festland entfernt – und an seinem Rahsegel konnte er erkennen, dass der Wind nachließ. Er befürchtete, dass es zu wenig war und für seine erschöpften Ruderer zu spät geschah.
Vitellus suchte die vor ihm liegende Landschaft ab. Er hoffte, irgendwo an Land gehen und seine Legionäre auf festem Boden antreten lassen zu können, wo sie ihre volle Kampfkraft entfalten mochten. Doch die Küstenlinie bestand aus einer hohen Felswand, die keine Lücke aufwies, in der die Galeere eine sichere Zuflucht hätte finden können.
Bei einem Vorsprung von fast vierhundert Metern drehte das führende Piratenschiff plötzlich. In einer perfekt ausgeführten Wende schwang es vollständig herum und hielt direkt auf die Galeere zu. Auf den ersten Blick erschien dieses Manöver selbstmörderisch. Die römische Seekriegsstrategie hatte sich lange Zeit auf das Rammen des Gegners als vorherrschende Kampftaktik verlassen, und sogar die kleine Diere war mit einem schweren Bugvorbau aus Bronze ausgestattet. Vielleicht war bei den Barbaren ja mehr Muskel- als Gehirnmasse vorhanden, dachte Vitellus. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als das erste Schiff zu rammen und zu versenken, da sich in diesem Fall, wie er zu wissen glaubte, das zweite Schiff zurückziehen würde.
»Wenn sie abdrehen oder wenden, folge ihnen und durchbohre sie um jeden Preis mit unserem Rammsporn«, befahl er dem Steuermann. Ein jüngerer Offizier stand an der Leiter ins Schiffsinnere, um Anweisungen an die Ruderer weiterzugeben. An Deck hielten die Legionäre ihre Schilde und Wurfspieße bereit. Erwartungsvolle Stille legte sich über die Galeere.
Die Barbaren behielten ihren direkten Kurs auf die Galeere bei, bis sie nur noch dreißig Meter von ihr entfernt waren. Dann schwenkte der Gegner, wie Vitellus vorausgesehen hatte, plötzlich nach Backbord.
»Ramm sie!«, rief der Römer, während der Steuermann die Ruderpinne herumriss. Unter Deck wechselten die Ruderer an Steuerbord für mehrere Züge die Richtung der Ruderblätter, so dass die Galeere eine scharfe Wende nach Steuerbord ausführte. Genauso schnell trieben sie das Schiff wieder vorwärts und zogen ihre Ruder ebenso wie ihre Kollegen an Backbord mit äußerster Kraft durchs Wasser.
Das kleinere Piratenschiff versuchte, den Kurs der Galeere zu kreuzen, doch das römische Schiff wendete ebenfalls. Die Barbaren verloren an Fahrt, als ihre Segel beim Wenden für einen Moment schlaff wurden, während die Galeere ihr Tempo beibehielt. Innerhalb eines kurzen Augenblicks war der Jäger zum Gejagten geworden. Als der Wind die Segel wieder füllte, sprang das kleinere Schiff geradezu vorwärts, aber nicht schnell genug. Der bronzene Rammsporn der Galeere küsste die hintere Flanke des Piratenschiffes und riss seinen Rumpf bis zum Heckspiegel auf. Bei der Kollision kenterte das Schiff beinahe, richtete sich dann jedoch wieder auf, während das Heck absackte.
Lauter Jubel brach unter den römischen Legionären aus, und Vitellus erlaubte sich ein triumphierendes Lächeln darüber, dass ihnen der Sieg so gut wie sicher war. Doch dann drehte er sich zu dem zweiten Schiff um und erkannte auf Anhieb, dass sie überlistet worden waren.
Während des kurzen Scharmützels hatte sich dieses zweite Schiff nämlich unauffällig genähert. Und während der Rammsporn der Galeere sein Ziel fand, schob sich das Schiff mit den grauen Segeln sofort an die Backbordseite der Galeere. Das Krachen und Knirschen berstender Ruder erklang, während eine dichte Salve von Pfeilen und Enterhaken auf das römische Deck herabregnete. Innerhalb von Sekunden waren die beiden Schiffe nahezu unlösbar miteinander verbunden, und eine ganze Masse von Schwerter schwingenden Barbaren ergoss sich über die Reling.
Die erste Welle Angreifer berührte kaum das Deck, als sie bereits von einer Phalanx rasiermesserscharfer Lanzen aufgespießt wurde. Die römischen Schleuderer verteidigten die Galeere zwar mit tödlicher Zielgenauigkeit, und ein Dutzend Angreifer wurden auch auf der Stelle ausgeschaltet. Aber die Heftigkeit des Angriffs wurde nicht gebrochen, da ein Dutzend weitere Barbaren ihre Plätze einnahmen. Plautius hielt seine Männer zurück, bis die Piratenhorde auf dem Galeerendeck ausschwärmte. Erst dann trat er aus seiner Deckung hervor und gab das Zeichen zum Gegenangriff. Das Klirren der Schwerter übertönte die qualvollen Todesschreie, als das Gemetzel begann. Die römischen Legionäre, besser ausgebildet und im Kampf um einiges disziplinierter, wehrten die ersten Angriffswellen mit Leichtigkeit ab. Die Barbaren waren daran gewöhnt, nur leicht bewaffnete Händler anzugreifen und keine schwer bewaffneten, erfahrenen Soldaten. So wichen sie vor der massiven Gegenwehr zurück. Um die enternden Piraten zurückzuschlagen sammelte Plautius die Hälfte seiner Männer, um dem eigenen Angriff mehr Druck zu verleihen. Er persönlich übernahm die Führung, als die Römer die Barbaren auf ihr eigenes Schiff zurücktrieben.
Die Angriffsreihen der Barbaren brachen schnell auseinander, formierten sich jedoch schon bald wieder neu, als die Piraten erkannten, dass sie den Legionären zahlenmäßig um ein Mehrfaches überlegen waren. Jeweils zu dritt oder zu viert konzentrierten sie sich auf einen einzelnen römischen Soldaten, griffen ihn von verschiedenen Seiten an und überrannten ihn. Auf diese Weise verlor Plautius sechs Männer, bevor er seine Soldaten eine geschlossene Formation einnehmen ließ und zu einem Quadrat ordnete.
Vom Achterdeck der Galeere aus beobachtete Vitellus, wie der römische Centurion einen Mann mit seinem Schwert regelrecht halbierte, als er die Barbaren wie mit einer Sense niedermähte. Der Kapitän hatte die Galeere mitsamt ihres an sie geketteten Verfolgers während des Kampfes Kurs aufs Festland nehmen lassen. Doch das Piratenschiff brachte einen Steinanker aus, der auf dem Meeresgrund Halt fand und beide Schiffe stoppte.
Unterdessen hatte das Schiff mit dem blauen Segel eine Wende ausgeführt und machte nun Anstalten, in den Kampf einzugreifen. Behindert durch das große Leck in seinem Rumpf, durch das Wasser ungehindert eindringen konnte, steuerte das Piratenschiff schwerfällig die freie Steuerbordseite der römischen Galeere an. Indem es das Manöver seines Schwesterschiffes nachahmte, schob es sich längsseits, und seine Mannschaft entfesselte einen wahren Regen von Enterhaken, der die Römer überschüttete.
»Ruderer zu den Waffen! Sofort an Deck antreten!«, rief Vitellus.
Unter Deck folgten die erschöpften Ruderer dem Ruf des Kapitäns. Da sie ursprünglich als Soldaten ausgebildet waren, erwartete man von den Ruderern und allen anderen Seeleuten an Bord, dass sie sich an der Verteidigung des Schiffes beteiligten. Arcelian schloss sich der Schlange seiner Kollegen an, von denen jeder einen tiefen Schluck kalten Wassers aus einem Tonkrug trank und danach mit einem Schwert in der Faust an Deck eilte.
»Halt den Kopf unten«, riet er dem celeusta, der die Waffen verteilt hatte und nun das Ende der Schlange bildete.
»Ich sehe dem Barbaren lieber ins Gesicht, wenn ich ihn töte«, erwiderte der Trommler mit seinem typischen Grinsen.
Die Ruderer griffen keinen Augenblick zu früh in den Kampf ein, während sich die zweite Welle Piraten über die Steuerbordreling schwang. Die Mannschaft der Galeere warf sich den Angreifern als kompakte Masse aus Muskeln und Stahl entgegen.
Als Arcelian das Hauptdeck betrat, war er über das Massaker entsetzt. Leichen und abgetrennte Gliedmaßen lagen verstreut zwischen ständig größer werdenden Blutpfützen. Kaum schlachterprobt erstarrte er für einen kurzen Moment, bis ein Offizier an ihm vorbeirannte und ihn anbrüllte: »Durchtrenn gefälligst die Enterseile!«
Als er ein straff gespanntes Seil am Bug der Galeere gewahrte, machte er einen entschlossenen Satz vorwärts und zerschnitt es mit seinem Schwert. Er verfolgte noch, wie das freie Ende peitschenartig zum Deck des Schiffes mit dem blauen Segel zurückschwang, dessen Deck sich einige Meter unterhalb des Galeerendecks befand. Dann ließ er den Blick an der Reling der Galeere entlangwandern und bemerkte ein halbes Dutzend weiterer Enterseile, die das Piratenschiff an Ort und Stelle fixierten.
»Kappt die Seile!«, rief er. »Stoßt die Piraten ab!«
Seine Worte fanden jedoch kein Gehör, und er musste erkennen, dass nahezu jedes Mannschaftsmitglied der Galeere mit den Barbaren in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt war. Nur am Heck der Galeere gewahrte er mit einiger Hoffnung, dass der celeusta seinem Beispiel folgte und ein Enterseil mit einem kleinen Beil attackierte. Doch allmählich wurde die Zeit knapp. An Bord des langsam sinkenden Piratenschiffes schickten sich die Barbaren an, das römische Schiff zu entern, da sie erkannten, dass sich ihr eigenes Schiff nicht mehr lange würde über Wasser halten können.
Arcelian stieg über einen sterbenden Schiffskameraden, um zum nächsten Enterseil zu gelangen, und hob sein Schwert. Ehe er aber zuschlagen konnte, hörte er in der Luft ein Pfeifen, und die Spitze eines Pfeils bohrte sich nur wenige Zentimeter von seinem Fuß entfernt in die Decksplanken. Er achtete nicht weiter darauf, sondern durchschlug das Seil mit der Schwertklinge und ging dann hinter der Reling in Deckung, als ein weiterer Pfeil über seinen Kopf hinwegzischte. Er lugte über das Geländer und entdeckte seinen Angreifer, einen kilikischen Bogenschützen, der sich einen halbwegs sicheren Platz in der Spitze des Segelmastes des Piratenschiffes gesucht hatte. Der Bogenschütze achtete schon nicht mehr auf den Ruderer, sondern zielte bereits für seinen nächsten Schuss auf das Achterschiff. Arcelian erkannte zu seinem Schrecken, dass der Schütze sich den celeusta, der gerade im Begriff war, ein drittes Enterseil zu kappen, als nächstes Opfer ausgesucht hatte.
»Celeusta!«, brüllte der Ruderer.
Die Warnung erfolgte jedoch zu spät. Ein Pfeil bohrte sich tief in die Brust des kleinen Mannes. Der Trommler gab einen tiefen Stöhnlaut von sich und sackte auf die Knie, während ein Blutstrom seine gesamte Brust rot färbte. In einer letzten Demonstration von Gefolgschaftstreue holte er mit dem Beil aus, zerschnitt das Enterseil und stürzte dann leblos auf das Deck.
Das Schiff der Barbaren tauchte zunehmend tiefer ins Wasser und löste einen letzten Sturm auf die Galeere aus. Nur noch zwei Enterseile hielten die beiden Schiffe zusammen, was die Piraten bislang aber – bis auf den Bogenschützen – übersehen hatten. Immer noch auf seinem Platz in der Mastspitze ausharrend, zielte und schoss er abermals auf Arcelian und verfehlte ihn nur knapp.
Arcelian zog reflexartig den Kopf ein und sah gleichzeitig, dass sich die noch intakten Enterseile mittschiffs zwischen den beiden Rümpfen spannten, obwohl sich die beiden Schiffe am Heck berührten und das Kampfgeschehen sich nach achtern verlagert hatte. Der Ruderer ging auf alle viere hinunter und kroch unter der Reling bis zum ersten Enterseil. Ein sterbender Barbar – sein Bauch bestand aus einer einzigen blutigen Masse zerfetzten Fleisches – lag nicht weit entfernt. Der kräftige Ruderer erreichte ihn und wuchtete sich den Mann auf die Schulter, dann machte er kehrt und näherte sich dem Enterseil. In diesem Augenblick hörte er einen dumpfen Laut, begleitet von einem heftigen Stoß gegen seine Schulter, als sich ein Pfeil in den Rücken des Piraten bohrte. Mit der freien Hand schwang Arcelian das Schwert, holte aus und durchtrennte das Seil, während ein zweiter Pfeil in seinen menschlichen Schutzschild eindrang. Der Ruderer brach in die Knie, stieß den mittlerweile toten Barbaren von seiner Schulter und rang nach Atem.
Von seinen Anstrengungen nahezu vollkommen erschöpft, betrachtete Arcelian den letzten Enterhaken, der sich ein paar Meter über ihm in eine Rah gegraben hatte. Über die Reling hinweg entdeckte er den feindlichen Bogenschützen, der seinen Platz am Segelmast endlich verlassen hatte und nun aufs Deck hinabkletterte. Arcelian nutzte diese günstige Gelegenheit, sprang auf und rannte über das Galeerendeck und kletterte dort auf die Reling, wo sich das Enterseil zum Piratenschiff spannte. Um sein Gleichgewicht kämpfend, holte er mit dem Schwert zum entscheidenden Befreiungsschlag aus – doch dazu kam er nicht mehr.
Die Belastung des Seils durch die beiden auseinanderweichenden Schiffe war zu groß, und der Eisenhaken verlor den Halt am Mast. Die enorme Spannung des Seils beschleunigte den Haken wie ein Geschoss, und so wirbelte er in einem flachen Bogen zum Wasser hinab. Die messerscharfen Widerhaken pfiffen knapp an Arcelian vorbei und hätten ihm beinahe einen blutigen Abgang beschert. Doch das Seil schlang sich um seinen Oberschenkel, riss ihn von der Reling und schleuderte ihn dicht vor dem Bug des Piratenschiffes ins Meer.
Da er nicht schwimmen konnte, strampelte und ruderte Arcelian wie wild, um den Kopf weiter über Wasser zu halten. Verzweifelt um sich schlagend stieß er gegen etwas Hartes und klammerte sich mit beiden Händen daran fest. Es war ein Stück Holzreling des Piratenschiffes, das während der ersten Kollision mit der römischen Galeere herausgebrochen und groß genug war, um ihn nicht untergehen zu lassen. Plötzlich ragte das Piratenschiff mit dem blauen Segel über ihm auf, und er trat heftig mit den Beinen, um ihm aus dem Weg zu gehen. Dabei wurde er von der Galeere weiter abgetrieben, zumal er in eine Strömung geriet, gegen die er in seinem geschwächten Zustand nicht ankämpfen konnte. Mühsam wassertretend, um seine Position zu halten, verfolgte er mit weit aufgerissenen Augen, wie das Piratenschiff von einer Windböe erfasst und auf die Küste zugetrieben wurde. Dabei ragte das Deck nur noch wenig über die Wasseroberfläche hinaus.
Während das römische Schiff an Steuerbord durch Arcelian von den Enterhaken befreit worden war, hatten Vitellus und ein jüngerer Offizier die Enterseile an Backbord bis auf ein letztes in Hecknähe gelöst. Sich mit einem Pfeil in seiner Schulter schwer auf die Ruderpinne stützend machte sich der Kapitän durch laute Rufe beim Centurio auf dem benachbarten Schiff bemerkbar.
»Plautius«, rief er mit matter Stimme, »komm auf die Galeere zurück. Wir haben uns von den Piraten befreit!«
Der Centurio und seine Legionäre waren auf dem Piratenschiff immer noch in heftige Kämpfe verstrickt, obwohl die Anzahl der kampffähigen Männer stark geschrumpft war. Plautius zog sein bluttriefendes Schwert aus dem Hals eines Barbaren und blickte kurz zur Galeere hinüber.
»Bring die Fracht an ihr Ziel. Ich werde die Barbaren aufhalten«, rief er zurück und stieß sein Schwert in den Leib eines weiteren Angreifers. Nur noch drei Legionäre standen ihm zur Seite, und Vitellus konnte erkennen, dass sie sich nicht mehr lange auf den Beinen halten würden.
»Eure Tapferkeit und euer Mut werden nicht ungerühmt bleiben«, rief der Kapitän und durchtrennte die letzte Verbindung zwischen Galeere und Piratenschiff. »Lebewohl, Centurio!«
Befreit von dem Räuberschiff, das an seinem Steinanker festlag, vollführte die Galeere einen Satz vorwärts, als sich ihr einzelnes Segel schlagartig mit Wind füllte. Da der Gubernator schon lange den Tod gefunden hatte, bot Vitellus seine gesamte noch verbliebene Kraft auf, um das Schiff in Richtung Festland zu lenken. Dabei spürte er, wie der Griff der Ruderpinne von seinem eigenen Blut benetzt und glitschig wurde. Eine gespenstische Stille breitete sich auf dem Deck aus und brachte ihn dazu, zum Rand des Achterkastells zu stolpern. Was er unten erblickte, verschlug ihm jedoch den Atem.
Verstreut auf dem Deck lag eine Masse toter und zerfleischter Körper, Römer wie Barbaren, in einem roten Tümpel. Eine fast gleichgroße Anzahl von Angreifern und Mannschaftsmitgliedern hatte also bis zu einem tödlichen Unentschieden gegeneinander gefochten. Es waren die Überreste eines Gemetzels, wie er noch nie eines erlebt hatte.
Erschüttert von dem Anblick und geschwächt von seinem eigenen Blutverlust, schickte er einen flehenden Blick gen Himmel.
»Mögen die Götter das Schiff des Kaisers schützen«, röchelte er.
Schwankend kehrte er zum Heck zurück, schlang die Arme um die Ruderpinne und korrigierte ein letztes Mal ihre Stellung. Die Hilfeschreie der im Wasser treibenden Männer drangen zu ihm, doch der Kapitän hörte sie schon nicht mehr, während das Schiff an ihnen vorbei segelte. Mit leeren Blicken auf die vor ihm liegende Landmasse starrend hielt er mit seinen letzten Kraftreserven die Ruderpinne fest und kämpfte um die letzten Sekunden seines Lebens.
Im kabbeligen Wasser treibend sah Arcelian überrascht hoch, als sich die römische Galeere von ihrem Verfolger löste und plötzlich auf ihn zusteuerte. Laute Hilferufe ausstoßend verfolgte er in qualvoller Verzweiflung, wie die Galeere in tiefer Stille an ihm vorbeiglitt und ihn dabei vollkommen ignorierte. Nur einen kurzen Augenblick später bot sich das Schiff, da es drehte, seinem Blick im Profil dar – und er erkannte voller Grauen, dass nicht eine einzige lebende Seele auf dem Hauptdeck stand. Nur die einsame Gestalt von Kapitän Vitellus, zusammengesunken über der Ruderpinne auf dem erhöhten Schiffsheck, war zu sehen. Dann raschelten und knallten die Segel des Schiffes im Wind, die Galeere nahm zügig Fahrt in Richtung Küste auf und war schon bald nicht mehr zu sehen.
JUNI 1916PORTSMOUTH, ENGLAND
Auf der Marinewerft herrschte trotz eines unangenehmen kalten Nieselregens hektische Betriebsamkeit. Schauerleute der Royal Navy hatten unter einem dampfgetriebenen Hafenkran alle Hände voll zu tun, riesige Mengen Lebensmittel und anderer Vorräte sowie Munition an Bord des grauen Schiffsriesen zu schaffen, der am Kai vertäut war. An Bord wurden die Kisten im vorderen Frachtraum säuberlich aufgestapelt, während ein Pulk Seeleute in dicken wollenen Kolanis das Schiff für die bevorstehende Reise klarmachte.
Obwohl sie seit mehr als zehn Jahren im Dienst war, und trotz ihres jüngsten Einsatzes während der Skagerrakschlacht zeichnete sich die HMS Hampshire durch extreme Sauberkeit und Gepflegtheit aus. Als Panzerkreuzer der Devonshire-Klasse war sie mit ihren an die zehntausend Bruttoregistertonnen eines der größten Schiffe der britischen Marine. Mit einem Dutzend schwerer Kanonen bestückt, stellte sie außerdem eins der tödlichsten dar.
In der offenen Tür eines leeren Lagerhauses etwa eine Viertelmeile den Kai hinunter stand ein Mann mit blonden Haaren und beobachtete durch ein Messingfernglas, wie das Schiff beladen wurde. Er hatte das Fernglas fast zwanzig Minuten lang vor den Augen, bis ein grüner Rolls-Royce erschien, den Kai überquerte und vor der Hauptgangway stoppte. Er verfolgte aufmerksam, wie eine Gruppe von Armeeoffizieren in Khakiuniformen wie aus dem Nichts erschien, den Wagen umringte und dann die Insassen die Gangway hinaufgeleitete. Ihrer Kleidung nach zu urteilen waren die beiden Ankömmlinge ein Politiker und ein hochrangiger Armeeoffizier. Er erhaschte einen kurzen Blick auf das Gesicht des Offiziers und lächelte zufrieden, als er sah, dass der Mann einen buschigen Schnurrbart hatte.
»Es wird Zeit, unsere Fracht abzuliefern, Dolly«, sagte er laut.
Dann trat er zurück in den Schatten, wo ein Gespann aus einem wettergegerbten Karren und einem gesattelten Pferd wartete. Er verstaute das Fernglas unter der Sitzbank, kletterte auf den Karren, ergriff die Zügel und ließ sie knallen. Dolly, eine alte scheckiggraue Stute, hob unwillig den Kopf, trottete dann los und zog den Karren in den Regen hinaus.
Die Dockarbeiter achteten kaum auf den Mann, als er ein paar Minuten später seinen Karren neben das Schiff lenkte. Bekleidet mit einer verblichenen Wolljacke und einer schmuddeligen Hose, eine flache Mütze tief in die Stirn gezogen, unterschied er sich kein bisschen von Dutzenden anderer einheimischer Sozialhilfeempfänger, die sich ihr Leben mit Gelegenheitsjobs ein wenig erträglicher machten. In diesem Fall war es eine einstudierte Rolle, perfektioniert durch den Verzicht auf eine Rasur und das Verteilen einer großzügigen Menge billigen Scotch Whiskys auf seiner Kleidung. Als der Zeitpunkt für seinen Auftritt gekommen war, machte er auf sich aufmerksam, indem er Dolly zum Ende der Gangway vorrücken ließ und dann den Zutritt versperrte.
»Schaff die Schindmähre aus dem Weg«, schimpfte ein rotgesichtiger Leutnant, der das Beladen des Schiffes überwachte.
»Ich habe eine Lieferung für die Hampshire«, knurrte der Mann im tiefsten Cockney-Slang.
»Dann zeig mal deine Papiere«, verlangte der Leutnant.
Der Spediteur griff in die Innentasche seiner Jacke und reichte dem Offizier ein zerknülltes, mit Wasserflecken übersätes Blatt Papier. Der Leutnant überflog es stirnrunzelnd, dann schüttelte er den Kopf.
»Das ist kein ordnungsgemäßer Frachtbrief«, stellte er fest und musterte den Karrenlenker prüfend.
»Das ist das, was der General mir gegeben hat. Das und einen Fünfer«, erwiderte der Mann mit einem Augenzwinkern.
Der Leutnant umrundete den Pferdekarren und betrachtete die Kiste, die etwa so groß war wie ein Sarg. Auf dem Deckel war mit schwarzer Farbe eine Adresse aufgepinselt worden.
PROPERTY OF THE ROYAL NAVYTO THE ATTENTION OF SIR LEIGH HUNTSPECIAL ENVOY TO THE RUSSIAN EMPIREC/O CONSULATE OF GREAT BRITAINPETROGRAD, RUSSIA
»Hmm«, murmelte der Offizier und sah wieder auf das Formular. »Nun, das ist die Unterschrift des Generals. Na gut«, sagte er und gab das Papier zurück. »Du da«, bellte er dann und winkte einem Dockarbeiter in der Nähe. »Hilf mal mit, diese Kiste an Bord zu bringen. Danach muss dieser Karren hier aber verschwinden.«
Stricke wurden um die Kiste geschlungen, danach hievte sie ein Schiffskran in die Luft, schwang sie über die Reling und ließ sie in den vorderen Frachtraum hinab. Der Spediteur verabschiedete sich von dem Leutnant, indem er einen militärischen Gruß imitierte, dann trieb er das Pferd vom Kai und aus dem Marinehafen. Nachdem er auf eine unbefestigte Straße abgebogen war, rollte er an einigen Lagerhäusern vorbei, die zum Hafen gehörten, und gelangte auf freies Ackerland. Knapp zwei Kilometer die Straße hinunter lenkte er den Karren in eine holprige Zufahrt und parkte den Pferdewagen neben einer windschiefen Hütte. Ein alter Mann, der auf einem Bein lahmte, kam aus einer nahen Scheune.
»Haben Sie Ihre Fracht abgeliefert?«, fragte er den Kutscher.
»Das habe ich. Vielen Dank für Ihren Wagen und Ihr Pferd«, erwiderte der Mann, zog eine Zehn-Pfund-Note aus seiner Brieftasche und reichte sie dem Bauern.
»Mit Verlaub, Sir, aber das ist viel mehr, als mein Pferd wert ist«, stammelte der Bauer und hielt den Geldschein in den Händen, als wäre er ein Baby.
»Und es ist ein wirklich gutes Pferd«, entgegnete der Mann und gab Dolly zum Abschied einen freundlichen Klaps auf den Hals. »Guten Tag«, sagte er zu dem Bauern, tippte gegen den Mützenschirm und ging dann die Zufahrt hinunter.
Er wanderte einige Minuten die Straße entlang, bis er das Motorengeräusch eines Automobils vernahm, das sich ihm näherte. Eine blaue Vauxhall Limousine bog um eine Ecke, bremste und blieb neben ihm stehen. Der Spediteur trat an den Straßenrand, als die hintere Tür der Limousine geöffnet wurde, und stieg ein. Ein würdevoll aussehender Mann im Habit eines anglikanischen Priesters rutschte über die Sitzbank, um dem neuen Fahrgast Platz zu machen. Er musterte den Spediteur mit einem gespannten Ausdruck in seinen mattgrauen Augen, dann griff er nach einer Brandykaraffe, die sich in der Halterung an der Rückenlehne des Vordersitzes befand. Nachdem er eine großzügige Menge in ein Kristallglas geschüttet hatte, reichte er dem Spediteur das Glas, dann gab er dem Chauffeur Anweisungen, die Fahrt fortzusetzen.
»Ist die Kiste an Bord?«, fragte er ohne Umschweife.
»Ja, Vater«, antwortete der Spediteur mit einem Unterton spöttischer Ehrerbietung. »Sie haben den gefälschten Frachtbrief akzeptiert und die Kiste in den vorderen Frachtraum geladen.« Von einem Cockney-Akzent war in seinen Worten jetzt nichts mehr zu hören. »In zweiundsiebzig Stunden können Sie Ihrem glorreichen General Lebewohl sagen.«
Die Worte schienen den Vikar zu schmerzen, obgleich sie ihm mitteilten, was er hören wollte. Stumm griff er in seinen Mantel und holte einen Briefumschlag hervor, der mit Banknoten prall gefüllt war.
»Wie wir vereinbart haben. Die eine Hälfte jetzt, die andere Hälfte nachdem … es passiert ist«, sagte er und gab den Briefumschlag weiter, während seine Stimme versiegte.
Der Spediteur lächelte, als er den dicken Stapel Banknoten betrachtete. »Ich frage mich, ob die Deutschen so viel bezahlen würden, um ein Schiff zu versenken und einen General zu ermorden«, sagte er. »Sie arbeiten nicht zufällig für den Kaiser, oder?«
Der Geistliche schüttelte heftig den Kopf. »Nein, dies alles ist eine rein theologische Angelegenheit. Wenn Sie das Dokument gefunden hätten, wäre all das gar nicht nötig gewesen.«
»Ich habe das Haus dreimal durchsucht. Wenn es dort gewesen wäre, hätte ich es sicher gefunden.«
»Das haben Sie mir bereits gesagt.«
»Sind Sie auch sicher, dass es an Bord gebracht wurde?«
»Wir haben von einem geplanten Treffen zwischen dem General und dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Petersburg erfahren. Was den Zweck dieser Zusammenkunft betrifft, so dürfte es wohl kaum irgendwelche Zweifel geben. Das Dokument muss an Bord sein. Es wird mit ihm zusammen vernichtet, und so wird das Geheimnis ein für alle Mal sterben.«
Die Reifen des Vauxhall rollten quietschend über nasses Kopfsteinpflaster, als sie die Außenbezirke von Portsmouth erreichten. Der Chauffeur wollte ins Stadtzentrum und passierte auf diesem Weg lange Reihen von hohen Klinkerbauten. An einer Kreuzung zweier Hauptstraßen bog er in die hintere Zufahrt einer im neunzehnten Jahrhundert erbauten Kirche mit dem Namen St. Mary’s ein, während der Regen an Heftigkeit zunahm.
»Es wäre nett, wenn Sie mich am Bahnhof absetzen könnten«, sagte der Spediteur, als er feststellte, dass die große Limousine über einen kleinen Friedhof neben der Kirche rollte und hinter der Sakristei stoppte.
»Ich wurde gebeten, den Text für eine Predigt hier abzugeben«, erwiderte der Geistliche. »Es dauert nur einen Augenblick. Wollen Sie nicht kurz mitkommen?«
Der Spediteur unterdrückte ein Gähnen, während er aus dem regennassen Fenster schaute. »Nein, ich glaube, ich bleibe lieber hier im Trocknen.«
»Wie Sie wollen. Wir sind gleich wieder da.«
Der Geistliche und der Chauffeur entfernten sich und gaben dem Spediteur Gelegenheit, sein Blutgeld zu zählen. Als er versuchte, die einzelnen Bank-von-England-Scheine zu addieren, hatte er plötzlich Schwierigkeiten, die Zahlen zu lesen, und stellte fest, dass vor seinen Augen alles verschwamm. Ihn überkam eine plötzliche Müdigkeit, dann steckte er das Geld ein und streckte sich auf dem Rücksitz aus, um sich auszuruhen. Auch wenn es ihm wie mehrere Stunden vorkam, waren doch nur ein paar Minuten verstrichen, als kaltes Wasser in sein Gesicht spritzte und er mühsam die Augen aufschlug. Das ernste Gesicht des Geistlichen schaute inmitten eines Regenschauers auf ihn herab. Sein Gehirn sagte ihm, dass sich sein Körper bewegte, und doch hatte er kein Gefühl in den Beinen. Immerhin schaffte er es, seinen Blick so weit zu schärfen, um zu erkennen, dass der Fahrer seine Beine trug, während der Geistliche ihn an den Armen schleppte. Ein Paniksignal hallte durch seinen Schädel, und er konzentrierte seinen Willen darauf, eine Webley-Bulldog-Pistole aus der Tasche zu holen. Aber seine Gliedmaßen gehorchten nicht. Der Brandy, dachte er in einem Anflug plötzlicher Klarheit. Es war der Brandy.
Ein Baldachin aus grünem Laub füllte sein Gesichtsfeld, als er durch einen Wald hoch aufragender Eichen getragen wurde. Das Gesicht des Geistlichen schwebte immer noch über ihm, eine düstere Maske tiefster Gleichgültigkeit, lediglich durch zwei eisige Augen erhellt. Dann sackte das Gesicht weg, oder genauer: Er sackte weg. Mehr als er spüren konnte, hörte er, wie sein Körper in einen Graben fiel und in einer Schlammpfütze landete. Flach und starr auf dem Rücken liegend blickte er zu dem Geistlichen hoch, der sich mit einer Miene über ihn beugte, die einen Anflug von Schuld ausdrückte.
»Vergib uns unsere Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes«, hörte er die ernste Stimme des Geistlichen sprechen. »Sie sind es, die wir hier zu Grabe tragen.«
Die Rückseite einer Schaufel erschien, gefolgt von einem Klumpen feuchter Erde, der auf seine Brust prallte und zerplatzte. Eine weitere Schaufel voller Erde regnete auf ihn herab, dann eine dritte.
Sein Körper war gelähmt, und seine Stimme versagte, doch sein Geist war hellwach und erkannte, was mit ihm geschah. Mit wachsendem Grauen begriff er, dass er lebendig begraben wurde. Er sandte seinen Gliedmaßen Befehle, sich zu bewegen, sich zu wehren, doch sie reagierten nicht. Während sich sein Grab stetig mit Erde füllte, hallten seine Entsetzensschreie nur in seinem Geist wider, bis sein letzter Atemzug qualvoll erstickt wurde.
Das Periskop glitt in einem weiten Bogen durch die schäumenden dunklen Fluten und war unter dem nächtlichen Himmel gar nicht zu sehen. Gut zehn Meter unter der Wasseroberfläche drehte ein milchgesichtiger Oberleutnant der deutschen Marine namens Voss das Okular um dreihundertsechzig Grad. Für einen kurzen Moment blieb sein Blick an ein paar funkelnden Lichtpunkten in größerer Entfernung hängen. Sie stammten von den Laternen einiger Bauernhäuser, die auf Cape Marwick standen, einem eisigen, windumtosten Teil der Orkneys. Voss hatte seine Rundumsicht fast beendet, als er ein mattes Leuchten am östlichen Horizont wahrnahm. Während er die Scharfeinstellung ständig nachjustierte, konnte er feststellen, dass es sich um ein Licht handelte, das einem stetigen Kurs folgte.
»Mögliches Zielobjekt bei Null-vier-acht Grad«, verkündete er und hatte Mühe, die Erregung in seiner Stimme zu unterdrücken.
Mehrere andere Matrosen, die im engen Kontrollraum des Unterseeboots ihren Dienst versahen, wurden bei seinen Worten sichtlich munterer.
Voss verfolgte das Objekt mehrere Minuten lang, in deren Verlauf ein Viertelmond kurz durch eine Lücke in einer dichten Bank schwerer Sturmwolken schien. Für einen winzigen Moment wurde das Mondlicht von dem Objekt reflektiert, so dass seine Dimensionen vor den Inselbergen im Hintergrund zu erkennen waren. Voss spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte und seine Handflächen an den Periskopgriffen schweißnass wurden. Er blinzelte heftig, vergewisserte sich, dass ihm seine Augen kein Trugbild vorgaukelten, und richtete sich dann auf. Ohne ein weiteres Wort verließ er hastig den Kontrollraum und eilte durch den engen Laufgang, der sich über die gesamte Länge des U-Boots erstreckte. Er erreichte die Kapitänskabine, klopfte laut an und schob dann einen dünnen Vorhang zur Seite.
Kapitän Kurt Beitzen lag schlafend in seiner Koje, wachte jedoch sofort auf und knipste eine Deckenlampe an.
»Herr Kapitän, ich habe soeben ein großes Schiff gesichtet, das sich von Südosten nähert, Entfernung circa zehn Kilometer. Dem Profil nach, das ich für einen kurzen Moment erkennen konnte, dürfte es ein britisches Kriegsschiff sein, möglicherweise sogar ein Schlachtschiff«, meldete er aufgeregt.
Beitzen nickte, während er sich aufsetzte und eine Decke zur Seite schleuderte. Er hatte in seiner Uniform geschlafen, schlüpfte schnell in ein Paar Schuhe und folgte seinem zweiten Offizier dann in den Kontrollraum. Beitzen war ein erfahrener U-Boot-Kommandant, blickte lange durch das Periskop und ratterte Entfernungs- und Kurskoordinaten herunter.
»Es ist ein Kriegsschiff«, bestätigte er betont lässig. »Ist dieser Quadrant minenfrei?«
»Jawohl«, antwortete Voss. »Die letzte Mine haben wir dreißig Kilometer weiter nördlich abgesetzt.«
»Dann bereithalten für den Angriff«, befahl Beitzen.
Beitzen und Voss traten an einen hölzernen Kartentisch, wo sie einen genauen Abfangkurs berechneten und dem Steuermann entsprechende Befehle übermittelten. Obwohl auf Tauchfahrt, wurde das U-Boot von der bewegten See über sich hin und her geworfen, was die bevorstehende Aufgabe erheblich erschwerte.
In einer der Hamburger Werften gebaut, war das U-75 ein U-Boot der UE I-Klasse und dafür konstruiert, Minen auf dem Meeresgrund abzusetzen. Außer einem umfangreichen Vorrat an Seeminen verfügte das Boot über vier Torpedos und eine leistungsfähige 105mm-Kanone auf dem Deck. Der Minenlege-Dienst war nahezu abgeschlossen, und niemand von der Mannschaft erwartete den Zusammenstoß mit einem feindlichen Kriegsschiff.
Das U-75 befand sich erst auf seiner zweiten Mission unter Beitzens Kommando, seit es ein halbes Jahr zuvor in Dienst gestellt worden war. Die augenblickliche Fahrt konnte bereits als erfolgreich gewertet werden, da die Minen des U-Boots ein kleines Handelsschiff und zwei Trawler versenkt hatten. Dies war jedoch ihre erste Chance auf eine fettere Beute. Schnell verbreitete sich bei der Mannschaft die Nachricht, dass sie es auf ein britisches Kriegsschiff abgesehen hatten, wodurch die allgemeine Anspannung schlagartig zunahm. Beitzen wusste, dass ein solcher Abschuss mit einem Eisernen Kreuz belohnt werden würde.
Der deutsche Kommandant lenkte das U-Boot in eine Position direkt vor Cape Marwick. Wenn das Kriegsschiff seinen Kurs beibehielt, würde es das in Lauerstellung befindliche U-Boot in einem Abstand von knapp fünfhundert Metern passieren. Die Torpedos des U-Boots waren bis auf eine Entfernung von höchstens achthundert Metern einigermaßen zielgenau, was eine ungemütliche nahe Abschussposition erforderlich machte. Während des Ersten Weltkriegs wurden die meisten Handelsschiffe mit Hilfe der Deckskanonen der U-Boote versenkt. Dem U-75 blieb diese Möglichkeit gegen den schwerbewaffneten Kreuzer jedoch versagt, vor allem bei der augenblicklich recht rauen See.
In Position für den tödlichen Schuss, klebte der Kapitän geradezu am Periskop und wartete auf seine Beute. Ein weiterer Strahl Mondlicht, der durch die Wolkendecke drang, enthüllte, dass der Oberleutnant mit seiner Einschätzung fast genau ins Schwarze getroffen hatte. Das feindliche Schiff war offenbar ein Panzerkreuzer und ein wenig kleiner als die furchteinflößenden Dreadnoughts.
»Rohr eins und zwei bereithalten für Abschuss«, befahl Beitzen.
Der Kreuzer war nur noch gut einen Kilometer entfernt, seine enorme Masse verdeckte bereits den Horizont. Eilig überprüfte Beitzen die Zieleinstellung der Torpedos und fasste seine Beute wieder ins Auge. Das Schiff näherte sich schnell dem Operationsbereich ihrer Torpedos.
»Bugklappen öffnen«, befahl er.
Ein paar Sekunden später drang eine Rückmeldung aus dem Lautsprecher im Kontrollraum: »Bugklappen geöffnet.«
»Rohre eins und zwei für Abschuss bereithalten.«
»Bereit«, kam die Bestätigung.
Beitzen verfolgte den Kurs des Kreuzers im Periskop und wartete geduldig, während die Mannschaft nahezu geschlossen den Atem anhielt. Er beobachtete, wie der Kreuzer direkt vor ihnen erschien. Beitzen holte kurz Luft und öffnete den Mund, um das Kommando zum Feuern zu geben, als ein greller Lichtblitz das Okular des Periskops ausfüllte. Eine Sekunde später erklang eine gedämpfte Explosion, deren Druckwelle den Stahlkörper des Minen-U-Boots durchschüttelte.
Entgeistert starrte Beitzen durch das Periskop, als Flammen und Rauchwolken aus dem Kreuzer schlugen und den nächtlichen Himmel dunkelrot färbten. Das große Kriegsschiff erschauerte und schüttelte sich, und dann tauchte sein Bug tief in die Wellen ein. Das Heck stieg steil in die Höhe, verharrte für einige Sekunden in dieser Position und drückte schließlich den Bug in Richtung Meeresgrund. Nach weniger als zehn Minuten war von dem riesigen Kreuzer nichts mehr zu sehen.
»Voss … sind Sie ganz sicher, dass in diesem Quadranten keine Minen abgesetzt wurden?«, fragte er heiser.
»Ich bin mir ganz sicher«, erwiderte der Offizier und zog noch einmal die Karte zu Rate, auf der die verschiedenen Minenfelder eingezeichnet waren.
»Sie ist weg«, murmelte Beitzen schließlich und sah die Männer im Kontrollraum, die auf seine Befehle warteten, ein wenig ratlos an. »Bugklappen schließen und Gefechtsbereitschaft beenden.«
Während die enttäuschte Mannschaft ihren Routinedienst wieder aufnahm, blieb der Kapitän am Periskop und starrte weiterhin durch das Okular. Eine Handvoll Überlebende hatte in Rettungsbooten Zuflucht gefunden, aber bei dem heftigen Seegang gab es nichts, was der deutsche U-Boot-Kapitän hätte tun können, um ihnen zu helfen. Während er die leere schwarze See um das U-Boot herum betrachtete, suchte er fieberhaft nach einer Erklärung für das soeben Erlebte. Aber keine noch so gewagte Theorie ergab einen Sinn. Kriegsschiffe explodierten nun mal nicht von selbst.
Es dauerte eine Weile, bis sich Beitzen vom Periskop losriss und schweigend zu seiner Kabine trottete. Da ihm die Mächte des Schicksals einen baldigen Heldentod bescherten, sollte er nie erfahren, weshalb die Hampshire vor seinen Augen in die Luft geflogen war. Doch bis zu seinem Tod konnte der junge Kapitän das Bild von den letzten Minuten des Kreuzers, in denen das riesige Kriegsschiff scheinbar völlig grundlos untergegangen war, nicht aus seinem Gedächtnis verdrängen.
TEIL I OSMANISCHE TRÄUME
1
JULI 2012KAIRO, Ägypten
Die Mittagssonne brannte durch die dichte Schicht aus Staub und Abgasen, die wie eine schmuddelige Decke auf der alten Metropole lag. Bei Temperaturen von über fünfunddreißig Grad Celsius schlenderten nur wenige Besucher über die heißen Steine, mit denen der mittlere Innenhof der Al-Azhar-Moschee gepflastert war.
Im östlichen Teil Kairos und gut drei Kilometer vom Nil entfernt gelegen, ist die Al-Azhar-Moschee eines der wichtigsten historischen Bauwerke der Stadt. Im Jahr 970 von fatimidischen Eroberern errichtet, wurde die Moschee im Laufe der Jahrhunderte immer wieder renoviert und vergrößert und erlangte schließlich den Status als fünftwichtigste Moschee des Islam. Kunstvolle Steinreliefs, hoch aufragende Minarette und Türme mit zwiebelförmigen Dächern buhlten um die Aufmerksamkeit der Besucher und gaben Zeugnis von tausend Jahren höchster Baukunst. Umgeben von festungsartigen Steinmauern, war der Mittelpunkt der Anlage ein großzügiger rechteckiger Innenhof, der auf allen Seiten von ansteigenden Arkaden eingerahmt wurde.
Im Schatten eines Säulenbogens stand ein schmächtiger Mann in ausgebeulter Hose und weit geschnittenem Hemd, polierte die Gläser einer Sonnenbrille und inspizierte dann den Innenhof. Wegen der Tageshitze waren nur wenige junge Leute zugegen und studierten die Architektur oder spazierten stumm meditierend umher. Vorwiegend waren es Studenten der angeschlossenen Al-Azhar-Universität, einer herausragenden Institution für islamisches Wissen im Nahen Osten. Der Mann strich sich durch einen dichten Bart, der sein jugendliches Gesicht verhüllte, dann schwang er sich einen abgetragenen Rucksack auf die Schulter. Mit einer weißen Kufiya um den Kopf unterschied er sich kaum von den Theologiestudenten in der Moschee.
Er trat ins Sonnenlicht und ging über den Hof zum östlichen Säulengang. Die Fassade über den kielförmigen Rundbögen bestand aus einer Reihe verschnörkelter Girlanden und anderer Verzierungen im Stuck, die, wie er bemerkte, von einigen der zahlreichen Tauben, die diesen heiligen Ort bevölkerten, als Schlafplätze genutzt wurden. Er steuerte auf einen leicht vorgeschobenen Rundbogen in der Mitte des Säulengangs zu, über dem sich eine größere rechteckige Fläche mit arabischen Schriftzeichen befand, die den Eingang zur Gebetshalle markierte.
Der Ruf zum mittäglichen salat, dem fünfmal am Tag vorgeschriebenen Gebet, war vor fast einer Stunde erfolgt, daher war die weitläufige Gebetshalle im Augenblick nahezu menschenleer. Draußen in der Vorhalle saß eine kleine Gruppe Studenten mit untergeschlagenen Beinen auf dem Fußboden und lauschte einem Universitätsdozenten, der gerade einen Vortrag über den Koran hielt. Der schmächtige Mann umrundete die Gruppe und näherte sich dem Eingang zur Halle. Dort erwartete ihn ein bärtiger Mann in weißem Gewand, der ihn prüfend musterte. Der Besucher zog die Schuhe aus, erbat leise murmelnd den Segen Mohammeds für sich und ging nach einem Kopfnicken des Türstehers weiter.
Die Gebetshalle bestand aus einer weiten, mit rotem Teppich bedeckten Fläche, die von Dutzenden von Alabastersäulen unterbrochen wurde, die eine Balkendecke stützten. Kuppelförmige Muster im Teppich, die jeweils einen individuellen Gebetsplatz markierten, deuteten zur Vorderseite der Halle. Als er feststellte, dass der bärtige Türsteher nicht mehr auf ihn achtete, entfernte sich der Mann schnell und verschwand zwischen den Säulen.
Während er sich mehreren Männern näherte, die ins Gebet versunken auf dem Teppich knieten, entdeckte er die Mihrab am Ende der Halle. Es war die in jeder Moschee vorhandene Wandnische, die die Gebetsrichtung nach Mekka anzeigte. Die Mihrab der Al-Azhar-Moschee bestand aus poliertem Marmor und war von einem beinahe modern anmutenden, in sich verschlungenen Mosaik umgeben, das schwarz und elfenbeinfarben gearbeitet war.
Der Mann ging zu einer Säule in nächster Nähe der Mihrab, nahm den Rucksack ab und streckte sich auf dem Teppich aus, um zu beten. Nach mehreren Minuten schob er den Rucksack zur Seite, bis er gegen die Basis der Säule stieß. Als er zwei Studenten beobachtete, die in Richtung Ausgang gingen, erhob er sich und folgte ihnen in die Vorhalle, wo er seine Schuhe anzog. Während er anschließend an dem bärtigen älteren Aufpasser vorbeiging, murmelte er ein andächtiges »Allahu Akbar« und verschwand dann schnell weiter in den Innenhof.
Er tat so, als würde er für einen Augenblick eine Rosette in der Fassade bewundern, dann lenkte er seine Schritte schnell zum Bab el-Muzaiyni, dem Tor des Friseurs, durch das er das Moscheegelände wieder verließ. Ein paar Straßen weiter stieg er in einen kleinen Mietwagen, der am Bordstein parkte, und fuhr in Richtung Nil. In einem schmuddeligen Industriebezirk bog er auf das Grundstück einer stillgelegten und allmählich verfallenden Ziegelei ab und lenkte den Wagen hinter die verlassene Laderampe. Dort zog er die ausgebeulte Hose und das weite Oberhemd aus, und zum Vorschein kamen eine Jeans und eine Seidenbluse. Die Sonnenbrille wurde abgenommen, desgleichen eine Perücke und der falsche Bart. Den muslimischen Studenten gab es nicht mehr. Ersetzt wurde er durch eine attraktive, dunkelhäutige Frau mit harten dunklen Augen und modisch frisiertem, kurzem und schwarzem Haar. Nachdem sie ihre Verkleidung in eine verrostete Mülltonne gestopft hatte, stieg sie wieder in den Wagen, fädelte sich in den schleppenden dichten Verkehr Kairos ein und rollte im Kriechtempo vom Nilufer zum Internationalen Flughafen auf der nordöstlichen Seite der Stadt.
Sie stand in der Schlange vor dem Check-in-Schalter, als der Rucksack explodierte. Eine kleine weiße Qualmwolke stieg über der Al-Azhar-Moschee auf, als das Dach der Gebetshalle wegflog und die Mihrab unter einem Trümmerhaufen verschüttet wurde. Obwohl der Zeitzünder der Bombe auf eine Uhrzeit zwischen den täglichen Gebeten eingestellt war, kamen mehrere Studenten und Moscheebesucher ums Leben, und Dutzende andere Menschen wurden verletzt.
Nachdem der erste Schock abgeebbt war, reagierte die Muslimische Gemeinschaft Kairos mit einem Aufschrei der Entrüstung. Zuerst wurde Israel der Urheberschaft beschuldigt, dann aber, als niemand bereit war, die Verantwortung für diesen Anschlag zu übernehmen, hat man andere westliche Nationen als mögliche Täter genannt. Innerhalb von wenigen Wochen wurde die Gebetshalle wieder aufgebaut und eine neue Mihrab angelegt. Doch für die Muslime in Ägypten und überall auf der ganzen Welt dauerte die Empörung über das Attentat an einem derart heiligen Ort noch lange an. Nur wenige erkannten jedoch, dass diese Attacke lediglich der erste Schritt in einem raffinierten Komplott war, um die Machtverhältnisse in dieser Region völlig auf den Kopf zu stellen.
2
»Nimm das Messer und schneid es frei.«
Ein wütender Ausdruck glitt über die Miene des Fischers, als er seinem Sohn ein rostiges Messer mit sägezahnartiger Klinge reichte. Der halbwüchsige Junge zog sich bis auf seine Shorts aus, dann sprang er vom Boot ins Wasser, das Messer in einer Hand.
Vor fast zwei Stunden hatten sich die Fangnetze des Fischerboots auf dem Meeresgrund verhakt, sehr zur Überraschung der Fischers, der schon oft seine Netze durch diese Gewässer geschleppt hatte, jedes Mal ohne Schwierigkeiten. Er fuhr mit dem Boot hin und her, immer in der Hoffnung, die Netze frei zu bekommen, und stieß dabei laute Flüche aus, während die Wut über die Erfolglosigkeit seiner Versuche zunahm. So sehr er sich auch bemühte, die Netze hingen fest. Es wäre ein ziemlich hoher Verlust gewesen, einen Teil seiner Netze abzuschneiden, doch der Fischer kannte dieses Berufsrisiko, nahm es widerspruchslos hin und schickte seinen Sohn über Bord.
Obwohl an der Oberfläche starker Wind wehte, war die östliche Ägäis warm und klar, und bei zehn Metern Wassertiefe konnte der Junge schwach den Meeresgrund erkennen. Doch er war tiefer, als er ohne Hilfsmittel tauchen konnte, daher unterbrach er seinen Abstieg und begann, die in die Tiefe hängenden Netze mit seinem Messer zu attackieren. Er musste mehrere Tauchgänge absolvieren, ehe der letzte Faden durchgeschnitten war. Dann ließ er sich mit dem restlichen Netz nach oben ziehen und tauchte erschöpft und völlig außer Atem auf. Immer noch verärgert über den Verlust, wendete der Fischer sein Boot und nahm Kurs auf Chios, eine griechische Insel dicht vor der türkischen Küste, die in nicht allzu weiter Entfernung aus den azurblauen Fluten ragte.
Etwa eine Viertelmeile weiter draußen auf dem Meer beobachtete ein Mann neugierig das Missgeschick des Fischers. Sein Körperbau, hochgewachsen und schlank, verriet Kraft und Ausdauer, und seine Haut war nach Jahren in der Sonne tief gebräunt. Er ließ das altmodische Messingfernrohr sinken, und zum Vorschein kam ein Paar seegrüner Augen, die von wacher Intelligenz funkelten. Es waren nachdenkliche Augen, abgehärtet durch den wiederholten Anblick von Elend und Tod, jedoch ständig zu einem befreienden Lächeln bereit. Er fuhr sich mit den Fingern durch dichtes schwarzes Haar, das mit grauen Strähnen durchsetzt war, und dann betrat er die Kommandobrücke des Forschungsschiffes Aegean Explorer.
»Rudi, wir haben doch bis jetzt schon eine ziemlich große Fläche Meeresgrund zwischen dieser Stelle und Chios abgesucht, nicht wahr?«, fragte er.
Ein schmächtiger Mann mit einer Hornbrille, der vor einem Computermonitor saß, blickte auf und nickte.
»Ja, das letzte Rasterfeld befand sich knapp eine Meile vor der Ostküste. Da die griechische Insel weniger als fünf Meilen vor dem türkischen Festland liegt, kann ich nicht einmal mit Sicherheit sagen, in wessen Gewässern wir zurzeit operieren. Wir hatten etwa neunzig Prozent unseres Rasters abgeschlossen, als am hinteren Sensor unseres AUV eine Dichtung riss und Salzwasser eindrang. Wir werden mindestens noch zwei weitere Stunden verlieren, während unsere Techniker den Schaden reparieren.«
Das Autonomous Underwater Vehicle, kurz AUV, war ein torpedoförmiger Roboter, vollgepackt mit modernster Sensorelektronik, der vom Forschungsschiff zu Wasser gelassen wurde. Mit einem eigenen Antrieb und einem vorprogrammierten Suchraster versehen, kreuzte das AUV über dem Meeresgrund und sammelte Daten, die in regelmäßigen Zeitabständen paketweise an das Forschungsschiff gesendet wurden.
Rudi Gunn beugte sich wieder über sein Keyboard und bearbeitete die Tasten. Wer ihn in seinem zerfledderten T-Shirt und den karierten Shorts sah, hätte niemals angenommen, dass er den Posten des Stellvertretenden Direktors der National Underwater and Marine Agency bekleidete, jener berühmten Regierungsorganisation, zu deren Hauptaufgaben auch wissenschaftliche Untersuchungen der Weltmeere gehörten. Normalerweise war Gunn ausschließlich in der NUMA-Zentrale in Washington anzutreffen und nicht an Bord eines der türkisfarbenen Forschungsschiffe, die die Agentur einsetzte, um Informationen über Meeresflora und -fauna, über Meeresströmungen, Wetterverhältnisse und Umweltverschmutzung zu sammeln. Einerseits ein erfahrener und fähiger Verwaltungsfachmann, genoss er es andererseits, der hybriden Hauptstadt der Nation gelegentlich zu entfliehen und praktische Arbeit zu leisten, vor allem wenn sein Chef ebenfalls die Flucht ergriff.
»Wie sehen die Bodenkonturen in diesen Untiefen aus?«
»So wie überall im Bereich der hiesigen Inseln. Ein sanft abfallendes Riff erstreckt sich einige Meilen weit ins Meer, ehe es abrupt abbricht und sich in einigen tausend Fuß Tiefe verliert. In unserer jetzigen Position haben wir einhundertzwanzig Fuß Wasser unterm Kiel. Soweit ich mich erinnern kann, haben wir hier vorwiegend sandigen Meeresboden mit nur wenigen Hindernissen.«
»Genau das hatte ich mir auch schon gedacht«, erwiderte der Mann mit strahlenden Augen.
Gunn fing den Blick auf und sagte: »Ich sehe geradezu vor mir, wie im Kopf meines Chefs ein hinterhältiger Plan Gestalt annimmt.«
Dirk Pitt lachte. Als Direktor der NUMA hatte er Dutzende von Unterwasseruntersuchungen geleitet, und das teilweise mit bemerkenswerten Ergebnissen. Vom Heben der Titanic bis zur Entdeckung der verschollenen Schiffe der Franklin-Expedition zum Nordpol, hatte Pitt eine geradezu unheimliche Fähigkeit, die Geheimnisse der Tiefsee zu entschlüsseln. Mit einem ausgeprägten Selbstvertrauen und einer unstillbaren Neugier gesegnet, war er schon in jungen Jahren vom Meer fasziniert gewesen. Die Verlockung ließ niemals nach und sorgte dafür, dass die NUMA-Zentrale in Washington mit einiger Regelmäßigkeit auf seine Anwesenheit verzichten musste.
»Es ist eine wohlbekannte Tatsache«, sagte er fröhlich, »dass die meisten küstennahen Schiffswracks von den Netzen örtlicher Fischer gefunden werden.«
»Schiffswracks?«, erwiderte Gunn. »Soweit ich mich erinnere, hat uns die Regierung der Türkei gebeten, die Auswirkungen des verstärkten Algenwuchses in ihren Küstengewässern zu untersuchen. Davon, dass wir nach irgendwelchen Wracks Ausschau halten sollen, war niemals die Rede.«
»Ich nehm sie eben immer so, wie sie auf mich zukommen«, meinte Pitt lächelnd.
»Na ja, zurzeit können wir sowieso nicht viel tun. Soll ich das ROV auf die Reise schicken?«
»Nein, die Netze unseres Fischers haben sich in leicht erreichbarer Tauchtiefe verfangen.«
Gunn sah auf seine Uhr. »Ich dachte, du wolltest in zwei Stunden aufbrechen, um das Wochenende mit deiner Frau in Istanbul zu verbringen?«
»Da bleibt mir doch mehr als genug Zeit«, sagte Pitt grinsend, »für einen schnellen Tauchgang auf der Fahrt zum Flughafen.«
»Dann heißt das wohl«, erwiderte Gunn mit einem resignierenden Kopfschütteln, »dass ich Al wecken muss.«
Zwanzig Minuten später warf Pitt eine Reisetasche in ein Zodiac, das neben der Aegean Explorer auf den Wellen tanzte, dann stieg er über die Klappleiter zum Boot hinunter. Während er Platz nahm, schob ein kleiner, athletisch gebauter Mann am Heck den Gashebel eines kleinen Außenbordmotors nach vorn, und das Schlauchboot sprang vom Schiff weg.
»Wo gehen wir runter?«, rief Al Giordino, während die letzten Reste Schlaf, die noch von der Nachmittagssiesta herrührten, aus seinen dunkelbraunen Augen wichen.
Pitt hatte sich mit Hilfe mehrerer Landmarken auf der benachbarten Insel orientiert und den Kurs festgelegt. Indem er Giordino in einem bestimmten Winkel zur Küste dirigierte, fuhren sie nur ein kurzes Stück, bevor Pitt befahl, den Motor zu stoppen. Dann warf er einen kleinen Anker vom Bug und fixierte die Leine, als sie schlaff wurde.
»Nur knapp über hundert Fuß«, stellte er fest, als er den roten Streifen an der Leine dicht unter der Wasseroberfläche gewahrte.
»Und was erwartest du da unten zu finden?«, fragte Giordino.
»Alles – von einem Haufen Steine bis hin zur Britannic«, erwiderte Pitt und erinnerte an das Schwesterschiff der Titanic, das während des Ersten Weltkriegs durch eine Mine im Mittelmeer versenkt wurde.
»Ich würde auf den Haufen Steine wetten«, sagte Giordino und schlüpfte in einen blauen Nasstauchanzug, dessen Nähte durch seine athletischen Schultern und Oberarme beinahe gesprengt wurden.
Tief in seinem Innern wusste Giordino, dass auf dem Meeresboden etwas viel Interessanteres wartete als nur ein paar große Felsen. Zu viel hatte er mit Pitt erlebt, um den offensichtlichen sechsten Sinn seines Freundes, wenn es um das Aufspüren von Unterwassergeheimnissen ging, in Zweifel zu ziehen. Die beiden waren seit ihrer Kindheit befreundet und in Südkalifornien aufgewachsen, wo sie vor Laguna Beach zusammen das Tauchen erlernt hatten. Während sie bei der Air Force dienten, hatten sie zusammen ein kurzes Gastspiel bei einer frischgebackenen neuen Regierungsabteilung absolviert, die sich dem eingehenden Studium der Ozeane widmete. Eine Menge Projekte und Abenteuer später leitete Pitt nun die um einiges vergrößerte Agentur namens NUMA, während ihm Giordino als Chef der Abteilung für Unterwasser-Technologie assistierte.
»Ich denke, wir sollten das Gelände in einem größeren Umkreis um die Ankerleine absuchen«, schlug Pitt vor, während sie sich die Atemgeräte auf den Rücken schnallten. »Wenn mich nicht alles täuscht, muss sich das Netz des Fischers von uns aus gesehen an einem Punkt verhakt haben, der näher an der Küste liegt.«
Giordino nickte, dann schob er sich den Atemregler zwischen die Zähne und ließ sich vom Randwulst des Zodiac rückwärts ins Wasser kippen. Pitt folgte ihm eine Sekunde später, und die beiden Männer sanken an der Ankerleine entlang hinab auf den Meeresgrund.
Das blaue Wasser des Ägäischen Meeres war erstaunlich klar, und Pitt konnte mehr als fünfzig Fuß weit sehen. Während sie sich dem Meeresgrund näherten, stellte er zufrieden fest, dass der Boden nahezu ausschließlich mit Geröll und Sand bedeckt war. Gunns Einschätzung traf zu. In dieser Region gab es offensichtlich keine natürlichen Hindernisse.
Die beiden Männer gingen über dem Meeresboden ein wenig auf Distanz zueinander und schwammen in einem weiten Bogen um die Ankerleine herum. Ein kleiner Schwarm Zackenbarsche zog an ihnen vorbei, beäugte die Taucher jedoch argwöhnisch, ehe er sich eilig in tiefere Gefilde verzog. Während sie in Richtung Chios paddelten, bemerkte Pitt, dass ihm Giordino zuwinkte. Indem er mit den Beinen einen kräftigen Scherenschlag ausführte, gelangte Pitt neben seinen Partner und sah, dass er auf ein großes dunkles Gebilde vor ihnen deutete.
Es war ein aufragender brauner Schatten, der im matten Licht zu schwanken schien. Er erinnerte Pitt an einen Baum im Wind, dessen belaubte Äste sich zum Himmel reckten. Doch als er näher heranschwamm, erkannte er, dass er keinen Baum vor sich hatte, sondern die Reste des Fischernetzes, die sich träge in der Strömung wiegten.





























