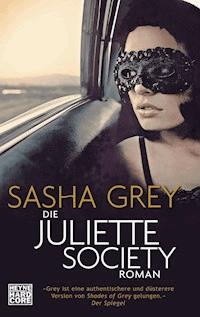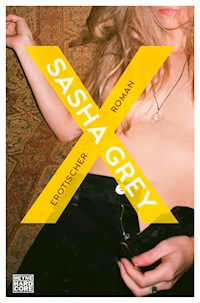
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Sasha Grey
- Sprache: Deutsch
Catherine ist jung, frei und selbstbewusst. Doch ihr Leben als Journalistin nimmt sie ganz schön ein. Bis sie einen Mann kennenlernt, der ihre Leidenschaft für hemmungslosen, ungezwungenen Sex endlich wieder zum Glühen bringt. Catherine will sich ganz in ihrer Lust verlieren. Doch sie muss erkennen, dass jener Mann nicht zufällig in ihr Leben getreten ist. Sie wird auf eine Insel eingeladen, wo die Mächtigen der Welt ihre dunkelsten Begierden ausleben. Ein Spiel um Macht und Sex beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Catherine ist jung, frei und selbstbewusst. Doch ihr Leben als Journalistin nimmt sie ganz schön ein. Bis sie einen Mann kennen lernt, der ihre Leidenschaft für Filme und hemmungslosen, ungezwungenen Sex endlich wieder zum Glühen bringt. Sie will sich ganz in ihrer Lust verlieren. Doch ein Skandal reißt sie aus ihren betörenden Träumen: Jemand will ihr etwas anhängen. Ihre Karriere zerstören. Sie mundtot machen.
Catherine muss rausfinden wer dahinter steckt - und taucht ein in eine Welt, die dunkler und geheimnissvoller ist, als alles, was sie je gesehen hat.
Die Autorin
Sasha Grey, geboren 1988 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete nach der Highschool als Bedienung und entschloss sich 2005, ins Pornogeschäft einzusteigen. Mit 18 Jahren dreht sie ihren ersten Porno und wurde in der Branche schnell zur erfolgreichsten Porno-Newcomerin aller Zeiten. Mittlerweile hat sie in mehr als 200 Hardcore-Filmen mitgespielt. Außerdem war sie in Jens Hoffmans vielgelobter Kino-Doku „9 to 5 Days In Porn“ zu sehen. Mit ihrer Hauptrolle für Steven Soderberghs „The Girlfriend Experience“ hat sie in den USA endgültig den Wandel zur Schauspielerin vollzogen. Außerdem ist sie als Musikerin unter dem Namen aTelecine aktiv. Für Furore sorgte ihr Engagement als Botschafterin der Tierschutzorganisation PETA, für die sie nackt posierte. X ist ihr dritter Roman.
SASHA GREY
X
Erotischer Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Carolin Müller
Wilhelm Heyne Verlag
München
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel The Mismade Girl by Cleis Press, an imprint of Start Midnight, LLC, New York.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2018 by Sasha Grey
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Marcus Jensen
Umschlaggestaltung: Designomicon
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-16455-3V003
www.heyne-hardcore.de
Für euch alle.
Prolog
Wissen ist Macht.
Zumindest wird das behauptet. Wieder so ein hübscher Spruch, der einen ködern oder verurteilen soll, der einem selbst die Last der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zuschiebt, der einem die Handlungsmacht aufbürdet. Wenn man sich nicht selbst schlaumacht, dann ist alles, was passiert, die eigene Schuld, weil man sich entschieden hat, lieber unwissend zu bleiben, stimmt’s? Das will man uns glauben machen, damit wir uns an die eigene Nase fassen, wenn etwas schiefläuft, anstatt das System umzustürzen.
Doch dann heißt es wieder, Unwissenheit sei ein Segen, und diese Sichtweise erscheint einem verdammt reizvoll, wenn man schon zu vieles gesehen hat, zu viel weiß, zu viel getan hat und sich nach einem Ausweg sehnt. Aber wenn man diese Linie einmal übertreten hat, kann man nie mehr wirklich zurück. Die Büchse der Pandora lässt sich nie mehr schließen, wenn man ihren Deckel auch nur einen Spaltbreit geöffnet hat, um einen harmlosen, kleinen voyeuristischen Blick hineinzuwerfen. Erfahrung kann nicht ungeschehen gemacht werden. Wenn man also hineinschaut, dann muss man diesen Weg weiter beschreiten, für immer verändert durch die Erkenntnis – obwohl niemand das Wissen sehen kann, das sich unter unserer Haut eingebrannt hat, in unseren Köpfen und Herzen.
Wissen ist Macht. Die Anwendung dieses Wissens bedeutet Weisheit, aber es macht die Dinge auch komplizierter, denn was tut man jetzt mit all dem Gelernten? Angriff oder Verteidigung, Waffe oder Schild? Unser Wissen kann uns aktive Macht verleihen oder passive Stärke. Die Entscheidung liegt bei uns.
Vor drei Jahren ließ ich einen hochragenden Monolithen in der Wüste zurück, nachdem ich eine Menge über die Welt herausgefunden hatte … und über mich selbst. Ich verlor mich im Leben einer Toten, einer Provokateurin namens Inana Luna, deren Mission es gewesen war, Kunst mittels sexueller Metaphorik und durch Handlungen zu schaffen, die die Grenzen der Sexualität verschieben sollten.
Ich stieß wieder auf die Juliette Society.
Ich hatte einen traumhaft unwirklichen Dreier mit DeVille und seinem Doppelgänger.
Ein USB-Stick gelangte in meinen Besitz, mit der Einladung, meinen Weg der Selbsterkenntnis noch ein wenig fortzusetzen – denn darum ging es. Ich musste mich bloß dazu entschließen.
Obwohl ich damals nicht ahnte, dass ich damit eine bestimmte Richtung einschlug, entschied ich mich dafür, Inanas Geschichte zu erzählen, anstatt meine eigene mehr zu leben. Ich beschloss, allen zu berichten, wer sie wirklich war, wer Frauen wie sie, die wahren Provokateurinnen, wirklich sind – und warum wir sie heute brauchen. In diesem Moment war mir ihre Geschichte wichtiger als meine eigene Reise tiefer in den Kaninchenbau der Juliette Society, auch wenn ich ihren Namen für meine Zeitungsreportage aus naheliegenden Gründen außen vor ließ.
Es war meine eigene Entscheidung, nicht sofort einen Blick auf den Inhalt des USB-Sticks zu werfen. Und als ich nach Hause zurückfuhr, um meinen Artikel abzugeben, verschwand er wieder aus meinem Besitz – ein Zeichen der Juliette Society, dass unsere gemeinsame Zeit vorbei war. Ich war von der Route abgewichen, als ich mich dazu entschied, Inanas Geschichte zu erzählen, anstatt bei der Juliette Society zu bleiben, und obwohl ich mich fragte, was sich mir dort offenbart hätte, lebte ich mit meiner Entscheidung. Und das nicht schlecht. Profitierte sogar davon.
Damals fühlte es sich für mich schlüssig an.
Der Artikel zog Interviews nach sich, das größte davon mit meinem alten Kumpel Forrester Sachs. Ironischerweise kannte er Inana vermutlich sogar besser als ich, da er selbst ein VIP-Mitglied und häufiger Gast in den geheimen Räumlichkeiten unter dem Hotel war, in dem sie gearbeitet hatte. Ich hatte ihn dort selbst gesehen, festgeschnallt, während eine Domina ihm einen kruzifixförmigen, unterarmlangen Dildo in eine sehr heikle Öffnung rammte.
Ich musste mir das Lachen verkneifen, als wir uns dann für das Interview vor der Kamera gegenübersaßen und er versuchte, in seinem Dreiteiler asketische Strenge und Seriosität auszustrahlen, und mir eindringliche Fragen (die Zweideutigkeit ist hier beabsichtigt) stellte. Doch dieses Interview war wichtig und gut gemacht, vielleicht eben weil auch er Inana gekannt und gemocht hatte. Abgesehen davon schuldete er mir noch einen Gefallen für mein Schweigen – auch wenn ich ihn nicht bloßgestellt hätte. Menschen sind oft sehr entgegenkommend, weil sie eine schlechte Meinung von einem haben und deswegen Schlimmes befürchten.
Das Interview bescherte mir weiteren beruflichen Erfolg, allerdings nicht unbedingt auf dem erwünschten Gebiet. Ich bin noch immer Journalistin, anstatt Filme zu machen, wie ich es mir erträumt hatte, aber ich habe eine gewisse Stufe der Erfolgsleiter erklommen. Die Türen, die der Artikel mir öffnete, waren nicht unbedingt jene, durch die ich zu gehen gehofft hatte, doch aus einem reinen Karriereblickwinkel betrachtet war es nur positiv: eine steile Kurve nach oben, voller Möglichkeiten, für die andere sterben würden. Trotzdem fühlt es sich manchmal so an, als würde ich den Traum einer anderen leben, anstatt meinen eigenen zu verfolgen. Ich bin nicht erfüllt in dieser Nische, aber nicht unzufrieden genug, um sie wirklich zu verlassen.
Seit einiger Zeit frage ich mich immer häufiger, welche Rolle das Schicksal in unserem Leben spielt. Befreit uns unsere Geburt bloß aus dem Bauch unserer Mutter, damit wir anschließend an die unsichtbaren Ketten der Vorsehung gelegt werden? Sind wir trotz all unserer Bemühungen im Rad des Schicksals gefangen? Landen wir, ganz gleich ob wir dagegen ankämpfen oder es akzeptieren, am Ende genau da, wo es uns vorbestimmt war?
Falls alles Vorsehung ist, welche Entscheidungen trifft man dann selbst? Ist es die Illusion einer Wahl, die Annahme eines freien Willens, die einen jeden Morgen aufstehen lässt, oder hat man sogar dabei eigentlich keine Entscheidungsmacht, und es ist nur eine weitere Sache, die sich der eigenen Kontrolle entzieht? Vielleicht ist »Schicksal« aber auch bloß ein Konstrukt, das einem ein Gefühl der Sicherheit vermitteln soll, wenn das Leben außer Kontrolle gerät. Gefeuert, betrogen, ein Freund, der stirbt: Gott hat es so gewollt, das Leben hat es so für uns vorgesehen, das Universum hat es uns geschickt, damit wir eine Lektion lernen und als Mensch wachsen, und man bekommt nur so viel aufgebürdet, wie man tragen kann? Etwas Schlimmes akzeptiert man leichter, wenn man sich nachts unter das tröstende Laken der höheren Gewalt flüchten darf.
Ich erinnere mich, wie es sich vor drei Jahren für mich angefühlt hatte, die Version von mir anzunehmen, die immer im Schatten darauf gewartet hatte, dass ich endlich zur Seite trete und sie mitspielen lasse.
Nachdem Jack und ich uns getrennt hatten, nachdem ich mich entschlossen hatte, den Ruf einer Toten zu retten und ihr Vermächtnis zu bewahren, war nichts mehr wie zuvor. Ich wollte Dinge von Jack, die er mir nicht geben konnte. Nach Jahren des Zusammenseins bemühte er sich nicht mehr, meine Sweetspots zu erkunden. Die Juliette Society gab mir genau das. Zu Inana zu werden gab mir genau das. Mein ganzes Wesen wurde mir auf eine Weise erschlossen, die ich nur damit beschreiben kann, mich in- und auswendig kennengelernt zu haben.
Doch indem ich zu Inana wurde, indem ich mich dafür entschied, sie zu retten, opferte ich auch diese Erfahrungen. In Wahrheit hatte ich alles, und am Ende blieb mir gar nichts.
Flüchtige Affären wurden zu heiklen Momenten, der Sex war anders. Ich kann zwar nicht sagen, dass es so wenig erfüllend war, wie nicht von Jack geschätzt zu werden oder null Spontaneität mit ihm ausleben zu können – aber es wurde zu einer erneuten sexuellen Selbstfindung. Ich konnte fühlen, riechen und mich meiner Erregung hingeben auf der Basis dessen, was mein Körper nun wusste. Was ich wusste. Was mich scharfmachte und was für mich einfach nicht funktionierte. Ich fühlte mich stärker und selbstsicherer als je zuvor.
Obwohl ich die Juliette Society dafür opfern musste und ich an Jack eine Seite erkannte, deren Existenz ich mir eigentlich nie eingestehen wollte, fühlte und fühle ich mich vollständig.
Aber ich kann nicht so recht vergessen, was geschehen ist. Den Geschmack des Loslassens. Das Gefühl, das sich einstellt, wenn man nur noch aus Sinneswahrnehmungen besteht und sich selbst total im eigenen Körper verliert. Seide und Satin fühlen sich auf der Haut ja ganz nett an, aber ich wollte das Rot brennender Haut und die geriffelten Einkerbungen von Seilabdrücken tragen.
Das ist noch immer das schönste Kleid, das ich je getragen habe. Doch ich zog es aus, und nun habe ich schon seit Jahren nicht mehr den Druck eines Seils gespürt. Das ist die Version von mir, für die ich alles andere in Zahlung gegeben habe. Vielleicht hatte ich auch nie wirklich die Wahl …
Ich weiß nicht, ob es so etwas wie Schicksal wirklich gibt. Habe ich mich mit beruflichem Erfolg zufriedengegeben, anstatt meine Träume zu verfolgen und alle Grenzen dessen, was ich zu sein glaubte, zu überschreiten? Wer ich sein könnte? Vielleicht. Ginge es mir heute besser, wenn ich den USB-Stick sofort eingestöpselt und mich auf seine Inhalte gestürzt hätte? Wen würde ich dann heute im Spiegel sehen?
Ich werde es nie erfahren.
Dennoch habe ich mich jetzt drei Jahre lang mit der Frage herumgeschlagen, ob ich an jenem Abend die richtige Entscheidung getroffen habe.
1
Es gibt einen Grad an Reichtum, den die meisten von uns niemals werden ermessen können. Nicht, dass nicht jeder davon träumen würde, reich zu werden. Wir wünschen uns wohl alle einen Lotteriegewinn oder einen unbekannten Erbonkel, der uns sein unverschämt hohes Vermögen hinterlässt. Und es gab immer die Kids, die man beneidete, weil sie Hausangestellte, einen beheizten Pool, einen Jacuzzi und ein eigenes Zimmer zum Videospielen und Filmeschauen hatten, und bei denen der Kühlschrank immer voll war.
Solche Fantasien sind nichts Ungewöhnliches. Wir alle wollen träumen. Kinder und Erwachsene. Niemand möchte sich abstrampeln oder sich die besten Jahre seines Lebens totarbeiten und sich damit vertrösten, dass das Leben nach der Pensionierung endlich richtig losgeht, wenn man eigentlich schon zu alt ist, die Dinge umzusetzen, die man schon immer ausprobieren wollte.
Deshalb sind diese Fantasien so reizvoll: Sie versprechen die Reichtümer ohne die ganze Arbeit – sofortigen Wohlstand, ohne dass man sich sein Imperium erst mühsam selbst aufbauen muss, denn das dauert uns schließlich zu lange in dieser Kultur der prompten Befriedigung. Wer hat schon Zeit dafür, wo doch alle die meiste Zeit damit beschäftigt sind, Fotos von ihrem Leben zu machen, um allen anderen zu beweisen, dass sie besser dran sind?
Doch es gibt einen Grad des Reichtums, der denjenigen, die ihn erreicht haben, mehr bringt als bloße Sicherheit – er beschert ihnen den puren, uneingeschränkten Genuss. Luxusgüter, für die unsereins monate- oder sogar jahrelang sparen müssten und die wir dann hegen und pflegen würden – neue Designerschuhe, eine Kroko-Birkin-Bag, ein protziges Auto –, sind für sie wie Wegwerfprodukte, schlicht weil sie es sich leisten können.
Man stelle sich vor, auf der eigenen Geburtstagsparty würde der Lieblingsmusiker auftreten, man würde über ganze Ferrari-Flotten verfügen, und es stünde jederzeit ein Privatjet für einen bereit – sogar für Flüge von gerade mal einer Viertelstunde. Man stelle sich vor, man hätte Penthousewohnungen mit der schönsten Aussicht, Promis gingen bei einem ein und aus, und an einem Shopping-Nachmittag könnte man das Jahresgehalt eines durchschnittlichen Amerikaners verprassen. Sterne-Menüs wären alltäglich und nicht bloß ein einmaliges Erlebnis. Auf einem Foto habe ich mal eine Hublot-Uhr aus Roségold gesehen – an einem Hund.
Die Leute, von denen ich hier rede, haben all das und noch mehr, und es geht ihnen am Arsch vorbei. Allerdings reden wir da nicht von dem gerne beschworenen einen Prozent. Vielmehr handelt es sich dabei um den Anteil der Reichen innerhalb der höchsten Kreise, die diese Millionäre noch weit hinter sich lassen. Ihre Garagen sind größer – und vermutlich schöner – als anderer Leute Wohnungen. Ihre Jachten verfügen über U-Boote und Helikopter.
Scheichs, Industriemagnaten und Internetgiganten. Ein Teil von ihnen zählt zur wirtschaftlichen Leistungselite, die sich ihr Vermögen selbst erarbeitet hat, oft auf Kosten anderer. Aber manche wurden in diese Kaste hineingeboren und suhlen sich darin. Sie und wir teilen nicht dieselbe Realität. Wie könnte man auch, wenn man jemand ist wie der jüngste Sohn von Donald Trump, von dem es heißt, er habe kein eigenes Zimmer, sondern sein eigenes Stockwerk im Anwesen seiner Eltern.
Die Kinder dieser Leute kommen nur dann mit dem Elend in »Kontakt«, wenn sie ihr wohltätiges Profil aufpolieren wollen, indem sie ehrenamtlich in Suppenküchen aushelfen oder Missionsarbeit in Afrika oder Südamerika leisten.
Sie leiden unter ganz anderen Belastungen als wir anderen, und auch die Türen, die sich angesichts der Farbe ihrer Kreditkarten oder des Klangs ihres geraunten Nachnamens öffnen, sind andere. Das Ansehen, das sich ihre Eltern hart erarbeitet haben, wird ihnen automatisch zuteil, und diese Zitze saugen sie gnadenlos wund.
Was uns direkt zu Rich Kids of Instagram führt. Ich bin zwar selbst ziemlich aktiv in den sozialen Netzwerken, und außerdem findet unser Leben sowieso zunehmend online statt, aber ich hatte noch nie von RKOI gehört, bis ich im Netz nach Jacob gesucht habe – meiner Verabredung für jenen Abend. Man kennt doch diese schrecklichen Typen, die vor jedem Essen minutenlang versuchen, das perfekte Foto für Instagram zu schießen. Die, die kein einziges Erlebnis genießen können, weil sie viel zu beschäftigt damit sind, Selfies zu knipsen. RKOI sind die absolute Steigerung dieser Typen, bloß dass sie das Leben festhalten, von dem man selbst nur träumen kann. Meist sind es Kinder von Adeligen, von Oligarchen und Moguln, die in diesen Lifestyle hineingeboren wurden und die ihn dokumentieren, als bekämen sie Geld für diese Fotos. Augenscheinlich haben einige von ihnen Instagram zu ihrem Job gemacht, und sie updaten ihre Profile ständig mit protzigen Bildern, die ihren Reichtum und ihre Privilegien offensiv zur Schau stellen.
Quittungen von Shoppingtrips durch Designerläden im Zehn- oder sogar Hunderttausenderbereich, teurer Champagner, der auf Jachten geschüttelt und ins Meer verspritzt wird, beiläufige Selfies, umgeben von Freunden an den exotischsten Schauplätzen der Welt, lauter flüchtige Blicke hinter die Kulissen, die beweisen sollen, dass es dort noch besser ist, als man es sich erträumen würde.
Selbstbestätigung? Vielleicht. Aber wer würde diesen Lifestyle nicht selbst gerne mal ausprobieren, um zu schauen, ob er zu einem passt?
Ich bin also mit einem dieser Rich Kids verabredet.
Er trägt eine trendy weiße Riesenuhr am Handgelenk, hat aber noch keinen einzigen Blick darauf geworfen in der Stunde, die wir nun schon im Restaurant sind. Außer an grotesk reichen Männern über fünfzig habe ich seit einer Ewigkeit keine Armbanduhr mehr gesehen – von Fitnesstrackern will ich hier gar nicht erst anfangen –, und es macht mich neugierig, ob er sie aus rein modischen oder funktionalen Gründen trägt. Doch er wirft nicht einmal dann einen Blick auf ihr Zifferblatt, als ich ihn nach der Uhrzeit frage. Stattdessen zieht er sein Smartphone hervor, das Modell, das erst noch kommen wird, und fummelt daran herum, in der Hoffnung, ich würde es bemerken und mich für sein Spielzeug begeistern.
Männer, die einer Frau imponieren wollen, haben einen bestimmten Gesichtsausdruck. Ein vielsagendes Spähen, als würden sie direkt in die Sonne starren, während sie sorgfältig nach den richtigen Worten suchen, nur dass das leuchtende Objekt in diesem Fall eine ihrer Anschaffungen ist und nicht das Zentrum unseres Universums. Doch für den Mann sind sie in diesem Moment ein und dasselbe, und er denkt, die Welt müsse innehalten und den edlen Gegenstand bewundern, mit dem er prahlt.
Ich tue es nicht. Was soll das bringen? Echter Wohlstand verbirgt sich in Qualität, während neues Geld unsicher und protzig ist, nach Aufmerksamkeit schreit wie dieser sexy Mann um die dreißig, dessen Ego durch seine Zeit als Highschool-Nerd noch immer angeschlagen ist. Also versucht er nun verzweifelt, bei den Frauen zu landen. Ein Mann, der eigentlich wissen müsste, wie es sich anfühlt, übersehen zu werden, und dennoch selbst zu einem echten Fuckboy wird. Er befindet sich in einer Tretmühle der Bestätigung, die niemals zum Stillstand kommen wird, denn Unsicherheit ist wie ein unersättliches schwarzes Loch. Außerdem beeindruckt mich Besitz nicht.
Je mehr ich in die Welt der Reichen und Berühmten eintauche, desto reizvoller finde ich intellektuelle Stimulation statt bloß hübscher Gesichter und Großspurigkeit. Letzte Woche wurde ich von einem vollkommen Fremden in ein Gespräch über Vorsehung und freien Willen verwickelt, das mich so berauschte, dass ich ihm am Ende in seinem Auto das Hirn wegvögelte, als könnte ich die Köstlichkeit seines Intellekts durch Osmose und sein Sperma aufnehmen.
Früher habe ich immer von einem Mann geträumt, der mein Herz im Sturm erobert. Dann wünschte ich mir einen, der mein Bett erobert. Jemanden, der mich fragen würde: »Was ist neu für dich? Welche sexuelle Fantasie würdest du mal gerne ausleben?« Und ich hätte geantwortet: »Können wir bekifft ficken und Churros essen? Oder Pizza? Kannst du mich am nächsten Tag mit lauter sexy Nachrichten oder Anrufen bombardieren, damit ich die Zeit, bis wir das nächste Mal vögeln, rumkriege? Und falls mein nächstes Mal nicht mit dir ist, dann will ich, dass du das okay findest. Kannst du mir die Füße massieren und mir sagen, dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als für immer in mir zu sein? Kannst du mich diskret unterm Restauranttisch befummeln?«
Und er hätte gesagt: »Sowieso. Wann legen wir los?«
Aber sie tun es nie, und ich glaube kaum, dass dieser Typ da anders sein wird.
Mein Date muss das Desinteresse in meinem Gesicht mitbekommen haben. »Also, diese Inana Luna.« Er beugt sich zu mir. »Hast du schon, äh, private Videos von ihr gesehen? Sie wirkte so hemmungslos. Wie abgefahren war sie hinter den Kulissen?«
Um meine Verbitterung hinunterzuspülen, nehme ich einen Schluck von dem pappsüßen Weißwein, den er für mich bestellt hat. Ich wollte, dass alle sich an Inana Luna erinnern, und zwar nicht nur an das hurenhafte Model, das die Medien aus ihr bis zu ihrem Tod gemacht hatten. Mir war damals nicht klar, dass es Leute geben würde, die sich aufgrund meiner zweifelhaften Berühmtheit durch den Artikel über sie an mich ranschmeißen und ihren Namen einsetzen würden, um sich bei mir einzuschleimen. Leute, die versuchen würden, über diese Schiene bei mir zu landen, in der Hoffnung, dies würde ihnen anschließend Verbindungen mit den Leuten bescheren, die sich höher auf der sozialen Leiter befindet als ich. Manchmal wünschte ich, ich könnte, um uns beide zu schützen, ihren Namen für manche Menschen vergessen machen.
Ich möchte nicht, dass meine gesamte weitere Laufbahn durch den Artikel über sie definiert wird – niemand steckt gerne in einer Schublade. Aber letzten Endes habe ich keinen Einfluss darauf, wie die Leute mich sehen. Ich kann mich lediglich darauf konzentrieren, Neues zu veröffentlichen, und hoffen, dass die Leute gut auf meine Bemühungen reagieren. Haters gonna hate, und die Geier kreisen eh. So ist das Leben.
Jetzt will mir dieser Typ doch tatsächlich irgendwas von abgefahren erzählen? Er ist ein totaler Anfänger. Das sind sie alle. Wenn ich sagen würde: »Ich will, dass dein heißes Sperma mir die Schenkel runterläuft, und dann will ich, dass du es abschleckst und mich aussaugst und mich immer wieder kommen lässt«, würde er erwidern: »Könnte ich das mit dem Auflecken meiner eigenen Wichse vielleicht skippen?« Und wenn ich dann sagen würde: »Nein, ich will, dass du jeden Winkel meiner köstlichen, süßen, feuchten Muschi liebst«, würde er sagen: »Aber meine Wichse finde ich jetzt nicht so lecker.«
Trotzdem würde er erwarten, dass ich sie so gierig schlucke, als wäre sie die neueste Geschmackssensation. Ich hab nichts dagegen, aber bei Sexspielchen geht es darum, dass beide Partner bekommen, was sie wollen.
Ich habe festgestellt, dass Männer normalerweise nur dann perverse Spielchen lieben, wenn sie auf uns abspritzen können. Titten, Arsch oder Gesicht, für sie ist dieser Moment der Macht das Schärfste. Aber wenn man dann wirklich mit ihnen abgehen will, werden sie zimperlich.
Ich setze mein Glas ab. »Bei ihr war alles Sein, kein Schein. Zu Inanas Schönheit gehört, dass nichts an ihr Fake war. Das Credo ihrer Reise war Transparenz, und sie hat sie gut dokumentiert. Aber ich durfte einen kleinen Einblick in ihre Gedankenwelt werfen …« Aus einem Beschützerreflex heraus verstumme ich, anstatt Einzelheiten aus ihrem Tagebuch zu nennen. Es ging ihr darum, ihre Grenzen durch Körperlichkeit und Sexualität auf künstlerische Weise auszuloten. Teilweise habe ich mich in den Seiten dieses Buches verloren. Eine Weile war ich selbst Inana Luna. Ich fuhr zu ihrem Haus, schlief in ihrem Bett, zog ihre Klamotten an und trank Kaffee aus Bechern, die ihre Lippen berührt hatten. Ich machte es mir in ihrer Badewanne. Ich blätterte in den Büchern aus ihren Regalen und entdeckte ihre Geheimnisse darin, indem ich der Spur zu Max Golds Hotel folgte, wo Inana als VIP-Concierge gearbeitet hatte … und wo sie zu Golds Geliebter wurde. Auch ich wurde seine Geliebte, doch dieser Teil der Geschichte schaffte es nicht in die endgültige Version meines Zeitungsartikels. Ich wollte sie sein. Für eine Weile war ich es, bis mir klar wurde, dass ich mich auf meine eigene Entwicklung konzentrieren musste.
Nun lächelt mich mein Date an und wartet auf meine Antwort. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich hören will oder bloß nach einer Möglichkeit sucht, mein Interesse an ihm zu wecken, doch über die Details aus ihrem Tagebuch zu sprechen wäre so, als würde man zu reinen Unterhaltungszwecken das Herz und die Seele eines Verstorbenen plündern.
Ich weigere mich, ihr Vermächtnis und meine Erfahrung abzuwerten, indem ich das tue.
Weil ich nicht fortfahre, souffliert er mir: »Du warst doch mit einem Politiker zusammen, oder? Jack irgendwas?«
Jack. Doch der war nicht mehr mein Jack, seit der Nacht in Golds Hotel, als er mich auf dem Boden fickte und mich dann für eine andere Frau verließ. Nach dieser Begegnung traf ich ihn noch zweimal, und beide Male war in seinem Blick keine Wärme mehr zu erkennen. Er hatte beschlossen, wieder eine Fremde in mir zu sehen, als hätte es unsere Beziehung nie gegeben. Er wollte die Verflechtung unserer Leben ausradieren, als wäre sie immer schon bedeutungslos gewesen. Ungeachtet der Tatsache, dass wir letztendlich nicht füreinander bestimmt waren, tat es höllisch weh. Ich meine, dass man mit jemandem Schluss macht, okay, aber man muss ja nicht gleich so tun, als hätte der andere nie existiert.
Direkt nach Jack war ich mit einem Typen zusammen, von dem ich mich mit dem Klassiker »Es liegt nicht an dir, sondern an mir« trennte, obwohl ich ihm eigentlich am liebsten einen Zettel hinterlassen hätte: Du hattest einen ziemlich kleinen Schwanz, aber ich hatte weiter Sex mit dir, denn a) wollte ich wissen, ob meine Muschi ausgeleiert oder eng ist, b) wollte ich, dass du dich in mich verliebst, und c) hoffte ich, dass dein Schwanz irgendwie größer werden könnte.
Jacob, mein aktuelles Date, beugt sich zu mir, als ich auf seine Frage, ob ich mit Jack zusammen war, nicke, und raunt verschwörerisch: »Wie ist es, DeVille so nahe zu kommen? Jack hat für ihn gearbeitet, oder? Und du warst doch schon seit der Schule mit Jack zusammen?« Er rattert ein paar Artikel herunter, die ich geschrieben habe, und mein Magen zieht sich zusammen, als seine Fragen immer gezielter und persönlicher werden.
Vor einem Jahr habe ich beschlossen, einen Schlussstrich unter meine Vergangenheit zu ziehen und nach vorne zu schauen – was schwierig ist, da einige Ereignisse aus meiner Vergangenheit Geld einbringen und ich darüber reden muss, um selbst im Gespräch zu bleiben.
»Du bist ja ganz schweigsam geworden«, sagt Jacob. »Ich werde niemandem weitererzählen, was du sagst, wenn es das ist, was dir Sorgen macht.«
Nun, bis er es eben erwähnte, hatte ich diese Sorge gar nicht gehabt.
Offenbar ist Jacob ein Fanboy meiner Arbeit und hat dies bloß bis zu unserem persönlichen Treffen geschickt verborgen. Jedenfalls hat dieses Date eine unerwartete Wendung genommen und fühlt sich nun eher wie ein Bewerbungsgespräch an. Verabredungen mit neuen Leuten sind ja meistens so; man möchte sich durch Fragen und Antworten besser kennenlernen. Manche dieser Fragen sind scharfsinniger als andere, aber alle dienen dem Zweck, das Gegenüber zu erforschen. Doch Jacob hier scheint lediglich an bestimmten Aspekten meines Lebens interessiert zu sein – nämlich an meiner Arbeit. Vielleicht war sein Desinteresse an allen restlichen Aspekten von mir, als ich versuchte, ihn in andere Gesprächsthemen zu verwickeln, bloß gespielt. Vielleicht war es nur darauf ausgelegt, mich zum Plappern zu bringen. Vielleicht hoffte er, ich würde mich dann eher bemühen, bei ihm gut anzukommen. Denn wenn man das Schweigen nicht überbrückt, tut es vermutlich der andere.
War das seine Absicht, bevor er das Gespräch auf Inana Luna lenkte, auf meine Leidenschaften und meine Vergangenheit?
Mein Argwohn steigt; seine Fragen sind so eigenartig persönlich, dass ich das Gefühl nicht loswerde, er sei verkabelt, um hinterher einen Enthüllungsbericht über mich zu verfassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand versucht, meine Geschichten zu verdrehen und mich zum Gegenstand von Anzüglichkeiten zu machen. In Hollywood wird man als junge, attraktive Frau schnell zum sexualisierten Freiwild für die Talentmaschine, man wird zermahlen und wieder ausgespuckt. Es ekelt mich an. Aber so tickt diese Branche nun mal, ob man nur eine Schauspielerin ist oder eine Frau hinter der Kamera, und aus diesem Grund ziehe ich das Printgeschäft dem Fernsehgeschäft vor. Wenn man lange genug vor der Kamera steht, fangen die Leute an, sich mehr dafür zu interessieren, wie man aussieht oder wie man den Mund verzieht, anstatt für die Worte, die aus ihm herauskommen. Man schaue sich jede beliebige Nachrichtensprecherin am Anfang ihrer Karriere an, und fünf Jahre später erkennt man deutlich ihre kosmetische Reise. Man beobachte, wie sie sich optisch in eine andere Person verwandelt, wie sie sich herausputzt und stylt und zur Plastikpuppe ihrer selbst wird. Schönere Haare, größere Titten, schmalere Taille. Mehr Make-up.
Doch seltsamerweise machen alle diese Bemühungen, das Wegbügeln der kleinen »Unvollkommenheiten«, aus einer einst interessanten Person eine weniger attraktive Version ihrer selbst. Schauspielerinnen zerstören damit ihre Karriere. Man sehe sich so ein Porzellanfurnier mal im hellen Sonnenlicht an. Wangenimplantate, Schlauchbootlippen, von Botox gelähmte Gesichter, bei denen man sich nie sicher sein kann, ob ihr Lächeln echt oder gefakt ist. Fairerweise muss man sagen, dass in diesem Geschäft eh alles Fake ist. Es ist gruselig.
Noch gruseliger ist nur, wie sie aus Angst vor der Bedeutungslosigkeit dazu getrieben werden. Für Frauen ab einem bestimmten Alter gibt es keine Rollen – die witzigen Sketche darüber sind wohl jedem bekannt. Unsere Kultur und besonders Hollywood stellen Jugend und Schönheit über alles andere, verspotten das Unperfekte und nennen die Menschen, die nicht das Glück hatten, mit makellosen Genen geboren worden zu sein, »Charakterschauspieler«. Das ist dann kein Beleg ihrer schauspielerischen Fähigkeiten, sondern ein Kommentar über ihr Aussehen.
Ich bin es leid, die ganze Zeit darauf achten zu müssen, was ich sage. »Erzähl doch mal von dir.« Ich lächle, um meinen Worten die Schärfe zu nehmen.
Jacob legt sein Handy wieder auf den Tisch. »Was willst du denn über mich wissen?« Er nimmt einen Schluck von seinem knallblauen Drink, ohne sich darum zu scheren, dass er aussieht wie der Cocktail des Tages in einem mexikanischen Urlaubsort – oder in einem Puff. Er ist ein reiches Söhnchen und nicht mein Typ, aber auf eine Weise unterhaltsam, die ich so nicht kenne. Ich möchte, dass es eine gute Nacht wird. Ich brauche dringend Ablenkung.
Vor unserem Treffen heute Abend habe ich ihn wie blöd gegoogelt. Kein Grund, mich zu verurteilen – das machen wir doch alle. Social-Media-Stalking ist das neue Schwarz.
Sein Vater, ein Schauspieler, war mit irgendeiner Promilady verheiratet. Jacob scheint nicht wirklich einen Beruf zu haben, zumindest konnte ich nichts darüber finden. Im Grunde ist er ein männliches It-Girl, das nebenbei ein bisschen auf Charity macht oder sich eine Weile in der Musikbranche versucht. Hauptsächlich trifft man ihn in Clubs und auf Partys, und er ist einer von den Rich Kids of Instagram. Wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich vermutlich nicht mit ihm ausgegangen, auch wenn solche Vorurteile natürlich unfair sind, aber so ist es eben. Auf die eine oder andere Art sind wir doch alle Heuchler.
Jacob und ich haben uns beim Autofahren auf dem La Cienega Boulevard kennengelernt. Er saß in einem hellblauen Lamborghini vor mir an der roten Ampel, und mir fiel auf, dass er mich über den Rückspiegel abcheckte und seinen Motor hochdrehte, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Als wäre ein Lamborghini in der falschen Farbe nicht schon aufdringlich genug. Als ich an der dritten Ampel nacheinander hinter ihm hielt, stieg er aus seinem Wagen und fing an, mit mir zu plaudern, als befänden wir uns in einem Club oder Coffeeshop. Er scherte sich gar nicht darum, dass er den Verkehr blockierte, und schien das Hupen und Rufen überhaupt nicht zu bemerken, als die Ampel wieder auf Grün sprang. Wie er sich an mein Auto lehnte und ganz lässig und unbekümmert mit mir flirtete, war peinlich und witzig zugleich und brachte mich dazu, ihm meine Nummer zu geben.
Jack war immer so ernst und wegen seiner politischen Tätigkeit auf die Wahrnehmung der Leute bedacht gewesen. Jacob schert sich einen Dreck um die Meinung der anderen – er will bloß Spaß haben. Es ist erfrischend, auch wenn sein Eifer etwas unreif rüberkommt. Sein Balzverhalten beruht nicht auf Selbstvertrauen, sondern auf Unsicherheit, ironischerweise aufgrund des Erfolges seiner Eltern, doch seine selbstbewusste Fassade ist enorm.
Normale Leute schämen sich, weil ihre Eltern keinen Erfolg haben. Anders in Los Angeles. Hier zählt nur ihr Anschein von Erfolg. Willkommen in Hollywood, wo Status alles ist, man Postleitzahlen anbetet und der Lack wichtiger ist als das, was man unter der Haube hat. Wenn man wegen Mami und Papi automatisch Anerkennung erfährt, dann bekommt man auch alle Privilegien, ohne je irgendetwas dafür leisten zu müssen.
Promikinder müssen nichts tun, sie haben bereits einen entscheidenden Vorteil, einfach weil sie die »Kinder von jemand« sind. Nicht alle Promikinder ruhen sich auf den Lorbeeren ihrer Eltern aus, aber viele. Selbst das Gute, was Jacob tut, wird finanziert durch den Treuhandfonds, den seine Eltern für ihn angelegt haben – und ihre Verbindungen sorgen für seine Möglichkeiten, etwas auf die Beine zu stellen. Sicher arbeiten Leute wie er auch, aber die wenigsten müssen ihren Lebensunterhalt damit bestreiten und haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Das sind die Schlimmsten.
Ich lächle. »Was machst du so in der Freizeit?«
Er zuckt mit den Schultern. »Weiß nicht. Charity und so. Egal.«
Bestechend.
Er wendet sich wieder seinem Handy zu, als es auf dem Tisch zu summen beginnt, und ich seufze durchaus enttäuscht. Daten wird auch immer uninteressanter. Nicht dass ich gerade eine feste Beziehung suche, aber ich möchte schon, dass meine Verabredungen wenigstens anregend sind und sich nicht wie Zeitverschwendung anfühlen. Wo ist bloß sein Elan hin? Manchen Typen geht es nur um die Jagd, aber dieser hier schwankt zwischen zwei Extremen: Er ist entweder irritierend persönlich oder vollkommen gleichgültig.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass niemand meine pikantesten Details kennt, weil ich sie nie erzählt habe. Irgendwie bin ich schon so umsichtig geworden wie die Politiker, denen Jack immer nachgeeifert hat.
Schließlich blickt Jacob von seinem Handy auf. »Ein Freund von mir schmeißt gerade ’ne Party. Sollen wir mal vorbeischauen?«
Wenigstens wird es da ein paar neue Gesichter geben, mit denen man sich unterhalten kann. »Logo.«
2
Nach einer kurzen Fahrt halten wir vor einem Haus oben in den Hügeln – allerdings wird mit Jacob höchstwahrscheinlich jede Fahrt zu einer kurzen, so wie er mit dem Lambo rumheizt.
Es handelt sich um ein Haus im älteren Stil, ohne die rasiermesserscharfen Linien der neueren Bauten, ohne Metall und Glas. Zwölf oder dreizehn Luxusschlitten stehen kreuz und quer in der Auffahrt. Manche wurden von anderen regelrecht zugeparkt, also bin ich froh, dass wir zu denjenigen gehören, die später dort auftauchen.
Ein bulliger Wachmann verlangt an der Tür unsere Ausweise wie vor einem Club, und wir zeigen sie ihm kurz. Entweder hatten sie in der Vergangenheit Probleme mit Alkoholausschank an Minderjährige, oder der Türsteher soll nach echten A-Promis Ausschau halten und den Gastgeber informieren, falls so einer auftaucht – was das wahrscheinlichere der beiden Szenarien ist. Der Türsteher weist die laute Freundestruppe hinter uns an, das Lachen zu unterlassen, als wäre es ein Verbrechen. Ich schaue mich flüchtig nach ihnen um und zucke genauso verwirrt wie sie mit den Schultern. Man wundert sich, welche Probleme gegen Bezahlung beseitigt werden, wenn Geld wirklich keine Rolle spielt.
Als wir hineingehen und weit und breit keine Möbel zu sehen sind, weiß ich, dass die Party megastrange wird. Ein Typ mit riesigen Pupillen läuft ohne Hose und mit einem Handtuch um den Hals an uns vorbei in den ausladenden Wohnbereich. Die Leute dort wirken ähnlich verstrahlt – vermutlich haben sie Pilze intus, so, wie zwei Mädchen dasitzen und kichernd ihre Hände betrachten. Ungefähr neun weitere Mädels lümmeln am Boden herum, voll drauf, und unterhalten sich über wirklich seltsames Zeug.
»Besorgen wir uns mal was zu trinken. Vielleicht in der Küche.« Jacob führt mich weiter durchs Haus. Noch immer keine Möbel. Entweder zieht hier gerade jemand aus oder ein – oder irgendwer nutzt es bloß als Partylocation und möchte keinen Stress mit Reinigungs- und Reparaturkosten oder sonstigen Partyunfällen haben. Verständlich. Ich habe sehr schnell gelernt, niemals Partys zu geben – am Ende bleibt das Aufräumen immer an einem hängen, und es sind die eigenen Sachen, die kaputtgehen, wenn jemand den einen oder anderen Drink zu viel hatte.
Neben einer offenen Glastür, die zu einem geschlossenen Hof hinausführt, steht eine Gruppe Kerle in Anzügen herum. Sie halten Plastikbecher in den Händen und reden hitzig aufeinander ein, obwohl sicher keiner keinem zuhört, angesichts der Menge an Koks, die sie alle intus haben. Mit verkrampften Kiefern und schwitzenden Gesichtern schniefen sie in regelmäßigen Abständen. Ich habe die Anziehungskraft von Kokain nie verstanden noch jemals irgendetwas Glamouröses darin erkennen können. Niemand, der auf Koks high ist, wirkt, als hätte er ’ne wahnsinnig tolle Zeit – eher wie jemand, der gleich eine Panikattacke haben wird. Solche Leute stehen nie herum und betonen, wie gut sie sich fühlen; alles, worüber sie labern, ist, wo sie die nächste Nase Koks herkriegen. Leute, die auf Halluzinogenen sind, diskutieren wenigstens über das Wesen des Universums und darüber, was Realität ist.
Wenn ich Drogen nehmen würde, wüsste ich jedenfalls, welchen Trip ich bevorzugen würde. Aber vorerst bleibe ich beim Tequila.
Die Küche ist so gut wie leer, als wir dort ankommen, und nachdem ich die Getränkeauswahl gesehen habe, weiß ich auch, warum. Es gibt lediglich Billigsprit aus Plastikflaschen, nichts zum Mischen und kein Eis. Auch keine Gläser, bloß rote Plastikbecher wie auf ’ner Studentenfete.
Ich schätze, diese Party ist eher was für Drogenkonsumenten – und Alkoholiker – als für Genusstrinker.
Jacob schüttet mir mit entschuldigendem Schulterzucken vier Fingerbreit Wodka in einen Plastikbecher. »Sorry.«
Ich nehme einen kleinen Schluck, um zu zeigen, dass ich keine Spielverderberin bin, aber das scharfe warme Gesöff brennt in der Kehle wie Feuerzeugbenzin und treibt mir Tränen in die Augen.
Jacob nickt jemandem am anderen Ende des Raumes zu. »Bin gleich zurück, Catherine.« Er zieht ab, und ich nehme noch einen Schluck.
Nope, das tu ich mir nicht an. Ich durchsuche den Kühlschrank nach irgendetwas, mit dem ich den Fusel in meinem Becher verdünnen könnte, und gebe schließlich neben einem Spritzer Wasser auch etwas Eis aus dem Eiswürfelbereiter hinein und eine großzügige Dosis Zitronensaft. Seltsam für einen wohlhabenden Gastgeber, dass er sich so gar nicht um das leibliche Wohl seiner Gäste schert und weder gute Drinks noch ordentliches Essen besorgt hat. Schein und Image sind eigentlich alles für diese Leute, und der völlige Mangel an Ästhetik und Präsentation ist verwirrend. Schon komisch, wenn ich daran denke, dass die Leute aus der Unterschichtsgegend, in der ich aufwuchs, stolz darauf waren, ihre Partys bestmöglich auszurichten. Ich kapier schon: Die Leute aus diesem gefakten Künstlermilieu hier wollen zeigen, dass sie so authentisch feiern können wie wir Normalsterbliche. Bei mir verfehlt diese Pseudofassade ihre Wirkung; ich sehe direkt durch sie hindurch, und mittlerweile habe ich das so oft erlebt, dass es mir schon nichts mehr ausmacht.
Working-Class-Leute haben einfach mehr Spaß, weil es ihnen wichtiger ist, ’ne echt gute Zeit zu haben, statt nur so zu wirken. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Nicht-Promis gehen nicht auf Partys, um gesehen zu werden. Sie sind dort, um nach einer harten Woche richtig abzufeiern, ihre Freunde zu treffen und vielleicht ein paar neue Leute kennenzulernen. In Hollywood hat man keine Freunde. Man hat Kontakte, wenn man Glück hat, Bekanntschaften, aber ich würde nicht darauf zählen, hier neue Freunde zu finden. Die Traumfabrik ist voller Poser und Schwätzer – das wurde mir schnell klar, als ich versuchte, Treffen mit Leuten zu arrangieren. Interviews zu organisieren war die reinste Sisyphusarbeit, weil ständig irgendwelche Termine kollidierten.
Mit meinem unwesentlich verbesserten Drink widme ich mich wieder dem Leutebeobachten, bis mein Date zurückkehrt. Mittlerweile sind mehr Gäste hinzugekommen, und die Musik ist lauter geworden. Jetzt, wo ich mich nicht mehr damit beschäftige, welche Drogen die Leute hier nehmen, erkenne ich ein paar Gesichter. Ein angesagter Fotograf ist da, und massenweise Mädels, kaum älter als einundzwanzig, versuchen, ihn mit allerlei Gepose, so billig wie ihre Outfits, zu beeindrucken, während sie die Stufen zum Haus erklimmen. Wie Fliegen, die einen verrottenden Kadaver umschwirren, kleben sie an ihm, in der Hoffnung, vom Nimbus seiner Nähe zu profitieren. Doch im besten Falle sind sie diejenigen, die ihm am Ende des Abends den Schwanz lutschen dürfen.
Ihm sind sie scheißegal, das ist so was von offensichtlich. Alle nennen ihn »Schatz« oder »Süßer« – vermutlich weil sie nicht wirklich wissen, wer er ist, aber weil ihn eine riesige Schar Bewunderer umgibt, denken sie, sie sollten dabei sein. Schon seltsam, dass sie ihn eigentlich gar nicht kennen, aber trotzdem hoffen, seine nächste Affäre oder Muse zu werden. Ich kann ihnen sagen, dass das nie passieren wird.
In den letzten Jahren habe ich mich eingehend mit Körpersprache befasst, um die Leute, die ich interviewe, besser einschätzen zu können. Es hilft einem herauszufinden, wie man sie dazu bekommt, sich einem zu öffnen, weil man weiß, wann man sich besser zurückhält, statt härter nachzubohren und sie offensiver zu befragen. Dieser Typ hier interessiert sich nur für eine Person: sich selbst. Alle anderen sind für ihn so austauschbar wie die roten Plastikbecher, aus denen wir trinken.
Eine Hand schlängelt sich über meinen Rücken. Ich drehe mich um und will der Person schon sagen, sie soll die Pfoten wegnehmen, doch es ist Jacob. »Hey.«
Ich entspanne mich ein wenig. »Hey. Ich konnte meinen Drink ein wenig aufpeppen.«
Er schnieft. »Hä?«
Oje. Verkrampftes Kinn, glänzende Augen. Jede Wette, mein Date hat eine Line gezogen. Nichts schmeichelt einem Mädchen mehr als ein Kerl, der in ihrer Anwesenheit harte Drogen nehmen muss. Nicht, dass ich von mir behaupten wollte, ich wäre so elektrisierend wie Crack, aber es kotzt mich an, dass er das gemacht hat.
Er grinst, ohne etwas von meinem Bedauern zu ahnen, mit ihm hierhergekommen zu sein. »Wollen wir uns mal umsehen? Uns unter die Leute mischen? Ich würde gern ein bisschen mit dir angeben.«
Sein Bewegungsdrang ist wohl eher darauf zurückzuführen, dass sein Herz rast und er die Aufmerksamkeitsspanne einer Stechmücke hat. Und dann noch dieses »mit dir angeben«? Ich schlucke meinen Stolz herunter und ringe mir ein möglichst würdevolles »klar« ab.
Die Pilzpartytruppe ist mittlerweile im nächsten Stadium angekommen. Irgendwer hat eine Lampe angeschleppt, und alle starren darauf, als würde darin, wenn sie nur lange genug schauen, der Sinn des Lebens offenbar werden.
In einer Ecke schieben ein paar Leute zum Rhythmus der Musik herum, und einige scheinen sich dabei nicht aufs Tanzen zu beschränken.
Während wir weiter unsere Runde durchs Erdgeschoss drehen, begrüßt Jacob ein paar Leute mit Gettofaust, aber ohne mich jemandem vorzustellen oder »mit mir anzugeben«, was mich erleichtert. Die meisten Leute sind eh so zugedröhnt, dass sie sich höchstens dann an mich erinnern würden, wenn ich mich splitterfasernackt auszöge und sie mich mit Gewürzsoßen aus dem Kühlschrank beschmieren dürften. Allerdings wäre das gar nicht möglich, denn im Kühlschrank befinden sich keine Gewürzsoßen. Abgesehen davon, bei all den Stringbikini-Höschen und den briefmarkengroßen Oberteilen, die kaum die Brustwarzen bedecken, hätte auch Nacktheit hier keinen großen Erinnerungswert.
Mir fällt ein Typ um die vierzig mit Spitzbart und Sonnenbrille auf, der verzweifelt von irgendeiner Tussi angegraben wird, indem sie seine Brille aufsetzt und so glotzt, als hätte sie einen Orgasmus. Jacob umarmt ihn brüderlich und stellt ihn mir vor. Sein Name kommt mir bekannt vor. Ich vernehme einen französischen Akzent, also küsse ich ihn auf die Wange, statt ihm die Hand zu reichen. Jacob flüstert mir irgendwas ins Ohr, von wegen, der Typ hätte gerade die Auszeichnung für das beste Video bei einer Preisverleihung gewonnen, und da wird mir klar, dass der Spitzbart und ich einige gemeinsame Freunde – oder besser Bekanntschaften – haben. Also kennt er mich wahrscheinlich auch. Jetzt, wo mir wieder einfällt, wer er ist, wird mir leicht übel beim Gedanken daran, dass ich ihn auf die französische Art begrüßt habe, obwohl ich das nicht hätte tun sollen.
Er wird umschwärmt von Leuten, die ihm von ihren aktuellen Rollen in irgendwelchen Filmen erzählen, in der Hoffnung, sein nächster Star zu werden. Einigen geht’s nicht mal darum, der Star zu sein; sie wollen sich nur nah genug an ihn heranwanzen, dass sie vielleicht den Musiker aus seinem kommenden Video vögeln können.
Die Quote der Groupies und Möchtegerns wird auf dieser Party mehr als erfüllt.
Eine grazile Blondine wirft ihr Haar zurück und reibt ihre falschen Möpse ach so zufällig am Arm des Regisseurs. »Die Leute fanden meine Hämorrhoidendarstellung so glaubwürdig, das tat ihnen beim Zuschauen echt weh.«
Das wette ich. Manchmal denke ich, dass Verzweiflung die Hirntätigkeit beeinträchtigt.
Eine kurvige Brünette tritt vor und schüttelt ihm die Hand. Eine überraschend formale Geste, wenn man bedenkt, dass die beiden bereits seit einer Weile miteinander im Gespräch sind. »Ich hatte gerade die Hauptrolle in einem Werbespot für Pillen gegen Reizdarmsyndrom. Wurde landesweit ausgestrahlt.«
Damit und mit jedem anderen normalen Job kann man sicher seine Rechnungen bezahlen, aber wie bitte passt das zu der aufreizenden Atmosphäre der meisten Musikvideos? Darin wird Sex und Sexappeal verkauft und, ja okay, man kann sich in dieser Welt auch was einfangen, Geschlechtskrankheiten werden immer verbreiteter, aber wenn man sein Gesicht für ein Medikament gegen Genitalherpes hinhält, dann ist das schon ein krasser Interessenskonflikt.