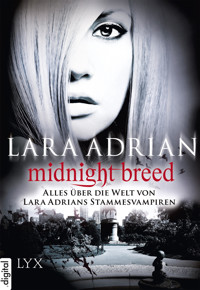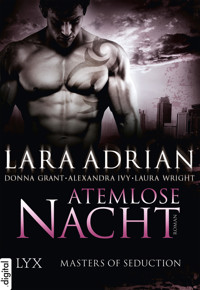9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Midnight Breed
- Sprache: Deutsch
Eine übermenschliche Kreatur macht die Einöde von Alaska unsicher und hinterlässt ein grauenhaftes Blutbad, wo immer sie auftaucht. Für die Pilotin Alexandra Maguire wecken die Morde Erinnerungen an ein schreckliches Ereignis aus ihrer Kindheit. Da tritt ein Fremder in ihr Leben, der überraschend tiefe Gefühle in ihr weckt. Der Vampirkrieger Kade wurde nach Alaska geschickt, um die brutalen Morde aufzuklären. Doch auch er wird von einem Geheimnis aus seiner Jugend verfolgt. Kade sieht sich einer dunklen Bedrohung gegenüber, die das zarte Band zu zerreißen droht, das zwischen ihm und der hübschen Alexandra entstanden ist...
Der siebte Band der erfolgreichen Vampirsaga "Midnight Breed" von Bestseller-Autorin Lara Adrian!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2010
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Danksagungen
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Impressum
LARA ADRIAN
GEZEICHNETEDES SCHICKSALS
Roman
Ins Deutsche übertragen von Katrin Kremmler und Barbara Häusler
Der charmanten und witzigen, der absolut unvergesslichen Miss Eithne O’Hanlon von der Grünen Insel, die sich so wunderbar für diese Serie einsetzt und in meinem Fanforum für so viel Wirbel und Gekicher sorgt.Danke, dass du so bist, wie du bist!
Danksagungen
Vielen herzlichen Dank allen, die mir helfen, meine Bücher zu produzieren und zu vermarkten und sie in die Hände meiner Leser zu legen, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch anderswo. Ich habe unglaubliches Glück, mit euch allen zu arbeiten, und weiß wirklich zu schätzen, was ihr für meine Bücher tut.
Wie immer gilt mein herzlicher Dank meinen wunderbaren Lesern, deren E-Mails, Briefe und Online-Messages mich sogar mitten im schlimmsten Deadline-Stress am Computer zum Lächeln bringen. Ich kann nicht einmal annähernd ausdrücken, wie viel euer Enthusiasmus und eure Freundschaft mir bedeuten.
Keines meiner Bücher wäre, was es ist, ohne den Input und die Unterstützung meines Mannes, dessen Glaube und Zuspruch – ganz zu schweigen von seinen brillanten Plotideen! – mir unschätzbar geworden sind. Ich könnte mir keinen besseren Partner wünschen, im Leben wie in der Fiktion. Danke dir für all unsere guten Zeiten.
Prolog
Unter einem winterlich dunklen Alaskahimmel erscholl das Heulen eines Wolfes klar und majestätisch in die Nacht. Es war ein lang gezogener Laut voll reiner, wilder Schönheit, der durch die dichten Fichten der Nordwälder drang und die zerklüfteten, schneebedeckten Felswände an den eisigen Ufern des Koyukuk River hinaufstieg. Als der Wolf seinen eindringlichen Ruf erneut erhob, erscholl misstönendes, johlendes Gelächter, und dann heulte eine betrunkene Stimme über die Flammen eines kleinen Lagerfeuers eine Antwort.
„Au-au-auuuu! Auuuuu!“ Einer der drei Jungs der Gruppe, die in dieser Nacht zu dem abgelegenen Plätzchen herausgefahren war, hielt sich seine dicken Handschuhe an den Mund und jaulte dem Wolf, der daraufhin in der Ferne verstummt war, eine weitere ohrenbetäubende Antwort zu. „Habt ihr das gehört? Wir quatschen miteinander.“ Er nahm seinem Nebenmann die Whiskeyflasche ab, die in der kleinen Gruppe herumging. „Hab ich dir schon erzählt, dass ich mit Wölfen reden kann, Annabeth?“
Aus der tiefen Kapuze des Mädchens auf der anderen Seite des Lagerfeuers drang mit einer Wolke Atemluft ein leises Lachen. „Klang mir eher nach abgestochener Sau.“
„Oh, das sind harte Worte, Süße.“ Er nahm einen Schluck Jack Daniel’s und reichte die Flasche an den Nächsten weiter. „Dabei bin ich so begabt. Ich rede nicht bloß mit Wölfen, ich bin auch ein Wolf im Bett. Sollte ich dir gelegentlich mal vorführen.“
„Ein Arschloch bist du, Chad Bishop.“
Sie hatte recht, aber ihrem Tonfall nach meinte sie es nicht ernst. Wieder lachte sie, ein warmes, flirtendes, weibliches Lachen, von dem es zwischen Teddys Beinen eng und heiß wurde. Er rutschte auf dem kalten Felsen, den er sich als Sitzplatz ausgesucht hatte, herum, damit nur niemand seinen Ständer bemerkte. Da verkündete Chad, dass er pinkeln müsste, und Annabeth und das andere Mädchen begannen, sich miteinander zu unterhalten.
Von rechts bohrte sich ein spitzer Ellbogen in Teddys Rippen. „Willst du die ganze Nacht nur dasitzen und sabbern? Los, du Lusche, jetzt geh schon und quatsch sie an, um Himmels willen.“
Teddy sah den hochgewachsenen, dünnen Typen, der neben ihm auf dem Felsen saß, an und schüttelte den Kopf.
„Komm schon, sei nicht so ein Hosenscheißer. Du willst es doch. Und sie beißt dich schon nicht. Das heißt, nur wenn du willst.“ Skeeter Arnold war derjenige gewesen, der Teddy auf diese Party mitgenommen hatte. Er hatte auch den Whiskey besorgt, etwas, was Teddy mit seinen neunzehn Jahren bisher nur einmal im Leben probiert hatte.
Alkohol war im Haus seines Vaters verboten – und auch in der ganzen Ansiedlung von sechs Personen, in der er lebte. Heute Nacht hatte Teddy die Flasche schon über zehnmal an die Lippen geführt. Er sah nicht ein, warum ihm das schaden sollte. Tatsächlich machte der Whiskey ihn warm und entspannt, ein gutes Gefühl. Er kam sich erwachsen vor, wie ein Mann.
Ein Mann, der jetzt nur eins wollte: aufstehen und Annabeth Jablonsky sagen, was er für sie empfand.
Skeeter reichte Teddy die Flasche, sie war fast leer, und sah ihm zu, wie er den letzten Schluck trank. „Ich glaube, ich hab noch was anderes, was du mögen wirst, mein Alter.“ Er zog seine Handschuhe aus und griff in die Tasche seines Parkas.
Teddy war nicht sicher, was Skeeter sonst noch dabeihatte, und momentan war es ihm auch egal. Er war völlig gebannt von Annabeth, die jetzt die Kapuze abgenommen hatte, um ihrer Freundin ihre neuen Piercings zu zeigen, die sich den ganzen Rand ihrer zarten Ohrmuschel hinaufzogen. Ihr Haar war polarweiß gefärbt, bis auf eine Strähne in hellem Pink, aber Teddy erinnerte sich, dass sie eigentlich brünett war. Das wusste er, weil er sie letzten Frühling in einem Stripclub in Fairbanks gesehen hatte, wo Annabeth Jablonsky als Amber Joy auftrat. Bei dem Gedanken wurden Teddys Wangen hochrot, und sein Ständer ließ sich jetzt auch nicht länger ignorieren.
„Hier“, sagte Skeeter und hielt ihm etwas hin, eine willkommene Ablenkung, als Annabeth und ihre Freundin vom Lagerfeuer aufstanden und zum Ufer des zugefrorenen Flusses hinuntergingen. „Zieh mal, mein Alter.“
Teddy nahm die kleine Metallpfeife und hielt sich den glimmenden Kopf unter die Nase. Ein helles, kalkiges Körnchen brannte darin, und ein unangenehmer chemischer Gestank wand sich seine Nasenlöcher hinauf. Er zog eine Grimasse und warf Skeeter einen skeptischen Blick zu. „W-w-was ist das?“
Skeeter grinste, seine schmalen Lippen entblößten seine schiefen Zähne. „Nur eine kleine Portion Mut. Na los, zieh mal. Das wirst du mögen.“
Teddy hielt sich die Pfeife an den Mund und sog den bittersüßen Rauch ein. Er musste kaum husten, also atmete er aus und nahm einen weiteren Zug.
„Gut, was?“ Skeeter sah ihm zu, wie er noch mal zog, dann streckte er die Hand aus, um ihm die Pfeife wieder abzunehmen. „Nur mal langsam, Alter, lass uns auch noch was übrig. Weißt du, ich kann dir noch mehr davon besorgen, wenn du willst – und auch Alk. Wenn du die Kohle hast, kann ich dir jeden Stoff besorgen, den du willst. Wenn du was brauchst, weißt du, zu wem du kommst, was?“
Teddy nickte. Sogar in den entlegensten Ecken des Buschlandes wussten die Leute, dass Skeeter Arnold dealte. Teddys Vater hasste ihn. Er hatte Teddy verboten, mit ihm rumzuhängen, und wenn er erfuhr, dass Teddy sich davongeschlichen hatte – und das ausgerechnet heute Nacht, wo sie doch morgen früh eine Warenlieferung erwarteten –, würde er Teddy einen gewaltigen Tritt in den Arsch versetzen.
„Nimm sie“, sagte Skeeter jetzt und hielt Teddy die Pfeife hin. „Geh sie den Ladies anbieten, mit schönem Gruß von mir.“
Teddy starrte ihn an. „Du meinst, ich s-soll sie Annabeth b-bringen?“
„Nein, Idiot, ihrer Mama.“
Teddy lachte nervös über seine Unbeholfenheit. Skeeters Lächeln wurde breiter, sodass er mit seinem schmalen Gesicht und der langen, dünnen Hakennase noch insektenartiger wirkte als sonst.
„Sag nicht, dass ich dir nie einen Gefallen tue“, sagte Skeeter, als Teddy die warme Pfeife nahm und zu Annabeth und ihrer Freundin hinübersah, die am Ufer des zugefrorenen Flusses standen und sich unterhielten.
Er hatte doch eine Gelegenheit gesucht, um sie anzuquatschen, oder nicht? Diese Chance war so gut wie jede andere. Vielleicht die beste, die er je bekommen würde.
Skeeters leises Kichern folgte Teddy, als er auf die Mädchen zuging. Der Boden unter seinen Füßen fühlte sich uneben an. Seine Beine waren wie Gummi, er hatte sie nicht ganz unter Kontrolle. Aber innerlich flog er, spürte das Hämmern seines Herzens und wie das Blut durch seine Adern rauschte.
Die beiden Mädchen hörten ihn kommen, als unter seinen Füßen Eis und Steine knirschten. Sie sahen sich nach ihm um, und Teddy starrte das Objekt seiner Sehnsucht an und kämpfte um die richtigen Worte, um sie zu gewinnen. Er musste eine ganze Weile so dagestanden und sie angestarrt haben, denn beide fingen zu kichern an.
„Was ist los?“ Annabeth sah ihn fragend an. „Teddy, stimmt’s? Ich hab dich schon ein paarmal gesehen. Gehst du manchmal zu Pete’s Kneipe unten in Harmony?“
Er schüttelte lahm den Kopf, schaffte kaum, zu verarbeiten, was sie eben gesagt hatte: dass er ihr vor heute Nacht tatsächlich schon mal aufgefallen war.
„Du solltest mal vorbeischauen, Teddy“, fügte sie fröhlich hinzu. „Wenn ich an der Bar bin, frag ich nicht nach deinem Ausweis.“ Der Klang ihrer Stimme, die seinen Namen sagte, machte ihn völlig fassungslos. Sie lächelte ihn an und enthüllte ihre leicht überstehenden Schneidezähne, die Teddy absolut anbetungswürdig fand.
„Äh, hier.“ Er warf ihr die Pfeife zu und trat einen Schritt zurück. Er wollte etwas Cooles sagen. Irgendwas, damit sie ihn irgendwie anders wahrnahm als einen hinterwäldlerischen Inuitjungen, der vom wirklichen Leben keinen blassen Schimmer hatte. Er kannte sich aus, wusste eine Menge. Zum Beispiel, dass Annabeth ein gutes Herz hatte, dass sie in ihrem tiefsten Innern ein nettes, anständiges Mädchen war. Das spürte er und hätte sein Leben drauf verwettet. Sie war besser als ihr Ruf, besser als diese Loser, mit denen sie heute Abend hier abhing. Wahrscheinlich besser als Teddy selbst.
Sie war ein Engel. Ein reiner und wunderbarer Engel, und sie brauchte nur jemanden, der sie daran erinnerte.
„Na dann, danke“, sagte sie jetzt und nahm einen schnellen Zug aus der Pfeife. Sie gab sie an ihre Freundin weiter, und die beiden wandten sich wieder von Teddy ab.
„Warte“, stieß Teddy hervor und holte hastig Atem, als sie innehielt und ihn wieder ansah. „Ich, äh, ich wollte dir sagen, dass … ich finde dich wunderschön.“
Ihre Freundin unterdrückte ein Lachen hinter ihrem Handschuh. Aber nicht Annabeth. Sie lachte nicht und starrte ihn schweigend an, blinzelte nicht einmal. Ein weicher Ausdruck glänzte in ihren Augen – vielleicht Verwirrung. Ihre Freundin schnaubte jetzt verächtlich, aber Annabeth hörte ihm immer noch zu, ohne sich über ihn lustig zu machen.
„Ich finde, du bist das tollste Mädchen, das ich je gesehen habe. Du bist … du bist Wahnsinn. Das ist mein Ernst. Du bist der totale Wahnsinn.“
Scheiße, er wiederholte sich, aber das war ihm egal. Der Klang seiner eigenen Stimme ohne das Stottern, das ihm das Reden sonst so verhasst machte, schockierte ihn. Er schluckte und holte Atem, um Mut zu schöpfen. Jetzt war er bereit, ihr alles zu sagen – alles, was er gedacht hatte, seit er sie auf der schummrig erleuchteten, heruntergekommenen Bühne in der Stadt hatte tanzen sehen. „Ich finde, du bist perfekt, Annabeth. Du verdienst es, respektiert und … geliebt zu werden, weißt du? Du bist was Besonderes. Du bist ein Engel, und du hast es verdient, dass man dich respektiert und anständig behandelt. Du verdienst einen Mann, der sich um dich kümmert, dich beschützt und … liebt …“
Die Luft neben Teddy regte sich und brachte den Gestank von Whiskey und Chad Bishops penetrantem Aftershave. „K-k-küss mich, Amber Joy. B-b-bitte! Lass mich deine g-geilen T-t-titten begrabschen!“
Teddy wich schlagartig alles Blut aus dem Kopf. Chad schlenderte zu Annabeth hinüber und legte ihr besitzergreifend den Arm um die Schulter. Seine Demütigung wuchs ins Unermessliche, als er zusehen musste, wie Chad Annabeth die Zunge in den Hals rammte – und sie den nassen Zungenkuss über sich ergehen ließ, obwohl sie alles andere als begeistert wirkte.
Als Chad sie endlich losließ, sah Annabeth Teddy an, dann stieß sie Chad leicht gegen die Brust. „Du bist echt behindert, weißt du das?“
„Und du bist so verdammt scharf, du m-m-machst meinen Sch-Schwanz …“
„Halts Maul!“ Die Worte waren Teddys Mund entwichen, bevor er sie zurückhalten konnte. „H-halt dein v-verdammtes Maul. Rede n-nicht so m-mit ihr.“
Chads Augen wurden schmal. „Ich weiß, dass du nicht mit mir redest, Arschloch. S-s-sag mir, dass du nicht dastehst und mich darum b-b-bittest, dass ich dir deine jämmerliche F-Fresse poliere, T-T-Teddy T-T-Toms.“
Als er Anstalten machte, sich auf Teddy zu stürzen, stellte Annabeth sich vor ihn. „Lass den armen Jungen in Ruhe. Er kann doch nichts dafür, dass er so redet.“
Am liebsten wäre Teddy im Erdboden versunken. All das Selbstbewusstsein, das er noch vor einer Minute empfunden hatte, verpuffte unter Chad Bishops Spott und Annabeths verletzendem Mitleid. Jetzt hörte er, dass Skeeter und Annabeths Freundin sich auf Chads Seite schlugen, sie lachten ihn alle aus. Alle machten sie sich über sein Stottern lustig, ihre Stimmen übertönten einander, klangen ihm schrill in den Ohren.
Teddy drehte sich um und rannte los. Er sprang auf sein Schneemobil und riss den Anlasser herum. In der Sekunde, als der alte Motor zum Leben erwachte, gab Teddy Gas. Er raste los, fort von der Gruppe. Ihm war ganz elend, und wütend war er auch.
Er hätte nie mit Skeeter herkommen sollen. Er hätte diesen Whiskey nicht trinken und den Stoff in Skeeters Pfeife nicht rauchen sollen. Er hätte auf seinen Vater hören und zu Hause bleiben sollen.
Seine Reue wuchs mit den Meilen, die er hinter sich ließ, und je mehr er sich seinem Zuhause näherte. Etwa hundert Meter vor der dicht gedrängten Ansammlung grober, handgebauter Blockhütten, in denen seine Familie schon seit Generationen lebte, wichen Teddys Wut und Demütigung einem Knoten kalter Angst.
Sein Vater war noch wach.
Eine Lampe brannte im Wohnzimmer, ihr Schein hinter dem Vorhang strahlte wie ein Suchscheinwerfer in die Dunkelheit hinaus. Wenn sein Vater noch wach war, wusste er, dass Teddy nicht zu Hause war. Und sobald Teddy ins Haus kam, würde sein Vater merken, dass er geraucht und getrunken hatte. Was bedeutete, dass Teddy tief in der Scheiße steckte.
„V-v-verdammt“, murmelte Teddy, schaltete den Scheinwerfer des Schneemobils aus, lenkte es vom Zufahrtsweg und stellte den Motor aus. Er stieg ab und stand eine Minute nur da, starrte zum Haus hinüber und wartete, dass seine Gummibeine sich wieder an sein Gewicht gewöhnten.
Aus dem Ärger, der ihn erwartete, konnte er sich nicht herausreden. Trotzdem versuchte er, sich eine vernünftige Entschuldigung zurechtzulegen, wo er in den letzten paar Stunden gewesen war und was er getan hatte. Eigentlich war er doch ein erwachsener Mann. Natürlich hatte er die Verantwortung, seinem Vater zu helfen, so gut er konnte, aber das bedeutete nicht, dass er außerhalb der Ansiedlung nicht seine eigenen Wege gehen konnte. Wenn sein Vater ihm deswegen gleich die Hölle heißmachte, brauchte Teddy sich das nicht mehr bieten zu lassen.
Aber als er sich dem Haus näherte, begann sein Mut ihn doch zu verlassen. Obwohl er vorsichtig auftrat, knirschte jeder Schritt laut im Schnee, noch lauter in der absoluten Stille, die in der Luft hing. Die Kälte kroch ihm in den Kragen seines Anoraks. Er zitterte sowieso schon, aber jetzt lief es ihm eiskalt über den Rücken. Ein heftiger Windstoß fegte zwischen den Hütten hindurch, und als der eisige Wind ihn mit voller Kraft ins Gesicht traf, spürte Teddy ein so tiefes Grauen, dass sich seine Nackenhaare aufstellten.
Er blieb stehen und sah sich um. Nur mondheller Schnee und die dunkle Silhouette des Waldes. Teddy ging weiter, vorbei am Laden seines Vaters, der die Familie und die paar anderen Leute versorgte, die in der Gegend verstreut wohnten, und spähte nach vorn, versuchte festzustellen, ob er sich unbemerkt ins Haus schleichen konnte. Sein keuchender Atem war das einzige Geräusch, das er hören konnte.
Alles schien so ruhig. So unnatürlich leblos und still.
Und dann blieb Teddy stehen und sah auf seine Füße hinunter. Der Schnee unter seinen Stiefeln war nicht mehr weiß, sondern dunkel – im Mondlicht fast schwarz, ein riesiger, schrecklicher Fleck. Es war Blut. Mehr Blut, als Teddy je gesehen hatte.
Ein paar Meter weiter war noch mehr. So viel Blut.
Und dann sah er den Toten.
Rechts von ihm, nahe am Waldrand. Er kannte diesen riesigen Körper. Kannte die massigen Schultern unter dem zerfetzten Thermounterhemd, das dunkel war von Blut.
„Dad!“ Teddy rannte zu seinem Vater hinüber und kniete sich neben ihn. Aber für seinen Vater kam jede Hilfe zu spät. Er war tot, sein Hals und seine Brust waren völlig zerfetzt. „Oh nein! Dad! Oh Gott, nein!“
Die Kehle zugeschnürt vor Entsetzen und Kummer, stand Teddy auf, um seinen Onkel und seine beiden älteren Cousins zu suchen. Wie war es möglich, dass sie nicht bemerkt hatten, was hier passiert war? Wie konnte es sein, dass sein Vater angegriffen wurde und im Schnee verblutete?
„Hilfe!“, schrie Teddy mit wunder Kehle. Er rannte zur nächsten Hütte und hämmerte gegen den Türpfosten, rief nach seinem Onkel, um ihn zu wecken. Nichts als Stille antwortete ihm. Stille in der ganzen Ansammlung von Blockhütten und Schuppen, die sich auf dieser winzigen Parzelle zusammendrängten. „Hallo! So kommt doch raus und helft mir, b-b-bitte!“
Tränenblind hob Teddy die Faust, um wieder an die Tür zu hämmern, aber er erstarrte mitten in der Bewegung. Die Tür öffnete sich langsam. Und direkt dahinter lag sein Onkel, genauso zugerichtet und blutüberströmt wie sein Vater. Teddy spähte in das dunkle Haus und sah die leblosen Gestalten seiner Tante und Cousins.
Sie rührten sich nicht. Auch sie waren ermordet worden. Alle, die er kannte – alle, die er liebte, waren tot.
Was zur Hölle war hier passiert?
Wer – oder was – in Gottes Namen konnte das getan haben?
Langsam ging er in die Mitte der Ansiedlung zurück, benommen und ungläubig. Das konnte nicht sein. Das konnte doch einfach nicht sein. Einen Sekundenbruchteil lang fragte er sich, ob er halluzinierte von dem Stoff, den Skeeter ihm zum Rauchen gegeben hatte. Vielleicht war das alles gar nicht real. Vielleicht hatte er einfach einen Trip, und alles, was er sah, war gar nicht real.
Es war eine verzweifelte, flüchtige Hoffnung. Denn das Blut war real. Ihm drehte sich fast der Magen um von dem schweren Blutgeruch, der sich in seinen Nasenlöchern und seinem Rachen festsetzte wie dickflüssiges Öl. All diese Toten um ihn herum waren tatsächlich da.
Teddy sank im Schnee auf die Knie. Er schluchzte auf, von Schock und Trauer überwältigt. Er heulte und schlug in seiner Verzweiflung auf den gefrorenen Boden ein.
Er hörte die Schritte nicht kommen. Sie waren zu leichtfüßig, verstohlen wie die einer Katze. Aber im nächsten Augenblick wusste Teddy, dass er nicht allein war.
Und noch bevor er den Kopf wandte und in den brennenden Schein der wilden Raubtieraugen sah, wusste er, dass er kurz davorstand, seiner Familie in den Tod zu folgen.
Teddy Toms schrie, aber sein Schrei verließ seine Kehle nie.
1
Neunhundert Meter unter den Tragflächen der roten einmotorigen De Havilland Beaver glänzte der zugefrorene Koyukuk River im morgendlichen Mondlicht wie ein breites Band aus zersplitterten Diamanten. Alexandra Maguire folgte ihm in nördlicher Richtung aus der Kleinstadt Harmony. Der Frachtraum ihres Flugzeugs war beladen mit Vorräten für ihre heutige Liefertour zu einigen abgelegenen Siedlungen im Hinterland.
Neben ihr im Cockpit auf dem Passagiersitz saß Luna, die beste Copilotin, die sie je gehabt hatte. Natürlich abgesehen von ihrem Vater, der Alex alles über das Fliegen beigebracht hatte, was sie wissen musste. Die grau-weiße Wolfshündin ersetzte Hank Maguire jetzt schon seit ein paar Jahren, seit seine Alzheimer-Erkrankung zu weit fortgeschritten war, als dass er noch hätte fliegen können. Schwer zu glauben, dass er jetzt schon sechs Monate tot war, obwohl Alex oft das Gefühl hatte, dass er schon viel früher begonnen hatte, ihr zu entgleiten. Ein kleiner Trost war, dass die Krankheit, die seinen Verstand und seine Erinnerungen zerstörte, ihm so auch seinen Schmerz genommen hatte.
Jetzt lebten nur noch sie und Luna in dem alten Haus in Harmony und belieferten Hanks wenige Stammkunden in der Wildnis. Luna saß aufrecht neben Alex, die spitzen Ohren aufmerksam aufgestellt, die scharfen blauen Augen unablässig auf die dunkle, gedrungene Masse der Brookskette gerichtet, die den Horizont im Nordwesten begrenzte. Als sie den Polarkreis überflogen, wurde der Hund im Sitz unruhig und stieß ein leises, eifriges Winseln aus.
„Du willst mir doch nicht sagen, dass du Papa Toms’ geräuchertes Elchfleisch schon von hier oben aus riechen kannst“, sagte Alex, streckte die Hand aus und wuschelte dem Hund über den großen, pelzigen Kopf, während sie über den mittleren Arm des Koyukuk in nördlicher Richtung weiterflogen, an den kleinen Dörfern Bettles und Evansville vorbei. „Frühstück gibt’s erst in zwanzig Minuten, altes Mädchen. Oder eher in dreißig, wenn diese schwarze Sturmwolke über dem Anaktuvuk Pass in unsere Richtung kommt.“ Alex beäugte die dunkle Gewitterwolke, die sich in einigen Meilen Entfernung von ihrer Flugroute zusammenballte. Laut Wetterbericht würde es wieder Schnee geben – in Alaska im November natürlich nicht ungewöhnlich, aber die besten Flugbedingungen für die heutige Liefertour waren es nicht. Alex stieß einen Fluch aus, als der Wind aus den Bergen stärker wurde und über das Flusstal hinwegfegte, um ihren sowieso schon turbulenten Flug noch etwas aufregender zu machen.
Gerade war das Schlimmste überstanden, als in der Tasche ihres Anoraks ihr Handy zu klingeln begann. Sie grub es aus und nahm den Anruf entgegen, ohne erst fragen zu müssen, wer am anderen Ende war.
„Hallo Jenna.“
Im Hintergrund im Haus ihrer besten Freundin konnte Alex eine Funkdurchsage der Nationalen Forstbetriebe hören, irgendetwas über die instabile Wetterlage und extrem fallende Wind-Kälte-Faktoren. „In ein paar Stunden gibt es Sturm auf deiner Route, Alex. Bist du schon gelandet?“
„Noch nicht ganz.“ Sie durchflog einige weitere Turbulenzen, als sie sich der Stadt Wiseman näherte, und lenkte das Flugzeug dann auf den Kurs, der sie zur ersten Station ihrer heutigen Liefertour bringen würde. „Ich bin jetzt etwa zehn Minuten vor Toms’ Laden. Danach noch drei Stationen, sollte nicht länger dauern als je eine Stunde, sogar bei diesem üblen Gegenwind. Bis dahin ist der Sturm längst durchgezogen.“
Das war eher Hoffnung als professionelle Schätzung, eher Mitgefühl für ihre besorgte Freundin als Sorge um ihre eigene Sicherheit. Alex war eine gute Pilotin und von Hank Maguire zu gut ausgebildet, um etwas völlig Waghalsiges zu tun, aber es war nun mal so, dass die Vorräte in ihrem Frachtraum wegen des schlechten Wetters schon eine Woche überfällig waren. Und verdammt noch mal, sie würde sich doch von ein paar Schneeflocken oder scharfen Windböen nicht davon abhalten lassen, den Leuten in den entlegenen Ecken des Hinterlandes, die vollständig auf sie angewiesen waren, ihre Lebensmittel und ihr Benzin zu bringen.
„Alles bestens hier, Jenna. Du weißt doch, dass ich vorsichtig bin.“
„Schon“, sagte sie. „Aber Unfälle passieren trotzdem, nicht?“
Alex hätte Jenna sagen können, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchte, aber genützt hätte es nichts. Ihre Freundin wusste so gut wie jeder andere, dass das inoffizielle Credo der Buschpiloten in etwa lautete wie das der Polizeibeamten: Du musst da raus; ob du auch zurückkommst, ist zweitrangig. Und wer wusste das besser als Jenna Tucker-Darrow, ehemalige Staatspolizistin aus einer alteingesessenen Polizistenfamilie und auch Witwe eines Polizisten. Sie schwieg einen Augenblick. Alex wusste, dass die Gedanken ihrer Freundin gerade eine düstere Wendung nahmen, also gab sie sich Mühe, die Stille mit Geplauder zu füllen.
„Hör mal, als ich gestern mit dem alten Papa Toms geredet habe, hat er mir gesagt, dass er eben eine Riesenportion Elchfleisch geräuchert hat. Soll ich ihm eine Kostprobe für dich abschwatzen?“
Jenna lachte, aber sie klang, als wäre sie in Gedanken meilenweit fort. „Klar. Wenn du denkst, dass Luna das mitmacht, dann klar, gerne.“
„Gebongt. Das Einzige, was besser ist als Toms’ geräuchertes Elchfleisch, sind seine heißen Buttermilchbrötchen. Und ich Glückspilz kriege von beidem was.“
Das Frühstück bei den Toms als Gegenleistung für die Warenlieferungen alle zwei Wochen war eine Tradition, die Alex’ Vater angefangen hatte und die sie gerne weiterführte, auch wenn der Kerosinpreis den Preis von Toms’ schlichten Mahlzeiten inzwischen weit überstieg. Aber Alex mochte den Alten und seine Familie. Sie waren gute, einfache Leute, die immer noch ursprünglich auf demselben felsigen Stück Land lebten wie schon Generationen ihrer Vorfahren.
Der Gedanke, sich zu einem warmen, hausgemachten Frühstück zu setzen und sich mit dem alten Toms über die Ereignisse der letzten Woche zu unterhalten, wog den unruhigen Flug zu der abgelegenen Ansiedlung auf. Als sie den letzten Gebirgskamm überflog und zum Anflug auf die provisorische Landebahn hinter Toms’ Laden ansetzte, stellte Alex sich den salzig-süßen Duft von geräuchertem Fleisch mit frischen Buttermilchbrötchen vor, die schon auf dem Holzofen für sie warm gehalten wurden.
„Hör mal, ich mach besser Schluss“, sagte sie zu Jenna. „Ich brauche beide Hände, um diese Kiste zu landen, und ich …“
Die Worte blieben ihr im Hals stecken. Auf dem Boden unter ihr fiel Alex etwas Seltsames ins Auge. In der Dunkelheit des Wintermorgens konnte sie das massige, schneebedeckte Ding nicht ganz ausmachen, das mitten in der Ansiedlung lag, aber was auch immer das war – bei dem Anblick stellten sich die Härchen in ihrem Nacken auf.
„Alex?“
Zuerst konnte sie nicht antworten, ihre ganze Aufmerksamkeit war auf das seltsame Objekt unter ihr gerichtet. Grauen kroch ihr den Rücken hinauf, so kalt wie der Wind, der gegen ihre Windschutzscheibe schlug.
„Alex, bist du noch da?“
„Ich, äh … ja, bin da.“
„Was ist los?“
„Bin mir nicht sicher. Ich sehe Toms’ Laden vor mir, aber irgendwas stimmt nicht da unten.“
„Was meinst du?“
„Weiß nicht genau.“ Alex spähte aus dem Fenster des Cockpits, als sie in Vorbereitung auf die Landung näher heranflog. „Da liegt was im Schnee. Bewegt sich nicht. Oh mein Gott … ich glaube, da unten liegt einer.“
„Bist du sicher?“
„Weiß nicht“, murmelte Alex in ihr Handy, aber so, wie ihr Puls hämmerte, hatte sie keinen Zweifel, dass dort unter der frischen Schneedecke ein Mensch lag.
Und zwar ein toter Mensch, wenn er schon ein paar Stunden unbemerkt in dieser Eiseskälte gelegen hatte.
Aber wie konnte das sein? Es war fast neun Uhr morgens. Auch wenn es so hoch im Norden erst gegen Mittag hell wurde, hätte der alte Toms schon seit Stunden wach sein müssen. Die anderen Leute in der Ansiedlung, seine Schwester und ihre Familie, müssten blind sein, um nicht zu bemerken, dass einer von ihnen nicht nur fehlte, sondern direkt vor ihrer Haustür lag und erfror.
„Rede mit mir, Alex“, sagte Jenna jetzt mit ihrer Polizistenstimme, die Gehorsam forderte. „Sag mir, was da los ist.“
Als sie zum Landeanflug ansetzte, bemerkte Alex unten auf dem Boden eine weitere beunruhigende Gestalt – diese lag zwischen Toms’ Hütte und dem Waldrand, der die Ansiedlung umgab. Der Schnee um den Körper war blutgetränkt, dunkle Flecken sickerten in entsetzlicher Intensität durch die frische weiße Schneedecke.
„Oh Jesus“, zischte sie leise. „Jenna, das ist übel, da ist was Schreckliches passiert. Das sind mehr als einer. Sie wurden irgendwie … verletzt.“
„Da sind Verletzte?“
„Tote“, murmelte Alex, ihr Mund war plötzlich trocken, als ihr zur Gewissheit wurde, was sie da sah. „Oh Gott, Jenna … da ist Blut. Eine Menge.“
„Scheiße“, flüsterte Jenna. „Okay, Alex, hör zu. Ich will, dass du jetzt am Telefon bleibst. Dreh um und komm zurück in die Stadt. Ich funke Zach an, solange ich dich hier am Telefon habe, okay? Was immer da passiert ist, Zach soll sich drum kümmern. Geh nicht in die Nähe …“
„Ich kann sie nicht alleine lassen“, stieß Alex hervor. „Da unten sind womöglich noch Verletzte. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Ich kann nicht einfach umdrehen und sie alleine lassen. Oh Gott. Ich muss landen und sehen, ob ich was tun kann.“
„Alex, verdammt, mach jetzt bloß keinen …“
„Muss Schluss machen“, sagte sie. „Bin kurz vor der Landung.“
Trotz Jennas wiederholter Befehle, die Situation ihrem Bruder Zach Tucker zu überlassen, dem einzigen Polizeibeamten in einem Umkreis von hundert Meilen, beendete Alex das Gespräch und setzte die Kufen der Beaver sanft auf dem kurzen Landestreifen auf. Sie machte eine Vollbremsung im frischen Pulverschnee – nicht die eleganteste Landung, aber auch nicht schlecht, wenn jedes Nervenende im Körper vor wachsender Panik schrie. Sie schaltete den Motor aus, und sobald sie die Tür des Cockpits geöffnet hatte, sprang Luna über ihren Schoß ins Freie und rannte auf die gedrängte Ansammlung von Blockhütten zu.
„Luna!“
Alex’ Stimme hallte in der gespenstischen Stille. Der Wolfshund war jetzt außer Sichtweite. Alex kletterte aus dem Flugzeug und rief ein weiteres Mal nach Luna, aber nur Stille antwortete ihr. Und aus den nahe gelegenen Hütten kam niemand, um sie zu begrüßen. Keine Spur von Toms in seinem Laden, nur dreißig Meter entfernt. Auch keine Spur von Teddy, der Luna trotz seiner gleichgültigen Teenager-Fassade genauso heiß und innig liebte wie der Hund ihn. Auch kein Zeichen von Toms’ Schwester Ruthanne, auch nicht von ihrem Mann und den erwachsenen Söhnen, die im November normalerweise schon lange vor dem späten Sonnenaufgang auf den Beinen waren und sich um die in der Ansiedlung anfallenden Arbeiten kümmerten. Alles war völlig still und unbelebt.
„Scheiße“, flüsterte Alex, ihr Herz schlug wie ein Presslufthammer.
Was zur Hölle war hier passiert? In was für eine Gefahrensituation lief sie hier hinein, sobald sie aus ihrem Flugzeug stieg?
Als sie nach hinten in den Frachtraum griff und sich ihr geladenes Gewehr schnappte, sah sie das schlimmstmögliche Szenario vor sich. Mitten im Winter im Hinterland kam es manchmal vor, dass jemand durchdrehte und seine Nachbarn angriff oder sich selbst etwas antat – womöglich beides kurz nacheinander. Sie wollte gar nicht daran denken und konnte sich auch niemanden vorstellen, der in diesem engen Familienverband einfach durchdrehte. Nicht einmal den mürrischen Teddy, um den der alte Toms sich in letzter Zeit Sorgen machte, weil er sich mit üblen Leuten herumtrieb.
Das Gewehr im Anschlag kletterte Alex aus dem Flugzeug und ging los in die Richtung, in die Luna gerannt war. Die frische Schneedecke von letzter Nacht war pulverig weich unter ihren Stiefeln und dämpfte das Geräusch ihrer Schritte, als sie sich vorsichtig Toms’ Laden näherte. Die Hintertür war unverriegelt, halb aufgezwängt von einer Schneewehe, die sich auf der Schwelle gebildet hatte. Hier war schon seit ein paar Stunden niemand mehr gewesen, um nach dem Rechten zu sehen.
Alex schluckte den Angstklumpen in ihrem Hals, der ständig größer wurde, hinunter. Jetzt wagte sie nicht mehr, nach jemandem zu rufen. Sie wagte kaum noch zu atmen, als sie weiterging, vorbei am Laden zu der gedrängten Ansammlung kleiner Blockhütten. Lunas Gebell ließ sie zusammenschrecken. Der Wolfshund saß in ein paar Metern Entfernung, zu seinen Füßen eine der leblosen Gestalten, die Alex aus der Luft entdeckt hatte. Luna bellte noch einmal, dann stupste sie den Toten mit der Nase an, als versuchte sie, ihn zum Aufstehen zu bewegen.
„Oh Herr im Himmel … wie kann das sein?“, flüsterte Alex, sah sich noch einmal in der stillen Ansiedlung um und packte ihr Gewehr fester. Ihre Füße fühlten sich wie Bleigewichte an, als sie auf Luna und die reglose, schneebedeckte Gestalt auf dem Boden zuging. „Braves Mädchen. Jetzt bin ich da. Lass mich mal sehen.“
Oh du lieber Gott, sie musste gar nicht näher rangehen, um zu sehen, dass es Teddy war, der dort lag. Aus dem zerfetzten, blutdurchweichten Daunenanorak sah ein schwarz-rotes Flanellhemd hervor, das Lieblingshemd des Jungen. Sein dunkelbraunes Haar war an Wange und Stirn vereist, seine olivfarbene Haut gefroren und wachsartig, blau angelaufen, wo sie nicht ziegelrot verkrustet war von geronnenem Blut. Und wo einmal sein Kehlkopf gewesen war, klaffte eine riesige Wunde.
Alex setzte sich auf die Hacken zurück und holte keuchend Luft, als die Realität dessen, was sie da sah, mit voller Gewalt von ihr Besitz ergriff. Teddy war tot. Er war doch nur ein Junge, verdammt noch mal, und jemand hatte ihn abgeschlachtet wie ein Tier und einfach hier liegen lassen.
Und er war nicht der Einzige in dieser abgelegenen Ansiedlung, den dieses Schicksal ereilt hatte. In ihrem Schock trat Alex von Teddys Leiche zurück und sah sich wild zum umliegenden Gelände und den Häusern um. Die Tür der gegenüberliegenden Blockhütte war aus den Angeln gerissen, und vor einer der anderen lag eine weitere reglose Gestalt. Und noch eine direkt unter der offenen Tür eines Pritschenwagens, der an einem alten hölzernen Lagerschuppen stand.
„Oh Gott … nein.“
Und dann war da der Tote, den sie schon von ihrem Landeanflug aus gesehen hatte – der aussah wie der alte Toms, tot und blutüberströmt am Waldrand hinter seinem Haus.
Sie packte ihr Gewehr fester, auch wenn sie bezweifelte, dass der Mörder – oder vielleicht waren es auch mehrere gewesen, beim Ausmaß dieses Gemetzels hier – noch in der Nähe war. Alex fand sich wieder, wie sie langsam auf diesen nassen, blutgetränkten Schneestreifen am Waldrand zuging, mit Luna dicht auf den Fersen.
Mit jedem Schritt zogen sich Alex’ Herz und Magen stärker zusammen. Sie wollte den alten Toms nicht so sehen, wollte niemanden, der ihr am Herzen lag, abgeschlachtet, verstümmelt und blutüberströmt sehen … nie wieder.
Und doch bewegten sich ihre Füße wie von selbst, und genauso wenig konnte sie sich zurückhalten, neben der grausigen, bäuchlings liegenden Leiche des Mannes niederzuknien, der sie immer mit einem Lächeln und einer bärigen Umarmung begrüßt hatte. Alex legte ihr Gewehr neben sich in den roten Schnee. Mit einem würgenden, wortlosen Aufschrei streckte sie die Hand aus, nahm den riesenhaften Mann an der Schulter und drehte ihn um. Das verwüstete Gesicht, das blicklos zu ihr aufstarrte, ließ Alex das Blut in den Adern gefrieren. Seine einst so heiteren Züge waren in einer Maske absoluten Entsetzens erstarrt. Alex konnte sich auch nicht annähernd vorstellen, was er im Augenblick seines Todes gesehen haben musste.
Obwohl …
Die alte Erinnerung sprang sie aus einer dunklen, verschlossenen Ecke ihrer Vergangenheit an. Alex spürte ihren scharfen Biss, hörte die Schreie, die die Nacht zerrissen und ihr Leben für immer zerstört hatten.
Nein.
Diesen Schmerz wollte Alex nicht wieder erleben. Sie wollte nicht an diese Nacht zurückdenken, und schon gar nicht jetzt, umgeben von all diesen Toten, völlig allein. Sie konnte nicht ertragen, die Vergangenheit ans Licht zu holen, die sie vor achtzehn Jahren Tausende von Meilen hinter sich gelassen hatte.
Aber die Vergangenheit kroch in ihre Gedanken zurück, als wäre es erst gestern gewesen. Und als ob es gerade wieder passierte. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass derselbe Schrecken, den sie und ihr Vater vor so langer Zeit in Florida überlebt hatten, irgendwie gekommen war, um diese unschuldige Familie in der isolierten Wildnis Alaskas heimzusuchen. Alex würgte ein Schluchzen zurück und wischte sich die Tränen ab, die ihr auf den Wangen brannten, als sie auf ihrer Haut gefroren.
Lunas leises Grunzen neben ihr unterbrach Alex’ Gedanken. Die Hündin grub neben der Leiche die Schnauze in den Pulverschnee, offenbar hatte sie einen Geruch aufgefangen. Dann ging sie vorwärts und folgte der Duftspur auf die Bäume zu. Alex stand auf, um zu sehen, was Luna gefunden hatte. Zuerst sah sie es nicht. Und als sie es sah, konnte ihr Verstand den Anblick gar nicht verarbeiten.
Es war ein blutiger Fußabdruck, teilweise vom Neuschnee verdeckt. Ein menschlicher Fußabdruck, der mindestens einem Stiefel der Größe fünfzig entsprach. Und der Fuß, der ihn hinterlassen hatte, war nackt gewesen. In dieser tödlichen Kälte mehr als unwahrscheinlich – es war schlichtweg unmöglich.
„Was zum Teufel …?“
Entsetzt packte Alex Luna am Nackenfell und hielt sie fest an ihrer Seite, bevor der Hund der Fußspur noch weiter nachging. Sie folgte ihr mit den Augen bis zu dem Punkt, wo sie verblasste und im Schnee verschwand. Es ergab keinen Sinn.
Nichts von alldem ergab irgendeinen Sinn in der Wirklichkeit, wie sie sie sehen wollte.
Im Flugzeug hörte sie ihr Handy klingeln, begleitet vom dumpfen Knistern der Funkanlage der Beaver, aus der eine aufgebrachte Männerstimme quäkend um Meldung bat.
„Alex, verdammt! Bitte kommen! Alex?“
Dankbar für die Ablenkung nahm sie ihr Gewehr auf und rannte zum Flugzeug zurück, Luna dicht an ihrer Seite, ganz der vierbeinige Bodyguard, der sie wirklich auch war.
„Alex!“ Wieder schrie Zach Tucker ihren Namen über den Äther. „Wenn du mich hören kannst, Alex, geh endlich ran!“
Sie beugte sich über den Sitz und schnappte sich das Funkgerät. „Roger“, sagte sie atemlos und zitternd. „Ich bin hier, Zach, und sie sind alle tot. Der alte Toms. Teddy. Alle.“
Zach zischte einen Fluch. „Und du? Bist du in Ordnung?“
„Ja“, murmelte sie. „Oh mein Gott. Zach, wie konnte das passieren?“
„Ich kümmere mich drum“, sagte er zu ihr. „Und jetzt musst du mir sagen, was du sehen kannst, du musst mir alles genau beschreiben, okay? Hast du irgendwelche Waffen gesehen, irgendeine Erklärung dafür, was da draußen passiert sein könnte?“
Alex warf einen trostlosen Blick zurück auf das Gemetzel in der Ansiedlung. Die Menschen, deren Leben so gewaltsam beendet worden war. Das Blut, das sie im eisigen Wind schmecken konnte.
„Alex? Hast du irgendeine Ahnung, wie diese Leute getötet wurden?“
Sie presste die Augen zu vor dem Ansturm der Erinnerungen, der über sie hereinbrach – die Schreie ihrer Mutter und ihres kleinen Bruders, die verzweifelten Rufe ihres Vaters, als er die neunjährige Alex hochriss und mit ihr in die Nacht floh, bevor die Monster sie alle töten konnten.
Alex schüttelte den Kopf, versuchte verzweifelt, diese schreckliche Erinnerung abzublocken … und den Gedanken, dass diese Morde der letzten Nacht genau dieselbe Handschrift trugen. Es war derselbe undenkbare Schrecken.
„Sprich mit mir“, redete Zach ihr zu. „Hilf mir zu verstehen, was passiert ist, Alex, wenn du kannst.“
Doch die Worte wollten ihr nicht über die Lippen kommen. Sie blieben in ihrer Kehle gefangen, geschluckt von dem eisigen Abgrund der Angst, der sich mitten in ihrer Brust aufgetan hatte.
„Ich weiß nicht“, antwortete sie, und ihre Stimme klang abwesend und hölzern in der Stille der leblosen, eisigen Wildnis. „Ich kann dir nicht sagen, wer oder was das gewesen ist. Ich kann nicht …“
„Ist schon okay, Alex. Ich weiß, du musst völlig durcheinander sein. Komm jetzt einfach heim. Ich habe schon Roger Bemis draußen am Flugplatz angerufen. Er fliegt mich noch in der nächsten Stunde hier raus, und wir kümmern uns um die Toms, in Ordnung?“
„Okay“, murmelte sie.
„Jetzt wird alles wieder gut, das verspreche ich dir.“
„Okay“, wiederholte sie und spürte, wie ihr eine weitere Träne die kalte Wange hinabrann.
Genau das hatte ihr Vater vor all den Jahren auch zu ihr gesagt – ihr versprochen, dass alles wieder gut werden würde. Sie hatte ihm nicht geglaubt. Nach allem, was sie heute hier gesehen hatte, und mit dem Gefühl, dass sich um sie herum schon wieder etwas unsagbar Böses zusammenbraute, fragte sich Alex, ob in ihrem Leben überhaupt jemals wieder etwas gut werden konnte.
Skeeter Arnold nahm einen tiefen Zug von seinem fetten Joint und lehnte sich in seinem ramponierten hellblauen Fernsehsessel zurück, dem besten Möbelstück in seiner vermüllten Einliegerwohnung im Haus seiner Mutter in Harmony. Er hielt den Rauch tief in den Lungen, schloss die Augen und lauschte dem Geplärr des Kurzwellenempfängers auf der Küchenablage. Bei seiner Art von Geschäften hielt Skeeter es für angeraten, nicht nur den Polizeifunk der Staatspolizei abzuhören, sondern auch die Hinterwäldler, die so bescheuert waren, dass sie alle naselang den Notruf brauchten.
Und klar, er hörte auch deshalb gern zu, weil er am Unglück anderer Leute auf perverse Art seinen Spaß hatte. Es war einfach nett, gelegentlich daran erinnert zu werden, dass er nicht der größte Versager im ganzen Staat von Alaska war, egal, was seine Schlampe von Mutter ihm regelmäßig sagte. Skeeter atmete langsam aus, dünner Rauch kringelte sich um den Fluch, den er murmelte, als das Knarren und Ächzen der alten Dielenbretter ihm ankündigte, dass die alte Nervensäge den Flur hinunter zu seinem Zimmer gestampft kam.
„Stanley, hast du nicht gehört, dass ich dich gerufen habe? Hast du vor, den ganzen Tag da drin zu verpennen?“ Ein paarmal schlug sie mit der Faust gegen die Tür, dann rüttelte sie heftig, aber vergeblich an der Türklinke. Er wusste schon, warum er immer abschloss. „Hab ich dich nicht gebeten, gleich heute früh loszufahren und Reis und Bohnenkonserven einzukaufen? Worauf zum Teufel wartest du, auf die Schneeschmelze im Frühling? Heb deinen faulen Arsch und tu zur Abwechslung mal was Nützliches!“
Skeeter machte sich weder die Mühe zu antworten, noch rührte er sich auf seinem Sessel, und er verzog auch keine Miene, als seine Mutter weiterschimpfte und gegen die Tür bollerte. Er nahm einen weiteren genüsslichen Zug von seinem Joint und ignorierte die Harpyie vor seinem Zimmer, denn er wusste, dass sie irgendwann genug haben und sich wieder vor ihre Glotze verziehen würde, wo sie hingehörte.
Um sie in der Zwischenzeit auszublenden, griff Skeeter nach der Funkanlage und drehte die Lautstärke hoch. Der einzige Ordnungshüter von Harmony, Trooper Zachary Tucker, klang heute, als hätte er die Hosen gestrichen voll. Da musste was ziemlich Großes passiert sein.
„Stanley Arnold, glaub bloß nicht, dass du mich übertönen kannst, du jämmerlicher Nichtsnutz von Sohn!“ Wieder hämmerte seine Mutter gegen die Tür, dann stürmte sie davon und schimpfte den ganzen Weg über den Flur weiter vor sich hin. „Genau wie dein Vater, keinen Furz bist du wert. Aus dir wird nie was!“
Skeeter stand von dem Fernsehsessel auf und stellte sich näher an die Funkanlage, als Tucker, der gerade den Jungs von der Staatspolizei in Fairbanks Meldung machte, die Koordinaten eines Tatortes mit offenbar mehreren Toten durchgab – wahrscheinlich Mord, sagte er –, etwa vierzig Meilen draußen in der Wildnis. Tucker wartete auf den Lufttransport von einem der beiden Piloten von Harmony. Er gab an, dass der andere, Alex Maguire, die Leichen auf einer Liefertour entdeckt hatte und sich momentan auf dem Rückflug in die Stadt befand.
Skeeter lauschte aufgeregt. Die Gegend, von der da die Rede war, kannte er sehr gut. Hölle noch mal, er war doch erst gestern Abend mit Chad Bishop und ein paar anderen da draußen gewesen. Sie waren am Fluss gewesen, hatten sich zugedröhnt und gesoffen … und dann hatten sie Teddy Toms gepiesackt. So, wie sich das Ganze anhörte, musste es die Ansiedlung von Teddys Familie sein, von der die Cops redeten.
„Verfickt und zugenäht“, flüsterte Skeeter und fragte sich, ob das wohl möglich war. Nur um sicherzugehen, schrieb er sich die Koordinaten in die Handfläche, dann wühlte er sich durch einen Stapel unbezahlter Rechnungen und anderen Müll, bis er die mit Bierflecken übersäte Karte der Gegend fand, die er die letzten Jahre über als Untersetzer benutzt hatte. Er triangulierte die Stelle auf der Karte, und Ungläubigkeit und eine perverse Art von Verwunderung breiteten sich in ihm aus.
„Scheiße, das gibt’s doch nicht“, sagte er und nahm noch einen tiefen Zug von seinem Joint, dann drückte er ihn auf dem brandfleckenübersäten Resopaltisch aus, um sich den Rest für später aufzuheben. Er war zu aufgeregt, um ihn jetzt fertig zu rauchen. Brennend vor Neugier tigerte er in dem engen Zimmer auf und ab.
Waren der alte Toms oder sein Schwager ausgetickt? Oder war es Teddy gewesen, der sich endlich von der Leine gerissen hatte? Vielleicht war der Kleine heimgegangen und durchgedreht, nachdem Skeeter und die anderen ihn letzte Nacht am Fluss heulend davongejagt hatten?
All das, dachte Skeeter, würde er schon bald wissen. Er hatte schon immer einen Toten aus der Nähe sehen wollen. Wenn er Bohnen und Reis für seine Mutter besorgte, würde er auf dem Weg zum Laden einfach einen kleinen Abstecher machen.
Ja, und vielleicht würde er den Laufburschenscheiß diesmal ganz weglassen und zur Abwechslung einfach mal tun, was er wollte.
Skeeter schnappte sich sein Handy – das neue mit Videokamera und dem coolen Totenschädel auf dem Gehäuse – und fischte den Schlüssel seines Yamaha-Schlittens aus dem Chaos auf dem Tisch. Er machte sich nicht die Mühe, seiner Mutter zu sagen, wohin er ging, sondern zog einfach nur seine Wintersachen über und ging in die eisige Kälte des Tages hinaus.
2
BOSTON, MASSACHUSETTS
Heiße Luft drang aus den Lüftungsschlitzen am Armaturenbrett des Range Rover, als Brock die Temperatur weiter aufdrehte.
„Scheiße, ist das kalt heute Nacht.“ Der riesige Mann aus Detroit hielt sich die Hände vor den Mund und hauchte sich in die Handflächen. „Ich hasse den Winter, Mann. Das reinste Sibirien da draußen.“
„Das hier? Sibirien? Du hast ja keine Ahnung“, antwortete Kade hinter dem Steuer des geparkten Geländewagens, den Blick auf die alte Sandsteinvilla gerichtet, die sie schon ein paar Stunden überwachten. Selbst in der Dunkelheit nach Mitternacht und mit einer frischen Schneedecke, die alles mit jungfräulichem Weiß kaschierte, sah das Haus von außen völlig heruntergekommen aus. Nicht dass das irgendwas ausmachte. Was immer da drin vertickt wurde – Drogen, Sex oder eine Kombination von beidem –, brachte einen stetigen Kundenstrom an die Tür. Kade sah zu, als drei Verbindungsstudenten in den Farben ihrer Universität mit ein paar vermummten jungen Frauen aus einer Rostlaube von Impala stiegen und hineingingen.
„Wenn das hier Sibirien wäre“, sagte Kade, sobald auf der Straße wieder alles ruhig war, „würden unsere Eier klingeln wie Schlittenglöckchen, und wir würden Eiswürfel pissen. Boston im November sind die Tropen, Mann.“
„Sagt der Vampir, der auf einem verdammten Gletscher in Alaska auf die Welt kam“, brummte Brock kopfschüttelnd und rieb seine dunklen Hände vor den Lüftungsschlitzen. „Was denkst du, wie lange wir noch hier draußen warten müssen, bis unser Mann endlich seine hässliche Fresse zeigt? Ich muss mich bewegen, sonst friert mir noch der Arsch am Sitz fest.“
Kades Kichern war eher ein Grunzlaut, er war genauso ungeduldig wie sein Partner auf dieser nächtlichen Patrouille in der Stadt. Es waren nicht die Menschen, die Brock und ihn zu dieser Adresse in einer der übelsten Gegenden von Boston geführt hatten, sondern der Mann, der angeblich hinter den illegalen Aktivitäten stand. Und wenn ihre Informationen sich als zutreffend erwiesen – dass der Vampir, der diesen Schuppen führte, auch mit anderer verbotener Ware handelte –, dann würde diese Nacht für ihn ein sehr unangenehmes, wahrscheinlich blutiges Ende finden.
Kade konnte es kaum erwarten.
„Da kommt er“, sagte er und sah zu, wie ein paar Autoscheinwerfer um die Ecke glitten und ein schwarzer Mercedes mit vergoldeten Stoßstangen und Felgen langsam am Bordstein ausrollte.
„Himmel, Arsch und Zwirn.“ Brock zog eine Grimasse, als das Spektakel andauerte.
Aus der Limousine wummerte Musik, die rhythmischen Bässe und aggressiven Texte wurden zu einem ohrenbetäubenden Vibrieren, als der Fahrer aus dem Wagen stieg und um ihn herumging, um die hintere Tür zu öffnen. Ein Paar angeleinte weiße Pitbulls waren die Ersten, die aus dem Wagen kletterten, gefolgt von ihrem Herrn, einem hochgewachsenen schwarzen Stammesvampir, der sich alle Mühe gab, die fiese Gangstertype zu markieren, obwohl er in einen langen Fuchspelzmantel gehüllt war und eine ziemliche Wampe vor sich hertrug.
„Vergiss den Scheiß, den Gideon über dieses Arschloch ausgegraben hat“, sagte Kade. „Der gehört allein schon dafür abgeknallt, wie er in der Öffentlichkeit rumläuft.“
Brock grinste und zeigte die Spitzen seiner Fänge. „Das können wir schon alleine deswegen tun, weil wir uns wegen ihm die Nüsse tiefgekühlt haben.“
Am Bordstein riss der Vampir kurz und heftig an den nietenbesetzten Lederleinen, als die Hunde wagten, ihm einen Schritt voranzugehen. Auf dem Weg zum Eingang der Sandsteinvilla versetzte er dem Hund, der ihm am nächsten war, einen Tritt und kicherte, als das Tier vor Schmerz ein schrilles Winseln ausstieß. Als er, sein Fahrer und seine beiden Höllenhunde in dem Gebäude verschwunden waren, zog Kade den Zündschlüssel des Rover ab und öffnete die Fahrertür.
„Na, dann wollen wir mal“, meinte er. „Suchen wir uns einen Eingang an der Rückseite, solange unser Junge noch seinen großen Auftritt hat.“
Sie gingen um das Haus herum und fanden an der Rückseite ein halb von Schnee und Straßenmüll verdecktes Kellerfenster. Kade ging in die Hocke und fegte das Eis und den festgefrorenen Müll beiseite, dann hob er die Scheibe an, die nur an einem Scharnier hing, und spähte in den dunklen Raum. Es war ein gemauerter Keller, zugemüllt mit vergammelten Matratzen, gebrauchten Kondomen und Einwegspritzen, und der Gestank nach Pisse, Erbrochenem und anderen Körperflüssigkeiten attackierte Kades geschärfte Sinne wie ein Vorschlaghammer einen Schädel.
„Herr im Himmel“, zischte er und bleckte die Lippen von Zähnen und Fängen. „Seine Putzfrau ist so was von gefeuert.“
Er schlüpfte hinein und landete geräuschlos auf dem Betonboden. Brock folgte ihm, der über hundertdreißig Kilo schwere, bis an die Zähne bewaffnete Vampir landete so leise neben ihm wie eine Katze. Kade zeigte vorbei an dem widerlichen Durcheinander auf dem Boden zu einer in pechschwarze Finsternis gehüllten Ecke des Raumes, wo ein kurzes Stück Kette und ein Paar Fußfesseln lagen und daneben ein abgerissener Streifen silbernes Isolierband, an dem einige lange blonde Haarsträhnen klebten.
Brock und Kade sahen einander im Dunkeln finster an. „Frauenhändler“, knurrte Brock.
Kade nickte grimmig, ihm war ganz elend. Es war nur allzu klar, was in diesem feuchten dunklen Kellergefängnis getrieben wurde. Er wollte gerade auf die Treppe zugehen und dem Typen oben die Party verderben, als Brocks leiser Fluch ihn innehalten ließ.
„Wir sind nicht alleine, Mann.“ Brock zeigte auf eine verriegelte Tür, von der Dunkelheit und vom rostigen Skelett einer Matratzenfeder, die zu ordentlich an ihr lehnte, fast verdeckt. „Da sind Menschen“, sagte er. „Frauen. Gleich hinter dieser Tür.“
Jetzt hörte auch Kade das leise, gebrochene Atmen und spürte die Unterströmung von Schmerz und Qualen in der abgestandenen Luft. Er schlich mit Brock in die dunkle Ecke des Kellers, sie stießen das alte Matratzengestell beiseite, dann hob Kade die dicke Metallstange, mit der die Tür von außen verriegelt war.
„Hölle noch mal“, flüsterte Brock in die Dunkelheit. Er trat in den kleinen Raum, wo drei junge Frauen sich zitternd und völlig verängstigt in der Ecke zusammendrängten. Als eine von ihnen zu schreien begann, bewegte Brock sich schneller, als die mit Drogen betäubten Frauen wahrnehmen konnten. Er bückte sich, strich mit der Hand über die Stirn der jungen Frau und versetzte sie mit seiner Berührung in Trance. „Ist schon gut. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wir tun euch nichts.“
„Wurden sie gebissen?“, fragte Kade und sah zu, wie Brock die beiden anderen Gefangenen auf dieselbe Weise beruhigte.
„Sie wurden erst vor Kurzem geschlagen, da sind Blutergüsse und Abschürfungen. Aber keine Bisswunden. Und auch kein Mal“, fügte er hinzu, nachdem er eine schnelle Überprüfung ihrer nackten Glieder vorgenommen hatte, auf der Suche nach dem Muttermal in Form einer Träne, die in eine Mondsichel fiel, das die genetisch außergewöhnlichen Frauen von ihren normalsterblichen Schwestern unterschied. Brock legte sanft den blassen Arm ab, den er hielt, dann stand er auf. „Wenigstens sind die drei keine Stammesgefährtinnen.“
Nur ein kleiner Trost, und das konnte den Vampirabschaum auch nicht entlasten, der ein Geschäft daraus gemacht hatte, Frauen zu entführen und an den höchsten Bieter zu verkaufen.
„Gib mir eine Minute, ich lösche ihre Erinnerungen und bring sie sicher hier raus“, sagte Brock. „Dann komme ich sofort nach.“
Kade nickte ihm knapp zu und ließ seine Fangzähne blitzen. „Ich geh schon mal auf ein kleines Schwätzchen mit unserem Homeboy rauf.“
Seine Aggression brannte ihm wie Säure in den Adern, als Kade die Treppe hinauf ins lärmerfüllte Erdgeschoss des Gebäudes schlich und an der Orgie vorbeiging, die dort unter einer Marihuanawolke, dahinfließender elektronischer Musik und rhythmisch blitzenden Stroboskoplichtern stattfand.
In einem Arbeitszimmer am hinteren Ende der Halle hörte er das Arschloch reden, das er suchte.
„Hol mir das Mädchen her, das eben mit diesen Uniwichsern kam – nein, nicht die Blonde, die andere. Wenn das eine echte Rothaarige ist, ist sie doppelt so viel wert.“
Kade blieb stehen und grinste, als Homeboys Muskelprotz von Fahrer-Schrägstrich-Bodyguard aus dem Büro kam und ihn in der Halle stehen sah. Der Mann war auch ein Stammesvampir, und seine Augen blitzten bernsteinfarben auf, als er die Gefahr vor sich erblickte.
„Schsch“, sagte Kade liebenswürdig, einen Dolch schon zum Wurf gezückt.
Als der Fahrer nach seiner Waffe griff, ließ er die Klinge fliegen und traf den riesenhaften Vampir mitten in die Kehle. Der massige Körper sackte vornüber auf den Boden, und als der schwere Rums die lärmende Musik und das Gestöhne aus der Halle übertönte, ging Kade um die Leiche herum und blockierte die offene Bürotür.
Die beiden weißen Pitbulls sprangen ihn schneller an, als ihr Gebieter in dem lächerlichen Pelzmantel reagieren konnte. Knurrend und schnappend griffen die Hunde Kade an. Er wich nicht zurück, das war auch nicht nötig. Er fing ihre wilden Augen in einem unverwandten, befehlenden Blick und brachte sie auf dem Teppichboden vor seinen Stiefeln abrupt zum Stehen.
Zusätzlich zu der Langlebigkeit, der Kraft und dem Blutdurst, die für ihre Spezies so charakteristisch waren, besaßen alle Stammesvampire von Geburt an ihre individuellen Talente oder – in einigen Fällen – Flüche. Kades spezielle Gabe war die Fähigkeit, telepathischen Kontakt zu Raubtieren herzustellen und sie mit bloßer Willenskraft zu lenken – eine Kraft, die er zu tödlicher Präzision perfektioniert hatte, als er ein kleiner Junge in der eisigen Wildnis von Alaska gewesen war, wo er mit viel gefährlicheren Tieren als diesen hier umgeben war.
„Platz“, sagte er ruhig zu den Hunden, dann sah er zu dem Stammesvampir auf, der ihn von der anderen Seite des kleinen Raumes mit offenem Mund anstarrte. „Das gilt auch für dich.“
„Was zum … wer zur Hölle bist du?“ Panik und Entrüstung gruben tiefe Falten um den Mund des Vampirs, als er Kades Erscheinung in sich aufnahm, von den schwarzen Drillichhosen und Kampfstiefeln in derselben Farbe wie sein stacheliger dunkler Haarschopf bis zu dem beeindruckenden Arsenal von Klingen und halb automatischen Pistolen in Gürtel- und Oberschenkelholstern. „Krieger“, hauchte der Mann. Offensichtlich war er nicht so arrogant oder dumm, wegen dieses unangekündigten Besuchs keine Angst zu haben. „Was mag der Orden bloß von mir wollen?“
„Informationen“, erwiderte Kade. Er trat einen Schritt in den Raum und schloss die Tür hinter sich, dann blieb er stehen und kraulte einen der Pitbulls, die jetzt völlig gefügig waren, hinter dem Ohr. „Was man so über dein Business hört, gefällt uns gar nicht. Wir müssen mehr wissen.“
Der Vampir hob die Schultern in einem wenig überzeugenden Versuch, verwirrt zu wirken. „Was gibt’s da schon zu sagen? Ich habe alle möglichen Geschäfte laufen.“
„Hab ich bemerkt. Nettes kleines Unternehmen hast du da unten im Keller. Wie lange bist du schon im Frauenhandel?“
„Keine Ahnung, wovon du redest.“
„Weißt du, ich wiederhole mich nicht gern.“ Kade kauerte sich hin und machte den beiden Pitbulls ein Zeichen, zu ihm zu kommen. Sie saßen ihm zu Füßen wie gedrungene Wasserspeier, starrten ihren ehemaligen Gebieter an und warteten gehorsam auf Kades Kommando zum Angriff, einfach weil er es so wollte. „Ich wette, diese Hunde hier muss ich nicht zweimal bitten, dir die Kehle rauszureißen. Was denkst du? Wollen wir’s herausfinden?“
Homeboy schluckte schwer. „N-noch nicht lange. Ein knappes Jahr. Hab angefangen mit Drogen und Nutten, und dann kamen spezielle … Kundenanfragen rein.“ Er spielte mit einem der vielen Goldringe herum, die an seinen Fingern glänzten. „Du weißt schon, Anfragen nach regelmäßiger Belieferung.“
„Und deine Kunden?“, drängte Kade und erhob sich zu seiner vollen Größe von eins fünfundneunzig. „Wer sind sie?“
„Menschen vor allem. Aber ich hab’s nicht so mit Kundenregistern.“
„Aber du belieferst“ – Kade zischte das Wort durch die Fänge – „auch Angehörige des Stammes.“
Es war keine Frage, und Homeboy wusste es. Wieder zuckte er die Achseln, und der Kragen seines Fuchspelzmantels streifte den Brillanten in seinem Ohrläppchen. „Das ist hier ein Bargeschäft, einfach eine Sache von Angebot und Nachfrage. Stammesvampire oder Menschen, das Geld ist das Gleiche.“
„Und die Geschäfte laufen gut“, riet Kade.
„Geht so. Warum ist der Orden so interessiert daran, was ich mache? Wollt ihr etwa auch mit einsteigen?“, fragte er mit einem schleimigen Lächeln. „Ich könnte Lucan Prozente geben, wenn es das ist, worum es hier geht. Schließlich bin ich Geschäftsmann.“
„Abschaum bist du“, sagte Kade, erbost, aber nicht überrascht, dass einer, der sich am Unglück von anderen bereicherte, ihn oder seine Ordensbrüder für käuflich hielt. „Und wenn ich Lucan erzähle, dass du das gesagt hast, schlitzt er dich auf vom Kinn bis zu den Eiern. Weißt du was? Die Arbeit nehme ich ihm ab …“
„Warte!“ Homeboy riss die Hände hoch. „Warte. Sag mir, was du wissen willst.“
„Okay. Fangen wir mal hiermit an: Wie viele von den Frauen, die du da unten im Keller eingesperrt und verkauft hast, waren Stammesgefährtinnen?“
Ein widerwärtiges Schweigen breitete sich aus, während der Vampir über die beste Antwort nachdachte. Sogar dieses wertlose Stück Scheiße musste wissen, dass die seltenen Frauen, die das Mal der Stammesgefährtinnen trugen, vom ganzen Stamm in Ehren gehalten wurden, weil sie ihm kostbar waren. Eine Stammesgefährtin zu schädigen hieß, das ganze Vampirvolk in Gefahr zu bringen, denn es gab auf diesem Planeten keine anderen Frauen, die die Kinder des Stammes austragen konnten. Wissentlich aus dem Leiden einer Stammesgefährtin Gewinn zu schlagen oder sonst in irgendeiner Weise von ihrem Tod zu profitieren war in etwa das Abscheulichste, was ein Angehöriger von Kades Spezies tun konnte.
Er beobachtete den anderen Vampir wie ein unter Glas gefangenes Insekt – so viel war sein Leben ihm in etwa auch wert.
„Wie viele, du widerliches Stück Scheiße? Mehr als eine? Ein Dutzend? Zwanzig?“ Er musste sich anstrengen, sich ein wütendes Fauchen zu verkneifen. „Hast du sie unwissentlich verkauft oder es sogar bewusst getan, weil Stammesgefährtinnen dir größeren Profit bringen? Ich hab dich was gefragt, verdammt noch mal!“
Bei Kades Ausbruch erhoben sich die beiden Pitbulls mit einem drohenden Knurren, die kompakten Muskeln straff gespannt. Die Hunde waren genauso mit Kade verbunden wie er mit ihnen, sie spürten seine Wut. Er hielt die Hunde nur mit seinem allerletzten Rest Selbstbeherrschung zurück. Wenn der Vampir, der sich da vor ihm duckte, wichtige Informationen hatte, war es seine Pflicht, ihn zum Reden zu bringen.
Dann konnte er ihn mit reinem Gewissen töten.
„Wem hast du Stammesgefährtinnen verkauft? Antworte, verdammt noch mal. Ich warte nicht die ganze Nacht.“
„I-ich weiß nicht“, stammelte er. „Das ist die Wahrheit. Ich weiß es wirklich nicht.“
„Aber du gibst zu, dass du es getan hast.“ Gott, er hätte dieses Stück Scheiße am liebsten abgeknallt. „Sag mir, wen du mit menschlicher Ware beliefert hast, bevor ich dir deine hässliche Fresse abreiße.“
„Ich schwöre – ich weiß nicht, wer sie bestellt hat!“
Doch damit gab Kade sich nicht zufrieden. „War es mehr als einer, der die Frauen bei dir abholen kam? Sagt dir der Name Dragos etwas?“
Kade beobachtete ihn mit schmalen Augen, wartete darauf, dass der Vampir den Köder schluckte. Aber der Name, den Kade hatte fallen lassen, rief keine besondere Reaktion hervor.
Jeder, der schon mit dem Stammesältesten zu tun gehabt hatte, der unter dem Namen Dragos bekannt war – ein Schuft, dessen üble Machenschaften der Orden erst vor Kurzem aufgedeckt hatte –, würde sicher irgendwie reagieren, wenn sein Name fiel.
Aber offenbar hatte Homeboy wirklich keine Ahnung. Er stieß einen Seufzer aus und schüttelte leicht den Kopf. „Ich hatte nur mit einem Typen zu tun. Er war nicht vom Stamm. Aber ein Mensch war der auch nicht mehr. Zumindest nicht, als er zu mir kam.“
„Ein Lakai?“
Das waren allerdings beunruhigende Neuigkeiten. Obwohl es gegen die Stammesgesetze verstieß, Lakaien zu erschaffen – von der Moral ganz zu schweigen –, konnten nur die mächtigsten Angehörigen des Stammes sich menschliche Geistsklaven erschaffen. Ausgesaugt bis fast an die Schwelle des Todes, waren Lakaien einzig ihrem Gebieter gegenüber loyal. Dragos war ein Stammesvampir der Zweiten Generation und dachte, dass er über dem Gesetz stand, dem des Stammes und dem der Menschen sowieso. Die Frage war nicht, ob Dragos sich Lakaien hielt, sondern vielmehr, wie viele und wie tief er sie schon in die menschliche Gesellschaft eingeschleust hatte.
„Würdest du diesen Lakai wiedererkennen?“
Der um den Hals des Vampirs geschlungene Tierkadaver hob sich in einem erneuten Schulterzucken. „Ich weiß nicht. Vielleicht. Er war schon lange nicht mehr da, drei oder vier Monate. Eine Weile war er einer meiner besten Stammkunden, dann hat er sich nicht mehr blicken lassen.“
„Mir kommen die Tränen“, meinte Kade gedehnt. „Beschreib ihn mir. Wie hat der Lakai ausgesehen?“
„Ehrlich gesagt hab ich ihn nie genau gesehen. Hab’s auch nie versucht. Ich konnte sehen, dass er ein Lakai war, und bezahlt hat er in großen Scheinen. Mehr musste ich nicht über ihn wissen.“