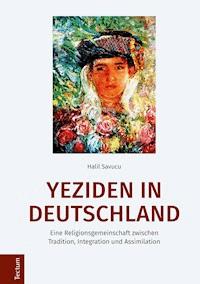
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
- Sprache: Deutsch
Sie missionieren nicht, sie kennen keine Hassprediger und sie legen Gott nicht entsprechend der eigenen Wünsche aus: Das Yezidentum ist eine der ältesten Religionen der Menschheit – und eine pazifistische Volksreligion. Die schicksalhafte Geschichte dieser Religionsgemeinschaft zeigt jedoch ein anderes Bild. Seit mehr als 1400 Jahren leiden Yeziden in ihrer Heimat unter systematischer Zwangsislamisierung, Massakern, Genoziden und Strafexpeditionen. Seit August 2014 werden sie vor den Augen der Weltöffentlichkeit von IS-Terroristen enthauptet, versklavt und vergewaltigt. Kulturelle Schätze und menschheitsgeschichtliches Erbe werden für immer zerstört. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland mittlerweile über 100.000 Yeziden leben, ist es erstaunlich, dass diese Glaubensgruppe und ihre diasporabedingten Probleme bislang nur unzureichend Eingang in die wissenschaftliche Forschung fanden. Es fehlen fast vollständig wissenschaftlich relevante Studien über ihre Geschichte, Religionssoziologie, Theologie, Tradition, religiöse Einstellung, Identitäts- und Integrationsprobleme und Perspektiven in Deutschland. Wer sind die Yeziden? Wie sieht ihre Zukunft in Deutschland aus? Mit ethnologisch-kulturellem Gesamtblick untersucht Halil Savucu, Gründungsmitglied des ZYD – Zentralrat der Yeziden in Deutschland, in seiner interdisziplinär ausgelegten Studie neben den Besonderheiten der yezidischen Gemeinschaft erstmals auch die "neue yezidische Elite" und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Versachlichung der Debatte über Yeziden in Deutschland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe Religionswissenschaften
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: ReligionswissenschaftenBand 9
Halil Savucu
Yeziden in Deutschland
Eine Religionsgemeinschaft zwischen Tradition, Integration und Assimilation
Tectum Verlag
Halil Savucu
Yeziden in Deutschland. Eine Religionsgemeinschaft zwischen Tradition, Integration und Assimilation
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum VerlagReihe: Religionswissenschaften; Bd. 9
© Tectum Verlag Marburg, 2016
Zugl. Diss. Universität Vechta 2015
ISBN: 978-3-8288-6547-1
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3813-0 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: Bild von Ammar Salim
Satz, Layout, Umschlaggestaltung: Mareike Gill | Tectum Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Hinweis des Autors und Widmung
Die vorliegende Studie wurde vom Institut für Politik und Philosophie der Universität Vechta als Dissertation angenommen. Nur wenige Monate nach Fertigstellung der Arbeit überfielen IS-Terroristen im August 2014 die yezidischen Siedlungsgebiete im Irak und in Syrien und lösten eine humanitäre Katastrophe aus. Vor den Augen einer schockierten Weltöffentlichkeit betreibt der IS, ganz in der Tradition des Jihads im „Dar al Islam“, ethnische und religiöse Säuberung an Yeziden, Christen, Assyrern/Aramäern/Chaldäern, Armeniern, Drusen und Juden.
Vor allem die „Weisen des Universums“, die lobbylosen Yeziden, gerieten erneut zwischen alle Fronten und wurden zum Spielball der geopolitischen und ideologischen Interessen der Islamisten sowie deren Unterstützern. Islamische Staaten, die Türkei sowie die Barzani-Regierung in Erbil scheinen weder fähig noch willens, den systematischen Genozid an Nicht-Muslimen zu beenden. Zahlreiche Fatwas, öffentlich ausgerufen von Mullas, sowie die politischen Hasstiraden Erdogans trugen dazu bei, dem blinden Fanatismus einen Weg zu bahnen. So ist es vielen Islamisten nun möglich, ganz offiziell und mit Stolz in den Häusern, Dörfern und Städten sowie von den Äckern und dem Lebenswerk ihrer „nicht-muslimischen“ Opfer zu leben.
Vor diesem Hintergrund entwickeln sich der politische Islam und seine zahlreichen Unterstützer-Staaten wie beispielsweise die Türkei (Nato-Partner), Saudi-Arabien und Katar sehenden Auges zu einer weltweiten Gefahr für ethnische und religiöse Minderheiten, Fortschritt, Demokratie, Frieden, Freiheit und Menschenrechte. Dieser Gefahr und der aus ihr resultierenden Flucht, Vertreibung, Migration und der systematischen Vernichtung nicht-islamischer Kultur haben sich die PYD und PKK, mit ihrer inzwischen viel beachteten politischen Alternative für den Mittleren Osten, dem gesellschaftlichen Konzept „Demokratischer Konföderalismus“ (Demokratisierung der Gesellschaft, Geschlechterbefreiung, Partizipation aller ethnischen, religiösen u. a. Identitäten) entgegengestellt. Die seit Jahren erfolgreich kämpfenden Guerilleros, darunter vor allem die Frauenkampfverbände der PYD und PKK, haben am 03.08.2014 sofort auf den Einmarsch des IS reagiert und hunderttausenden vor allem Yeziden und Christen das Leben gerettet. Nachdem die Barzani-Pêșmergas geflohen sind, konnten die YPG- und PKK-Guerilleros die militärische Ausbildung, den Widerstand und die Rettung der Minderheiten organisieren und koordinieren und diese so auch von der Flucht nach Europa abhalten.
„Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“
Ich widme mein Buch den tapferen FreiheitskämperInnen der YPG/YPJ –Volksverteidigungseinheiten/Frauenkampfverband, YBŞ – Widerstandseinheit Şengals, YJÊ – Fraueneinheit Êzîdxans und der HPÊ – Verteidigungskraft Êzîdxan, allen Opfern und vor allem den Waisenkindern. Der Erlös aus diesem Buch soll den Opfern des Völkermordes an den Yeziden, den yezidischen und christlichen Hilfsorganisationen für traumatisierte und misshandelte Frauen, Mädchen und Kinder in Şengal und Rojava zugutekommen.
Vorwort und Danksagung
Die Geschichte der Wissenschaften ist eine große Fuge, in der die Stimmen der Völker nach und nach zum Vorschein kommen.
Johann Wolfgang von Goethe
Die Yeziden im Allgemeinen und ihre diasporabedingten Probleme in Deutschland im Besonderen sind kaum erforscht. Es fehlen fast vollständig wissenschaftlich relevante Studien über ihre Geschichte, Religionssoziologie, Theologie, Tradition, religiöse Einstellung, Identitäts- und Integrationsprobleme und Perspektiven in Deutschland. Meine interdisziplinär angelegte Studie soll im historischen und vor allem soziologischen sowie religionssoziologischen Bereich verifizierbare Beiträge leisten. Nicht zuletzt soll sie zur Versachlichung der Debatte über die Yeziden in Deutschland beitragen und eine wissenschaftliche Lücke schließen. Eine solche Arbeit braucht immer die Unterstützung Vieler, damit sie erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist somit nie das Werk eines Einzelnen. Darum möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich in der herausfordernden Phase des Forschungsprozesses begleitet, beraten und motiviert haben. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank. Zuallererst meinen herzlichen Dank an meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Peter Nitschke, der mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Arbeit unter seiner Leitung durchzuführen. Seine wertvollen Ratschläge und die konstruktiven Konversationen ermöglichten mir eine eigenständige Arbeitseinteilung. Zu Dank verpflichtet bin ich auch meinem Zweitbetreuer Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Breier.
Dem „Bavê-Sheikh“ sowie den Mitgliedern der „Meclisa Ruhanî“ in Lalish möchte ich für die höchst lehrreichen Gespräche z. B. über Philosophie und Theologie im Yezidentum hochachtungsvoll danken. Durch seine Weisheit, seine innere Ruhe und seine vielen Anregungen sprach er mir Mut zu und bestärkte mich bei meinem Forschungsvorhaben. Bei allen Freunden in Deutschland, England, der Türkei sowie in Kurdistan und dem Irak möchte ich mich an dieser Stelle für ihre Unterstützung, ihre Aufmunterungen und besonders für die entgegengebrachte Nachsicht während der gesamten Promotionsphase ganz herzlich bedanken. Sie standen immer ohne Wenn und Aber an meiner Seite und motivierten mich in den richtigen Momenten. Mein Dank gilt auch meinen Interviewpartnern sowie den yezidischen Vereinen und Organisationen wie z. B. dem yezidischen Forum in Oldenburg, Çira-TV und der NAV-YEK, für das mir entgegengebrachte Vertrauen sowie die Unterstützung.
Silêmanê Emerê Gênco
Dayê Sêvê
Größten Dank schulde ich meiner Familie für die uneingeschränkte und vielseitige Unterstützung, nicht nur während meiner Promotionsphase, sondern auch für all die Jahre, in denen sie mir diesen Weg ermöglicht hat. Ihr Verständnis, ihre Geduld sowie die moralische Aufbauarbeit haben mir den notwendigen familiären Rückhalt zur Durchführung der vorliegenden Forschungsarbeit gegeben. Schließlich danke ich ganz besonders meinem 1979 in Deutschland verstorbenen Vater Suleyman Savucu, Silêmanê Emerê Gênço, und meiner nur wenige Jahre später in Kurdistan verstorbenen Großmutter, Dayê Sêvê, die in jeglicher Hinsicht den Grundstein für meinen Werdegang gelegt haben. Ihre besonderen Charaktereigenschaften, ihr soziales Engagement und das verantwortungsvolle Wirken haben bleibende Werte, nicht nur für die eigene Familie hinterlassen. Für dieses Erbe bin ich beiden unendlich dankbar und werde ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Halil Savucu
Inhaltsverzeichnis
AEinleitung: Wer sind die Yeziden?
ILiteratur und Methodik
1Quellenlage der Studie
2Methodik
3Leitthesen und -fragen
4Verwandte Begriffe
IIUntersuchungsaspekte
1Zielrichtung der Studie
2Einzelne Untersuchungsaspekte
BHistorischer Teil
IUrsprung und Herkunft der Yeziden
1Verständnis von „kollektiver Identität“
2Woher kommen die Yeziden?
3Sind die Yeziden Zoroastrier?
4Sind die Yeziden Yarasan (Ahl-e Haqq)?
5Yezidentum – die älteste monotheistische Religion?
6Yezidentum als Geheimreligion?
IIDie historische Manifestation des Yezidentums
IIIYeziden im Reich der sunnitischen Osmanen
1Allgemeines
2Verfolgung der Yeziden im Ottoman Empire?
IV„Unterdrückungsgeschichte“ der Yeziden in der modernen Türkei?
1Vorbemerkungen
2Diskriminierung der Yeziden in der Türkei
VEinwanderungsgeschichte der Yeziden in die Bundesrepublik
1Die erste Phase der yezidischen Migration nach Deutschland
2„Vertreibung“ der Yeziden aus der Türkei ab 1980
3Diskriminierung der Yeziden aus Syrien?
4Yeziden aus dem Irak
5„Assimilation“ gegenüber Yeziden in Georgien und in Armenien
6Was wollen Yeziden in der Bundesrepublik Deutschland?
CMigrationspolitischer Teil
IMigrations- und Integrationspolitik
1Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
1.1Assimilation als die negative Form der Integration
1.2Inhaltliche Anforderungen an die Integration
2Integrationspolitik in einigen EU-Staaten
2.1Die Niederlande
2.2Schweden
2.3Frankreich
2.4Großbritannien
2.5Zusammenfassung
3Integrationspolitik in Australien, in Kanada und in den USA
3.1Australien
3.2Kanada
3.3Die USA
3.4Zusammenfassung
IIMigrationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland
1Einwanderungs- und „Integrationspolitik“ in Deutschland
1.1Geschichte der ausländerrechtlichen Regelungen
1.2Regelungen über die Staatsbürgerreform von 2000
2Gesetzliche Integrationsansprüche von 2005
2.1Integrations- und Orientierungskurse
2.2Ausländer mit Teilnahmeanspruch an Integrationskursen
2.3Verpflichtungsberechtigte („Altmigranten gleich Altyeziden“)
3Ausführungen
4Konsequenzen
5Fazit
DReligionssoziologischer Teil
IDie Sonderstellung der Kirche in Deutschland
IIDie yezidische Gesellschaft in Deutschland
1Allgemeines
2Die yezidische Familie
IIIDas Glaubenssystem der Yeziden
1Tawisî Melek
2Sheikh Adî (der Reformer)
3Das „Kastenwesen“ und seine Besonderheiten
4Weitere Normen des Yezidentums
5Die Reformen von Sheikh Adî und ihre Folgen
IVProbleme der yezidischen Gesellschaft am Beispiel der Frau
1Die Stellung der Frau in der „säkularen Welt“
2Die Stellung der yezidischen Frau am Beispiel der Überlieferungen
2.1Überlegungen zur Stellung der Frau
2.2Überlegungen zu Auslegung und Relevanz yezidischer Texte
a)Hymne der Eltern (Qewlê Dayik û Bavan)
b)Hymne des richtigen Benehmens (Qewlê Şeqeserî)
aa)Wortlaut
bb)Entstehungsgeschichte
cc)Systematik
3Die tatsächliche Stellung der Frau im Yezidentum
4Ergebnis
VWeitere Probleme der yezidischen Gesellschaft
1Die Kastenordnung
2Sanktionen gegen Abweichler
3Blutrache?
VIÄnderungen im Yezidentum in Deutschland
1Die erblichen Würdenträger und ihr Machtverlust
2Der Jenseitsbruder
3Das Şeytan-Tabu
4Tabus und Speiseverbote bei den Yeziden
5Der Grundsatz von Respekt und Loyalität
VIIÄnderungen in der Stellung der Frau
1Ehepartner in den Herkunftsländern
2Der Brautpreis
2.1Begriffliche Klärung
2.2Die Aushandlung des Brautpreises
2.3Probleme des Brautpreises
3Fälle der Zwangsheirat
3.1Wer ist betroffen?
3.2Die Einstellung zu Zwangsehen
4Jungfräulichkeit vor der Ehe
4.1 Bedeutung der Jungfräulichkeit
4.2Praxis der Jungfräulichkeit
5Fälle der „einverständlichen Entführung“
6Situation der jungen Ehepartner
7 Außereheliche Verhältnisse
VIIIPazifismus im Yezidentum?
IXZusammenfassung
EEmpirischer Teil
IAnmerkungen zu Umfrage und Methodik
IIBefragung zur Integration und Assimilation der Yeziden
1Einige Defizite des Schulsystems und die yezidische Einstellung zur Bildung
1.1Die Haltung zu Veränderungen
1.2Der Umgang mit Abweichlern
1.3Die Benachteiligung der Yeziden in Deutschland
1.4Sprachkenntnisse (Deutsch/Kurdisch)
1.5Kenntnis der yezidischen Religion
2Identitäts-Gefährdung
3Fehlender Unterricht in der Religion
4Fehlender Unterricht in der Muttersprache
4.1Die Stellung von Amts- und „Migrantensprachen“
4.2Die „Nicht-Förderung“ des Kurdischen und die Folgen
5Der PKK-Faktor und seine Nachteile
IIIDie Identifikation der Yeziden mit dem politischen System
IVZwischenergebnis
VDie neue yezidische Elite
1Besonderheiten der yezidischen Elite
2Yezidische Akademie mit Sitz in Hannover
3Gesellschaft für Christlich-Yezidische Zusammenarbeit
4Gesellschaft Ezidischer AkademikerInnen (GEA)
5Zusammenfassung
VI Versäumnisse yezidischer Vereine
FSchlussteil
IReformen in den Religionen
IIYeziden in der Diaspora und Reformen – quo vadis?
Literaturverzeichnis
Bücher (d, e, k*)
Aufsätze, Interviews, Gutachten (d, e, t, k*)
Tageszeitungen (d, t, e*)
TV-Programme (k*)
Yezidische Hymnen (Zeitschriften; Online-Quellen)
Wörterbücher (d, t, o, e*)
Lexika (d, t*)
Homepages der yezidischen Vereine
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
Bildanhang
Wappen, Wimpel, Symbole
Bilder von Ammar Salim
Bilder von Kamal Haraqi
Fotos von Halil Savucu
AEinleitung: Wer sind die Yeziden?
Als Yeziden1 werden Anhänger einer Religion bezeichnet, die ausschließlich unter Kurden verbreitet ist. Sie bilden eine streng monotheistische Religion.
Die Yeziden verfügen über keine theologisch-historischen Schriften, wie die Bibel oder den Koran. Die Zugehörigkeit zum Yezidentum definiert sich durch direkte Abstammung von yezidischen Eltern. Man kann nur als Yezide geboren werden. Ein Übertritt zum Yezidentum ist nicht möglich. Die Muttersprache der Yeziden ist das Kurmancî („Nordkurdisch“). Kurmancî ist einer der zwei Hauptdialekte des Kurdischen. Das Yezidentum basiert auf mündlichen Überlieferungen (oral tradition). Von zentraler Bedeutung für die Yeziden ist die Befolgung bestimmter Riten und Pflichten innerhalb der Gemeinschaft. Eine Heirat mit Nicht-Yeziden ist verboten. Das Yezidentum kennt keine Missionierung; seine Anhänger rekrutieren sich aus neugeborenen Yeziden, die qua Geburt Mitglied der Glaubensgemeinschaft werden. Ethnisch handelt es sich bei den Yeziden um Kurden. Yezidische Zugehörigkeit ist bisher nur im Rahmen der autonomen Region Kurdistan im Irak anerkannt.
Das Yezidentum ist von einem Kastensystem sui generis geprägt, das aber keine Gemeinsamkeiten mit der indischen Kastenordnung aufweist. So existiert bei den Yeziden kein Über- und Unterordnungsverhältnis verschiedener Kasten. Jeder Yezide wird, unabhängig von seiner „Kastenzugehörigkeit“, mit den gleichen persönlichen und wirtschaftlichen Rechten und Pflichten geboren. Die einzige Gemeinsamkeit von indischem und yezidischem Kastensystem besteht in der Geburt in eine Kaste und dem Heiratsverbot zwischen Angehörigen der verschiedenen Kasten.
Die Yeziden befinden sich jedoch in einer ungleich schwierigeren Situation. Denn sie sind eine Minderheit in doppelter Hinsicht: Zum einen gelten sie als Kurden und sind somit eine ethnische Minderheit innerhalb der Staaten Irak, Syrien und der Türkei; zum anderen sind sie innerhalb der mehrheitlich sunnitisch geprägten Kurden eine religiöse Minderheit: Mehr als 75 % der Kurden sind Sunniten (Hauptrichtung des Islam). Ein weiterer Teil der Kurden besteht aus Aleviten (ca. 20 %). Aleviten bestehen aus Türken und Kurden. Sie weisen in ihrer Philosophie und Praxis mehr Gemeinsamkeiten mit den Yeziden auf, als mit den schiitischen Muslimen (eine Minderheit innerhalb des Islam)2.
Yeziden machen statistisch weniger als 2 % der Gesamtbevölkerung der Kurden aus. Sie sind in allen Staaten des Nahen Ostens direkt oder indirekt einer repressiven Minderheitenpolitik ausgesetzt, die von ethnischer und/bzw. religiöser Verfolgung geprägt ist.
Die meisten Yeziden leben unter Kurden in den Ländern Türkei, Irak und Syrien. Der erst in den 1980er-Jahren begonnene Exodus der Yeziden aus der Türkei ist fast abgeschlossen. Es leben aber noch nennenswerte Teile der Yeziden in Armenien und Georgien. Es gibt keine verlässlichen Daten über die Größe der yezidischen Bevölkerung in den einzelnen Ländern. Ihre Gesamtzahl wird auf ca. 600.000 weltweit geschätzt. Der größte Teil von ihnen lebt im heutigen Irak,3 weitere Teile leben in Syrien, in Armenien und Georgien.4 Die meisten Yeziden, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, stammen aus der Türkei. In der Türkei sollen inzwischen weniger als 600 Yeziden leben5 und in Syrien sollen rund zwei Drittel ihre Dörfer verlassen haben.6 Insgesamt lebt ungefähr ein Zehntel aller Yeziden in Deutschland. Sieht man vom asiatischen Kaukasus und dem Irak ab, so gehören die Yeziden in Deutschland mit ca. 100.000 Angehörigen zu der drittgrößten yezidischen Gemeinde auf der Welt. Doch genau wie in den Herkunftsländern sind die Yeziden auch in Deutschland eine religiöse und politisch relativ einflusslose Minderheit. Weitere, wesentlich kleinere Gruppen von Yeziden leben in Belgien, Dänemark, Schweden, Frankreich und in Großbritannien, aber auch in den USA und Australien.
Historisch lebte die kleine Gemeinschaft der Yeziden zunächst im Islamisch-Osmanischen Reich. Innerhalb dieses Reichs waren die Yeziden de facto machtlos.7 Ihre politisch-religiöse Situation änderte sich auch durch die Gründung der säkularen Türkei (ab 1923) kaum. Die neue Türkei setzte die Verfolgung, Enteignung und Ausgrenzung der Yeziden fort, deshalb sahen sie keinen anderen Ausweg als nach Europa auszuwandern. Die ersten von ihnen kamen bereits in den 1960er-Jahren, zunächst als Gastarbeiter, in die Bundesrepublik Deutschland. Später, ab den 1980er-Jahren, als Flüchtlinge aus der Türkei und dann auch aus Syrien, Armenien und Georgien.
Diese yezidischen Flüchtlinge, die anfänglich in Deutschland „Wirtschaftsflüchtlinge“8 genannt wurden, haben inzwischen vierzehn eingetragene Vereine sowie zwei konkurrierende Dachorganisationen in Deutschland gegründet. Ihre Vereine verfolgen pro forma das Ziel, die Gemeinschaft der Yeziden vor der drohenden Assimilation zu bewahren. Denn die säkular-liberalen Gesellschaften Europas stellen für Yeziden eine Herausforderung dar. So scheinen die Yeziden in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Minderheiten9 ungleich mehr von „Identitätsproblemen“10 betroffen zu sein. Zwar ist durch den gesicherten aufenthaltsrechtlichen Status, den die meisten Yeziden in Deutschland bereits seit 1990 erlangt haben, der politisch-religiöse Druck, der auf ihnen durch sunnitische Muslime und staatliche Institutionen in der Türkei, im Irak und in Syrien lastete, weggefallen, doch an seine Stelle sind andere gesellschaftspolitische oder theologische Probleme getreten. So sind Yeziden mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich zu integrieren, aber auch mit anderen Gemeinschaften in den Dialog zu treten. Sie haben keine andere Wahl, als ihre Gemeinschaft und Religion den herrschenden Bedingungen in der Diaspora anzupassen. Insbesondere müssen sie wesentliche Elemente ihrer Religion neu interpretieren und gleichzeitig ihren Kindern zeitgemäßen Yezidenunterricht anbieten. Dabei müssen sie eine komplett neue Lernkultur in Deutschland praktizieren lernen, wenn sie in ihrer „Wahlheimat“ als Religionsgemeinschaft überleben wollen. Dies ist keine leichte Aufgabe für eine bis in die 1990er-Jahre von Analphabetentum11 und Stammesstrukturen geprägte Gemeinschaft.
Wie soll man unter diesen Umständen eine kleine Religionsgemeinschaft (tiny minority), die im Wesentlichen auf mündlicher Tradition basiert, vor dem drohenden Untergang in der neuen Wahlheimat bewahren? Was steht dieser Gemeinde bzw. Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland bevor – Integration oder Assimilation?
ILiteratur und Methodik
1Quellenlage der Studie
Die Quellenlage für die vorliegende Studie kann als dürftig bezeichnet werden, deshalb war es unerlässlich, auf online-Quellen unterschiedlicher Qualität zurückzugreifen. Viele yezidische Überlieferungen und ihre verschiedenen Versionen sind nur im Internet veröffentlicht. Zudem haben die „deutschen Yeziden“ die Herausgabe ihrer Print-Zeitschriften12 bereits vor mehr als zehn Jahren eingestellt. Es gibt jedoch einige yezidische Vereine, die Homepages und Internetplattformen betreiben, die Schriften unterschiedlicher Qualität veröffentlichen. Auf diese online-Quellen wurde fortwährend zurückgegriffen.
Es handelt sich um online-Quellen, die vom Verfasser inhaltlich überprüft werden konnten13. So wurde auf Quellen aus Wikipedia („Wikipedia – Die Enzyklopädie“) nur zurückgegriffen, wenn es sich dabei um von „kritischen“ Lesern unbeanstandete Beiträge handelte. Des Weiteren wurden zahlreiche Publikationen, vornehmlich Bücher und Aufsätze, für die Studie ausgewertet. Von besonderer Relevanz erwiesen sich dabei die Schriften des Iranisten Philip G. Kreyenbroek, der Religionswissenschaftlerin Eszter Spät und dem Rechts- und Migrationsforscher Celalettin Kartal. Aus ihren Schriften und Publikationen wurde – soweit relevant – zitiert.
2Methodik
Für die Studie standen die veröffentlichten religiösen Überlieferungstexte der Yeziden14 (Hymnen und Gebetstexte) zur Verfügung. Mehr als 90 % dieser Texte sind erst in den letzten zwei Dekaden veröffentlicht worden. Der Inhalt dieser Texte ist theologisch und philosophisch von zentraler Bedeutung. Für die Auslegung dieser Texte wurde die hermeneutische Methode15 (ergänzend) herangezogen. Zu fast allen Hymnen (qewls) sind bereits unterschiedliche Versionen veröffentlicht worden. Diese Überlieferungstexte sind Teil der mündlichen Tradition der Yeziden. Als Teil der oral tradition16 kann jedoch keine der beiden, teils unterschiedlichen Versionen für sich in Anspruch nehmen, allein richtig oder falsch zu sein. Die Auslegung17 dieser Texte bildet wichtige Aspekte dieser Studie, so z. B. über die Stellung der Frau im Yezidentum und den Grundsatz des Pazifismus, der Teil der yezidischen Lehre ist. Beide Aspekte wurden in dieser Studie erstmalig systematisch geprüft und eingearbeitet.
Um die integration policy der führenden Staaten der Europäischen Gemeinschaft (EU) mit der überseeischer Staaten wie den USA, Kanada und Australien zu vergleichen, wurde auf die in den Politikwissenschaften übliche Vergleichsmethode zurückgegriffen. Mit Blick auf die Schwerpunkte der Studie (Integration, Assimilation) wurden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der untersuchten Staaten herausgearbeitet.
Bei der Auslegung der yezidischen Überlieferungstexte (z. B. Qewls, Jandils, Beyts, Diwas) wurde vornehmlich die Methode der Hermeneutik angewandt. Dazu wurden in einem ersten Schritt die Bedeutung und die Inhalte dieser Hymnen erklärt und erst im zweiten Schritt philologisch ausgelegt. Allerdings enthalten die oralen Texte nicht selten auch konkrete Hinweise, Empfehlungen und Pflichten. Insofern wurde vielfach nur hilfsweise von der Hermeneutik Gebrauch gemacht.
Für den empirischen Teil stand ein relativ umfangreicher Fragenkatalog zur Verfügung. Dafür wurde anhand eines vorgefertigten Fragenkatalogs mit geschlossenen Fragen gearbeitet, um zu verhindern, dass bei der Durchführung der Befragung unbedacht methodisch unzulässige Suggestivfragen gestellt werden.
3Leitthesen und -fragen
Im Alltag wird in der Bundesrepublik Deutschland häufig mit dem Begriff „Integration“ ein einseitiger Anpassungsprozess der Migranten an die Mehrheits- bzw. Aufnahmegesellschaft bezeichnet. Wie lässt sich Integration unter Berücksichtigung der Interessenlage der yezidischen Migranten definieren? Wird die Integrationspolitik der Bundesrepublik den Interessen aller Migrantengruppen gleichermaßen gerecht? Welche Integrationspolitik betreiben die wichtigsten Länder der EU sowie überseeischen Staaten wie USA, Kanada und Australien?
Die kurdischen Yeziden sind Teil der orientalisch-patriarchalischen Gesellschaft. Ist die Situation der yezidischen Frau im Vergleich zu Islam und Judentum weniger streng reglementiert?
Seit zwei Dekaden lässt sich bei den „deutschen Yeziden“ ein rapider Wertewandel, aber auch „Werteverlust“ beobachten. Welche relevanten Veränderungen hat es seitdem diasporabedingt gegeben? Wie gehen die „deutschen Yeziden“ oder ihre Mehrheit mit diesen Veränderungen um?
Die Lage der Yeziden in Deutschland ist vielfach mit „dem Bild eines im Wasser dahinschwindenden Zuckerstücks“ verglichen worden18. Ist die Behauptung begründet, dass Yeziden in Deutschland dem Untergang ihrer Religion entgegensehen? Wird sich die tiny Gemeinschaft der Yeziden ohne enge Berührung mit ihren Herkunftsländern noch mehr verändern, aber letztlich in der Diaspora überleben?
Nach Meinung der „neuen yezidischen Elite“ würde das Yezidentum in Europa ohne eine gründliche Reform aussterben. Eine Elite, die das Schicksal der „deutschen Yeziden“ mit fundamentalen Reformen verknüpft, wozu auch die Öffnung nach außen gehört. Welche Chancen, Risiken und Gefahren sind mit Reformen in den Religionen verbunden? Können Reformen das Überleben der Yeziden in der Diaspora sicherstellen? Welche Ziele und Strategien verfolgen yezidische Vereine und die neue yezidische Elite? Wie sieht die Zukunft der Yeziden in der Bundesrepublik Deutschland aus? Welchen Benachteiligungen sind Yeziden im Vergleich zu anderen nationalen oder religiösen Migrantengruppen oder Religionsgemeinschaften ausgesetzt?
Nicht selten wird behauptet, die Yeziden seien nicht integrationsfähig. In welche Richtung bewegt sich das „deutsche Yezidentum“: Integration oder Assimilation? Wie weit lässt sich von einer breiten Assimilation großer Teile der Yeziden in der Bundesrepublik sprechen?
4Verwandte Begriffe
Für die Studie wurden unterschiedliche oder zum Teil ähnliche Begriffe wie Gesellschaft, Gemeinschaft, Gemeinde benutzt. Für die Zwecke der Untersuchung erwies sich der Begriff der „Gemeinschaft“ als am besten geeignet. So wird unter „Gemeinschaft“ (von „gemein“) eine zu einer Einheit zusammengefasste Gruppe von Individuen, die emotionale Bindekräfte aufweist, mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl (Wir-Gefühl) verstanden, aber auch eine Rechtsgemeinschaft, also eine Vertragsgemeinschaft. Die Yeziden, die in verschiedenen Ländern der Welt verstreut leben, bilden wahrscheinlich ein loseres Wir-Gefühl, aber eine Gemeinschaft mit einem Wir-Gefühl. Eine „Gemeinschaft“ genügt sich selbst, hingegen ist die „Gesellschaft“ ein Instrument. Gemeinschaften bzw. Religionsgemeinschaften werden von ihren Mitgliedern vor allem gegen Außenstehende abgegrenzt, ohne dass diese das notwendig erkennen müssten. Insofern bilden die Yeziden in Deutschland eine Gemeinschaft, wenn auch keine Gemeinschaft im Rechtssinne. Sofern in der Studie dennoch die Begriffe „Gemeinschaft“ oder „Gesellschaft“ benutzt wurden, so stehen sie als Synonyme und keineswegs als sich ausschließende Begriffe.
Nicht selten wurden auch die Begriffe „yezidische Minderheit“ oder „yezidische Migrationsgruppe“ benutzt. Auch diese Bezeichnungen schließen sich nicht aus und wurden aus stilistischen Gründen angewandt. Im migrationspolitischen Teil der Studie wurden weitere Bezeichnungen bzw. „Umschreibungen“ wie z. B. „gegenseitige“ oder „gelingende Integration“ sowie „zweiseitige Integration“ benutzt, die inhaltlich eine positive bzw. „bejahende Integration“ beschreiben.
Schließlich wurde der Begriff bzw. die Bezeichnung „Elite“ bzw. „die neue yezidische Elite“ angewandt. Mit diesem Begriff sind Inhaber von sozialen und politischen Herrschaftspositionen gemeint19. Elite („ausgelesen“) bezeichnet hier eine Gruppe von Menschen, die (tatsächlich oder mutmaßlich) im Vergleich zu der Masse der Yeziden überdurchschnittlich qualifiziert ist.
IIUntersuchungsaspekte
1Zielrichtung der Studie
Der Schwerpunkt der Studie liegt im soziologischen, religionssoziologischen sowie politikwissenschaftlichen Bereich. In diesen Bereichen wurden zahlreiche Besonderheiten der yezidischen Gemeinschaft punktuell untersucht. Die Studie leistet damit vornehmlich einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte über die Yeziden in Deutschland und die bereits eingetretenen Veränderungen in der yezidischen Gemeinschaft.
Zu diesem Zweck wurde die Migrations- und Vertreibungsgeschichte der Yeziden, ihre zahlreichen Identitäts- und Assimilationsprobleme in der „Diaspora“20, ihre Rechtsstellung im Vergleich zu anderen Migrantengemeinschaften sowie die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ihrer Integration in der Bundesrepublik näher untersucht. Ebenso wurde die Übergangs- und Orientierungsphase, in der sich die Yeziden seit zwei Dekaden in Deutschland befinden, analysiert und die „Gefahren,“ denen sie ihrer Besonderheiten wegen ausgesetzt sind, betrachtet.
2Einzelne Untersuchungsaspekte
Die Arbeit beginnt zunächst mit der in der Forschung noch völlig ungeklärten Frage nach der Herkunft der Yeziden (vgl. B. I). Im Anschluss geht die Studie auf die Verfolgung und die Rechtssituation der Yeziden im ehemaligen Osmanischen Reich und in der modernen Republik Türkei ein (vgl. B. II, III). In diesem Abschnitt wurden die Konturen der „Verfolgungs- und Vertreibungsgeschichte“ der Yeziden aus der Türkei näher untersucht und dargelegt. Es folgt ein kurzer Abschnitt (B. IV) über die Diskriminierungspolitik an Yeziden aus Syrien und der systematischen Ausgrenzung aus dem Irak. Im Weiteren geht es um die indirekte bzw. latent vorhandene Assimilationspolitik gegenüber Yeziden in den ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Georgien. Es wird die Frage untersucht, was die Yeziden bzw. ihre Vereine in Deutschland gesellschaftspolitisch bezwecken und leitet so zum fünften Abschnitt der Untersuchung über (vgl. B. V). Hier sollen die begrifflichen Unterschiede zwischen Integration und Assimilation sowie ihre theoretischen Abgrenzung näher dargelegt werden. In diesem Abschnitt werden, mit Blick auf die Interessenlage der Yeziden in Deutschland, die Anforderungen an eine „positive Integration“ und der vorgegebene verfassungsrechtliche Rahmen (Gleichheitssatz aus Art. 3 GG) für religiöse und ethnische Minderheiten, die ihre Kultur und Religion in einem plural-demokratischen Staat bewahren wollen, mit untersucht.
Der zweite Teil behandelt Fragen der Einbürgerungs- und Integrationspolitik führender Staaten der EU (vgl. C. I). Dabei geht es vor allem darum, wie die untersuchten EU-Länder Großbritannien, Frankreich, Schweden und die Niederlande sowie die außer-europäischen Staaten, insbesondere die USA, Kanada und Australien, sich in ihrer Integrationspolitik inhaltlich und konzeptionell voneinander und von der Bundesrepublik im Besonderen unterscheiden. Ziel dieses Teils ist es, die Integrationspolitik führender Einwanderungsstaaten mit der Integrationspolitik Deutschlands zu vergleichen (vgl. C. II), um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können. Zwei Fragen prägen diesen migrationspolitischen Teil: Inwieweit hat Deutschland mit dem neuen Aufenthaltsgesetz eine zeitgemäße Integrationspolitik eingeführt? Hat der „Zuwanderungsgesetzgeber“ mit dem geltenden Aufenthaltsgesetz auch die Interessenlage der traditionellen „Altimmigranten“ (Yeziden) mitberücksichtigt bzw. hinreichend berücksichtigt?
Der dritte Teil (vgl. D) führt in die Besonderheiten der yezidischen Gemeinschaft ein (D. II, III) und untersucht anschließend punktuell den bei den Yeziden in Deutschland eingetretenen religiösen und gesellschaftlichen Wertewandel. Außerdem beschäftigt er sich mit bereits erfolgten zahlreichen Veränderungen unter hervorgehobener Berücksichtigung der Stellung der Frau im Yezidentum (D. IV ff.). Untersucht werden vornehmlich Probleme, die infolge des Aufenthalts in der Diaspora entstanden sind, sowie der eingetretene Machverlust der yezidischen Würdenträger21 und seine Folgen.
Dem migrationspolitischen Teil folgt der vierte Teil der Arbeit (E). Hier wird zunächst die Frage untersucht, ob die yezidische Religion im Vergleich zu anderen monotheistischen Religionen – wie von einigen Forschern und vor allem Yeziden-Kennern behauptet wird – gewisse pazifistische Elemente aufweist (E. II). Es folgt ein Abschnitt über die Ergebnisse der Befragung zu Integration und Assimilation. Hier wurden vor allem Fragen eingebettet, die mit der indirekten oder direkten Benachteiligung der Yeziden in Deutschland verbunden sind. In diesem empirischen Teil werden die Interviews und ihre Ergebnisse, die mittels eines Fragenkatalogs vorgenommen wurden, dargelegt und analysiert. Der verwendete Fragenkatalog umfasst vor allem die Gebiete der Benachteiligung von Yeziden, Yeziden und ihre Einstellung zur Bildung, eingetretene Veränderungen im Yezidentum in Deutschland, den veränderten Umgang mit eigenen Abweichlern, Fragen des religiösen Wissens bei Yeziden sowie die bestehende bzw. drohende Identitätsgefahr für Yeziden in Deutschland.
Nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse der Studie, des eingetretenen Wertewandels und der Gefahr des Identitätsverlusts, der Yeziden in Deutschland ausgesetzt sind, wird auch die Einstellung „der neuen yezidischen Elite“ untersucht (E. VI). Es folgt ein Abschnitt über Versäumnisse yezidischer Vereine sowie über die Zukunftsaussichten für Yeziden in Deutschland. Die bisherigen Aktivitäten der yezidischen Vereine sowie ihre Überlebensstrategien in der deutschen Diaspora wurden ebenfalls untersucht.
Der letzte Teil der Studie untersucht in gebotener Kürze, in welche Richtung sich die yezidische Gemeinschaft in Deutschland bewegt und in Zukunft wohl bewegen wird. Es wird beleuchtet, ob Reformen in monotheistischen Religionen überhaupt möglich sind bzw. eine Reformierung des Yezidentums möglich und geboten bzw. sinnvoll erscheint. Vor allem in diesem Teil wurden die laufenden Kontroversen um Reformen des Yezidentums, die in der yezidischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik stattfinden, eingebettet und mit untersucht.
1In der Literatur werden unter anderem die Bezeichnungen „Jesiden“ (deutsch), „Yezidi“ (türkisch) oder „Êzîdî“ bzw. „Êzdî“ (kurdisch) verwendet. In dieser Arbeit wird die türkische Schreibweise beibehalten, weil sie sich international durchgesetzt hat. Außerdem wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, die weibliche und die männliche Bezeichnung zu verwenden. Soweit neutrale oder männliche Bezeichnungen verwendet werden, sind darunter jeweils weibliche und männliche Personen zu verstehen.
2Das Alevitentum ist eine Lebensform, eine Glaubenslehre, ein kulturelles System und eine sozioökonomische Ordnung, die unter den Vorzeichen des Islam steht, so Ursula Spuler-Stegemann. Ist die Alevitische Gemeinde Deutschland e. V. eine Religionsgemeinschaft? Religionswissenschaftliches Gutachten, Marburg 2003, S. 21.
3Vgl. Guest John S. Guest: Survival among the Kurds – A History of the Yezidis, London and New York, 1993, S. 204; Celalettin Kartal: Zukunftsaussichten der Yezidi-Kurden als Religionsgemeinschaft in Europa, in: Kurdistan heute, Nr. 11, 1994, (37 – 42) S. 37. Ca. 550.000 Yeziden leben im Irak, so Telim Tolan: Yeziden fühlen sich als Bürger dieser Stadt, in: Dengê Ezidiyan, Dezember 2001, Nr. 8+9, (23 – 29) S. 24, 69.
4In Armenien sollen etwa 45.000 und in Georgien ca. 35.000 Yeziden leben, vgl. Philip G. Kreyenbroek: Yezidism in Europe: Different Generations speak about their Religion/In Collaboration with Z. Kartal, Kh. Omarkhali, and Kh. Jindy Rashow (Gottinger … III. Reihe: Iranica. Neue Folge), 2009, S. 35; ähnlich Michael Stausberg: Kurdische Yezidi, in: Religionen feiern – Feste und Feiertage religiöser Gemeinschaften in Deutschland, Marburg 1997, (154 – 161) S. 154 vgl. dort Anm. 2.
5Man kann nicht mehr von einer Existenz der Yeziden in der türkischen Republik sprechen, vgl. Banu Breddermann: Yezidische Flüchtlinge in Deutschland, in: ROJ 2000, (73 – 99) S. 87.
6Im Jahr 2000 lebten noch 4000 Yeziden in Syrien. Doch inzwischen sollen rund zwei Drittel der syrischen Yeziden ihre Dörfer verlassen haben, vgl. Telim Tolan: Stellungnahme zur Situation der Yeziden, in: Dengê Ezidiyan, 8 – 9, 2001, (32 – 41) S. 37.
7“(…) as time passed, conversions to Islam became increasingly common and Yezidi power declined (…) Yezidis had suffered enormously from religious persecution”, Christine Allison: Yazidism – A Heterodox Kurdish Religion, in: http://www.iranica.com/articles/yazidis-i-general-1 (abgerufen am 24.11.2010).
8Die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen ist kaum hilfreich, wenn wir es mit türkischen Kurden in Westeuropa zu tun haben, die ihre Heimat sowohl aus Angst vor Verfolgung und aus ethnischen Gründen verlassen wie auch wegen des „kriegerischen“ Konflikts im Südosten des Landes und des Mangels an wirtschaftlichen Alternativen, vgl. Sophie Westermann: Irreguläre Migration – Ist der Nationalstaat überfordert? Staatliches Regieren auf dem Prüfstand, Marburg 2009, S. 27.
9Eine Minderheit ist eine Volksgruppe, die innerhalb eines Staates lebt und sich numerisch gegenüber dem staatstragenden Volk oder anderen Völkern in der Minderheit befindet, vgl. Celalettin Kartal: Der Rechtsstatus der Kurden im Osmanischen Reich und in der modernen Türkei, Hamburg 2002, S. 16.
10„Ich sage, wir sind in ein Meer geraten, aus dem nur sehr schwer zu entrinnen ist.“, so das Oberhaupt der Yeziden in einem Interview mit Dengê Êzîdiyan, vgl. Kemal Tolan: Nasandina Kevneşopên Êzdiyatiye, Istanbul 2006, S. 369, m. Übers. ferner Celalettin Kartal: Çima akademîkerên êzdî nabin çalakger û berpirsê çarenûsa civaka xwe?, in: http://www.serbesti.net/?id=1422 (zuletzt abgerufen am 18.02.20013).
11Die Yeziden, die innerhalb des Osmanischen Reichs und der Republik Türkei lebten, blieben bis 1946 Analphabeten. Auch danach dauerte es lange bis viele alphabetisiert werden konnten, zum Teil dauerte diese Entwicklung bis in die 1980er-/1990er-Jahre.
12Gemeint sind die ehemaligen Zeitschriften wie Dengê Êzidiyan; Laliş; Roj. Dengê Êzîdiyan hat ihr Erscheinen im Dezember 2001 und Roj wohl 2002 eingestellt. Laliş hat wohl ihr Erscheinen 1998 eingestellt, Verf.
13Dem Verfasser sind alle yezidischen Publizisten, Autoren, Forscher und Wissenschaftler bekannt.
14Z. B. Kemal Tolan: Êzdiyatiyê, Istanbul 2006; Philip G. Kreyenbroek: Yezidism – its Background, Observances and Textual Tradition, Lewiston; Queenton; Lapeter 1995; Philip G. Kreyenbroek/Khalil Jindy Rashow: God and Sheikh Adi are Perfect 2005; Xana Omerxalî & Kovan Xankî: Analiza Qewlên Êzdiyan, Istanbul 2009; Emin Akbaş: Êzdiyatî – 1, Almanya 2009; Christine Allison: Yezidi Sözlü Kültürü, Istanbul 2007 (türk. Übers.) sowie einige yezidische Zeitschriften und Homepages.
15Jede Analyse eines Textes als Ganzes beginnt mit seiner sprachlichen Verfassung, vgl. Hans-Georg Gadamer 1986, S. 178; vgl. Thesen, Themen und Materialien zur sechsten Vorlesungseinheit vom 14.11.2002, in: http://evakreisky.at/onlinetexte/nachlese_hermeneutik.php; http://de.wikipedia.org/wiki/Auslegung_(Recht) (zuletzt abgerufen am 29.04.2013).
16Eszter Spät 2010, a. a. O., S. 17.
17Xana Omerxalî/Kovan Xankî 2009 vertreten die Ansicht, dass die eigentliche Schwierigkeit der Auslegung dieser Texte darin bestehe, die explizit unerwähnte Botschaft aus ihnen herauszulesen, S. 27. Philip G. Kreyenbroek/Khalil Jindy Rashow 2005, a. a. O., S. IX erklären „Qewls are very difficult by any standard, using an allusive style.“
18Z. B. Andreas Ackermann: Kontinuität und Wandel der yezidischen Identität in Deutschland – Eine vorläufige Bestandsaufnahme, in: Dengê Êzidiyan, Dezember 2001, Nr. 8+9, (10 – 12) S. 10.
19Everhard Holtman, Heinz Ulrich Brinkmann, Heinrich Pehle (Hrsg.): Politik-Lexikon, 2. Aufl. München, München, Wien, Oldenburg, 1994, S. 140.
20Der Begriff „Diaspora“ bezeichnet seit dem 19. Jahrhundert Gruppen, die aus religiösen und politischen Gründen ihre Heimat verlassen haben und über weite Teile der Welt verstreut leben, Maria do Mar Castro Varela und Paul Mecheril, in: Wie Rassismus aus Wörtern spricht, Münster 2011, (154 – 176) S. 164.
21Der Begriff des „Priesters“ (religious figure) ist für die yezidische Religionsgemeinschaft insofern unangebracht, als dass es keine Priester nach christlichem Muster bei den Yeziden gibt. Die erbliche Zuteilung bei den Yeziden erfolgt vielmehr auf der funktionalen Ebene; d. h. bestimmten Şêxs und Pîrs werden von Geburt an geistliche Funktionen zugewiesen.
BHistorischer Teil
IUrsprung und Herkunft der Yeziden
In diesem Abschnitt wird näher dargelegt, welches Verständnis von „kollektiver Identität“ bei den Yeziden vorherrscht. Welche Erkenntnisse hat die Forschung bereits über Ursprung und Herkunft der Yeziden erlangt: Sind die modernen Yeziden Zoroastrier oder Yarasan bzw. umgekehrt? Woher stammt der Name „Yezidi“? Ist das Yezidentum vielleicht die älteste monotheistische Religion oder doch eine „Geheimreligion“?
1Verständnis von „kollektiver Identität“
Die Yeziden verstehen sich als Angehörige einer „uralten“, pazifistischen Religionsgemeinschaft, denen historisch „großes Unrecht“ widerfahren ist, aber auch als „millet“, also als Volk. Als Religion verfügt das Yezidentum über ein vielfältiges Normengeflecht, das die spirituelle Verbindung zwischen Menschen in ihrer irdischen Existenz und einer überweltlichen, göttlichen bzw. heiligen Wesenheit begründet. Als Volk verstehen sich die meisten Yeziden als Teil der kurdischen Nation.
Historisch diente den Yeziden ihre religiöse Identität als Abgrenzung gegenüber den dominierenden kurdisch-sunnitischen Muslimen und fungierte gleichzeitig als inneryezidische Stütze22 gegen die jeweils in Kurdistan herrschende Mehrheit. Gleichwohl teilen die Yeziden historisch und geografisch das Schicksal der Kurden. Die in der Zeit des Ersten Weltkrieges und zum Teil bis in die Gegenwart in vielen Stämmen organisierten Kurden konnten, anders als die Türken und die Araber, keinen eigenständigen Staat gründen. Trotz politischer und zum Teil vertraglich festgehaltener Versprechen23 durch Briten und Franzosen, die das Mandat über Kurdistan ausübten, gingen die Kurden nach der Aufteilung des Osmanischen Imperiums leer aus. Kurdistan und somit alle Kurden wurden zwischen der neuen Republik Türkei (1923), dem Irak (1932) und später auch Syrien (1946) aufgeteilt.
Während die Yeziden bis zur Proklamation der Türkei als Republik fast alle innerhalb des Osmanischen Reichs lebten, wurden sie nun allmählich unter den drei neuen Staaten (Türkei, Irak, Syrien) aufgeteilt. Seit dieser, für alle Kurden verheerenden Aufteilung Kurdistans werfen nationale Entwicklungen und Umbrüche die Frage nach einer „kollektiven Identität“ für Kurden im Allgemeinen und für Yeziden im Besonderen auf. So erklärten „die nationalistisch orientierten“ Gebrüder Bedirxan24 bereits in den 1930er-Jahren die Yeziden als „die wahren Kurden“ (Kurdên resen), die es bereits vor dem Aufkommen des Islam gab. Im Grunde hat die Suche nach einem „kollektiven Selbst“, „kultureller Authentizität“ bzw. einer „gemeinschaftlichen Lebensform“ für Yeziden nicht schon in den 1930er-, sondern erst seit den 1980er-, zum Teil erst ab den 1990er-Jahren begonnen und hält weiter an. Die regionalen Entwicklungen und Diskussionen um Abstammung, Herkunft und Einordnung der yezidischen Gemeinschaft in ein Volk bzw. eine Nation sowie politische Vorstellungen der Yeziden in der Diaspora (Armenien, Georgien, Deutschland) als auch in der angestammten Heimat (Kurdistan bzw. Irak, Türkei, Syrien) sind zu vielfältig und unterschiedlich, als dass in dieser Studie des Umfangs wegen weiter darauf eingegangen werden könnte.
Trotz bzw. gerade wegen dieser „kollektiven Suche“ nach nationaler Identität versteht sich das moderne Yezidentum mehrheitlich als exklusiver „urkurdische Glaube“, gelebte Kultur und Lebensphilosophie. Nach yezidischer Auffassung hat das sich als Minorität definierende Yezidentum es vermocht, an seinen religiösen und gesellschaftlichen Besonderheiten (Sprache, Tradition, yezidische Identität) festzuhalten. Dies gelang trotz jahrhundertelanger Verfolgung und Anfeindung durch „orthodoxe Sunniten“ und „osmanisch-türkische Statthalter“ sowie der rigorosen Assimilationspolitik der modernen Türkei gegenüber der kurdischen Minderheit.
Wie dargelegt wird das Yezidentum vor allem von Kurden hofiert, die nationalistisch orientiert sind, obwohl es unklar ist, ob alle Kurden früher tatsächlich ausnahmslos Yeziden waren: Während die einen die Yeziden als eine vom Islam abgespaltene und folglich irregeleitete Sekte25 definier(t)en, ordnen die anderen sie ethnisch als Araber oder Türken ein. Die Yeziden selbst verstehen ihre Religion als die „älteste monotheistische Religion“26; beachtliche Teile davon begreifen sich als Zoroastrier27. Unter Yeziden und „nationalistisch orientierten Kurden“ ist die Auffassung vorherrschend, dass vor der Islamisierungswelle in Kurdistan alle Kurden Yeziden waren. Angesichts dieser unter Kurden und Yeziden anhaltenden Kontroverse soll untersucht werden, ob die bisherige Forschung nachprüfbare bzw. gesicherte Erkenntnisse über Ursprung und Herkunft der yezidischen Kultur erbracht hat.28 Zur Überprüfung dieser These soll zuerst geklärt werden, was die Begriffe „Yezidi“ bzw. „Ezdayî“ oder „Êzîdî“, etymologisch bedeuten. Sodann soll ausgeführt werden, wie diese Bezeichnungen bzw. Namen von den Yeziden selbst verstanden werden.
2Woher kommen die Yeziden?
Yezidischen Quellen29 zufolge stammt der Name „Ezdayî“ vom „Ez da“ bzw. „ewê ez dame“, was mit „Schöpfer“ bzw. „der mich selbst geschaffene Gott“ gleichgesetzt wird. Diese Erklärung entspricht der Ansicht aller yezidischen Autoren und berücksichtigt die Etymologie des Begriffs „Ezdayî“. Gleichwohl wurde bis zum 20. Jahrhundert in einigen islamisch orientierten Kreisen die Ansicht vertreten, dass die Bezeichnung „Yezidi“ auf den muslimischen Kalifen Yazid I. (680 – 683 n. Chr.) hinweise und die Yeziden Anhänger des erwähnten Kalifen seien.30 Dazu erklärt John S. Guest
“It seems most probable that the name ‘Yezidi’ was used by Moslems, particularly Shiites, as an insulting nickname for the members of this alien faith and that in the course of time it became their official designation”31
Konsequenz dieser verwirrenden bzw. unhistorischen Auffassung war, die Yeziden als eine vom Islam abgespaltene Sekte zu betrachten. Es gibt keine nachvollziehbaren, historischen Beweise dafür, dass die Bezeichnung „Yezidi“ oder „Ezdayî“ etwas mit dem sunnitischen Kalifen Yazid zu tun haben könnte32.Andere Forscher leiten die Bezeichnung „Yezidi“ von der altiranischen Bezeichnung „Yazata“ oder von der persischen Bezeichnung „Yazdan“ ab.33 An anderer Stelle wird versucht, den Namen „Yezidi“ mit der sumerischen Sprache34 in Verbindung zu bringen, wenn auch bisher ohne Erfolg. Demgegenüber erklären yezidische Autoren unter Berufung auf mündliche Überlieferungen, dass der Name „Yezidi“ vom Namen „Ezda“ für Gott (Xwedê) abstamme:
Êzî ist ein König. Er gab sich selbst 1001 Namen. Doch sein wichtigster Name ist Xwedê (Gott),“35 m. Übers.
Demnach bedeutet „Ezdayî“ so viel wie „Volk Gottes“ („gelê yan jî miletê Xwedê“). Yeziden zufolge seien ähnliche Namen wie „Ezd,“ „Ezda,“ „Ezdan“ nur Namen Gottes, während die Bezeichnung „Êzîdî“ oder „Ezdayî“ „Anhänger Gottes“ (Xwedêperest) bedeutet.36 In diesem Zusammenhang wird von Teilen der Yeziden die Auffassung vertreten, dass sie bis zur Ära der Sassaniden (224 – 651 n. Chr.) Zoroastrier hießen. Hingegen meint PîrMamou Othman, yezidischer Religionshistoriker, es sei unklar, wie die Yeziden vor dem Aufkommen des Islam wirklich hießen oder sich selbst nannten37.
Kreyenbroek und Khalil Jindy Rashow vermuten, dass der Name „Yezidi“ oder „Êzidî“ in früheren Zeiten (etwa vor 1415 n. Chr.) mehrere Gemeinschaften umfasst habe. Allerdings erwähnen sie nicht, welche weiteren Gemeinschaften gemeint sein könnten.
“Nor do we know exactly when the name Yezidi (or Êzîdî), which in earlier times seems to have been used for more than one community in Kurdistan, came to denote this particular group.”38
Tatsächlich ist in den yezidischen Überlieferungen die Bezeichnung Êzidî aufgeführt, es fehlt hingegen der Name Zoroastrier. In den Überlieferungen werden Begriffe wie „Sunet“ (Tradition) bzw. „Sûnî“39 oder auch „Sunetxan“ (House of the Tradition) oder „Dasini“ in unterschiedlichen Zusammenhängen erwähnt. Die Bezeichnungen „Sunet“ bzw. „Sunetxan“ stehen für „yezidische Tradition“ oder „yezidische Gemeinschaft“40, bei der Bezeichnung „Dasinî“ handelt es sich um den Namen eines yezidischen Stammes in Duhok (heutiger Irak).41Pîr Dîma zufolge war Dasinî ein ehemaliges yezidisches Fürstentum (Mîrgeha Dasinî), dessen Hauptstadt Duhok42 war. Der Begriff „Sunet“ weist zwar auf die yezidische Gemeinschaft hin, ist aber nicht der Name der Yeziden selbst. Es ist durchaus möglich, dass sich die Yeziden temporär als „Sunet“ (peşka sunnetê) oder „Sûní“43 bezeichnet haben, um einer gezielt politisch-religiösen Verfolgung vornehmlich durch orthodoxe Muslime wie z. B. safawidischen Schiiten oder sunnitisch-osmanischen Statthaltern zu entgehen.44 Es lässt sich nicht feststellen, ob der Name „Yezidi“ in früheren Zeiten tatsächlich mehrere Gemeinschaften umfasste. Es ist auch unklar, welche weiteren Gemeinschaften sich ebenso Yezidi nannten. Sofern Kreyenbroek/Rashow Aleviten und Yarasan (Ahl-e Haqq) meinen sollten, ist bislang ungeklärt bzw. unbewiesen, ob diese Gemeinschaften sich je als „Yezidi“ oder „Yeziden“ bezeichneten. Es kann aber bis auf Weiteres angenommen werden, dass einige Schiiten und „orthodoxe Sunniten“ einen „Sündenbock“ gesucht haben, um die Ermordung des vor allem bei den Aleviten verehrten Kalifen Imam Husain den Yeziden anzulasten. Wohl in der Folgezeit wurden die Yeziden jahrhundertelang als Anhänger des Kalifen Yazid tituliert und deswegen von vielen orthodoxen Muslimen angefeindet bzw. radikal bekämpft.45 Imam Husain war der Sohn des vierten Kalifen Ali. Er wird von Schiiten als auch von „anatolischen Aleviten“ gleichermaßen verehrt.
Folglich bleibt bis auf Weiteres die etymologische Herkunft der Yeziden ungeklärt. Allerdings gehören die Yeziden ihrer Alltags- und Kultursprache nach zu den Kurden, weil sie fast durchgehend das nordkurdische Kurmancî sprechen und alle ihre religiösen Texte in Kurdisch vorgetragen werden.46 Gleichwohl werden die Yeziden sowohl inoffiziell47 als auch offiziell entweder als Araber oder als Türken48 bzw. Zoroastrier bezeichnet. Letzteres wird vor allem von den in Europa bzw. Deutschland ansässig gewordenen „politisierten Yeziden“ angenommen, ist aber auch unter „nationalistisch orientierten Kurden“ im Allgemeinen verbreitet.49 Zur Verdeutlichung dieser Behauptung dienen folgende Zitate:
„Die yezidische Religion ist fünftausend Jahre alt (S. 13). (…) Auf der Grundlage des Yezidentums war Zarathustra eine entscheidende Brücke zwischen der alten und der neuen Epoche (…) Das ‚Mysterium‘ von Tawisî Melek (Oberengel, Anm. Verf.) erreichte Zarathustra (S. 14). So ist die Heilige Schrift Avesta in Kurdisch niedergeschrieben (S. 15). Alle diejenigen, die das Gegenteil behaupten, wonach Yeziden und Zarathustrianer nicht identisch seien, haben keine Kenntnisse von der Historie.“ (S. 16),50 m. Übers.
3Sind die Yeziden Zoroastrier?
Beim Zoroastrismus handelt es sich um eine vom Dualismus geprägte Religion. Seine Anhänger sind im Koran (Sure 22, Vers 17) erwähnt. Er geht von der Vorstellung aus, dass ein Weltgericht stattfinden wird. Dieses wird dann die „Bösen“ bestrafen und die „Guten“ belohnen. Der böse Geist wird verschwinden und ein neues, ewiges Reich des Ahura Mazdas wird entstehen.
Viele Yeziden und insbesondere „nationalistisch orientierte Kurden“ vertreten die Auffassung, dass Yeziden Zoroastrier,51 also Anhänger Zarathustras (ca. 628 – 551 v. Chr.) sind. Demnach ist der yezidische Glaube die Ursprungsreligion aller Kurden52 und ist gleichzeitig die älteste monotheistische Religion.53
“While simple people are satisfied with stressing the fact that their religion is very old or even the oldest one, and that they used to be far more numerous, educated Yezidis try to trace the lineage of their faith to the once glorious cultures and religions of the Middle East, the cradle of modern civilization, or what is more, they try to argue for a Yezidi origin for these cultures”54. However the Yezidi are neither the only nor the first ones to try to race their descent from the long gone empires of the Middle East. Moreover „claiming a glorious ancestry is a source of prestige in the region”55. Andere Teile der Yeziden und auch yezidische Forscher lehnen kategorisch ab, dass die Yeziden zoroastrischen Ursprungs seien.56
Möglicherweise steht hinter der Auffassung, dass Yeziden Zoroastrier seien, die politisch-theologische Überlegung, dass die Zoroastrier – anders als die Yeziden – „Schriftbesitzer“ sind, deren Religion auf der „Heiligen Schrift“ Avesta beruht, während die Yeziden selbst keine „Heiligen Schriften“ vergleichbar der Bibel oder dem Koran besitzen. Außerdem nehmen die „nationalistisch orientierten Kurden“ an, dass alle Kurden einst dem zoroastrischen Glauben angehört hätten57. Geht man also davon aus, dass alle Kurden einst tatsächlich Zoroastrier waren und Yeziden ethnisch zu Kurden gehören, dann müssen notwendigerweise auch die Yeziden Zoroastrier gewesen sein. Die Vertreter bzw. Befürworter dieser Theorie58 gehen zwar zu Recht von bestimmten Gemeinsamkeiten aus, verschweigen aber die sich essenziell widersprechenden Elemente beider Religionen bzw. deren Inhalte:
1.Mithra, das Oberhaupt von sieben Engeln, symbolisiert die Sonne. Viele Yeziden bezeichnen sich selbst als „Sonnenanbeter.“ Bei den Yeziden symbolisiert Sheikh Schems die Sonne59;
2.Die „Sonnenanbeter“ (Mithras) opferten Bullen zu Ehren von Mithra in ihrem Tempel. Die Yeziden opfern ebenso einen Bullen zu Ehren von Sheikh Shems, der bei ihnen die Sonne symbolisiert;
3.Der von Yeziden gesprochene Kurmancî-Dialekt ist eng verwandt mit dem persischen Pahlevi-Dialekt, der seinerzeit von den Medern gesprochen wurde;
4.Wie die Zoroastrier verehren auch die Yeziden das Feuer;
5.Zoroastrier wie Yeziden werden durch die Geburt Angehörige ihrer Glaubensgemeinschaft, ein Übertritt zu diesen Glaubensgemeinschaften ist nicht möglich;
6.die weiße Farbe ist die traditionelle Farbe bei den Yeziden und Zoroastriern60;
7.Avesta, das „heilige“ Buch der Zoroastrier ist in kurdischer Sprache veröffentlicht worden61 (m. Übers.)
Wie erwähnt gehen die Vertreter der Zarathustra-These zunächst von verifizierbaren Gemeinsamkeiten aus. Sie gehen zwar von einer linguistischen Verbindung zwischen beiden Religionsgemeinschaften aus62 (oben Nr. 3, 7), vermögen aber keine verifizierbaren Belege für ihre These zu nennen. Insbesondere übergehen sie die Tatsache, dass vielfach nur ethnisch motivierte, säkular oder meistens areligiös eingestellte Yeziden sich Zoroastrier bzw. „Sonnenanbeter“ nennen (oben Nr. 1)63. Sie lassen außer Acht, dass der Zoroastrismus sich längere Zeit unter den ost-iranischen Völkern, also weit weg von den west-iranischen Kurden entwickelt hat.64 Die „Bibel der Zoroastrier“, die Avesta, war bis zur Ära der Sassaniden (224 – 651 n. Chr.) nur mündlich überliefert und wurde erst später niedergeschrieben. Die noch vorhandenen Reste der Avesta können keine Authentizität beanspruchen. Die älteren Texte der Gathas (Textteile der Avesta) bereiten den modernen Interpretatoren und den Pahlavi-Kommentatoren große sprachliche Schwierigkeiten.65
Der von „politisierten Yeziden“ favorisierte Zoroastrismus ist vor allem durch Dualismus und Magie gekennzeichnet; das Yezidentum ist hingegen durch Hochgott (Xwedê) und seinen herrschenden Oberengel (Tawisî Melek) sowie weiteren sechs untergeordneten Engeln bestimmt. Die Vertreter der Zarathustra-These berufen sich zur Begründung ihrer Auffassung auf zwei der yezidischen Mîrs, die ihrerseits einem entsprechenden Trend folgend, in den Zoroastriern die modernen Yeziden sehen.66 Ihre Ansicht, dass Yeziden Zoroastrier seien, ist vor allem gesellschaftspolitisch motiviert.67 Zwar existieren zwischen beiden Religionsgemeinschaften viele theologische Gemeinsamkeiten, aber auch viele essenzielle Unterschiede.
“It is true that Zoroastrianism had impact on Yezidism, but they differ in many cases, such as in cosmogony, interment, the future of the spirit, and the most important thing; the life after death and rebirth.”68
Die linguistische Verbindung, auf die sich die Vertreter bzw. Befürworter der Zarathustra-These beziehen, kann nicht als Beweis für ihre Ansicht dienen, da die yezidischen Überlieferungen im Kurmancî-Dialekt vorgetragen werden, der Avesta-Corpus hingegen in der Liturgiesprache der Zoroastrier (Pahlevi-Dialekt) verfasst ist. Zudem kennt der Zoroastrismus, anders als das Yezidentum, wesentliche Elemente wie z. B. die Verehrung des Tawisî Melek69 nicht. Tawisî Melek ist aus yezidischer Sicht der Oberengel („sermelek“) und somit die zentrale Gestalt des yezidischen Glaubens70. Er ist der Vermittler zwischen seinem Schöpfer (Xwedê) und seinen yezidischen Anhängern sowie der alleinige Stellvertreter Gottes (wekilê Xwedê).71 Im Yezidentum ist der Schöpfer Êzîd (Ezdan) die allein göttliche Quelle, aus dessen Licht Tawisî Melek hervorging. Demnach könnte Êzîd identisch sein mit Zervan, der zarathustrischen Religion. Aus Zervan, dem Prinzip der „unendlichen Zeit“, gingen Ahura Mazda, der das Gute verkörpert und sein Gegenspieler Ahriman, der böse Geist, hervor. Die Weltgeschichte endet aber mit dem Sieg Ahura Mazdas. Folglich könnte Tawisî Melek tatsächlich das yezidische Pendant zu Ahura Mazda sein, aber mit dem essenziellen Unterschied, dass er den im Zoroastrismus innewohnenden Dualismus zwischen Gut und Böse in sich vereint, er also keinen Gegner Gottes darstellt, sondern explizit Gottes Pläne erfüllt.72
In beiden Religionen (Zoroastrismus/Yezidentum) hat ein Pakt, aber auch eine Stiertötung stattgefunden.73 In der zoroastrischen Mythologie wird der Pakt jedoch nicht wie im Yezidentum zwischen einem Hochgott (Xwedê)74 und seinem einzigen Verwalter, also Tawisî Melek75, auf Erden geschlossen, sondern zwischen Ahura Mazda als die Macht des Bösen, also der Verkörperung des Teufels, und Ahriman als Inbegriff des Guten bzw. ewigem Gegner des Satans. Demnach ist im Zoroastrismus die Welt des Guten in idealer Form geschaffen worden, aber durch den Angriff des Bösen zerstört worden. Im Yezidentum hingegen ist die Stiertötung ein positiver, weltbefreiender Akt76. Einen Engel des Bösen oder einen dämonischen Gott kennt die yezidische Religion nicht77. Dies steht im Gegensatz zur zarathustrischen Lehre, die von einem dualistischen Prinzip zweier Götter ausgeht, die als Urpotenzen miteinander im ewigen und unversöhnlichen Dauerstreit stehen78.
Überdies existiert im Yezidentum der Glaube an die Wiederverkörperung der Seele (kiras guhertin), die unmittelbar nach dem Tod den Körper verlässt, um sich dann in einem anderen Wesen zu manifestieren. Das Leben im Yezidentum endet nicht mit dem Tod, sondern erreicht nach der Seelenwanderung einen neuen Zustand. Dieser ist abhängig von den Taten im vorherigen Leben. Dieser Glaube ist dem Zoroastrismus fremd. Ähnliches gilt für das dem Yezidentum innewohnenden Şeytan-Tabu, das die Zoroastrier ebenso wenig kennen. Außerdem spielt die Avesta, die „Heilige Schrift“ der Zoroastrier, bei den Yeziden keine Rolle: Sie ist weder in den Hymnen (Qewl) noch in den Gebeten (Diwas) oder in weiteren Überlieferungen (Jandils, Beyts) erwähnt. Die einzige Hymne, die den Propheten Zarathustra (Qewlê Zerdeşt) namentlich erwähnt, ist von den Vertretern der Zarathustra-These nachträglich erdichtet worden.79
Der Zoroastrismus war über drei Jahrhunderte lang die offizielle Staatsreligion im Iran, wurde aber nie von allen Bewohnern der yezidisch-kurdischen Region im Iran übernommen.80 Während es sich beim Zoroastrismus um eine Schriftreligion handelt, ist das Yezidentum eine auf mündlicher Überlieferung beruhende Religion (oral tradition). Die Glaubensgemeinschaft der Yeziden und ihre Würdenträgerschicht hat diese Tatsache fortwährend bestätigt. Es sind also im Wesentlichen „politisierte Yeziden“, die sich Zoroastrier nennen, aber essenzielle Bestandteile des zoroastrischen Glaubens nicht kennen oder nicht kennen wollen.81
Demzufoge sind Yeziden keine Zoroastrier, obwohl sie sehr viele Gemeinsamkeiten mit ihnen haben. Wesentlich mehr Gemeinsamkeiten – wie noch aufzuzeigen sein wird – scheinen die Yeziden aber mit den schiitisch-muslimischen Yarasan (Ahl-e Haqq) zu haben, die in den kurdischen Bergen im Irak und im Iran, hier in Kermānshāh, beheimatet sind. Eine Klassifizierung der Yeziden als Yarasan würde aber bedeuten, dass die Yeziden sich eventuell vom Islam abgespalten haben. Sind Yeziden mit Yarasan identisch?
4Sind die Yeziden Yarasan (Ahl-e Haqq)?
Die Ahl-e Haqq (Anhänger der Wahrheit), auch Kakai bzw. Yarsan genannt, sind überwiegend Kurden. Doch anders als bei den Yeziden gibt es unter Yarasan82 nicht nur Kurden, sondern auch Luren, Aserbaidschaner, Perser und Araber. Möglicherweise weisen die Yeziden und die Yarasan die meisten religiösen Gemeinsamkeiten auf83: Beide Gemeinschaften haben als Gemeinsamkeit den Glauben an einen obersten Engel, Tawisî Melek bei den Yeziden, der bei den Yarasan jedoch als Dawid bezeichnet wird. Yeziden und Yarasan kennen ein Engelsystem, haben jeweils fünf religiöse Pflichten und gemeinsame Mythen und Sagen.84 In der Mythologie beider Glaubensgemeinschaften finden sich die Lebenselemente Feuer, Wasser, Erde und Wind. Yeziden und Yarasan gehen von der Perlentheorie aus, mit der die Welt ihren Anfang genommen haben soll. Auch die Elemente der Kosmogonie, also der Erklärungsmodelle zur Weltentstehung stimmen fast überein: Vor Himmel und Erde existierte eine Perle, die Gott aus seinem Licht geschaffen hat. Der Mythologie nach wird das Universum von einem Bullen und einem Wal getragen. Genau wie bei den Yeziden hat Gott mit dem Oberengel ein Abkommen abgeschlossen, bei dessen Zustandekommen die anderen sechs Engel als Zeugen zugegen waren.85 Zu bestimmten Anlässen opfern beide Gemeinschaften einmal im Jahr einen Stier. Weder bei den Yeziden noch bei den Yarasan gibt es einen Religionsstifter bzw. Propheten.86
Trotz dieser essenziellen Gemeinsamkeiten lassen sich weder die Yeziden als Anhänger der Yarasan klassifizieren noch umgekehrt. Allerdings deutet alles darauf hin, dass diese erstaunlich deckungsgleichen Gemeinsamkeiten nicht zufälliger Natur sein können und wohl auf einen gemeinsamen Ursprung hinweisen. Doch linguistische, geografische, strukturelle und teilweise auch philosophische Gründe sprechen gegen eine Klassifizierung der Yeziden als Yarasan und umgekehrt: Während die Yeziden – wie oben ausgeführt – nicht als eine Sekte des Islam gelten, betrachtet die Mehrheit der Yarasan sich selbst als schiitische Muslime, weshalb die Yarasan von den Schiiten akzeptiert werden. Hingegen werden die Yeziden in weiten Teilen der islamisch-arabischen Welt als „Teufelsanbeter“ („Şeytanperest“) bezeichnet. Beide Glaubensgemeinschaften sprechen unterschiedliche Dialekte des Kurdischen, die Yeziden das Nordkurdische (Kurmancî), die Yarasan den südkurdischen Dialekt, Goranî. Das Südkurdische wird vorwiegend in der Provinz Kermānshāh im Iran und der weiteren Umgebung gesprochen, während die Yeziden verstreut in fast allen Teilen Kurdistans leben. Die Yarasan lehnen jede Einteilung der Gläubigen in Klassen und Schichten ab. Die Yeziden hingegen teilen sich in drei verschiedene Schichten (Kasten) und weitere Untergruppen ein.87 Im Gegensatz zum Yezidentum kennen die Yarasan die Möglichkeit der Konversion. Da dies bei den Yeziden nicht der Fall ist, könnte diese Möglichkeit auch später von den Yarasan eingeführt worden sein, was aber hier dahinstehen kann. Yeziden gibt es nur unter Kurden, Yarasan jedoch unterteilen sich in verschiedene Ethnien. Folglich bleibt es bis auf Weiteres offen, ob Yarasan Yeziden oder Yeziden Yarasan sind oder beide Religionen einen gemeinsamen Ursprung haben, sich aber in der Isolation der kurdischen Berge unterschiedlich entwickelt haben, was durchaus wahrscheinlich ist.
5Yezidentum – die älteste monotheistische Religion?
Nach einer insbesondere in yezidischen Kreisen vertretenen, bislang nur mythisch begründeten Ansicht, handelt es sich beim Yezidentum um die älteste kurdische Religion unter den monotheistischen Glaubensrichtungen. Die Vertreter dieser Ansicht verweisen auf uralte Elemente, die Bestandteil des Yezidentums sind und erklären, dass alle Kurden vor dem Eindringen der islamischen Truppen in Kurdistan Yeziden waren. Tatsächlich weist das Yezidentum viele uralte Elemente auf wie z. B. die Engellehre88 bzw. die Verehrung der Sonne (Mithra).89 Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass das Yezidentum entweder tatsächlich älter ist als bisher in der Forschung angenommen oder zumindest Teilelemente archaischer Religionen integriert hat oder solche erhalten geblieben sind. Es ist möglich, dass die Vorstellung von einem Gott, der Gutes und Böses parallel geschehen lässt, älter ist als die Vorstellung von zwei sich bekämpfenden Mächten (Dualismus), wie es die zarathustrische Lehre oder die Religionen der Christen und Muslime propagieren. Letztlich kann es jedoch für die Untersuchung dahinstehen, ob das Yezidentum wirklich älter ist als alle anderen „ein-Gott-zentrierten Religionen“. Noch ist die Entstehung des Yezidentums weitgehend unerforscht.90 Nach der dargelegten Quellenlage sind Yeziden weder Zoroastrier noch Yarasan. Die lange Zeit von europäischen Gelehrten verbreitete Ansicht, wonach die Yeziden sich aus dem Islam abgespalten haben, wird von Forschern nicht mehr vertreten.91 Vielmehr sind sich die meisten Quellen dahin gehend einig, dass das Yezidentum von einem vorislamischen Religionssystem kurdischer Kultur wesentlich geprägt worden ist. Dessen ungeachtet hat auch durch den Islam eine wesentliche Prägung der yezidischen Religion stattgefunden.92
6Yezidentum als Geheimreligion?
Bis in die Gegenwart wird die Auffassung vertreten, dass das Yezidentum eine Geheimreligion sei. Die bereits veröffentlichten Überlieferungen der Yeziden belegen, dass das Yezidentum als Glaubenssystem mit universellen Prinzipien wie Ethik, Moral, Recht und Unrecht, Loyalität, Barmherzigkeit und Liebe ausgestattet ist. Gleichwohl steht das Yezidentum seit mehr als einem Jahrhundert in Verruf, eine Geheimreligion oder eine Art Geheimreligion zu sein. So führt z. B. der ehemalige Forschungsreisende Carsten Niebuhr (1733 – 1815) vorsichtig aus, dass die Yeziden gezwungen sind, die Grundlehren ihrer Religion geheim zu halten, weil sie keine „göttlichen“ Bücher besitzen.93 Später vertraten im 20. Jahrhundert deutsche Religionswissenschaftler wie z. B. Klaus E.Müller und GernotWießner die Ansicht, dass das Yezidentum eine Geheimreligion sei.94 Auch das niedersächsische Oberlandesgericht Lüneburg war der Auffassung, dass das Yezidentum eine Geheimreligion sei, die nicht öffentlich ausgeübt werden müsse.95 Diese Ansicht wurde auch von der deutschen Islamwissenschaftlerin Ursula Spuler-Stegemann übernommen.
Wann kann man tatsächlich von einer Geheimreligion sprechen? Der Begriff Geheimkult ist geläufig, aber Geheimreligion? Handelt es sich vielleicht um direkte oder indirekte Versuche nicht hinreichend informierter Forscher, eine tiny minority ungerechtfertigt zu diskriminieren?
Bereits begriffslogisch bestehen Zweifel, ob es eine Geheimreligion geben kann. Wenn eine „Religion“ im Geheimen gefeiert wird, dann liegt die Vermutung nahe, dass selbst Insider über die Glaubenslehren und Inhalte dieser Religion kaum Bescheid wissen. So lässt sich vor allem aus online-Quellen entnehmen, dass die Verfasser mit dem negativ besetzten Begriff Geheimreligion das Yezidentum meinen.96 Die Islamwissenschaftlerin UrsulaSpuler-Stegemann geht einen Schritt weiter und behauptet, dass zu den Überlebensstrategien der Yeziden die taqīya („die weise Vorsicht“) gehört. Danach seien Yeziden berechtigt, so die Verfasserin, im Falle einer Bedrohung ihre religiöse Identität nicht preisgeben zu müssen.97
Anders als die genannten Religionswissenschaftler, die durchweg der kurdischen Sprache nicht mächtig sind, lehnt der Iranist Philip G. Kreyenbroek den Begriff Geheimreligion entschieden ab. Kreyenbroek nach haben selbst hervorragende Forscher bei der Untersuchung des Yezidentums Missverständnisse verursacht, weil sie versucht haben, das Yezidentum in das Klischee ihrer auf Schriftreligionen basierenden Vorstellungen zu zwängen.98 Er begründet seine Meinung vor allem damit, dass der Begriff Geheimreligion in der vergleichenden Religionswissenschaft keine Anwendung findet. So werde das Yezidentum stets öffentlich praktiziert, also nicht im Geheimen. Es gibt yezidische Experten wie Qewals und zahlreiche weitere yezidische Würdenträger sowie interessierte Yeziden und Nicht-Yeziden, die sich mit den Inhalten des Yezidentums auskennen. Die Ergebnisse seiner langjährigen Studien haben ergeben, dass die Yeziden ihre Religion stets öffentlich praktiziert haben. So wurden in den Herkunftsländern der Yeziden religiöse Feste öffentlich begangen soweit es die politischen Verhältnisse zuließen. An diesen yezidischen Festen und Zeremonien nehmen auch Nicht-Muslime, vor allem Christen teil. Es bleibe ihm unerklärlich, so Philip G.Kreyenbroek, warum in Bezug auf Yeziden der Vorwurf der Geheimreligion fortwährend erhoben werde.99
Andreas Ackermann (Ethnologe) von der Universität Koblenz fügt als Erklärung hinzu, dass die „Schriftfeindlichkeit“ der Yeziden dazu geführt habe, dass ihr Glaube früher als „Geheimreligion“ galt. Doch Ackermanns Behauptung stellt sich als eine historisch beweisbedürftige Behauptung dar und hält einer näheren Untersuchung nicht stand.100 Wie der Verfasser dieser Studie in einer Stellungnahme näher dargelegt hat, kann von einer „Schriftfeindlichkeit“ der Yeziden nicht gesprochen werden. So erklärt die politische Führung der Yeziden, Mîr, in einer im Jahre 1872 dem ottomanischen Sultan eingereichten Petition, dass die Yeziden verpflichtet seien, Schulen zu bauen und ihre Kinder auszubilden.101 Es waren also die prekären Umstände, unter denen Yeziden leben mussten, die sie dazu gezwungen haben, ihre Oralität fortzusetzen, aber nicht eine ihnen nachträglich unterstellte Schriftfeindlichkeit.102 Zudem stützt sich Ackermann auf Christine Allison, die zwar in der ersten Auflage ihres Buches „The Yezidi Oral Tradition In Iraqi Kurdistan“ den Begriff „antiliterate“103 in Bezug auf Yeziden und ihre Einstellung zur Alphabetisierung benutzt, ihn dann aber gleich danach mehrfach relativiert. Entgegen der Auffassung von Ackermann zitiert Allison in diesem Zusammenhang vor allem den Yezidenautor K. Jindi Rashow, der ihr erklärt habe, Yeziden wollten nicht mit Muslimen zusammen zur Schule gehen, um ihre „heiligen Werte“ nicht verleugnen zu müssen.104 Es muss also angenommen werden, dass Forscher und die ehemaligen Missionare bzw. Forschungsreisenden aufgrund mangelnden Vertrauens105 bei den ehemaligen Yeziden oder mangelnder Sprachkenntnisse, keine zuverlässigen Erkenntnisse über die Yeziden erlangen konnten. Die Behauptungen von Gernot Wießner106, Klaus E. Müller107 oder Ursula Spuler-Stegemann108, wonach die yezidische Religion eine Geheimreligion sei, beruht wohl vor allem auf mangelnder Fachkompetenz sowie auf fehlenden kurdischen Sprachkenntnissen. Es ist möglich, dass bei vielen yezidischen Laien in der Türkei die Einstellung herrschte, gegebenenfalls ihre yezidische Zugehörigkeit nicht preiszugeben, wenn in einer sunnitischen Umgebung Gefahr für Leib und Leben bestand. Dies war aber weder die herrschende Praxis noch lässt sich die Verheimlichung der yezidischen Zugehörigkeit mit den veröffentlichten Überlieferungen der Yeziden begründen. Es kann aber angenommen werden, dass Teile der Yeziden aus (leidvoller) Erfahrung vor allem mit (sunnitisch-orthodoxen) Muslimen einen Austausch mit Andersgläubigen über ihre Religion und deren Lehren gemieden haben. Dies geschah jedoch nicht, weil das Yezidentum eine Geheimreligion ist, sondern aus begründetem Selbstschutz. Des Weiteren liegen Dokumente aus dem 19. Jh. vor, in denen die politische Führung der Yeziden fortwährend die „Hohe Pforte“ auf die Besonderheiten der yezidische Religion hingewiesen hat109, um eine Befreiung vom osmanisch-islamischen Militärdienst zu erlangen.
Demnach bleibt zwar die Herkunftsfrage der Yeziden offen, doch ist offensichtlich, dass das Yezidentum keine Geheimreligion ist. Es stellt sich die Frage, seit wann von einer erstmaligen historischen Manifestation des Yezidentums gesprochen werden kann.
IIDie historische Manifestation des Yezidentums
Es stellt sich die Frage, ab wann in historisch nachprüfbarer Weise von Yeziden gesprochen werden kann. Hängt das erstmalige Erscheinen der Yeziden mit Sheikh Adî, dem wichtigsten Reformer, zusammen? Wie war die politische Situation der Yeziden im 13. bzw. 14 Jahrhundert n. Chr.?
Yeziden sind eine Religionsgemeinschaft, deren Kultur und Religion auf „mündlichen Überlieferungen“ (kevneşopên devkî) wie „primär religiösen Hymnen“ (qewl), Gebeten (diwas), einfachen Erzählungen (çîrok) und weiteren Texten (jandil, beyt, dirozî) beruht. Christine Allison erklärt dazu:
„Oral tradition is crucially important for the Yezidis (…). They communicated with their neighbours, and passed on their community history, literature, wisdom and religious texts to their descendants, orally.”110





























