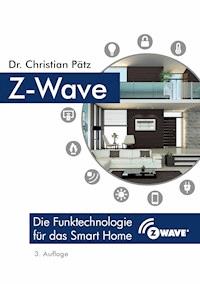
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Z-Wave ist der führende internationale Standard für die drahtlose Kommunikation im Smart Home. Verschiedene Produkte von verschiedenen Anbietern arbeiten zusammen und interagieren in einem einzigen Netzwerk und bieten intelligente Beleuchtung, Sicherheit und Energieeffizienz. In diesem Buch wird Z-Wave als Technologie vorgestellt und Hinweise für die Nutzung beim Aufbau eines Smart Home gegeben. Kapitel 1 vergleicht verschiedene Funktechniken und Führt in Z-Wave ein. Es werden die Historie, der Zertifizierungsprozess und der aktuelle Stand der Technik erklärt. Kapitel 2 beschreibt die auf dem ITU-T Standard G.9959 basierende Funkschicht mit Kodierungen, Antennentechnik, etc. Kapitel 3 widmet sich der Nerzwerk-Schicht und erklärt die Adressierung, die Selbstorganisation und die Zusammenarbeit der einzelnen Z-Wave Geräte. Im vierten Kapitel werden die Befehlsstrukturen und die damit einhergehenden Anforderungen zur Einhaltung der Interoperabilität unterschiedlicher Geräte erklärt. Kapitel 5 gibt sehr praktische Hinweise zum Aufbau, zum Management von Z-Wave Funknetzen und liefert einige praktische Tipps und Erfahrungen. Im letzten Kapitel werden einige Spezialthemen rund um Z-Wave wie die rechtliche Situation oder spezielle praktische Probleme z.B. das Dimmen von Leuchten betrachtet. Das Buch richtet sich an Anwender, Installateure und Entwickler. Es setzt kein Fachwissen über Z-Wave, jedoch solide allgemein-technische Grundkenntnisse voraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben..
Johannes 3, 16
(LUT)
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Was ist ein intelligentes Haus
1.2 Begriffs-Definition im Intelligenten Hauses
1.3 Allgemeines Schichtenmodell der Funkkommunikation
1.4 Anforderungen an ein Funksystem zur Automation von Häusern
1.5 Alternativen für ein Haus-Funksystem
1.5.1 Analoger Funk im 27 MHz oder MHz Frequenzbereich
1.5.2 Proprietäre Protokolle verschiedener Hersteller
1.5.3 Wifi oder WLAN
1.5.4 IEEE 802.15.4 basierte Kommunikation
1.5.5 ZigBee
1.5.6 Thread
1.5.7 EnOcean
1.5.8 DECT ULE
1.5.9 Z-Wave
1.6 Z-Wave - eine Kurzeinführung
1.6.1 Z-Wave Geschichte
1.6.2 Das Geschäftsmodell
1.6.3 Z-Wave entwickelt sich zum offenen Standard
1.6.4 Z-Wave Plus
1.6.5 Z-Wave Logos
2 Funkschicht
2.1 Grundlagen zur Funkausbreitung
2.2 Frequenznutzung bei Z-Wave
2.2.1 SRD860
2.2.2 ISM915
2.2.3 Wie Z-Wave mit unterschiedlichen Frequenzen umgeht
2.3 Reichweitenabschätzung
2.3.1 Hintergrund-Rauschen
2.3.2 Antennendesign und Antennenverlust
2.3.3 Dämpfung
2.3.4 Funkschatten
2.3.5 Reflektion und Interferenz
2.3.6 Fading
2.3.7 Zusammenfassung
2.4 Elektromagnetische Verträglichkeit
3 Z-Wave Netzwerkschicht
3.1 Datenkommunikation mit G.9959
3.1.1 Die PHY-Funktionsschicht
3.1.2 Z-Wave-Funkrahmen
3.1.3 Home-ID und Geräte-ID
3.1.4 Transportschicht
3.1.5 Zuverlässigkeit und Fehlerkorrektur
3.2 Routing
3.2.1 Grundlagen des Routing
3.2.2 Der Routingalgorithmus
3.3 Verschiedene Gerätearten bei Z-Wave
3.3.1 Rolle im Netz: Controller und Slaves
3.3.2 Arten der Stromversorgung
3.3.3 Zusammenfassung
3.4 Manuelle Aktualisierung des Netzes
3.4.1 Exklusion - Entfernen funktionierender Geräte
3.4.2 Entfernen defekter Geräte
3.4.3 Netzwerkneuorganisation
3.5 Automatische Aktualisierung des Netzes
3.5.1 Statische Controller
3.5.2 Explorer-Frame
3.5.3 Vergleich zwischen Explorer-Frames und SUC/SIS
3.6 Verschiedene Netzwerk-Konfigurationen
3.6.1 Z-Wave-Netzwerk mit einem portablen Controller
3.6.2 Z-Wave-Netzwerk mit einem statischen Controller
3.6.3 Portabler und statischer Controller in einem Netzwerk
3.6.4 Netzwerke mit SUC- und SIS-Controller
3.6.5 Vergleich der Netzkonfigurationen
4 Z-Wave Anwendungsschicht
4.1 Geräte und Kommandos
4.1.1 Verschiedene Arten von Z-Wave-Geräten
4.1.2 Kommandoklassen (Command Classes)
4.1.3 Die Kommandoklasse Basic
4.1.4 Geräteklassen
4.2 Verwaltung von Geräten
4.2.1 Node Information Frame
4.2.2 Interview
4.2.3 Konfiguration
4.2.4 Batterie-Management
4.2.5 Maximierung der Batterielebensdauer
4.2.6 Multi-Channel-Geräte
4.3 Assoziationen
4.4 Szenen
4.4.1 Beispiele
4.4.2 Szenen-Schnappschuss
4.4.3 Definition von Szenen in einem zentralen Controller
4.4.4 Aktivieren von Szenen mit Zeitgebern
4.4.5 Aktivieren von Szenen mit Funkkommandos
4.4.6 Aktivieren von Szenen durch logische Verbindungen
4.4.7 Komplexe Szenen mit Scripting
4.4.8 Vergleich zwischen Assoziationsgruppen und Szenen
4.5 Nutzerschnittstellen
4.5.1 Wandschalter und Fernbedienungen
4.5.2 Installationswerkzeuge
4.5.3 Web-Schnittstellen und Apps
4.6 Funksicherheit im Smart Home
4.6.1 Allgemeine Informationen über Sicherheit und mögliche Angriffsversuche
4.6.2 Verschlüsselung
4.6.3
Replay
-Attacke
4.6.4
Denial-of-Service-Attacken
4.6.5 Weitere Aspekte zur Funksicherheit
4.6.6 Das herkömmliche Sicherheitskonzept von Z-Wave
4.6.7 Die Sicherheitsarchitektur S2
5 Z-Wave in der Praxis
5.1 Netzwerkaufbau - der allgemeine Ablauf
5.1.1 Definieren der gewünschten Funktion
5.1.2 Wählen der richtigen Geräte
5.1.3 Funk-Wandschalter versus Schalteinsätze
5.1.4 Inklusion aller Geräte in ein gemeinsames Netz
5.1.5 Arten von Inklusion
5.1.6 Inklusion von Controllern
5.1.7 Probleme batteriegespeister Geräte
5.1.8 Interview-Prozess
5.1.9 Konfiguration
5.1.10 Assoziationen und Szenen
5.2 Hausaufgaben - wie entsteht ein stabiles Funknetz
5.2.1 Funkschicht
5.2.2 Z-Wave Netzwerkfunktion und Routing
5.3 Fehlersuche mit CIT bzw. Z-Way Expert UI
5.3.1 Radio-Schicht
5.3.2 Netzwerk-Schicht - defekte Geräte
5.3.3 Netzwerkschicht - falsche oder schlechte Verbindungen
5.3.4 Konfigurationsfehler auf Applikations-Ebene
5.3.5 Zusammenfassung
5.4 Bekannte Probleme und Lösungen
5.4.1 Sprachverwirrung
5.4.2 Verwechslung von Funktionen
5.4.3 Keine Vorwärts-Kompatibilität
5.4.4 Multi Channels versus Multi Instances
5.4.5 Sünden der Vergangenheit
5.4.6 IP-Gateways
5.4.7 Schwacher Prüfsummenalgorithmus
5.4.8 Komplettangebote von bestimmten Herstellern
6 Spezialthemen rund um Z-Wave
6.1 Rechtliche Situation
6.1.1 Wichtige Patente im Zusammenhang mit Z-Wave
6.1.2 Wichtige Patente, die Z-Wave gegenüberstehen
6.2 SDKs
6.3 Wie werden Z-Wave Geräte entwickelt
6.3.1 Hardware
6.3.2 Firmware
6.3.3 ZUNO
6.3.4 Z-Way Middleware
6.3.5 Z-Wave-Zertifizierung
6.4 Allgemeines über Dimmer
6.4.1 Phasenanschnittdimmer
6.4.2 Phasenanschnittdimmer für induktive Lasten
6.4.3 Phasenabschnittsdimmer
6.4.4 Universaldimmer
6.4.5 Leuchtstofflampen
6.4.6 LED-Leuchten
6.4.7 Zusammenfassung
6.5 Zweidraht versus Dreidraht
6.5.1 Dreidraht-Verkabelungen
6.5.2 Zweidraht-Verkabelung
6.5.3 Der Bypass
6.6 Treppenhausschaltung
A Nützliche Online-Ressourcen
B Z-Wave Device Types
C Z-Wave Command Classes Reference
D Frequencies by Country
Literaturverzeichnis
Zur deutschen Übersetzung Z-Wave ist ein internationaler Funk-Standard und daher sind alle Bezeichnungen und Prozesse in englischer Sprache definiert. Eine Übersetzung all dieser Begriffe in die deutsche Sprache ist nicht immer möglich und führt teilweise auch zu Irritationen.
Das vorliegende Buch basiert daher auf den folgenden Prinzipien für die Übersetzung der englischen Originalbegriffe.
Bei den zentralen Prozessen, für die die Z-Wave Spezifikation sogar Vorschriften zur Benutzung in Handbüchern macht, existieren dem englischen Original entsprechende deutsche Begriffe, die nur der deutschen Orthographie entsprechen. Die Begriffe Inclusion → Inklusion, Exclusion → Exklusion, Association → Assoziation, Generic Class → generische Klasse, Controller → Controller und Primary Controller → Primärcontroller werden damit in der eingedeutschten Form verwendet und die Beziehung zum englischen Original ist deutlich erkennbar. Im Anhang sind die Kernbezeichnungen der Z-Wave Welt sowie deren Bedeutung im Sinne eines Glossars aufgelistet.
Z-Wave kennt als Gegenstück zum Controller den Slave. Die deutsche Übersetzung dieses Begriffes ist definitiv irreführend und alle anderen Begrifflichkeiten sind nicht präzise genug. Daher wurde entschieden, den englischen Begriff des
Slave
als Bezeichnung für ein Z-Wave Gerät, das kein Controller ist, zu belassen.
Namen von Funk-Kommandos werden nur übersetzt, wenn es eine sinnvolle deutsche Bezeichnung gibt und aus dieser deutschen Bezeichnung der englische Originalbegriff herleitbar ist. Teilweise wird zur Sicherheit der englische Originalbegriff kursiv daneben gestellt.
Quelltexte oder Bezeichnungen, die direkt im Zusammenhang mit quellcodeartigen Darstellungen stehen, werden nicht übersetzt und bleiben im englischen Original erhalten
Für alle anderen Bezeichner und Beschreibungen wurde so weit wie möglich die deutsche Sprache verwendet.
Gegenüber der Ausgabe von 2014 wurden folgende Themen hinzugefügt bzw. aktualisiert:
(K1) Update zu alternativen Funkprotokollen
(K1) Z-Wave ist jetzt Public Domain
(K1) Neufassung der Einführung in Z-Wave mit Z- Wave-Historie, Geschäftsmodell, Logo-Historie, Technologie und Z-Wave Plus
(K2) Komplette Neufassung des Kapitels 2 über Funkausbreitung und Reichweitenabschätzung
(K3) Explorer-Frame Verfahren im Detail erklärt
(K3) Netzwerkrollen von Z-Wave Plus jetzt im Rahmen der Netzwerkschicht
(K3) Energie-Harvesting
(K3) Z-Wave Kanalkonzept
(K3) CRC16 im Z-Wave Kanal 3
(K4) Z-Wave+ Gerätetypen im Rahmen der Geräteklassen
(K4) Multi-Channel-Geräte
(K4) Lifeline
(K4) Central Scene
(K4) Dezentrale Natur von Assoziationen
(K4) Neue Sicherheitsarchitektur S2
(K5) Praktisches zum Interview-Prozess
(K5) Fehlersuche mit CIT oder Expert-UI von Z-Way
(K5) Probleme mit Komplett-Angeboten von manchen Herstellern
(K6) Entwicklung von Z-Wave Geräten
Aktualisierung in Bezug auf ICs, SDKs, etc.
Klarstellungen in Bezug auf PHY, MAC und Transportschicht
Über 80 % der Abbildungen wurden überarbeitet oder neu gesetzt
Gegenüber der englischen Erstausgabe von 2012 wurden folgende Themen hinzugefügt:
Betrachtungen zu Vor- und Nachteilen von Schalteinsätzen gegenüber kompletten Wandschaltern
Sicherheit im intelligenten Haus und bei Z-Wave
Update auf Serie 500 Chips
Update auf FLIRS
Update auf Autoinklusion als die neue Standard- Version zur Inklusion
Z-Wave Plus
1 Einleitung
Die Z-Wave-Technologie ist ein internationaler Funkstandard, der drahtlose Kommunikation in intelligenten Häusern ermöglicht. Sie verbindet einzelne elektrische Funktionen im Haus, wie beispielsweise Licht, Klimaanalagen, Heizungen, sowie Entertainment- und Sicherheitssysteme. Das Zusammenspiel dieser Systeme ergibt ein intelligentes Haus, in dem elektronische Geräte verschiedener Anbieter verbunden werden, um den Grad an Sicherheit, Komfort und Lebensqualität der dort lebenden Personen zu erhöhen. Darüber hinaus hilft ein intelligentes Haus auch dabei, Energie zu sparen sowie Umwelt und Menschenleben zu schützen.
Ein intelligentes Haus ist gekennzeichnet durch die Verbindung unterschiedlicher Geräte im Haus und die Möglichkeit diese über eine Bedienoberfläche zu kontrollieren. Diese Bedienoberfläche kann ein Web-Browser, ein an der Wand montiertes Touch-Panel, eine Fernbedienung oder ein Mobiltelefon sein.
Zur Verbindung der Geräte in einem Wohnhaus gibt es drei Möglichkeiten:
Drahtgebundene Lösungen erfordern Kabel, die während des Baus oder der Sanierung im Gebäude installiert werden müssen. Beispiele dafür sind BACnet (BACnet ist ein Protokoll, das mit verschiedenen Datenträgern funktioniert), bestimmte Versionen von LON oder KNX bzw. Instabus sind typischerweise teuer und daher nur im gewerblichen Bereich und in einigen wenigen Luxuswohnhäusern anzutreffen.
Sogenannte
Powerline
-Kommunikationsprotokolle verwenden das 230 V Stromnetz als Kommunikationsmedium. Gewisse Standards wie HomeplugAV werden gebräuchlicher, wenn auch eher als Ersatz für die Ethernet-Technologie, die für TV, Video und Audio angewandt wird.
Drahtlose Lösungen verzeichnen das größte Wachstum am Markt, da sie sowohl zuverlässig als auch bezahlbar sind und im Haus ohne aufwändige Renovierungsarbeiten installiert werden können. Außerdem können gewisse Funktionen, wie beispielsweise intelligente Türschlösser oder -sensoren, nicht drahtgebunden installiert werden, da sich die Tür bewegt oder sie an Stellen angebracht werden sollen, an denen keine Kabel verfügbar sind.
1.1Was ist ein intelligentes Haus
Der Begriff ’intelligentes Haus’, englisch Smart Home wird häufig zusammen mit dem Begriff Home Automationgenutzt. Wikipedia definiert Home Automation wie folgt:
Home automation is the residential extension of building automation. It is automation of the home, housework or household activity. Home automation may include centralized control of lighting, HVAC(heating, ventilation and air conditioning), appliances, and other systems, to provide improved convenience, comfort, energy efficiency and security. Home automation for the elderly and disabled can provide increased quality of life for persons who might otherwise require caregivers or institutional care. A home automation system integrates electrical devices in a house with each other. The techniques employed in home automation include those in building automation as well as the control of domestic activities, such as home entertainment systems, houseplant and yard watering, pet feeding, changing the ambiance ’scenes’ for different events (such as dinners or parties), and the use of domestic robots. Devices may be connected through a computer network to allow control by a personal computer, and may allow remote access from the internet. Through the integration of information technologies with the home environment, systems and appliances are able to communicate in an integrated manner which results in convenience, energy efficiency, and safety benefits. [SmartHome2017]
Die Definition ist korrekt aber nicht sehr aufschlussreich. Um sich der Thematik zu nähern, bietet es sich an, sich zunächst einmal in die gute alte Zeit zurück zu versetzen.
Früher erfolgte die Bedienung eines jeden Gerätes oder Produktes direkt am Gerät - Funktion und Bedienung waren eine Einheit. Eine Kerze wurde am Docht angezündet und das Licht kam direkt von der Kerze. Ein Türklopfer musste von Hand bedient werden und das Geräusch des Klopfens wurde unmittelbar vom Türklopfer generiert.
Durch das Aufkommen von Elektrizität hat sich in den letzten 100 Jahren einiges geändert. Die elektronische Türklingel wird an der Tür durch das Drücken eines Knopfes bedient. Der mehr oder weniger schöne Klang der Klingel kommt von einer elektrisch mit dem Knopf an der Tür verbundenen ’Schelle’. Das elektrische Licht wird typischerweise mit einem Lichtschalter an der Wand bedient, der sich nicht mehr direkt neben der Lichtquelle befindet, sondern bequem neben der Tür, sodass der Bewohner ihn einfach erreichen kann, wenn er den Raum betritt. Dieser Lichtschalter an der Wand ist durch einen elektrischen Stromkreis mit der Lichtquelle verbunden.
Andere Beispiele sind die Bedienung der Jalousien am Fenster, Wandthermostate, die die Temperatur im Raum regeln oder einfache Fernbedienungen, mit denen man Geräte ein- und ausschalten kann, die umständlich direkt zu bedienen sind. Viele Geräte im Haus werden immer noch direkt am Gerät bedient, wie beispielsweise Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Wäschetrockner oder Elektroherde. Fernsehgeräte werden seit der Einführung der Infrarot-Fernbedienung vor 40 Jahren mit eben dieser bedient.
Abbildung 1.1: Herkömmliches Haus am Ende des 20sten Jahrhunderts
Die Abbildung 1.1 zeigt die verschiedenen Arten die Geräte im Haus zu bedienen in einem herkömmlichen Haus am Anfang des 21. Jahrhunderts. Das intelligente Haus bzw. die Hausautomatisierung hat diese Situation vielfach verändert.
Die Bedienung unterschiedlicher Geräte erfolgt über eine Bedieneinheit. Der Lichtschalter dient nicht mehr nur zum Anschalten des Lichtes, sondern auch für andere Funktionen des Raumes. Die Fernbedienung ist nicht mehr nur einem Gerät zugeordnet, sondern bedient mehrere Unterhaltungsgeräte und Hausfunktionen, wie Licht oder Klimaanlage.
Abbildung 1.2: Erster Schritt zum intelligenten Haus
Abbildung 1.2 veranschaulicht den ersten Schritt hin zum intelligenten Haus.
Dieser erste Schritt bietet dem Bewohner erste Erleichterungen im Gebrauch und in der Bedienung der Geräte. Die Bedienung wird zentralisiert und vereint und ist somit in der Nutzung sehr viel bequemer. Ein gutes Beispiel für zentrale Bedienung sind Mobiltelefone, die zunehmend dazu genutzt werden, verschiedene Funktionen und Services im täglichen Leben zu vereinfachen.
Abbildung 1.3: Zweiter Schritt zum intelligenten Haus
Das zweite Merkmal eines intelligenten Hauses ist die Nutzung von Sensoren, die ausführliche Informationen über den Status des Hauses liefern.
Dies ist keinesfalls ein neues Konzept. Wandthermostate haben einen Temperatursensor, der die Heizung steuert und ein Rauchmelder ist ebenfalls ein Sensor. Die Idee eines intelligenten Hauses bringt die Nutzung von Sensoren auf ein neues Level: Bewegungsmelder steuern das Licht, wenn jemand im Raum ist oder sie drehen die Heizung herunter bzw. schalten sie ganz aus, wenn jemand den Raum verlässt. Sensoren für die Luftqualität steuern Fenster und Ventilation, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen, wenn der Raum genutzt wird.
Diese zweite Funktion ist in Abbildung 1.3 dargestellt.
Die Kernfunktion eines intelligenten Hauses ist die Automatisierung. Eine intelligente Schaltzentrale verbindet die Informationen, die Sensoren oder Interaktionen der Benutzer, wie beispielsweise durch Drücken eines Buttons, um eine Funktion des Hauses zu regulieren, ihnen liefern. Die Automatisierung bildet die Verbindung von verschiedenen Funktionen, die schon in der manuellen Bedienung im Schritt 1 eines intelligenten Hauses zentralisiert wurden, mit einer intelligenten Schaltzentrale. Diese stellt sicher, dass das Haus die verschiedenen Funktionen automatisch und unabhängig von der Bedienung durch den Nutzer ausführt.
Ein gutes Beispiel ist die Steuerung eines Dachfensters. Im Winter soll es geschlossen bleiben und während der Nacht sollen die Rollläden unten bleiben, um so viel Energie wie möglich zu bewahren. Tagsüber werden die Jalousien geöffnet und am Mittag, wenn die Außentemperatur hoch genug ist, öffnet sich das Fenster automatisch, um frische Luft in das Gebäude zu bringen. Ein Regen-und Windsensor sorgt dafür, dass das Fenster geschlossen bleibt, wenn es regnet oder starker Wind weht. Im Sommer unterscheidet sich die Automatisierung. Jetzt soll das Fenster tagsüber geschlossen mit heruntergelassenen Rollläden bleiben. Damit soll eine Überhitzung vermieden werden. Nachts soll das Fenster dann geöffnet sein, um frische Luft in den Raum zu leiten. Natürlich ist auch im Sommer der Schutz vor Regen und Wind relevant. Falls die Schaltzentrale weiß, dass der Bewohner nicht im Haus ist, können die Fenster aus Sicherheitsgründen 24h geschlossen bleiben. Neben der Steuerung des Hauses erhebt das vernetzte System von Sensoren und Geräten Informationen über gewisse Messwerte bezüglich des Status des Hauses und der Bewohner. Das hilft bei der weiteren Optimierung der Funktionen und informiert die Bewohner über die Sicherheit und hilft, wenn möglich, Energie zu sparen.
Abbildung 1.4: Letzter Schritt zum intelligenten Haus
Abbildung 1.4 zeigt den finalen Schritt zu einem intelligenten Haus. Die Eigenschaften eines intelligenten Hauses können folgendermaßen definiert werden:
“ Verschiedene, zentralisierte Bedienoberflächen steuern durch Interaktion mit dem Bewohner, Sensordaten und intelligente Entscheidungen, die die Bedienoberfläche selbst trifft, eine Vielzahl von Funktionen im Haus. Gleichzeitig stellt das intelligente Haus dem Bewohner nützliche Informationen zur Verfügung, die dabei helfen kluge Entscheidungen, wie das Einsparen von Energie zu treffen. ”
Es gibt keine klare Grenze, wann ein Haus zu einem intelligenten Haus wird. Sobald Kommunikationstechnik genutzt wird, muss der Bauherr entscheiden, welche Art von intelligenten Funktionen er integrieren will. Insbesondere die Nutzung von drahtloser Technologie erlaubt es Schritt für Schritt neue Funktionen einzubringen und das Leben und Arbeiten immer ’intelligenter’ zu machen.
1.2Begriffs-Definition im Intelligenten Hauses
Es gibt einige geläufige Eigenschaften und Begriffe, die im Zusammenhang mit einem intelligenten Haus genutzt werden.
Sensor:
Ein Sensor ist eine Vorrichtung, die Informationen generiert und diese an andere Geräte mittels eines Kommunikationsnetzwerkes übermittelt. Beispiele für derartige Sensoren sind Temperatursensoren im Raumthermostat, Bewegungsmelder, Türsensoren oder Rauchmelder.
Controller:
Controller sind Vorrichtungen, die andere Vorrichtungen mittels des Kommunikationsnetzwerkes steuern. Typischerweise sind es Bedienoberflächen. Beispiele sind Fernbedienungen, Tastaturen oder Wandschalter.
Aktoren:
Aktoren sind Vorrichtungen, die eine Aktion ausführen. Sie schalten ein oder aus, dimmen, laden auf, schließen usw. Beispiele für Aktoren sind Fenstermotoren, Lichtschalter, Lichtdimmer und elektrische Türschlösser.
Steuernetz:
Das Netzwerk ist ein Kommunikationsmedium, das Aktoren, Controller und Sensoren miteinander verbindet.
Gateways:
Gateways verbinden das Kommunikationsnetzwerk des Hauses mit anderen Kommunikationsnetzwerken wie TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) -basiertes Internet oder dem Mobilfunknetzwerk.
Die Intelligenz des Steuernetzes des Hauses ist meist in einem einzelnen Gerät konzentriert, dem Zentralcontroller oder auch im IP-Gateway, weil ohnehin höhere Rechenleistung gebraucht wird. Es kann aber auch auf mehrere Geräte verteilt sein.
Manche Anbieter mischen verschiedene Funktionen in einem Gerät. Mehrfachsensoren, wie beispielsweise Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, sind sehr gebräuchlich. Ein anderes Beispiel einer solchen Mischform ist ein Raumthermostat, das typischerweise einen Temperatursensor mit einer Bedienoberfläche für das Festlegen der Temperatur im Raum kombiniert.
1.3Allgemeines Schichtenmodell der Funkkommunikation
Drahtlose Kommunikationssysteme sind komplex und bestehen aus zahlreichen Funktionen. Um all diese Funktionen zu strukturieren, gruppieren Kommunikationsingenieure sie in einem Schichtenmodell und sogenannten Protokollstapeln (engl. protocol stack). Jede Schicht führt dabei eine bestimmte Funktion aus und nutzt dazu die Funktionen der darunter liegenden Schicht. Die Funktionen sind alle exakt definiert, so dass eine Schicht - zumindest theoretisch - durch eine andere, unterschiedliche Implementierung der gleichen Schicht ausgetauscht werden kann, ohne das andere Schichten und Funktionen betroffen sind.
Jede Schicht hat definierte Funktionen, die sie verrichtet, und diese Funktionen bestimmen die Dienste, die eine Schicht der darüber liegenden Schicht bereitstellt. Für Kommunikationsnetzwerke in intelligenten Häusern ist eine 4-Schichten-Struktur sinnvoll:
Funkschicht:
Diese Schicht bestimmt, wie ein Funk-Signal zwischen einem Sender (
Transmitter
) und einem Empfänger (
Receiver
) ausgetauscht wird. Dabei spielen Frequenz, Signal-Kodierung etc. eine Rolle. Der Dienst, den die Funkschicht bereitstellt, ist der Transport von verschiedenen Bits und Bytes von einem Gerät zu einem anderen Gerät.
Netzwerkschicht:
Diese Schicht organisiert, dass die Daten sicher und verlässlich von der Quelle zum Ziel übertragen werden. In einem drahtlosen Netzwerk können dabei andere Geräte zur Signalverstärkung oder Weiterleitung verwendet werden. Zu den Aufgaben der Netzwerkschicht gehören die Organisation des Netzwerks (wer ist drin, wer ist draußen), Adressierung, Routing, Verschlüsselung und Datenweiterleitung.
Anwenderschicht:
Die Anwenderschicht definiert die Bedeutung der Daten, die von der Netzwerkschicht und anschließend der Funkschicht übertragen werden. Die Netzwerkschicht kennt nur Bytes. Die Anwenderschicht legt die Bedeutung der Bytes fest. Sie definiert das Format, in dem Werte gemessen werden und die verschiedenen Befehle, die bestimmte Aktionen auslösen sollen.
Nutzerschnittstelle:
Die Nutzerschnittstelle dient als Schnittstelle für den Benutzer. Sie legt fest, wie Funktionen und Statusinformationen des Netzwerks auf verschiedenen Nutzeroberflächen wie Mobiltelefonen, Tablets oder Wandschaltern dargestellt werden. Nutzerschnittstellen definieren die Bedeutung von Symbolen, das Blinken der LEDs, Anzahl und Geschwindigkeit von erforderlichen Button-Betätigungen, etc.
Abbildung 1.5: Allgemeines Schichtenmodell der Funkkommunikation
Diese 4-Schichten-Struktur ist in Abbildung 1.5 ersichtlich. Dieses Buch nutzt zur Beschreibung des drahtlosen Kommunikationsprotokolls von Z-Wave dieses Schichtenmodell.
1.4Anforderungen an ein Funksystem zur Automation von Häusern
Das Kommunikationsnetzwerk eines intelligenten Hauses muss einige Anforderungen erfüllen:
1.5Alternativen für ein Haus-Funksystem
Am Markt existieren verschiedene drahtlose Funktechnologien für intelligente Häuser, die den oben genannten Anforderungen mehr oder weniger entsprechen.
1.5.1Analoger Funk im 27 MHz oder 433 MHz Frequenzbereich
Analoge drahtlose Systeme werden meist von No-Name-Herstellern angeboten und haben einen bemerkenswert niedrigen Preis. Das geht einher mit eher dürftiger Qualität und Sicherheit. Weil die Frequenz häufig mit dem Babyphone oder einem CB-Transceiver geteilt wird, sind Überlagerungen alltäglich und das Verhalten dieser Systeme wird unvorhersehbar. Aufgrund dieser Einschränkungen sind analoge Funklösungen als seriöse Hausinstallationen nicht weit verbreitet. Sie werden zunehmend von digitalen Systemen ersetzt, die zuverlässiger sind und mehr Leistung und Flexibilität bieten.
Zuverlässigkeit:
nein
Sicherheit:
nein
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
ja
Einfachheit:
ja
Günstiger Preis:
ja
Investitionsschutz:
nein
Interoperabilität:
nein
1.5.2Proprietäre Protokolle verschiedener Hersteller
Mehrere Hersteller haben ihre eigenen proprietären digitalen Funklösungen entwickelt und bieten teilweise sehr umfangreiche Produktfamilien an. Einige dieser Protokolle haben die zuverlässige und durch vollständige Rückbestätigung der Übertragung gekennzeichnete Zwei-Wege-Kommunikation implementiert.
Der größte Nachteil dieser Angebote ist allerdings die Beschränkung auf einen oder sehr wenige Hersteller. Das stellt kein Problem für einfache Lösungen dar, aber verhindert häufig die Umsetzung einer kompletten Automation. Nicht nur die Auswahl der Produkte ist begrenzt, auch die Erhältlichkeit der Produkte nach längerer Zeit ist meist nicht gewährleistet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Hersteller die Protokolle ändern und somit die Vorgängerprodukte nicht mehr zu gebrauchen sind. Trotzdem spielen die proprietären Technologien am Markt immer noch eine große Rolle. Das ist begründet in den dauerhaften Marketinganstrengungen der Hersteller und deren Einfachheit im Kauf einer Komplettlösung.
Zuverlässigkeit:
teilweise
Sicherheit:
teilweise
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
ja
Einfachheit:
ja
Günstiger Preis:
meistens
Investitionsschutz:
nein
Interoperabilität:
nein
1.5.3Wifi oder WLAN
Wireless LAN (WLAN) ist die Technologie, die am Markt am meisten vertreten ist. Alle Notebooks, Netbooks, Tablet PCs und fast alle Smart Phones sind WLAN-fähig. Das wirft die Frage auf, warum intelligente Häuser WLAN nicht als Standard-Kommunikationsnetzwerk nutzen. Dafür gibt es drei Gründe:
(1) WLAN wurde entwickelt zur Übermittlung großer Datenmengen. Für Übertragung und Empfang der Daten wird viel Energie gebraucht. Der klare Fokus auf Geschwindigkeit, hohe Sicherheit und eine hohe Übertragungsrate hat seinen Preis: WLAN braucht zu viel Energie für ein Hausautomationsnetzwerk, dass zumindest teilweise auf batteriebetriebenen Geräten oder sogar auf Geräten, die ihre Energie aus ihrer Umgebung beziehen (Energy Harvesting) basiert. WLAN kann in den Bereichen eines intelligenten Hauses genutzt werden, in denen die Geräte netzbetrieben werden, aber es kann nicht alle Einsatzbereiche bedienen. Die Verbindung von Geräten eines intelligenten Hauses zu Mobiltelefonen oder Tablets wird ermöglicht durch die Nutzung von WLAN bis zu einem Gateway. Von da aus wird das Signal über eine Technologie mit niedrigerer Geschwindigkeit und geringerem Energieverbrauch weiter zu den Endgeräten wie Sensoren und Aktoren geleitet. Es gibt verschiedene Bemühungen, den Energieverbrauch von WLAN zu senken, aber es wurde noch kein Niveau erreicht, auf dem batteriebetriebene Geräte mit WLAN mit einer sinnvollen Batterielaufzeit genutzt werden können.
(2) WLAN nutzt die 2.4 GHz - und 5 GHz - Funkfrequenz und dieser Frequenzbereich ist schon sehr ausgelastet. Mit steigender Anzahl von WLAN-Geräten und den schnell steigenden Anforderungen an die Datenrate durch IP-Fernsehen und andere Videostreaming- Dienste wird WLAN immer intensiver genutzt. Aussteller auf Fachmessen wissen bereits, dass eine gewisse Menge an aktiven WLAN-Geräten in einem Raum die WLAN-Kommunikation schnell zum Erliegen bringt.
(3) WLAN spezifiziert nur die Funkschicht und die Netzwerkschicht. Bis jetzt gibt es noch keine allgemeingültige, spezifizierte Anwendungsschicht für WLAN-basierte, intelligente Häuser. Das bedeutet, dass verschiedene Geräte, die WLAN nutzen, in einem einzelnen Netzwerk arbeiten, aber nicht miteinander interagieren können. Die IETF (Internet Engineering Task Force) als Standardisierungsgruppe für Internet-Anwendungen arbeitet an einer Lösung des Problems, aber bis jetzt steht kein allgemein gültiger Standard zur Verfügung. Die einzige momentan erhältliche Verbindung zwischen der Internet/WLAN-Technologie und intelligenten Häusern ist die sogenannte 6Lo- WPAN-Spezifikation [6LoWPAN2017]. 6LoWPAN definiert, wie eine IP-Adresse auf die Adressen, die im Internet genutzt werden und auf drahtlose Technologien, die in intelligenten Häusern genutzt werden, übertragen wird. Das Ziel ist es, ein Internet der Dinge zu entwickeln, in dem jedes Gerät im Haus seine eigene IP-Adresse hat und vom Internet aus erreichbar ist. Die Entscheidung, ob diese Lösung im Hinblick auf Aspekte der Sicherheit und der Privatsphäre wünschenswert ist, liegt beim Nutzer.
Zuverlässigkeit:
größtenteils ja
Sicherheit:
ja
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
nein
Einfachheit:
ja
Günstiger Preis:
ja
Investitionsschutz:
teilweise
Interoperabilität:
nein, kein Standard auf Anwendungsebene
1.5.4IEEE 802.15.4 basierte Kommunikation
Der IEEE 802.15.4 - Standard ist definiert als Kommunikationsverbindung mit niedrigem Energieverbrauch und einer niedrigen Datenrate und wird als zugrundeliegende Schicht für verschiedene Kommunikationslösungen auch im Smart Home genutzt. Die Spezifikation deckt aber nur die unteren Protokollebenen ab. Damit können unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Protokollen zwar eine gemeinsame und damit preiswert herzustellende Hardwarebasis nutzen; sie sind aber zueinander nicht interoperabel.
Tatsächlich ist IEEE 802.15.4 - Funk die meist genutzte Schmalbandfrequenz aufgrund der günstigen Hardware und auch der sehr preiswerten Entwicklungswerkzeuge. Viele proprietäre drahtlose Kommunikationslösungen basieren auf diesem Protokoll. Da es aber keine höheren Kommunikationsschichten gibt, kann dieser Standard nicht als komplette Lösung für das Kommunikationsnetzwerk dienen.
1.5.5ZigBee
ZigBee ist einer der vielen Kommunikationsstandards, die IEEE 802.15.4 als ihre Funkschicht nutzen. Ursprünglich war ZigBee nur eine Spezifikation einer Netzwerkschicht auf Basis dieser Funkschicht. Später wurden verschiedene Anwenderschichtspezifikationen hinzugefügt und andere Funkprotokolle in das ZigBee-System integriert. Als Resultat gibt es heute eine große Vielfalt an ZigBee-Spezifikationen, die aber außer der Nutzung der gleichen Funk-Schicht und dem Namen wenig gemeinsam haben.
Um der Situation Herr zu werden, wurden verschiedene Anwenderprofile definiert. Leider konnte man sich auch hier wiederum nicht auf eine einzige Definition einigen so das verschiedene Profile existieren, die zueinander ebenfalls nicht kompatibel sind. Bekannte Profile sind das Smart Energy Profile und das Smart Home Profile. Von diesen gibt es nun wiederum mehrere Versionsnummern, die ebenfalls wiederum nicht zu 100 % zueinander kompatibel sind.
Die folgende Liste zeigt die Spezifikationen von ZigBee, wie sie im Jahre 2017 verfügbar sind (nach Wikipedia).
Aktuelle Spezifikationen
ZigBee Home Automation 1.2
ZigBee Smart Energy 1.1b
ZigBee Telecommunication Services 1.0
ZigBee Health Care 1.0
ZigBee RF4CE - Remote Control 1.0
ZigBee RF4CE - Input Device 1.0
ZigBee Remote Control 2.0
ZigBee Light Link 1.0
ZigBee IP 1.0
ZigBee Building Automation 1.0
ZigBee Gateway 1.0
ZigBee Green Power 1.0 as optional feature of ZigBee 2012
ZigBee Retail Services
Spezifikationen in Entwicklung
ZigBee Smart Energy 2.0
ZigBee Smart Energy 1.2/1.3
ZigBee Light Link 1.1
ZigBee Home Automation 1.3
Es ist also nicht unrealistisch, ZigBee als einen großen Werkzeugkasten zu bezeichnen bei dem sich jeder Hersteller das nimmt, was er für sein jeweiliges Produkt als sinnvoll sieht. Das macht ZigBee gerade für große Hersteller mit Marktmacht attraktiv, verhindert allerdings die Interoperabilität und damit die Bildung eines freien Marktes kompatibler Geräte.
ZigBee-Hardware wird häufig in Geräte der Hausautomation eingebaut, dann aber aus Mangel an kompatiblen Geräten nicht genutzt (ein Beispiel dafür ist das bekannte Wand-Thermostat NEST aus den USA). In jüngster Zeit bekommt ZigBee auch Gegenwind wegen teilweise schwerwiegender Sicherheitslücken [Markoffnov2016].
Zuverlässigkeit:
ja
Sicherheit:
ja
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
ja
Einfachheit:
ja
Günstiger Preis:
noch nicht
Investitionsschutz:
teilweise
Interoperabilität:
auf Funkebene ja, verschiedene Anwenderprofile verhindern Interoperabilität auf Anwenderebene
1.5.6Thread
Ein weiteres Protokoll, das die Funkchips nach IEEE 802.15.4 nutzt, ist Thread. Die Thread Group wurde 2014 um das Unternehmen Nest gegründet. Nest wurde bekannt durch einen sehr schönen Wandthermostat und später auch durch die Tatsache, das Google dieses Unternehmen für ca. 2500 Mio. US-Dollar übernommen hat. Die Teilnahme namhafter Unternehmen wie Google oder Samsung führten zuviel Vorschuss-Lorbeeren für das Projekt, noch bevor überhaupt eine erste Spezifikation des Protokolls publiziert wurde. Es brauchte bis zum Jahre 2016, bis eine erste anwendbare Spezifikation vom Thread veröffentlicht wurde. Auch danach sind kompatible Produkte auf Basis von Thread nur auf Messen zu bestaunen. Trotzdem existieren bereits zwei verschiedene Versionen von Thread, die untereinander auch nicht mehr kompatibel sind.
Wie ZigBee definiert auch Thread lediglich eine Netzwerkschicht und ermöglicht es damit Herstellern, mit beliebig eigenen proprietären Anwenderschichten zu arbeiten. Eine Interoperabilität von Geräten ist erklärtermaßen kein Ziel von Thread. Die Netzwerkschicht beruht auf 6LoWPAN, einem Mapping von langen IPv6 Adressen auf die kleinen Datenpakete von IEEE 802.15.4. Damit kann Thread damit werben, IP-kompatibel zu sein.
Zuverlässigkeit:
ja
Sicherheit:
ja
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
ja
Einfachheit:
nicht bekannt
Günstiger Preis:
ja
Investitionsschutz:
noch nicht
Interoperabilität:
nein
1.5.7EnOcean
Die EnOcean GmbH wurde 2001 gegründet und ist ein Ableger der deutschen Siemens AG. EnOcean - Aktoren und - Sensoren funktionieren ohne Batterien, indem sie Methoden zur alternativen Energiegewinnung (Energie Harvesting) nutzen. Das Angebot batteriefreier Geräte, die ihre Energie aus alternativen Quellen wie Wind oder Sonne beziehen, wird von der Gesellschaft, die Wert auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit legt, gern angenommen. Dieser Anspruch hat aber auch seinen Preis: Die Kommunikation ist nicht so zuverlässig wie andere Technologien, wie z.B. ZigBee oder Z-Wave. Die Energie, die durch alternative Energiegewinnung wie Solarzellen (Ausnutzung des Piezoeffektes) oder Peltier-Elemente (Ausnutzen von Temperaturdifferenzen) zur Verfügung gestellt wird, ist einfach zu gering, um eine Zwei-Wege-Kommunikation zu realisieren. Das EnOcean Protokoll wurde zwar um Zwei-Wege-Kommunikation erweitert. Hier sind die entsprechenden Geräte entweder netzgespeist oder besitzen Batterien.
EnOcean-Geräte sind im Vergleich zu Z-Wave oder Zig-Bee teuer, so dass die Technologie bisher nur im kommerziellen Zweckbau erfolgreich war wo es mit kabelgebundenen Techniken kombiniert werden kann. Gerade im Bereich privater Wohnungen mit unterschiedlichen Gerätetypen und der Notwendigkeit, mit einer Funkverbindung das gesamte Haus abzudecken, ist EnOcean kaum verbreitet.
Zuverlässigkeit:
nein
Sicherheit:
nein
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
ja
Einfachheit:
ja
Günstiger Preis:
nein
Investitionsschutz:
ja
Interoperabilität:
ja
1.5.8DECT ULE
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT, ursprünglich Digital European Cordless Telephony) ist ein internationaler Standard zur Funkanbindung von schnurlosen Telefonen.
DECT besitzt den Vorteil, dass es immer noch in vielen Routern in Häusern installiert ist und mit dem 1800 MHz Band über ein eigenes nicht durch Fremdanwendungen gestörtes Frequenz-Band verfügt.
Die DECT ULE-Allianz treibt die Standardisierung der Anwendungsebene voran. Bisher ist jedoch von Ausnahmen abgesehen aufgrund fehlender kompatibler Geräte noch kein breiter Markterfolg sichtbar.
Zuverlässigkeit:
ja
Sicherheit:
ja
Wenig Funkabstrahlung und Energieverbrauch:
ja
Einfachheit:
ja
Günstiger Preis:
wahrscheinlich
Investitionsschutz:
unbekannt
Interoperabilität:
noch nicht
1.5.9Z-Wave
Z-Wave wurde insbesondere als drahtlose Kommunikationstechnologie für Wohnhäuser entwickelt. Daher erfüllt es auch perfekt die Anforderungen dieses Marktes. Die Hauptvorteile von Z-Wave sind:
Z-Wave nutzt das für Industrie- und Medizinanwendungen reservierte Frequenzband von 868 MHz und vermeidet damit die stark überfüllten 2.4 GHz-Frequenzen, auf denen WLAN und ZigBee angesiedelt sind.
Z-Wave bietet sichere und zuverlässige Zwei-Wege- Kommunikation, indem es Empfangsbestätigungen und ein funkvermaschtes Netz nutzt. (Eine Definition und Erläuterung von Funkvermaschung befindet sich in Abschnitt 3.2)
Z-Wave bietet einen angemessenen Preis; sicherlich höher als für einfache analoge Technologien, aber wesentlich niedriger als vergleichbare Technologien wie EnOcean, die eher für den Industriemarkt geeignet sind.





























