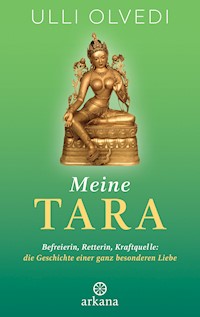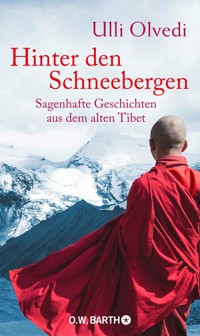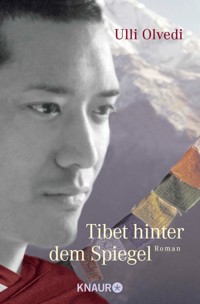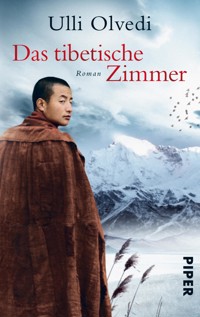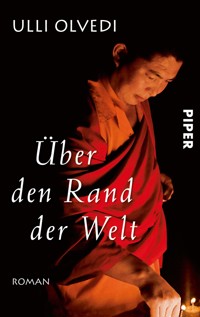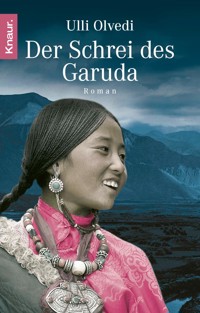9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Als kleines Kind verliert Dölma ihre Eltern bei der Flucht aus Tibet und wächst bei Adoptiveltern in der Schweiz auf. Sie ist ein stilles, braves Kind, heiratet einen Mann mit akademischer Karriere und bekommt eine Tochter. Dann stürzt ihr Leben ab in Depression. Nur ihre Sehnsucht nach der Heimat hält sie aufrecht, und als die Tochter Pema-Marie achtzehn Jahre alt ist, verlässt Dölma die Familie Richtung Tibet und kehrt nie zurück. Von den äußeren und inneren Dramen ihrer Reise erzählen ihre Tagebücher, die sie in Kathmandu zurückgelassen hat. Die Freundschaft mit einer Nonne hatte sie in ein Kloster nach Zanskar geführt, eine abgelegene und extrem hohe Region im westlichen Himalaya. Zehn Jahre später gelangen diese Tagebücher in die Hände ihrer Tochter. Pema-Marie, eine moderne Naturwissenschaftlerin und fern allem Tibetischen, fliegt mit ihrem Mann nach Kathmandu, um die Echtheit der Tagebücher zu prüfen. Das Vermächtnis der Mutter, ein Bericht über eine große innere Befreiung, wird ihrem eigenen Leben eine neue innere Ausrichtung geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ulli Olvedi
Zanskar und ein Leben mehr
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die verborgene Welt des Himalaya und die Suche einer Frau nach ihren Wurzeln
Das Leben der 28-jährigen Pema-Marie wird auf den Kopf gestellt, als Briefe ihrer verschollenen Mutter aus Tibet auftauchen. Sie reist nach Kathmandu und begibt sich auf die Spuren ihrer Mutter Dölma. In den Tagebüchern offenbart Dölma, wie sie auf der Suche nach ihren Wurzeln nach Zanskar gereist ist, um zu sich selbst zu finden und lange Zeit in einem Kloster verbringt. Pema-Marie taucht ein in eine völlig neue Welt, die eine ungeahnte Wende in ihrem Leben bedeutet. Mit großem schriftstellerischem Talent entführt Olvedi ihre Leser*innen in die spirituelle Atmosphäre des Klosterlebens im Himalaya und bietet tiefe Einblicke in die Geisteswelt des Buddhismus.
Inhaltsübersicht
PEMA-MARIE
Dölmas Tagebuch
Erstes Heft
Zweites Heft
Drittes Heft
PEMA-MARIE
Dölmas Tagebuch
Fortsetzung drittes Heft
PEMA-MARIE
Dölmas Tagebuch
Viertes Heft
Fünftes Heft
PEMA-MARIE
Dölmas Tagebuch
Sechstes Heft
Siebtes Heft
PEMA-MARIE
Dölmas Tagebuch
Achtes Heft
PEMA-MARIE
PEMA-MARIE
Wie lange saß sie schon in ihrer Sofaecke? Das Zimmer verschwamm in den sanften Schatten des winterlichen Nachmittags. Stillstehende Zeit, verwirbelt von dicken, nassen Schneeflocken. Eingefroren in Erschrecken oder Wut oder Trauer saß sie da. Es mochte all dies sein und noch mehr. Selbst das leise Klirren des Schlüssels brachte die Zeit nicht zurück, und all die vertrauten Geräusche setzten sich nicht zur gewohnten gelangweilten Geborgenheit zusammen. Das Stampfen auf dem Schuhabstreifer, das Klicken, als die Wohnungstür ins Schloss fiel, mit der Schulter zugedrückt, denn René machte das immer so, gegen die Tür gelehnt, während er die Tasche abstellte und den ersten Schuh auszog. Mit einem Plopp fiel der zweite Schuh, dann raschelte der Daunenmantel. Doch sie hatten keinen Zusammenhalt, diese Geräusche. Nichts hatte mehr Zusammenhalt. Sie hing an einem Ast und fühlte, wie er brach, langsam.
»Pema«, rief René, »bist du da?«
Sie hätte sich finden müssen, um zu antworten. Doch es war fraglich, ob sie sich finden wollte.
»Pema-Marie!«
Plötzliche Helligkeit folgte dem Klicken des Lichtschalters.
Sie hatte René vergessen. Sie hatte ihr Leben vergessen, ihr ordentliches, gefrorenes Leben.
Was hätte Mama über René gedacht? Über diesen Mann mit dem vollen, mattbraunen Haar und den festen Zügen, die grauen Augen am äußeren Ende ein wenig herabgezogen, was seinem Blick einen Anflug von Erstaunen gab. Vielleicht ist er deshalb mein Mann geworden, wegen des untergründigen Erstaunens, dachte Pema-Marie in diesem unbewachten Augenblick, doch schon war er vorbei, und René war einfach nur ein gewohnter René, der von irgendeiner Recherche nach Hause kam. Pema-Marie versuchte, mit flachen Atemzügen eine Welle von Abneigung abzuwehren.
»Mistwetter«, sagte René. »Was ist los, warum sitzt du so im Dunkeln?«
»Nicht im Dunkeln«, sagte Pema-Marie, »Dämmerung. Es ist Dämmerung.«
Sie ärgerte sich über die Störung, hätte noch länger in der Versteinerung sitzen wollen. Vielleicht wäre der Ast gebrochen, und sie wäre gefallen. Wohin?
René setzte sich in den Sessel, in dem er immer saß, und schaute erwartungsvoll auf ihre Hände mit dem Brief.
»Aus Kathmandu«, sagte Pema-Marie und hob die Blätter ein wenig von dem Kissen auf ihrem Schoß. »Sie haben Tagebücher meiner Mutter gefunden. Wahrscheinlich. Hier, die Kopie einer Seite. Mamas Handschrift, glaube ich wenigstens.«
Sie hätte damals Mamas Postkarten aufheben sollen. Augen der Stupa, Affen mit Coladosen, Tauben auf steinernen Hinduschreinen. Lapidare Sätze ohne Inhalt, die Pema-Marie stets nur flüchtig überflog, um Mama zu bestrafen.
»Von einer Nina, Sekretärin eines tibetischen Klosters.« Sie reichte René den Brief. »Mein Name wird in den Tagebüchern genannt und auch Zollikon. So hat man mich ausfindig gemacht.«
Plötzlich setzte die Zeit wieder ein, heftig, wie ein scharfer Wind. Sie musste Papa verständigen, sie mussten die Handschrift vergleichen. Man würde sich wieder auf die Suche machen müssen, die Tagebücher konnten Hinweise enthalten.
»Es sind wohl tatsächlich ihre Tagebücher«, sagte René und legte den Brief auf den Couchtisch. »Aber kein neueres Lebenszeichen von ihr.«
»Seit dem Fax vor zehn Jahren kam nichts mehr. Und da enden auch ihre Tagebücher. Was soll man denn erwarten? Ich jedenfalls habe nichts erwartet.«
René hatte eine Art, sie mit hochgezogenen Brauen anzusehen, die hilflosen Ärger in ihr auslöste. Er hatte kein Recht auf diesen Blick. Gewiss, sie hatte nie über ihre Mutter sprechen wollen. Fast nie. Dachte er, sie wäre ihm etwas schuldig? Man redete nicht über seine Eltern. Sie waren da oder nicht mehr da. Das genügte. Papa war da, Mama war nicht da. Eine der gut verschlossenen Geschichten, die in der Schublade der Geheimnisse ruhen, bis man sie nicht mehr weiß. Sie musste einfach nur irgendwohin schauen, in ein leeres Irgendwo, als habe sie mit der Sache nichts zu tun. Das half immer.
»Sie hat sehr selten geschrieben, einmal fast ein Jahr lang nicht«, sagte sie mit angestrengter Sachlichkeit. »Und nach dem letzten Brief haben wir über ein Jahr gewartet, bevor Papa anfing, nach ihr zu suchen. Und das tat er nur meinetwegen. Obwohl ich kaum jemals an sie dachte. Ich vermisste sie nie.«
Ohne es zu bemerken, hatte sie das Kissen schützend an ihre Brust gezogen. Sie legte es wieder auf die Knie und strich es glatt, immer wieder. Das Gefühl des brechenden Astes wollte wieder einsetzen, das spürte sie jenseits der unruhigen Gedanken, deshalb musste sie reden, dagegen anreden, denn René sollte nichts davon wissen. Niemand sollte je etwas davon wissen.
»Mama war so eine stille Person. Sie gab nie zurück, wenn man sie angriff. Und Tante Anna ging sie aus dem Weg. Du weißt, wie das ist, wenn Tante Anna knurrt wie ein Dobermann.«
René stand auf und hantierte in der Küche. Ihr fiel ein, dass sie versprochen hatte zu kochen. Sie kochte nicht gern.
Dreimal hatte sie den Brief gelesen. In Verdana 11 ausgedruckt, am Schluss in Handschrift »Liebe Grüße, Nina«, in einer vertrauten Art, als kennten sie einander. Was hatte diese fremde Frau aus den Tagebüchern erfahren? Pema-Marie schaltete die Nachttischlampe aus. Doch die Frage wurde im Dunkeln größer als zuvor: Was hatte Mama über ihre Tochter geschrieben? Über Pema-Maries böse Worte nach der Scheidung, als sei nur Mama daran schuld? Über die Szenen der Anklage und Zurückweisung, wenn Pema-Marie wütend auf Tante Anna war und die Wut an der wortlosen Mutter ausließ? Über die Kälte des Abschieds, als Pema-Marie an ihrem sechzehnten Geburtstag aus dem Haus ging und mit Papa die beiden Koffer und ihre kostbare Musikanlage ins Auto lud, um mit ihm zu seiner großen, lichten Wohnung zu fahren? Für immer, nicht nur für die Ferien oder Wochenenden. Triumphierend, obwohl es eher der Triumph über Tante Dobermann war.
Das Bild ließ sich nicht löschen in ihrem Kopf: Tante Anna hatte sich wütend ins Haus zurückgezogen, Mama war in der Haustür stehen geblieben und hatte sich am Türrahmen festgehalten, das Gesicht kantiger und hilfloser denn je. Du undankbares, erbarmungsloses Kind, hatte Tante Anna gesagt. Doch viel schlimmer war Mamas starrer, verzweifelter Blick gewesen.
War sie noch am Leben?
Pema-Marie erkannte, dass sie ihre Mutter nicht finden wollte. Was könnten sie einander zu sagen haben? Ihre Leben waren zu weit auseinandergedriftet.
Vielleicht hatte sie deshalb Papa nicht gleich angerufen, es auf morgen verschoben, als würde morgen vielleicht alles ganz anders sein.
»Ich hoffe, dass Sie die richtige Ansprechpartnerin sind«, schrieb Nina in ihrem Brief. »Aber da Pema-Marie ein seltener Name ist und die Verfasserin der Tagebücher Dölma hieß, hat man in der Botschaft schließlich Ihre Adresse herausgefunden. Es gab dort auch eine Dame, die sich an Ihren Vater und seine Suche nach Dölma erinnerte. Ihren Unterlagen nach ist das neun Jahre her.«
Damals war Papa nach Kathmandu geflogen. Er hatte nicht mehr herausgefunden, als sie schon wussten: dass es keinen Hinweis auf eine Ausreise gab und Mamas Visum längst abgelaufen war. Zwei weitere Anfragen in den Jahren darauf waren ergebnislos. Und dann verging die Zeit, legte sich über die Erinnerung, begrub sie unter einem jungen, angestrengten Leben. Es gab keinen Grund, an eine Mutter zu denken, die selbst damals, als sie noch hier lebte, nie wirklich da war.
Der eisige Wind beißt, wo er auf nackte Haut trifft. Die Luft knistert vor Kälte. Manchmal bricht die gefrorene Schneedecke durch, dann stoßen die Knie an harte Kanten. Doch es ist zu kalt für Schmerz.
Das Tal erstreckt sich weit vor ihr, schwer und starr ruhen die weißen Berge rundum, schlafende Wächter. Nirgendwo ein Lebewesen. Wäre doch nur irgendjemand da. Sie ist so müde, möchte sich fallen lassen, doch dann würde sich die Einsamkeit Lage um Lage über ihr auftürmen und sie erdrücken.
Dann erscheint ein Punkt, wächst unendlich langsam an zu einer Gestalt. Doch sie muss nicht warten, sie weiß es bereits, wirft die Arme hoch, ruft Mama, Mama!.
Die Gestalt geht an ihr vorbei, schaut durch sie hindurch. Sieht sie nicht, hört sie nicht, nimmt sie nicht wahr und ist doch ihre Mutter. Mamaaaaa! Aaaaaaaaaaaa!
»Pema! Was ist? Was ist mit dir?«
René war da und schüttelte sie. Es war kalt, und sie fürchtete sich vor der Einsamkeit. René war wenigstens irgendjemand, und das war gut so, erlösend.
Sie lehnte sich gegen ihn, die Arme um sich selbst geschlungen. Er sollte nicht Pema sagen, das war so tibetisch, sie brauchte die Marie in sich. Warum verstand er das nicht?
»Ein Albtraum? Du hast geschrien.«
»Ja«, sagte sie, »ich weiß.« Sie hatte es gehört. Urlaut des Lebens, doch das würde er nicht verstehen.
Er zog die Bettdecke um sie herum, hielt sie, und sie fühlte sich plötzlich weich, fast flüssig, denn die Einsamkeit drohte nicht mehr. Nicht jetzt. Doch bald, das wusste sie ohne Gedanken, würde sie sich wieder um sie geschlossen haben, nahtlos, unberührbar. Doch nicht jetzt, noch nicht.
»Mama«, sagte sie, »Mama hat mich nicht gesehen, und es war so kalt.«
»Alles ist gut«, sagte René und wiegte sie. »Du träumst nicht mehr. Erzähl mir den Traum.«
Er zog das Kopfkissen heran, um ihren Rücken zu stützen, hüllte sie ein mit seinem Geruch, der sie einst berauscht hatte, als sie ihn kennenlernte. Mit geschlossenen Augen sprach sie gegen seine weiche Pyjamajacke von der Einsamkeit und dem Warten in einer Welt der Kälte. Worte ohne Zensur, leise und atemlos.
»Es war so unerträglich, dass sie einfach an mir vorbeiging. Als hätte sie mich so vollkommen aufgegeben, dass es mich gar nicht mehr gab.«
René strich beruhigend über ihren Kopf. »Soll ich bei dir bleiben?«
In einem blitzhellen Augenblick war sie wach. Rollte die Zehen ein in Abwehr. Schnell sagte sie: »Nein, nein, das ist nicht nötig.«
Er ließ sie los und stand auf, die Bettdecke glitt von ihren Schultern, von einer Sekunde zur nächsten stürzte sie aus der brüchigen Geborgenheit auf sich selbst zurück.
»Mich gibt es noch«, sagte er. Fast war es ein Flüstern. Er schloss die Tür ihres Zimmers, ganz vorsichtig, als ginge es darum, sie nicht zu stören.
Pema-Marie saß in der Sofaecke, während ihr Vater den Brief las. Das Bedürfnis nach dem Kissen vor der Brust machte ihre Hände unruhig. Papa pflegte das Kissen in ihren Armen mit dem unnachahmlich beiläufigen Blick zu streifen, der sie klein machte. Heute war sie schon klein genug. Sie zog die Jacke vor sich zusammen, wusste einen Augenblick lang, dass die feine Kaschmirwolle darunter litt, und vergaß es sogleich wieder.
»Es ist eindeutig ihre Handschrift«, sagte er, während er die Kopie und den letzten Brief, den Mama gefaxt hatte, nebeneinanderhielt. »Kein Zweifel.« Sie wolle noch in Nepal bleiben, hatte sie geschrieben, in den Bergen, um als eine andere Dölma heimkehren zu können.
»Warum hast du das Fax aufgehoben?«, fragte Pema-Marie.
»Keine Ahnung«, antwortete er. »Ich fand es bei dem Briefwechsel mit der Botschaft.«
Er las Ninas Brief ein zweites Mal. Das Feuer im offenen Kamin brannte mit leisem Knistern. René nippte schweigend an seinem Weinglas. Sie sind einander irgendwie ähnlich, dachte Pema-Marie. Große Köpfe, breite Schultern, Papa, der Ungeduldigere, René, der bessere Stratege. Einigermaßen sozialisierte Platzhirsche. Sie erwartete nicht, sich mit ihnen wohlzufühlen, weder mit dem einen noch mit dem anderen.
»Ich werde dieser Nina schreiben, dass sie mir die Tagebücher schicken soll«, sagte Papa.
René stellte sein Weinglas auf den Couchtisch, langsam, mit Nachdruck. »Darum wird sich Pema-Marie kümmern.«
Dies, wusste Pema-Marie, würde ihr Vater keinesfalls hinnehmen. Und René wusste es auch.
»Hans-Peter, es geht in erster Linie um Pema-Maries Mutter«, sagte René mit leicht erhobener Stimme. »Und ich glaube, das ist eine Baustelle in Pema-Marie, die du respektieren solltest.«
Pema-Marie tastete unwillkürlich nach ihrem Kissen und zog es nah neben sich. Es würde Streit geben. Florett, nicht Schwert. Sie wahrten beide die Form, ihre Männer, doch sie waren allzeit bereit, gegeneinander anzutreten. René begleitete sie selten, wenn sie ihren Vater besuchte, den er nur den »Professor« zu nennen pflegte. Fremdes Territorium, hatte Pema-Marie zu Beginn ihrer Ehe verständnisvoll gedacht. Später sah sie eher Feigheit darin.
Sie beobachtete die Vorbereitung des Rituals. Ihr Vater streckte die Beine aus und legte die Fingerspitzen aneinander, scheinbar gelassen, doch die Finger konnten die Spannung nicht verbergen.
»Warum hältst du dann nicht den Mund und überlässt ihr das Reden?«, sagte er.
Pema-Marie ergriff die Weinflasche und füllte die Gläser nach, bevor René antworten konnte. »Okay, kein Streit, heute nicht. Ich rede. Es geht um meine Mutter, ich bin erwachsen, und ich kümmere mich um die Sache. Ich mache das!«
Papa würde das letzte Wort haben wollen, anderes war nicht zu erwarten. Doch sie hatte ihre Position deutlich gemacht. Er selbst hatte ihr dies schon früh beigebracht: Du musst deine Position deutlich machen, Mädchen, und dann hältst du daran fest und lässt dich nicht beirren. Doch es war immer sein Spiel, und die Regeln legte er fest.
»Wenn ich es recht bedenke«, sagte er, »kann man das Tagebuch auf keinen Fall der Post in Nepal anvertrauen. Nepal! Maoisten! Man muss sich das Chaos einmal vorstellen! Am besten fliege ich hin, ich kenne mich dort aus, dann lässt sich vielleicht doch noch einiges klären.«
Renés und Pema-Maries Widerspruch löste nur ein ungeduldiges Wedeln seiner Hände aus. Er argumentierte, beschwor seine frühere Reise nach Nepal herauf, seine Suche in Kathmandu, eine Woche lang endlose Telefonate, Warten in der Botschaft, Warten im tibetischen Flüchtlingszentrum, Warten in nepalesischen Behörden, Suche nach Übersetzern, Gespräche mit unzähligen Leuten. Und wie viele gute persönliche Kontakte er dadurch gewonnen hatte, auf die er würde zurückgreifen können.
»Nein! Ich fliege!«, erklärte Pema-Marie, ergriff entschlossen ihr Kissen, drückte es gegen die Brust und lehnte sich in die Sofaecke zurück. Genug Position geklärt. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie wirklich in dieses hoffnungslos arme Land mit seiner absurden Regierung fliegen wollte, um nach einer Mutter zu suchen, nach der sie nicht verlangte und die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr lebte. Dennoch wuchs in ihr die Überzeugung, dass es ihre Aufgabe war. Es war unübersehbar, dass sie sich stellen musste. Die Traumbilder lauerten am Rand ihrer Gedanken, während Papa und René darüber stritten, wer fliegen sollte oder ob überhaupt jemand fliegen sollte und wie gefährlich Nepal gegenwärtig sei.
»Ich fliege«, sagte sie noch einmal und stand auf. »Diesmal gibt es für dich keine Veranlassung, Papa. Ich habe einen Brief bekommen, dass die Tagebücher meiner Mutter aufgetaucht sind, und damit gehören sie mir, und ich kümmere mich darum. Und jetzt geh ich schlafen.«
Ihr Vater stand ebenfalls auf, legte den Arm um ihre Schultern und drückte sie an sich. »Darüber reden wir noch, Kleines.« Dann wünschte er ihr eine gute Nacht, bevor sie einwenden konnte, dass sie doch ihre Position klargemacht habe. Sie warf René einen Blick zu, der belustigt den Mund verzog.
Eine lange Umarmung für ihren Vater, weil sie ihn liebte und weil sie ihn verriet. Dabei der Gedanke: Sag, was du willst, und ich tu, was ich will. Und ein zweiter Gedanke: Ich lasse dir immer das letzte Wort, und du hast den Trick bis heute nicht durchschaut. Sie winkte ihm vom Balkon aus nach, mit zappelnden Fingern, wie sie es seit der Kindheit tat, sah ihn ins Taxi einsteigen mit den steifen Bewegungen eines Mannes an der Schwelle zum Alter. Eine Mischung von Schuldgefühl und Dankbarkeit überkam sie, dass er immer im Flughafenhotel übernachtete, wenn er sie besuchte. Um bequem einen frühen Flieger zu bekommen, wie er sagte.
René stand am Herd und löffelte einen Rest Gulasch aus der Kasserolle. »Weißt du, was mir gerade einfällt? Der Professor ist so wild darauf, die Tagebücher als Erster in die Hände zu bekommen, dass ich mich frage, ob er sich vielleicht vor etwas fürchtet, das seine Ex-Frau über ihn geschrieben haben könnte.«
Ein Kleinkind schrie in den vorderen Reihen der Economyclass, wo die Familien platziert waren. Sie hatte sich vergebens gewehrt, als er erklärte, dass er mit nach Kathmandu fliegen werde. Einmal hatte sie etwas allein unternehmen wollen, nur sie, Pema-Marie, nicht die Ehefrau von René. Nicht wir, nur ich. Lediglich drei ungebundene Jahre hatte sie während des Studiums verbracht, zehn Prozent ihres Lebens, zu wenig. René war gern zu zweit, hatte er ihr zu Beginn ihrer Ehe gestanden, das Alleinsein mache ihn verrückt. Sogar lesen wollte er in ihrem Beisein, sie in der Sofaecke, er in seinem Sessel. Mein Gott, hatte sie gesagt, wie alte Leute.
So saß er nun neben ihr und schlief, wie er in jeder Situation und Haltung schlafen konnte, zu ihrem heimlichen Ärger. Denn sie mochte es nicht, dass er das Leben ausblendete, dem sie allzu sehr ausgesetzt war, schlechte Schläferin mit schlechten Nerven. Sie sei eine hysterische Person, hatte er einmal gesagt, und sie hatte ihm gedroht, ihn zu verlassen, falls er das noch einmal sage. Hatte so leise und böse gedroht, dass er es ernst nahm.
Das Kleinkind brüllte völlig außer sich. Pure Verzweiflung, dachte Pema-Marie. Sie spürte die wütende Ausweglosigkeit in der sich überschlagenden Kinderstimme. Kein Ausweg aus sich selbst. Ein Kind durfte das fühlen. Sie nicht.
Unruhe in den Reihen. Passagiere standen auf und stellten sich in die Flure, lehnten sich über die glücklicher Platzierten auf der linken Seite. Sie schreckte auf aus ihrer Lektüre, einer elegant gewobenen Geschichte von den Windungen und Verdrehungen einer schwierigen Liebe, in manchem eine Spiegelung ihrer eigenen Verwirrung.
Die weißen Riesen! In gleicher Höhe mit dem Flugzeug ragten die urgewaltigen Berge des Himalaya auf, wuchtig, erschreckend, herzzerreißend schön. Pema-Marie tupfte eine Träne aus den Wimpern. Warum brachten diese Berge sie zum Weinen? War es einfach die Schönheit, die reine, unvergleichliche Schönheit, die sie traurig und glücklich zugleich machte?
Sie warf einen Blick auf René. Er schlief noch immer. »René, wach auf! Der Himalaya!« In diesem Augenblick empfand sie eine fast vergessene Freude, dass René bei ihr war.
Als das Flugzeug sich auf die Stadt herabsenkte, in das graubraune Gewirr hässlicher, billiger Bauten, und vor dem gesichtslosen Flughafengebäude ausrollte, stellte sich das Bild der strahlenden Berge schützend vor diesen Anblick.
»Maschinengewehre!«, sagte Pema-Marie. »Mein Gott, wo sind wir hier gelandet?«
»In der Vorhölle«, antwortete Nina heiter vom Vordersitz des Taxis. »Diese nepalesischen Möchtegern-Maoisten sind paranoid. Das ist leider so.« Ihre Stimme war hell und fest, mit einem leichten, flauschigen Wiener Akzent.
Groß gewachsen, lange, flatternde blonde Haare, himmelblaue Augen in einem geordneten, ungeschminkten Gesicht, enge Jeans, wehendes indisches Hemd, Pema-Marie hatte sich die Klostersekretärin anders vorgestellt. Beim Näherkommen schien sie nicht mehr so jung wie auf den ersten Blick. Sie hatte Pema-Marie und René mit freundschaftlichem Du begrüßt und sie mit sich gezogen durch die dichte, wogende Menschenschicht vor dem Flughafengebäude, hinaus zum Parkplatz, auf dem ein Geländewagen auf sie wartete. Der dunkle Fahrer lud ihre Koffer auf, scheuchte ungebetene Träger weg und schob seine Gäste eilig in die künstliche Kälte des Autos.
»Zu Hause schneit es«, sagte Pema-Marie und strich die schweißnassen Haare aus dem Gesicht. Bluse und Jacke klebten an ihr. Im Internet stand etwas vom schönen Frühling im Kathmandu-Tal. Was verstand man hier unter Frühling?
Sie mochte Nina. Schnell, schnörkellos und dabei entspannt und souverän. Pema-Marie wünschte sich, so zu sein, entspannt und souverän. Sie war weder das eine noch das andere. Weichtier in Perlmuttschale, hatte René sie genannt, als sie verliebt waren. Harte Nuss, nannte er sie später.
Der Weg bis zum Hotel auf der anderen Seite der Stadt war weit, führte, eingekeilt in lauten Verkehr, über eine Ringstraße und durch die armselige, staubige Hässlichkeit des Stadtrands. Nina lockerte die Fahrt auf durch den Bericht, dass die Tagebücher in ihre Hände gelangt seien, weil die Tibeterin, die sie gefunden hatte, eine Verbindung zu ihrem Kloster habe und niemand dort Deutsch verstehe außer ihr. Die Hefte seien im Haus dieser Tibeterin auf einem hohen Schrank gelegen und nur durch Zufall entdeckt worden.
Der lange Weg lohne sich, erklärte Nina, als sie endlich durch enge Straßen in eine Einfahrt einbogen. »Ein Hotel für Individualisten, es wird euch gefallen.«
Es war ein schönes altes Gebäude aus dunklem Holz mit reichen Schnitzereien, und dahinter erstreckte sich ein Garten mit blühenden Büschen und nostalgischen Gartenmöbeln in kleinen Terrassen am Hang über dem Fluss.
»Zwei Zimmer?«, vergewisserte sich der Junge am Empfang. Sein wacher Blick schoss zwischen den beiden Gästen hin und her.
In einem weichen Sessel in der Lobby streckte Pema-Marie ihre Beine aus und schloss die Augen. Sie wollte ankommen, doch ihre Nerven flatterten wie aufgeregte Vögel.
Nina hatte den Stapel Tagebücher aus ihrer Tasche auf den Tisch gepackt, sieben Ringhefte in verschiedenen Farben. »Ich bin überzeugt, dass deine Mutter das geschrieben hat«, sagte sie. »Sie erwähnt oft ihre Tochter Pema-Marie, und auch dein Alter stimmt. Pema-Marie ist ein sehr unüblicher Name.«
»Es war die Idee meiner Großmutter«, erwiderte Pema-Marie. »Sie fand, er klinge so schön nach Ost-West-Verbindung.«
Pema-Marie ließ ihren Blick wandern. Eine Touristin in Trekkerkleidung hatte sich in einem nahen Sessel niedergelassen. Ein rundes Gesicht mit Sommersprossen, runde Hände mit runden Fingern, eine breite, eifrige Stirn, die Ausstrahlung unerschütterlicher Sachlichkeit. Eine praktische Person, hätte Oma Madeleine sie genannt. Das war Oma Madeleines Art, ihrem Hochmut einen dezenten Ausdruck zu geben.
»Meine Großmutter hat eine Neigung zu großen Ideen«, hörte sie sich sagen. Sie lächelte ein wenig im Gedanken an Oma Madeleine mit ihren Jerseykleidern und den Ringen an den alten Händen, bestimmte Ringe für bestimmte Tage. Hoffentlich bekomme ich nie die Gicht wie Martin, pflegte sie zu sagen, ich wüsste nicht, was ich ohne Ringe machen würde.
Nachdem Nina sich mit einer kleinen Umarmung verabschiedet hatte, griff René nach dem obersten der Hefte und begann zu lesen. »Sie hat eine gute Schrift, deine Mama, liest sich leicht.«
Mit einem schnellen Griff nahm Pema-Marie ihm das Heft aus der Hand. »So nicht!«
Renés Blick war eher verletzt als ärgerlich. »Was ist denn los? Hast du das Erstleserecht? Sei doch nicht absurd.«
Der Ast am Brechen. Sie sah sich selbst, starr aufgerichtet, das Tagebuch umklammert, die Knöchel weiß. Sie konnte nicht denken. Ihr Blick sickerte in den blauen, abgegriffenen Umschlag des Heftes hinein. Auf das Schild in der Mitte hatte Mama eine große Eins geschrieben, nur eine Eins, kunstvoll mit Schattenwurf. Als habe sie an dieser Eins herumgezeichnet und nicht gewusst, wie sie mit dem Schreiben beginnen sollte.
»Ein Vorschlag«, lenkte René ein. »Wir lesen zusammen. Du kannst vorlesen, wenn du willst, oder wir wechseln uns ab.«
Pema-Marie presste die Lippen zusammen. Die Tagebücher gehörten ihr. Sie sollte diejenige sein, die sie zuerst las.
Hätte sie sich doch durchgesetzt und wäre allein geflogen. Es ging um sie und ihre Mutter. Deshalb war sie hier. René störte. Sie war irrational und ungerecht, dessen war sie sich bewusst, doch das Gefühl blieb. Sie wollte, er wäre nicht mitgekommen.
»Ich weiß nicht«, sagte sie und raffte entschlossen die Hefte zusammen. »Lass uns erst mal ankommen.«
Sie aß wenig, duckte sich unter der Missstimmung, die René mit oberflächlichen Bemerkungen zu entschärfen versuchte, floh in ihr hübsches kleines Zimmer mit Ausblick in den Garten, erschöpft, verwirrt und zutiefst unzufrieden mit sich selbst. Ich möchte nicht schwierig sein, dachte sie, aber ich bin schwierig. René ist auch schwierig. Warum stehe ich immer als die Schwierige da?
Sie wollte schlafen, ausschalten, nichts mehr wissen. Es war ihr zunächst so einfach erschienen – nur nach Kathmandu fliegen, die Tagebücher in Empfang nehmen und lesen, vielleicht noch ein bisschen mit den Leuten reden, die Mama zuletzt gesehen hatten. Dann heimkehren und die ganze Geschichte wegräumen, ein für alle Mal. Und dann würde es kaum anders sein als vorher, jedoch beendet, nur mit einem so kleinen Rest von Ungewissheit, dass er nicht störte.
Doch es war nicht so einfach. Weil sie mit René hier war. Weil es plötzlich auch um sie und René ging.
Um sich abzulenken, ergriff sie das erste Heft und begann zu lesen.
Dölmas Tagebuch
Erstes Heft
Wahrscheinlich träume ich. Oder bin ich wirklich da, wo ich zu sein glaube? Vor Tibets Haustür?
Es regnet, als wolle der Himmel sich ausschütten, bis zum letzten Tropfen. Eine Welt von Nässe, und wenn die Sonne sich darauf stürzt, dampft es wie die Hölle. Monsun, stand im Reiseführer, aber kein Wort von aufgeweichten Straßen mit knöcheltiefen Wasserlöchern, von schweißnassen Haaren und ständig feuchter Unterwäsche.
Ich bin ein phantasieloser Mensch. Das hat Hans-Peter immer gesagt. Warum denke ich jetzt an Hans-Peter? Nach sechs Jahren liegt sein Schatten noch immer auf mir. Doch den werde ich abschütteln, ich gehe in meine verzweifelte Heimat und schüttle Hans-Peter und Anna und das Haus in Zollikon und den ganzen Berg falschen Lebens ab.
Gestern war ich auf der weißen Stupa und schaute nach Norden zum Shivapuri, der die Schneeberge verdeckt. Dahinter Tibet. Ich musste weinen. Land meiner Eltern, meiner Verwandten, meiner Vorfahren. Es tut so weh, dass ich nichts von ihnen weiß. Vielleicht gibt es irgendwo eine Schwester, einen Bruder, Nichten, Neffen, Großeltern. Ich werde sie nie kennenlernen.
Nirgends gibt es einen großen Spiegel, in dem ich mich sehen könnte mit meinem neuen tibetischen Kleid, nicht einmal in dem kleinen Laden an der Stupa, wo sie mir morgens die Maße nahmen, und am Nachmittag lag das Kleid schon fertig bereit. Es ist sattblau – wie der Himmel über Tibet, sagte der Schneider, und die Seidenbluse glänzt silbern wie der Zürichsee am Morgen. Ich versuche, nicht an die giftigen Farbstoffe zu denken. Sie sind überall, nicht nur in den Kleidern. Das leere Spekulationsgrundstück hinter dem Gästehaus steht teilweise unter Wasser, Abwasser, die Oberfläche schillert bösartig, aber es scheint allen gleichgültig zu sein. Wundert mich das? Ich habe so lange inmitten von Gleichgültigkeit gegenüber allen seelischen Vergiftungen gelebt, und die sind wohl noch viel schlimmer.
Es ist schön, ein langes Kleid zu tragen. Als verwandle es den Körper. Ich nehme die Spange aus den Haaren und fühle mich wie Rapunzel oben im Turm. Doch unten ruft kein Prinz nach mir. Wird irgendwann in diesem Leben noch ein Prinz nach mir rufen? Vielleicht werde dann ich selbst die Hexe sein, die Rapunzel festhält.
Stromausfall. Glücklicherweise lag eine Kerze auf dem Tisch bereit, man ist das hier gewohnt. Die Kerze ist krumm, sie zischt und spuckt und tropft hysterisch. Selbst die Kerzen sind anders in diesem Land.
Die Karte an Pema-Marie, soll ich sie abschicken? Es ist eine hübsche Karte, die weiße Kuppel der Stupa mit den großen Augen und den unzähligen flatternden Gebetsfähnchen, alles golden überzogen vom Abendlicht. Aber nichts von dem steht darauf, was ich schreiben wollte. Nichts davon, dass ich mir Mühe gebe, sie zu lieben, und ihr so viel Gutes wünsche, ein besseres Leben als meines, oder davon, wie unglücklich ich immer war, weil ich keine gute Mutter sein konnte. Erst vor sehr kurzer Zeit, als ich mich entschlossen hatte, in meine verlorene Heimat zu reisen, begann dieses Gefühl des Unglücks, der Bordunton meines Lebens, aufzusteigen und Form anzunehmen. Es wird immer sichtbarer.
Schon drei Tage in Kathmandu, und noch zwei weitere muss ich aushalten. Irgendjemand hat gesagt, Kathmandu sei schön. Man soll nicht alles glauben.
Ich gehe nur ungern aus dem Gästehaus. Diese Fremdheit erschreckt mich zutiefst. So viele Menschen, Farben, Geräusche, Gerüche. Die Eindrücke rasen, kreisen mich ein, meine Nerven schreien, ich zittere, möchte umkehren, zurückrennen in den schützenden Garten hinter der Mauer. Doch ich zwinge mich, gehe zur Stupa, drehe die Gebetstrommeln bei jedem Schritt, lege kleine Scheine in die Hände der Bettler und schaue weg dabei. Ich kann sie nicht anschauen, denn manchmal schauen sie zurück, und das halte ich nicht aus.
Man kann gleich die Stufen hinaufgehen zum oberen oder zum obersten Rundgang, aber Puntsok, die Wirtin des Gästehauses, sagt, man müsse unten anfangen, um Verdienste zu erwerben, sonst gebe es kein gutes Karma. Also gehe ich erst unten herum, mein Karma muss dringend besser werden. Und es beruhigt ein bisschen, das Richtige zu tun. Erst untenrum, dann in der Mitte, dann oben, im Uhrzeigersinn, so muss es sein.
Das alles kann ich Pema-Marie nicht schreiben.
Aber für mich selbst schreiben muss ich, das ist mir klar geworden. Daheim ging das nicht, dort dachte ich, nur wenn ich gut schreibe, offiziell anerkennenswert schreibe, ist es sinnvoll. Ich schaute mir ständig über die Schulter, kritikbereit, vergleichend, zensierend, und fand nichts gut genug. Kaum hingeschrieben, verblassten die Farben der Worte.
Nie konnte ich etwas leisten. Nicht wirklich.
Jetzt schaut mir niemand mehr über die Schulter. Und es gefällt mir, bei Kerzenlicht zu schreiben. Ein kleiner, sanfter Lichtkreis, um ihn herum die Dunkelheit wie ein schützender Mantel. Warum kam ich früher nie auf die Idee, mit Kerzenschein zu leben?
Ich wundere mich, dass ich mich bis hierher gewagt habe. Es war wie rennen mit angehaltenem Atem und geschlossenen Augen, und vielleicht war es nur deshalb möglich, weil Pema-Marie so erwachsen wirkte an ihrem achtzehnten Geburtstag. Es spielte keine Rolle, ob ich blieb oder ging, also ging ich. Für sie war ich nie wirklich da. Aber wie sollte sie mich auch wahrnehmen, da ich mich selbst kaum wahrnehmen konnte? Wahrscheinlich hat es sie sogar erleichtert, als ich abreiste.
Ich ertappe mich dabei, dass ich ständig rückwärtsschaue. Als wäre ich nicht deshalb weggegangen, weil ich eine Zukunft haben wollte. Ich war schon kurz davor, sehr alt zu werden. Aber sollte man mit zweiundvierzig Jahren nicht noch weit vom Alter entfernt sein? Ich befehle mir: Nicht mehr zurückschauen! Es genügt, dass die Vergangenheit mich bis hierher, an dieses Ende, an diesen Anfang geschoben hat. Ich will ein neues Leben haben!
Puntsok, klein, robust, die flinken Augen eingebettet in ein Gesicht wie zerknülltes Papier, ist sehr nett zu mir. Sie könnte fünfzig sein oder siebzig.
Als eine Tibeterin aus dem Westen bin ich eine Besonderheit für sie, wahrscheinlich ein bisschen verwirrend mit meinen teuren Kleidern und meinem unzulänglichen Tibetisch. Sie lacht über meine konstruierte Art, ihre Sprache zu sprechen, über manche Worte, die ich benütze. Aber wie sollte ich es besser machen? Immer bin ich am Blättern und Nachschlagen, und die Zunge krümmt sich angestrengt um die Wörter. Manchmal lähmt mich dieser Zwang zur Kommunikation, ich habe keine Übung darin. Anstatt mit Leben bin ich mit Büchern angefüllt bis zum Rand. Ihr wart gute Eltern, Madeleine und Martin. Ihr habt mir Bildung mitgegeben, wie ihr es verstandet, ich danke es euch. Aber wie solltet ihr wissen, mit wem ihr es zu tun hattet? Ich weiß es ja bis heute selbst nicht.
Ich muss daran denken, wie wir das tibetische Kloster Rikon besuchten. Es muss in meinem siebzehnten Jahr gewesen sein, während meiner Internatszeit. Der Dalai Lama war dort zu Besuch auf seiner ersten Reise in den Westen. Es war Madeleines Idee, wie schön es doch für mich wäre, ihn zu sehen. Und all die vielen Tibeter, die kommen würden! Ein großes Ereignis, riesengroß. Unser Lebensrahmen war so klein, gelegentlich ein Konzert oder Theater. Madeleine und Martin mochten es beschaulich. Unsere alljährlichen Ferien bei Madeleines Schwester in Florida waren für die beiden genug weite Welt.
Da waren mehr Tibeter, als ich vertragen konnte. Und ich empfand sie als über alle Maßen fremd. Sie stießen und drängten, rissen mich weg von Martin und Madeleine. In Panik suchte ich eine Wand, eine Ecke, die mich schützen sollte, bis ich eine Tür sah, darauf zustürzte, sie öffnen wollte. Ein großer Mönch stieß mich zurück. Ich kann mich nicht erinnern, mich je zuvor so hilflos ausgeliefert gefühlt zu haben, so empört gewesen zu sein. Der wuterfüllte Schmerz gab mir die Kraft, mich durch die Menge nach draußen zu drängen, nass von Tränen und Angstschweiß. Ich wartete lang, bis Martin und Madeleine mich endlich fanden. Wir sahen nichts vom Dalai Lama. Ich sagte, er sei mir völlig gleichgültig. Nur nach Hause wollte ich. Madeleine war traurig und insgeheim verletzt, es hatte ein besonders schönes Geschenk für mich sein sollen. Heute denke ich, dass ich ihr irgendwann dafür hätte danken sollen. Ich bin sicher, dass sie es nicht vergessen hat. Meine Mutter Madeleine hat ein Gedächtnis wie ein Elefant.
Ich legte nie Wert darauf, mit den Exiltibetern in Kontakt zu kommen. Schließlich gehörte ich nicht zu ihnen, und sie hatten damals keinen besonders guten Ruf. Doch wo haben Asylanten schon einen guten Ruf.
Wenn ich nur aufhören könnte, mich zu erinnern.
Was ich unternehmen wolle an diesem Ruhetag, hat Puntsok mich heute Morgen gefragt, als ich zum Frühstück in den Garten hinausging. Die Sonne war schon am frühen Morgen grell, aber noch nicht heiß. Es sei Samstag, da sei alles geschlossen, Behörden, Büros, Geschäfte.
Ein Fremder kam ins Foyer und fügte lachend in einem englisch gefärbten Tibetisch hinzu: »Ja, alle haben geschlossen, auch Polizei, Feuerwehr, Notfalldienste und Krankenhäuser. Also bitte schön stillhalten, nicht wahr, Puntsok-la?«
Er legte die Hände zusammen und machte eine kleine Verbeugung vor mir: »Humphrey Tenzin Dorje, Madam.«
Ich legte ebenfalls die Hände zusammen und nannte meinen Namen. Ich mag diese Geste, sie hat so viel Würde. Hans-Peter sagte einmal, das westliche Händeschütteln komme aus kriegerischen Zeiten, weil man dabei keine Waffe in der Hand halten konnte und so seine friedlichen Absichten ausdrückte. Anjali hingegen, die Hände aneinandergelegt vor der Brust wie im Gebet, hat ganz andere Wurzeln und erzeugt eine andere Stimmung, Respekt, Würde und Würdigung des anderen. Man kann sogar nur eine Hand dazu nehmen, wenn man nicht beide Hände frei hat.
Humphrey Tenzin Dorje ist ein angenehmer Mann. Er setzte sich zu mir zum Frühstück, fragte vorher, ob es mir recht sei, und ich freute mich darüber, doch mehr als ein Lächeln brachte ich nicht zustande und war so wortarm wie immer. Humphrey spricht ein weitaus eleganteres Tibetisch als ich. Übersetzer sei er, ließ er mich wissen, und unterrichte an der buddhistischen Hochschule eines Klosters. Er übernahm höflich – vielleicht auch mitfühlend – das Reden, breitete einen Teppich von netten kleinen Anekdoten aus. Ich bin die Nähe eines achtsamen Mannes nicht gewohnt. Er gefiel mir, und unerwartet bewegte sich in tiefen, verborgenen Bereichen in mir etwas wie Abenteuerlust. Unglaublich, dass ich es bin, die das schreibt. Dölma und Abenteuerlust! Ich schaue mir zu, wie ich es erkenne, in konkrete Gedanken fasse, mich sogar überwinde, es niederzuschreiben. Mein gesamtes erwachsenes Leben lang bin ich eine traurige Einsiedlerin gewesen. Jetzt habe ich mir ein neues Leben versprochen. Das darf man doch, sich ein anderes Leben wünschen?
Vor wem verteidige ich mich?
Dann kam ein junger Mann an unseren Tisch. Noch bevor er seine Hand auf Humphreys Nacken legte, knisterte die Luft. Humphrey hatte auf ihn gewartet, hatte die Lücke mit mir gefüllt. Sein gutes Recht. Es hatte nichts mit mir zu tun. Ich befahl mir augenblicklich, nicht enttäuscht zu sein. Als er ging, lächelte er mich mit selbstverständlicher Wärme an, als wären wir Vertraute. Er gab mir seine Karte, ich solle mich melden nach meiner Rückkehr von Tibet. Wann immer er mir helfen könne. Unbedingt.
Vielleicht werde ich das tun. Warum nicht? Ich brauche Freunde.
Nach all den vielen Jahren Einsamkeit sollte ich mich an das Alleinsein gewöhnt haben. Aber vielleicht kann man sich gar nicht daran gewöhnen, vielleicht sitzt die Sehnsucht nach einem Du in allen Zellen. Würden sonst so viele Menschen mit den armseligsten Surrogaten vorliebnehmen? Ich dachte immer, ich müsse Hans-Peter und Anna und sogar Pema-Marie wegdenken, um überleben zu können. Es könnte aber auch sein, dass ich mich stattdessen insgeheim an sie angelehnt habe mit all meiner Abneigung. Wie hätte es mir sonst so wehtun können, dass Pema-Marie mich nach der Scheidung verließ?
Ich habe mich gestern gezwungen, aus dem Haus zu gehen. Puntsok schob mich hinaus, ließ ein Taxi für mich holen. Zur Swayambu-Stupa solle ich fahren, zum Affenberg, das sei ein sehr heiliger Ort und würde mir Glück bringen.
Der heilige Ort bestand aus mindestens hunderttausend Treppenstufen, die immer steiler wurden, Tempelgebäuden oben auf der Hügelspitze und darüber eine Stupa-Kuppel mit den allgegenwärtigen Buddha-Augen. Ich setzte mich in eine schattige Ecke und machte mich unsichtbar. Es ist leicht für mich, hier unsichtbar zu sein, vor allem in meinem tibetischen Kleid. Ich bin einfach eine Tibeterin wie so viele andere.
Lange schaute ich den Affenfamilien zu. Sie leerten die letzten Tropfen aus Coladosen, untersuchten weggeworfene Verpackungen von Keksen, warfen misstrauische Blicke um sich, wenn sie einen guten Fund gemacht hatten. Wie menschlich! Haben wollen, nicht haben wollen, ignorant bis in die Knochen, bedenkenlos wild auf Leben. Und so unglaublich es ist – ich konnte sie mögen.
Vielleicht war dies das Glück des heiligen Orts. Wie fühlt sich »heilig« an?
Eine junge Touristin ging an mir vorbei zum Lhakang, in dem Mönche sangen. Sie trug Jeans, ein indisches Hemd, Sandalen mit kleinen Absätzen, unlackierte Zehennägel, um den Hals eine Mala aus Lotossamen. Sie machte kleine, zögernde Schritte, hielt inne auf der obersten der drei Treppenstufen, die ins dämmerige Innere führten, der Blick leer vor Andacht. Ich hatte zynische Gedanken. Dummes Mädchen, spielst du Frömmigkeit? Suchst ein bisschen religiösen Rausch? Doch sie bekamen mir nicht gut, diese Gedanken, zogen mich weg vom heiligen Ort, leugneten das kleine Glück, die Affen zu mögen. Also versuchte ich, auch das Mädchen zu mögen, aber da hatte ich schon alles verdorben und stieg die vielen Stufen wieder hinunter.
Ich verstehe mich nicht.
Wie kurz die Dämmerung hier ist! Und dann wird der Abend so lang. Unten im kleinen Restaurant – ein überdachtes Podest mit Binsenmatten an der Wetterseite – sitzen ein paar Touristen. Ich könnte hinuntergehen, aber dort bin ich doppelt eine Fremde. Man würde vielleicht Erklärungen erwarten. Oder mich übersehen.
Und ich sollte über die seltsame Heimfahrt nachdenken, obwohl es nichts zum Nachdenken gibt. Man braucht Logik zum Denken, und diese Situation hat keine Logik.
Am Fuß des Swayambu-Hügels fand ich ein Taxi. Die Hindu-Fahrer verlangen keine Touristenpreise von mir, weil ich ja einheimisch aussehe. Ich könnte Punjabi-Tracht tragen, die hübschen, schmalen, geschlitzten Kleider mit Hosen darunter, oder auch Jeans und T-Shirt, und würde doch nicht als Fremde betrachtet werden mit meiner braunen Haut und dem langen, schwarzen Zopf.
Es war nichts los am Taxistand, die Wolken zogen sich bereits zusammen, der Regen würde nicht lang auf sich warten lassen. Kaum war ich eingestiegen und hatte die Tür geschlossen, da wurde sie wieder aufgerissen, und ein Mann im roten Klostergewand drückte sich neben mich, ungeniert nah, bevor ich zur anderen Seite ausweichen konnte. Ein ziemlich alter Mann mit einem tief gefurchten Gesicht und grauen Bartfäden am Kinn, die langen Haare auf dem Kopf zu einem Knötchen gerollt. Ein vielfältiger Geruch hüllte ihn ein – Sandelholzrauch, Kräuter, Knoblauch, Haaröl.
»Hey!«, sagte ich. »What the hell …?« Ich habe schnell gelernt, Englisch zu verwenden, wenn ich als Fremde erkannt werden will.
Der Mann tippte dem Taxifahrer auf die Schulter und brummte etwas Unverständliches. Ich wollte protestieren, doch plötzlich hing das alte Gesicht mit all seinen Schluchten vor mir, und meine Gedanken stürzten völlig haltlos zusammen. Wie in Träumen, die nur deshalb zutiefst überzeugend sind, weil man ihnen nicht entrinnen kann.
»Wach auf!«, tönte es aus dem Gesicht. »Du hast nicht ewig Zeit, Kunsang Lhamo. Hörst du? Du hast nicht unbeschränkt Zeit!« Mit einem tiefen, hallenden Grollen, als käme ein Gewitter.
Und schon war er wieder ausgestiegen. Doch fühlte ich ihn noch immer neben mir, während das Taxi losfuhr, roch ihn sogar, hörte noch den Nachhall der Stimme, der meinen Kopf ausfüllte. Ich fand keine Gedanken, um darüber nachzudenken, und selbst jetzt noch fällt mir wenig dazu ein. Habe ich ihn richtig verstanden? Vielleicht habe ich nur geträumt. Oder war es eine Verwechslung? Wer ist Kunsang Lhamo?
Ich nehme die Szene auseinander, schaue mir zu, wie ich sie sortiere, hierhin Realität, dorthin Traum, doch das geht nicht, der Alte war dazwischen, berührte beides und war eine Wirklichkeit, die sich bereits auflösen will, weil ich keine Schublade dafür habe. Es gab ein Taxi, es gab ein Gewitter, wir fuhren durch prasselnden Regen, so viel ist sicher. Jemand stieg ein und wieder aus, auch daran besteht kein Zweifel, und er nannte mich Kunsang Lhamo. Habe ich ihn richtig verstanden? Was meinte er? Zeit wozu? Für mein Leben? Das Flugzeug nach Lhasa kann vom Himmel fallen, alles Mögliche kann geschehen, man lebt nicht ewig, aber ich mag nicht an den Tod denken, nicht gerade jetzt, wo ich anfangen will zu leben.
Zweites Heft
War ich tatsächlich heute Morgen noch in Kathmandu?
Ich bin müde, aber ich muss schreiben, sonst verliere ich mich in all dem, das ich aufsauge wie besessen. Endlich bin ich da, wo ich herkomme! Ich gehe durch die Gassen der Altstadt, möchte alle umarmen, sie, die »mein Volk« sind, echte Tibet-Tibeter, wie meine Mutter, mein Vater, von denen ich nichts weiß.
Und es ist entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich. So viele Chinesen in Uniform, schwer bewaffnet, harte Männer mit stereotypen Gesichtern voll kalter, gedankenloser Gewalt. Überall chinesische Schrift, an den Geschäften, auf Plakaten. Und all die gesichtslosen neuen Häuser. Das ganze breite Tal des Kichu angefüllt mit unendlich hässlichen Bauten. Wenigstens sieht das Hotel am Rand der Altstadt, das ich gebucht habe, ein bisschen tibetisch aus. Vom Fenster aus sieht man in der Ferne den Potala mit seinen goldenen Dächern. Wie eine Fata Morgana.
Die Angst, sie ist überall, hockt in den neuen breiten Straßen und den alten engen Gassen, in den Augen »meiner Leute«. Aber nicht vor dem Jokhang, wo die Pilger und die Einheimischen sich niederwerfen, um den Jowo-Buddha im Inneren zu grüßen. Nur einmal am Tag, erfuhr ich im Hotel, dürfen sie eine Stunde lang hinein. Vor dem verschlossenen Tor mit dem riesigen Vorhang davor gesellte ich mich zu ihnen, passte dazu in meinem blauen Kleid, kniete nieder auf meinem weichen Pashminaschal aus Kathmandu, streckte mich aus in der Geste vollkommener Unterwerfung oder vielleicht auch vollkommener Umarmung. Seltsam, diese Berührung des harten Körpers der Erde mit Schenkeln, Bauch, Brüsten und Stirn. Die Natursteinplatten waren warm von der Sonne. Zuerst genierte ich mich, zögerte, aber bald wurde ich mutiger, passte mich dem Rhythmus einer Frau neben mir an. Ich warf mich gegen die Angst, gegen die Unterdrückung, gegen das Unglück meines Lebens und gegen meine Dunkelheit, warf mich der Erde an die Brust, bis ich völlig erschöpft war.
Die Frau lächelte und bot mir buttrigen, salzigen Tee aus ihrer Thermoskanne an. Ihre Hände waren uralt.
Im Flugzeug hatte ein freundliches Paar neben mir gesessen, Niederländer, Geert und Bea. Zum zweiten Mal sind sie in Lhasa, sie wollen mich demnächst mitnehmen nach Samyé, zum ersten Kloster in der Geschichte Tibets, dort waren sie noch nicht. Vier Stunden Fahrt im Bus, das sei gut für mich, dann könne ich ein wenig von Tibet sehen. Es sei nicht einfach, hier zu reisen, sagte Geert, am besten nur so, wie das Touristbüro es vorgesehen hat. Immer gut achtgeben, was man sage, die Aufpasser könnten auch kollaborierende Tibeter sein. Nicht alle Tibeter seien arme Opfer, und ich habe hoffentlich keine Fotos vom Dalai Lama dabei. Sie finden mich interessant, die tibetische Europäerin, die sich tibetisch verkleidet, und ich habe Schutzinstinkte in ihnen geweckt. Vielleicht denken sie auch heimlich, dass sie dann zu Hause etwas Besseres zu erzählen haben als das Übliche.
In der Altstadt kam ich an einem kleinen Restaurant vorbei, darin sang ein Mann, und alle lachten. Das meiste verstand ich nicht, wahrscheinlich war es ein freches Lied; ich habe gelesen, dass meine Landsleute sich gern mit Anzüglichkeiten vergnügen. Es tat gut, sie lachen zu hören trotz all des Schreckens. Menschen gewöhnen sich an alles, pflegte Hans-Peters Großmutter zu sagen, die im Krieg vor den Nazis in die Schweiz geflohen war.
Vor drei Tagen kam ich hier an, also muss es heute wohl Freitag sein. Nur eine Stunde Flug in die andere Dimension. Und so nah am Chomolungma vorbei, der Mutter des Universums, Göttersitz auf Augenhöhe. Flugzeuge sind etwas Wunderbares. Ich habe nie aufgehört, sie zu verehren, seit ich mit Madeleine und Martin zum ersten Mal über den großen Ozean geflogen bin. Zwölf Jahre war ich alt, das muss 68 gewesen sein. Sie hatten mir einen Jeansanzug gekauft. Damals fand ich mich schön.
Vorgestern lief ich benommen in Lhasa herum, unter dem beunruhigend niedrigen, tiefblauen Himmel, als wäre ich in ein Buch mit all den vertrauten Bildern gefallen – Barkhor, Ramoche-Tempel, die Altstadt kreuz und quer. Zum Jokhang kam ich zur richtigen Stunde, um mit den Tibetern eingelassen zu werden. Aber zum Potala wurde mir der Zugang verwehrt, dort war es die falsche Zeit. Nur Ausländer wurden eingelassen. Ich wollte in meinem Vater- und Mutterland nicht Ausländerin sein und ging wütend weg.
Gestern fuhr ich mit Geert und Bea nach Samyé, heute kamen wir zurück. Ich bin müde, irgendwie leer, stelle fest, dass ich nichts fühle. Die ganze Zeit warte ich darauf, etwas Besonderes zu fühlen. Was habe ich mir vorgestellt? Was ist »Heimat«?
Dies hier nicht!
Stattdessen bin ich in einem bizarren Film gelandet. Straßensperren mit bewaffneten Statisten, die sich aus einem Politkrimi an den falschen Drehort verirrt haben. Die starren Terminator-Gesichter der Uniformierten, träume ich sie? Eine Landschaft in unwirklichen Farben, über alle Maßen gewaltig. Schließlich eine riesige rekonstruierte Klosteranlage. Ich kenne sie aus der Vogelperspektive in einem Buch, doch nun erlebe ich sie in 3-D. Man kann durch die Gassen und in die Gebäude gehen, richtige Mönche laufen herum. Wo bin ich? Alles, was ich über Samyé gelesen habe, tobt durch meinen Kopf. Die tibetischen Dämonen, die vor tausend Jahren den Bau des Klosters boykottierten, dann die chinesischen Dämonen, die es in der Kulturrevolution zerstörten, und die zitternde, mutige buddhistische Identität eines Volkes, die damit verwoben ist.
Ich lief hinter Geert und Bea her, die sich von dem Touristengrüppchen und dem lästigen chinesischen Guide abgesetzt hatten. Bea schwitzte, ihre blonden Haare kräuselten sich und standen vom Kopf ab. Von hinten sah sie aus wie ein kleines Mädchen neben ihrem großen, breiten Geert. Das rührte mich. Ich muss mir eingestehen, dass dies das einzige interessante Gefühl während des Ausflugs war.
Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Was will ich hier?
Ich krame in meinen Erinnerungen an die jahrelange Sehnsucht. Heimat. Sucht des Sehnens. Tibetbilder an der Wand und all die vielen Bücher, ein halbes Leben lang so sehr eingesponnen in meinen »Heimat«-Kokon. Aber anstatt lebendiger Vorstellungen gab es nur Gedanken wie: Wäre ich doch dort und nicht hier! Dort könnte ich ich sein.
Jetzt bin ich »dort«.
Aber wer soll das sein – ich? Und reise mit Niederländern herum.
Geert erzählt mit entnervender Begeisterung von seinem und Beas tibetischem Lehrer zu Hause. In jedem zweiten Satz heißt es: »Rinpoche hat gesagt.« Bea wollte wissen, ob ich auch einen Rinpoche habe. Als ich es verneinte, fragte sie mit großen Augen: »Warum nicht?« Geert stieß sie mahnend an. Sieh an, es steckt unvermutet ein feinfühliger Mensch in diesem massiven Körper. Das wisse ich nicht, war meine Antwort.
Ich weiß es wirklich nicht.
Es gibt wahrscheinlich ziemlich viel, das ich von mir nicht weiß.