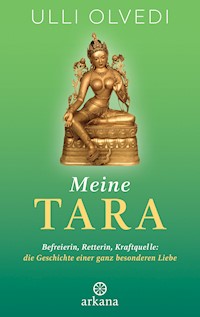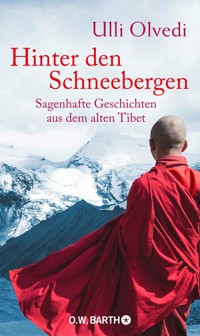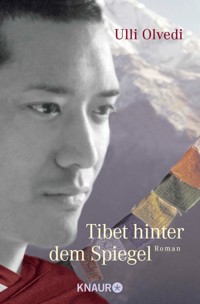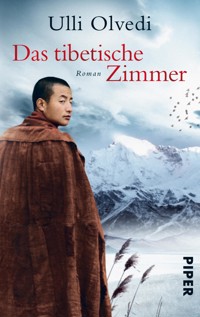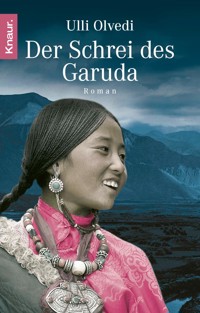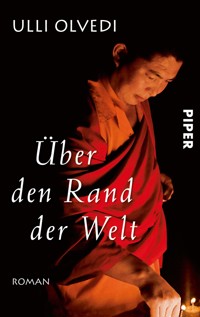
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nora ist über sechzig, als der Krebs sie wieder einholt. Voller Angst, aber fest entschlossen, dem Tod offen und mit wachem Geist zu begegnen, begibt sie sich auf die letzte große Reise ihres Lebens. Äußerlich nach Kathmandu – innerlich auf die Suche nach einem Weg, Leben und Tod miteinander zu versöhnen. Ein eindringlicher und spiritueller Roman über das Sterben, der uns vor die Frage stellt, welchen Sinn wir unserem Leben geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95575-1
© 2008 Piper Verlag GmbH, München, erschienen im Verlagsprogramm Pendo Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling Umschlagfoto: Michael Reinhold
Heiße alles willkommen, weise nichts zurück.
1.
Aus. Ende. Das Todesurteil. Die Bäume taumeln vorbei. Rasen, rasen an den Rand der Welt. Dann hinunterstürzen – wohin? Aus dem Außen ins Innen, dort geht es weiter. Keine Lösung.
Nora nimmt den Fuß vom Gaspedal.
Wie sehr die nette Ärztin mit den Übermüdungsschatten auf den Augenlidern sich doch Mühe gab, nicht beteiligt zu sein. Metastasen. Wollen Sie wirklich nicht? Sie sollten. Ich verstehe. Es tut mir leid. Wie lange? Kann man nicht wissen. Monate. Vielleicht. Kommen Sie, wenn etwas ist. Auf Wiedersehen.
Nein, nein, diesmal kein Wiedersehen.
Die Ärztin nickt. Verständnis im mitleidigen Blick. Sie kann den Tod zulassen. Es ist nicht ihre Niederlage. Sie sind sich einig. Wie Verschwörer.
Wird man mich in Ruhe sterben lassen? Manchmal gibt es das. Dass Menschen in Ruhe sterben.
Immer noch die schnurgerade Allee, Baum um Baum um Baum. Zeit und Raum, dicht gepackt. Die Straße eine Flucht nach vorn, wie das Leben – verengt sich schließlich zu einem Punkt. Aus.
Nichts ist so sicher wie der Tod. Das einzig wirklich Sichere. Todsicher.
Sie hört sich wimmern. Ein seltsamer, tierartiger Laut. Es gibt nichts zu artikulieren. Keine Argumente gegen den Tod.
Sie stellt das Auto ganz am Ende des Parkplatzes ab, nah am See. Keine Fußgänger auf dem Uferweg, die Wolken haben dicke Regenbäuche, da geht niemand spazieren. Die weite, milchiggraue Fläche des Sees breitet sich vor ihr aus: Dui, das Heitere. Der lächelnde See. Die Wolken von Westen her neigen sich zu ihm hinab, berühren ihn fast. Eine Mischung aus Intimität und Drohung.
Die Bewegung lockert den Druck auf der Brust. Jetzt möchte sie nur gehen, nicht denken. Einen Fuß vor den anderen setzen, rechts, links, atmen, ein, aus. Sich lebendig fühlen. Noch. Bis die Schmerzen kommen. Werden sie kommen? Nicht daran denken.
Sie wusste es, bevor das Urteil verkündet wurde. Tage- und nächtelang hat das Bild des zerstörerischen Wachstums in ihrem Körper sie gepeinigt. Kleine böse Wesen, die Jahrzehnte im Geheimen gelauert und ihre Kräfte gesammelt haben, um plötzlich auszubrechen, unaufhaltsam. Schon einmal hatten sie ihr den Krieg erklärt, doch sie hatte gesiegt, oder wer auch immer. Sie war wieder gesund geworden, hatte den Feind vergessen können. Als wäre nichts gewesen. Sie sollte dankbar sein für die geschenkte Zeit.
Kein Gefühl der Dankbarkeit. Nur Angst.
Es beginnt zu regnen und sie geht den Uferweg zurück. Dicke, satte Tropfen. Nasse Schleier verbergen das andere Ufer. Ein schönes, trauriges Bild ohne Farben.
Sie fährt wieder durch die Allee, zurück zur Stadt, zur leeren Wohnung. Zum letzten Stück ihres Lebens. Die Einsamkeit hüllt sie in ihre kalte Umarmung.
Sie hat tatsächlich geschlafen. Es ist schwierig mit dem Schlaf, er sitzt wie ein dunkler Engel auf der Vorhangstange über der Balkontür und schaut auf sie herunter, nicht bereit, sich ihr zu nähern. Wenn sie nach ihm greift, schlägt er abwehrend mit den Flügeln. Wendet sie sich von ihm ab, sitzt er still und böse da oben, missachtet sie, leugnet sie.
Irgendwann hat er sich doch auf sie herabgesenkt und sie hineingezogen in seine Dunkelheit.
Die Morgenstimmen der Vögel reichen in ihren Schlaf und locken sie heraus in das frühe, kühle Licht, das durch den Vorhang vor der Balkontür ins Zimmer sickert. Ihr erster Gedanke: Sie singen aus Freude am Leben.
Einer dieser neuen Gedanken. Seit sie um die Krankheit weiß, gibt es neue Gedanken. So als schliche sich, wenn sie sich vergisst, eine frische Nora ein und ließe die frühere Nora verblassen, bemächtige sich ihrer Farben, um ein neues Leben daraus zu gestalten.
Singen die Vögel wirklich aus Freude am Leben? Wie mag man sich fühlen, so leicht, so voller Federn und winziger Knochen, mit verlässlichen Flügeln, mit denen man sich in die Luft werfen kann?
Sie gleitet sanft zurück in den Schlaf, träumt ein wenig vom Fliegen und denkt im Traum: Ich muss mir unbedingt merken, wie es geht.
Stimmen unten in der kleinen Straße. Der Wind bläht die Vorhänge wie Segel. Diesmal ist das Aufwachen schwerfällig, sie hätte nicht wieder einschlafen sollen. Alle Gewohnheiten stehen stramm und warten. Jetzt weiß sie schon nicht mehr, wie man das macht, das Fliegen.
Heute wird sie einen Brief an Lisa schreiben, oder besser, sie wird damit beginnen. Es wird ein langer Brief werden. Zweiundzwanzig Jahre des Schweigens muss er überbrücken. Schon seit Tagen geht dieser Wunsch in ihr um. Vielleicht wird es jetzt leicht sein zu schreiben, keine Antwort ist zu erhoffen oder zu befürchten. Es wird zu spät sein für eine Antwort. Keine Versprechungen für eine Zukunft. Selbst der Verzicht auf eine mögliche Absolution ist erträglich. Über die Zeit hinaus geschrieben wird dies der beste aller Briefe sein.
Nora entdeckt ein halbes Lächeln in ihrem Spiegelbild im Badezimmer. Sie wird alles niederschreiben, die Wolken der Vergangenheit herauslassen, ihnen Worte geben und sie so entgiften. Es muss möglich sein.
Süßer kleiner Engel Lisa, so nannten sie alle. Niemand sagte das jemals über Nora. An Nora war nichts süß. Nora, das war groß, knochig, dunkel. Zu groß, zu knochig, zu dunkel. Lisa, das war klein und zierlich und blond gelockt. Die Große und die Kleine. Die Große, das war kein gutes Wort. Es war geladen mit Erwartung, Forderung, Vorwurf. Nora, pass auf deine kleine Schwester auf, du bist doch die Große.
Aber Lisa war auch Nähe. Warme Nähe, unbekümmerte Vertrautheit. Manchmal. Oder auch zerrende Nähe, schuldig sprechende Nähe, zäh und unausweichlich.
Die ewige kleine Schwester.
Lisa, wenn Du diesen Brief bekommst, lebe ich nicht mehr. Eine Freundin wird dafür sorgen, dass Dich dieser Brief erreicht, wo immer Du jetzt sein magst.
Seitdem ich beschlossen habe, diesen Brief zu schreiben, erlebe ich ein Gefühl der Verbindung, das mir guttut. Als würde etwas zusammengefügt, das zusammengehört. Denke nicht, dass ich Dich jemals vergessen hätte. Ich glaube auch nicht, dass Du mich vergessen konntest. Und wenn es auch nur der Hass war, der Dich an mich erinnert hat.
Ich möchte Dir mein Leben zeigen, damit Du mich nicht mehr hassen musst. Oder mich vielleicht sogar verstehen kannst. Ich hatte mal vor langer Zeit einen Nachbarn, der mich nicht leiden konnte, weil ich kurze Röcke trug. Ich konnte ihn auch nicht leiden. Eines Tages sagte ich zu ihm, dass ich an Porträts für ein Buch arbeite, und weil er so ein ausdrucksvolles Gesicht habe, wolle ich ihn fotografieren. Er fühlte sich zu geschmeichelt, um Nein sagen zu können. Ich machte viele Fotos von ihm und lernte dieses Gesicht kennen, jeden Schatten seiner Ängste, jede Furche seiner Sorgen. Und am Schluss mochte ich ihn. Ziemlich.
Wenn ich jetzt an Dich denke, sehe ich als Erstes den Speicher in Opa Wallners Haus, angefüllt mit den alten Möbeln und mottenlöchrigen Vorhängen, und ich sehe uns dort spielen in unserer eigenen, staubigen Welt. Ich glaube, das war die schönste Zeit meiner Kindheit. Mama war mit ihrem neuen Mann beschäftigt, und unsere neuen Großeltern hatten ihre Zuneigung zu den neuen Enkeln noch nicht abgenutzt. Und genug Zeit war vergangen seit den Bomben und dem Rennen in den Luftschutzkeller – und meiner Schuld.
Schuld. Mein Leben ist bald vorbei, und es gibt in meiner Erinnerung nur einige wenige kleine Inseln ohne Schuld. Ist das nicht grässlich? Ich fürchte, ich werde Dir viel von Schuld erzählen.
Es begann in den Bombennächten, als ich etwa sieben Jahre alt war. Wenn ich mit den Kindern aus der Nachbarwohnung losrannte zum Luftschutzkeller am Ende der Straße und hoffte, Mama würde Dich vergessen oder verlieren in der Hektik, und wir würden heimkommen in eine Wohnung ohne die Rivalin, die mir die Liebe aller stahl. Ich wusste ja nicht, dass es da nicht viel zu stehlen gab. Dann saßen wir in diesem scheußlichen Keller, in dem es immer nach Schweiß roch, eng nebeneinander auf der Bank, und ich war wütend, dass Mama Dich nicht vergessen oder verloren hatte. So beschäftigt war ich mit meiner Wut, dass ich die Angst vor den Bomben vergaß. Nur einmal, als eine ganz nah einschlug, machte ich mich nass.
Und als wir dann wieder heimgingen, war ich froh, dass wir alle noch lebten.
Eigentlich begann das mit der Schuld erst später, als es mit dem Beichten losging. Ich wurde in die Schuld hineingezwungen und fand nicht mehr heraus. Karma aus früheren Leben, sagte Wangmo, meine tibetische Freundin. Sie wollte mich trösten und fügte hinzu: Aber es ist doch nichts Schlimmes geschehen, du hast ja niemanden umgebracht. Ich konnte nicht sagen: Doch, das habe ich getan.
Aber unsere Mutter hat mir verziehen, bevor sie starb.
Sie lehnt sich zurück und lässt die Hände sinken, ein wenig erschöpft, ein wenig befreit. Es ist gut, an Lisa zu schreiben, die alten Gefühle und Gedanken aus ihrem Verlies zu holen, anstatt sie mitzunehmen. Wohin?
Und nun sterbe auch ich an Krebs, tippt sie ein, wie Mama.
Sie will besser verstehen, warum sie an Lisa schreibt. Vielleicht ist es sinnlos. Vielleicht ist Lisa noch immer böse auf sie, nach mehr als zwanzig Jahren. Denn Lisa ist unter ihrem zarten, hellen Äußeren eine unnachgiebige Person, wie Mama. Fels unter weichem Moos.
Nora ist eigensinnig, sagten alle. Nora sagte Nein. Lisa lächelte und sagte Ja. Nora tat unwillig, was von ihr verlangt wurde. Lisa tat nichts, schönte ihr Nichtstun mit freundlichen Entschuldigungen. Die süße Lisa war voller Unschuld. Eine Prinzessin ist nicht jemand, der etwas muss. Prinzessinnen sind dazu da, geliebt zu werden.
Nora beichtete, wenn sie Lisa gehasst hatte, und sagte zur Buße drei Ave Maria auf. Wütend.
Es gab so viel Wut in dieser Familie. Mama mit den zusammengepressten Lippen. Tante Hedi, die jedes Jahr zum Geburtstag ihres Bruders kam, um ihn mit harten Blicken an seine Schuld zu erinnern. Und Gerhard selbst, den sie nicht – wie Lisa – Vati nennen wollte, von dem sie als »er« sprach oder »mein Stiefvater«. Er mochte sie nicht. Und sie gab ihm nie Gelegenheit, sie zu mögen. Seit dem ersten Tag, als »der Witwer« zu Besuch kam und Lisa auf den Arm nahm und sagte: Was für ein süßer kleiner Engel. Mama hatte rote Lippen und rote Fingernägel, und Nora musste dem Fremden die Hand reichen, und er sagte: Ah, ja, deine Große.
Sie hat nie aufhören können, sich daran zu erinnern, obwohl sie so viel anderes vergessen, zumindest fast vergessen hat, das Heulen des Bombenalarms, den Hunger, Mamas Ohrfeigen, den gleichgültigen Sadismus des alten Lehrers in der Grundschule.
Tante Hedi, die Schwester des Witwers, die immer zu seinem Geburtstag und an Weihnachten zu Besuch kam, war auf ihre Weise freundlich. Sie erkannte eine Gleichgesinnte in Nora, bereit zum Hinterhalt. Auch Große möchten mal klein sein, sagte Tante Hedi mit belehrender, überlegener Miene zu Mama. Der vierzehnjährigen Nora schenkte sie einen Lippenstift mit dem gemurmelten Rat: Brauchst ihn ja nicht gerade daheim zu tragen.
Tante Hedi mit den buschigen blonden Dauerwellen, weißen Hemdblusen und engen Röcken. Noras Vorbild. Tante Hedi war älter als Mama und sah jünger aus. Blondiert, sagte Mama abfällig, wenn Tante Hedi wieder abgereist war. Aufgetakelt.
An jenem schicksalhaften Geburtstagsbesuch brachte Tante Hedi Jeans für Nora mit, richtige amerikanische Jeans mit Knöpfen vorn anstatt dem züchtigen Reißverschluss an der Seite. Und sie sagte zu Mama: Lass sie doch um Himmels willen Stöckelschuhe haben, sie ist doch fast sechzehn. Und so bekam Nora herrliche weiße Stöckelschuhe zum Sommerkleid mit dem weiten, wadenlangen Rock, und sie fühlte sich so gut wie erwachsen und entlassen aus der Machtlosigkeit.
Wo beginnen die Tragödien?Sind es nicht immer lange Ketten von Ereignissen? Meine Wut, die von Tante Hedis Wut genährt wurde, aber zurückreichte bis zu meiner Geburt, zu Mamas Wut auf unseren Vater, zu Großmutters Wut auf Mama. Bevor sie starb, hat Mama mir von ihrer Mutter erzählt, von dem erbarmungslosen Druck, mit dem sie in die ungewünschte Ehe getrieben wurde. Da verstand ich, warum aus ihr die Frau mit den zusammengepressten Lippen geworden war. Wenn wir doch immer alles wüssten von den anderen, es wäre so viel leichter zu verzeihen. Ja, deshalb schreibe ich diesen Brief, damit Du so viel wie möglich über mich weißt, die einzige Form der Wiedergutmachung, die mir einfällt.
Neulich überlegte ich, was ich hätte anders machen sollen in meinem Leben. Wahrscheinlich alles. Aber wie viel Wahl hat man denn, vor allem wenn man jung ist? Je älter ich wurde, desto weniger wollte ich urteilen, nur bei mir selbst konnte ich nicht aufhören. Ich schleppte die angehäufte Schuld mit in jede Gegenwart. Wie die legendären Eisenkugeln der Verurteilten.
Die Stimmen aus dem Arbeitszimmer – »er« hatte natürlich ein Arbeitszimmer, das die Kinder nicht betreten durften – waren wie das Surren gespannter Saiten. Der Er und Tante Hedi. Ihre Schärfe schnitt durch den warmen Morgen. Nora kauerte in ihrem Beet und legte Holzwolle unter die fast reifen Erdbeeren. Erdbeeren brauchten viel Pflege. Noras Stolz. Warum sagte nie jemand, Lisa sei faul? Lisa hatte nie Erdbeeren. Sie entfernte aus ihrem persönlichen Beet mit dem fröhlich drauflos wachsenden Kopfsalat höchstens hin und wieder ein paar Schnecken. Eine Lisa hatte den Triumph nicht nötig, zum Sonntagsfrühstück die Schale mit frischen Erdbeeren auf den Tisch zu stellen und Schlagsahne dazu, die man endlos mit dem Schneebesen schlagen musste. Man liebte Lisa ganz ohne Erdbeeren mit Schlagsahne.
Die Stimmen wurden lauter, das halb offene Fenster war unwiderstehlich. Nora lauschte angestrengt, doch nur einzelne Worte waren erkennbar. Sie zögerte. Wenn man sie ertappte!
Sie kniff die Lippen zusammen und erhob sich. Und wenn schon. Vorsichtig kroch sie unter dem Fliederstrauch hindurch zur Hauswand. Das Fenster lag hoch, sie konnte nicht hineinschauen, nur hören.
»… und es geht dich überhaupt nichts an, was ich mit meinem Leben anfange«, sagte Tante Hedi wütend. Sie stand in der Nähe des Fensters und war leicht zu verstehen. »Ich heirate, wenn ich will, und ich lasse es bleiben, wenn ich will. Du hast dich da nicht einzumischen.«
»Es ist eine Schande«, sagte Gerhard. »Alle wissen es.«
Nora brauchte sein Gesicht nicht zu sehen, um sich vor Widerwillen zu krümmen. Die vorgewölbte Unterlippe, die ihm stets einen leicht beleidigten Ausdruck gab. Die farblosen Augen. Das mattblonde, strähnige Haar, streng gescheitelt.
»Du redest von Schande?« Tante Hedis Stimme zitterte vor Empörung. »Du hast es nötig. Dass du vor Scham noch nicht gestorben bist! Ich schade niemandem. Das kann man von gewissen anderen Leuten nicht sagen.«
»Halt den Mund!«
Nora hörte Wut. Und sie hörte noch etwas anderes. Angst?
»Ich denke nicht daran«, sagte Tante Hedi, doch nicht mehr so laut wie zuvor. »Glaubst du, zehn Jahre genügen, um zu vergessen? Ich werde es nie vergessen.«
»Hör auf!« Seine Stimme zitterte, als hielte er sie mühsam fest, damit sie nicht ausbrach und wegrannte und alle auf sich aufmerksam machte. Noras Herz klopfte wild.
»Wer hat denn den armen Kerl angezeigt, nur weil er ein Jude war?« Tante Hedi sprach plötzlich so leise, dass Nora den Atem anhielt. »Elsa hätte viel lieber ihn geheiratet als dich. Oh, mein Gott, ich werd es mir nie verzeihen. Ich dumme Kuh hab das ausgerechnet dir erzählt. Damals hätten sie es noch über die Grenze geschafft. Arme Elsa.«
»Du hast nicht das Recht …«, fuhr er dazwischen.
»Ich sage, was ich will.« Tante Hedis Stimme war schrill von alter Wut. »Sie hat dich nur genommen, weil du den Mann beseitigt hast, den sie haben wollte. Vor Kummer gestorben ist sie deshalb. Du glaubst doch nicht, dass ich dir das jemals verzeihen werde.«
»Das ist nicht wahr«, erwiderte er schwach. »Die Tuberkulose hatte sie schon vorher, wir wussten es nur nicht. Niemand wusste es.«
Mit einem empörten Aufschrei unterbrach ihn Tante Hedi: »Und wenn du es gewusst hättest? Dann hättest du sie nicht haben wollen? Mein Gott, was bist du für ein unglaublich jämmerlicher Tropf!«
Eine Tür schlug zu. Nora kroch unter dem Busch hervor und ging zu ihrem Beet zurück. Sie durfte nicht nachdenken über das, was sie gehört hatte. Sie durfte es nicht gehört haben. Nicht nur das Lauschen machte sie schuldig, auch das Wissen.
Von Elsa hatten sie gesprochen, Gerhards früherer Frau, die im Krieg gestorben war. Irgendjemand hatte einmal gesagt, sie habe es auf der Lunge gehabt. Man sprach nicht über Sterben und nicht über Tote. Man sprach überhaupt nicht über Persönliches, schon gar nicht vor den Kindern. Mama machte manchmal Bemerkungen, aber oft war nicht klar, was sie bedeuteten. Spitze Bemerkungen, die irgendjemanden wegen irgendetwas aufspießten. Die Erwachsenen lachten dann unfreundlich oder machten höflich verkniffene Gesichter. Fragen war undenkbar.
Wer war der arme Kerl, der ein Jude war?
Am Abend erzählte sie es Lisa. »Tante Hedi kannte diese Elsa«, flüsterte sie. »Ich glaube, sie war ihre Freundin, darum wusste sie, dass sie mit dem Mann fliehen wollte. Aber er wollte sie haben. Darum hat er den anderen verraten, den Juden. Der kam natürlich ins Konzentrationslager. Stell dir das vor. Wir haben einen Mörder im Haus. Judenmörder werden vor Gericht gestellt. Wir müssen zur Polizei gehen.«
»Oh nein, das kannst du nicht tun. Vati ist kein Mörder.« Lisa weigerte sich, Verbündete zu sein. Vati war lieb zu ihr, Vati konnte kein Mörder sein.
Nora blieb dabei: »Ich hab es gehört. Frag Tante Hedi.«
Natürlich konnte man Tante Hedi nicht fragen.
Und man konnte mit niemandem darüber reden. Außer mit Lisa. Und Nora saß jeden Abend auf Lisas Bett und fing von Neuem an: »Ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Es ist so schrecklich. Stell dir doch nur vor, was er getan hat. Wir leben mit einem mörderischen Nazi unter einem Dach. Mit einem Verräter. Seinetwegen wurde ein Mensch umgebracht.« Und sie fügte leise hinzu: »Vergast.«
Das war ein Wort, das man nicht benützen durfte. Um das schlimme Wort zu übertönen, sagte sie: »Vielleicht ganz in der Nähe, in Dachau.« Gegen das Wort Dachau konnte niemand etwas einwenden. »Du hast doch die Bilder gesehen.«
Lisa wand sich. »Es ist schon so lang her.«
»Dem Opfer ist es egal, wie lang es her ist«, sagte Nora. Es war ein großartiges Gefühl, für die gerechte Sache zu kämpfen. Wie Jeanne d’Arc. Je öfter sie davon sprach, desto wahrer und gewichtiger wurden ihre Argumente: »Das Opfer ist tot, zu Tode gequält, und der Mörder läuft ungestraft frei herum und kauft sich ein neues Auto. So ist das.«
Schließlich gab Lisa nach. Sie sah ein, dass böse Taten nicht ungesühnt bleiben durften. Aber keine Polizei, darin blieb sie fest.
Es war eine gute Zeit mit Lisa. Sie stimmten nicht in allem überein, aber dennoch waren sie fast Verbündete. Nach ein paar Wochen sprachen sie nicht mehr über »die Geschichte«, aber sie war ständig gegenwärtig. Sie teilten das Geheimnis. Mit Befriedigung sah Nora, wie Lisa sich vom Stiefvater zurückzog, und die heimliche Macht verlieh ihr den Mut, frech zu sein.
»Hilf deiner Mutter in der Küche«, sagte er.
Nora zuckte mit den Schultern. »Hab zu tun.«
»Was erlaubst du dir!«, fuhr er sie an. »Benimm dich anständig.«
Nora senkte den Kopf. »Es gibt Leute, die erlauben sich ganz andere Sachen. Von wegen anständig.« Dann ging sie schnell hinaus und schloss sorgfältig die Tür. Auf dem Weg in ihr Zimmer wiederholte sie mit heftigem Herzklopfen die Litanei ihrer Argumente. Sie war im Recht.
»Du wirst dich Vati gegenüber benehmen«, sagte Mama in der Tür zum Mädchenzimmer.
»Er ist nicht mein Vati«, erwiderte Nora störrisch. »Und er konnte mich noch nie leiden. Ich ihn auch nicht.«
»So lang du in diesem Haus lebst, benimmst du dich gefälligst so, wie es sich gehört. Ich lasse mir von dir nicht das Leben verderben.«
»Wieso soll ich mir alles gefallen lassen? Ich tu doch gar nichts. Er ist der schlechte Mensch, nicht ich.«
»Wie kommst du dazu, so etwas zu sagen?« Die Ohrfeige kam schnell und hart.
»Frag doch ihn«, schrie sie Mamas Rücken nach. »Oder Tante Hedi.«
So machte Mama es immer. Schimpfen, ohrfeigen, nicht reden. Über nichts reden.
Ein paar Tage später die Explosion. Viele nächtliche Stunden lang hatte Nora an ihrer gerechten Empörung gearbeitet. Mörder! Manchmal gelang es ihr sogar, sich ein wenig vor ihm zu fürchten.
Sie erinnerte sich nicht, womit der Streit beim Abendessen begonnen hatte. Es gab oft Ärger beim Abendessen. Dann wurde sie vom Tisch geschickt und musste ihren Teller mit in die Küche nehmen. Diesmal ging sie nicht.
Es war ein erbitterter Streit. Vielleicht darüber, dass Nora abends mit einer Freundin weggegangen war. Immer unterstützte Gerhard Mamas Geschimpfe. Nie war er auf Noras Seite. Oma und Opa Wallner schwiegen missbilligend. Manchmal schüttelte Oma den Kopf und erklärte, dass Kinder sich früher nie so schlecht benommen hätten. Jedenfalls nicht ihr Kind. Gerhard. Und der legte theatralisch seine Hand auf die Brust und starrte vor sich hin, weil er doch einen Herzfehler hatte und deswegen ihm auch niemand vorwerfen konnte, dass er das Vaterland nicht verteidigt hatte. Diese Geste machte Nora jedes Mal so wütend, dass sie wegschauen musste und heimlich in den Klöppelspitzensaum der Tischdecke ein Loch riss. Dann hatte Oma eine Beschäftigung nach der nächsten Wäsche.
»Ich tu niemand was an!«, schrie Nora. »Aber er – er kann jeden tyrannisieren. Wahrscheinlich würde er mich auch ins KZ schicken, wenn man das heute noch könnte.«
Sie sprang auf, erschreckt von ihren eigenen Worten, und rannte hinauf ins Mädchenzimmer. Da man es nicht abschließen konnte, klemmte sie einen Stuhl mit der Lehne unter die Klinke. Doch es war nur Lisa, die einige Zeit später versuchte, die Tür zu öffnen.
Lisas Gesicht war rot, die Lider dick vom Weinen. Sie setzte sich auf ihr Bett und lehnte sich vor, die Arme um sich gelegt, als hätte sie Schmerzen.
»Ich habe ihnen gesagt, dass du es von Tante Hedi gehört hast«, flüsterte sie nach einer Weile. »Am Fenster.«
Nora schwieg. Sie konnte nicht denken. Es war geschehen. Sie war sich nicht sicher, ob sie es gewollt hatte. Vielleicht hatte sie es nicht gewollt, vielleicht hätte das Gefühl der heimlichen Macht genügt. Es war einfach geschehen, wie ein randvoller Topf überschwappt, wenn er bewegt wird.
»Was haben sie gesagt?«
Lisa schüttelte den Kopf. »Nicht viel. Mama wollte wissen, was du gemeint hast. Ich hab gesagt, sie kann ja mit Tante Hedi reden. Vati hat nichts gesagt. Er sitzt da wie tot.«
»Sie hassen mich«, sagte Nora. »Aber das ist ja nichts Neues.«
Es wurde nicht darüber gesprochen. Nora schrieb in großen Buchstaben auf ein Blatt:
Probleme werden totgeschwiegen,
Doch sie sind nicht totzukriegen.
Sie malte eine Girlande aus Stacheldraht darum herum und hängte es über ihr Bett. Und sie füllte das im Schweigen erstickende Haus jeden Tag wenigstens einmal mit den verbotenen zügellosen Klängen des AFN, bis Mama mit zusammengepressten Lippen ins Zimmer stürmte und das Radio abschaltete.
Aus dem Arbeitszimmer kam kein Laut. Niemand war darin. Er kam oft erst spät abends heim, um nicht mit der Familie essen zu müssen.
Opa Wallner hatte einen Schlaganfall und Mamas Lippen pressten sich noch ein bisschen mehr zusammen, denn sie musste Oma helfen, ihn zu versorgen. Es lag in der Luft, dass es Noras Schuld war, obwohl niemand ein Wort darüber verlor. Es gab keine Worte zu verlieren, sie wurden alle verschluckt.
Nora erzählte es schließlich ihrer Schulfreundin Karoline im Gymnasium.
»Es ist unser Geheimnis«, sagte sie zu Karoline. Natürlich erzählte Karoline das Geheimnis weiter, die Klasse berauschte sich am Gerücht. Es kroch nach und nach in alle Ohren, auch in die der Lehrer. Nora wurde zur Klassenlehrerin gerufen.
»Was erzählst du da herum?«, fragte die Lehrerin.
Nora hatte viel Zeit mit dem Ausfeilen von Selbstrechtfertigungen verbracht, sie war gewappnet.
»Ich habe nichts herumerzählt«, erwiderte sie. »Ich hab nur meiner Freundin Karoline etwas erzählt. Zu Hause darf man ja nicht darüber reden. Wenn ich über ein Verbrechen rede, bin ich die Verbrecherin. Tolle Gerechtigkeit. Wo saßen dann bitte die Verbrecher bei den Nürnberger Prozessen?«
Nora war stolz auf sich. Auf diesen Augenblick hatte sie gewartet, dieses Argument hatte sie sich gut zurechtgelegt. Dahinter war sie sicher.
Die Lehrerin wollte die ganze Geschichte von Nora hören.
»Sie hassen mich daheim auch so schon, und sie werden mich noch mehr hassen, wenn ich es Ihnen erzähle«, sagte Nora.
Die Lehrerin legte den Arm um Noras Schulter. »Niemand hasst dich wegen der Wahrheit.«
»Ich – ich fürchte mich vor meinem Stiefvater«, erklärte Nora mit kleinem Mund. »Er ist skrupellos.«
In einer Zeitschrift war sie auf dieses Wort gestoßen und hatte es in ihr geheimes Fremdwörterheft geschrieben. Sie sammelte Fremdwörter, man konnte sich eine Position damit schaffen. Mache ein unbewegtes Gesicht und lasse hin und wieder ein Fremdwort hören, das macht Eindruck.
Kurz und sachlich erzählte sie, was sie gehört hatte, flocht immer wieder ein, wie sie zu Hause geächtet wurde, wie niemand mehr mit ihr sprach, wie sie zur Schuldigen gemacht wurde, weil sie wusste, was niemand wissen sollte. Sie sah sich zu. Niemals zuvor hatte sie so deutlich erlebt, wie sie sich spielte. Sie war ihre eigene Marionette. Ihr Geist zog an Fäden und ließ sie auftreten auf ihrer Nora-Bühne. Die aufrichtige Nora. Die arglose Nora. Die ungerecht behandelte Nora. Die leidende Nora.
Auch bei der Lehrerin konnte man an Fäden ziehen. Dann trat die Lehrerin auf, wie man es wollte.
»Jetzt fürchte ich mich, nach Hause zu gehen«, sagte Nora mit gesenktem Kopf. »Wenn ich das alles nur nie gehört hätte. Es ist ja nicht meine Schuld. Er ist doch der … Schuldige.«
Sie freute sich über ihre Intelligenz, die sie zögern ließ, das falsche Wort zu sagen. Sie sagte nicht »Mörder«. Das sagte sie nur zu Lisa oder zu Karoline.
»Wenn es Probleme gibt, kommst du zu mir«, sagte die Lehrerin und drückte Noras Schulter.
In der Nacht hatte sie wieder den Alptraum von der schwarzen Wolke, die sie verfolgte. Lisa verlangte von Mama ein eigenes Zimmer, weil Nora nachts wimmerte und manchmal aufschrie.
Das brachte das ganze Haus in Bewegung. Oma Wallner zog mit dem Opa in ein Altersheim, und die Schwestern bekamen die beiden Zimmer im obersten Stock. Mama zog in das frühere Kinderzimmer neben dem Elternschlafzimmer.
»Sie schläft nicht mehr bei Vati«, sagte Lisa anklagend.
Der Stiefvater kam abends immer später nach Hause, und an Wochenenden war er häufig verreist. Tante Hedi schob eine Ausrede vor, um nicht zum Geburtstag ihres Bruders kommen zu müssen. Sie schickte auch kein Geschenk zu Noras Geburtstag.
Nach einem Wochenende kam Gerhard nicht nach Hause. Mamas Gesicht sah aus wie ein zugezogener Reißverschluss, sie brachte kaum die Lippen auseinander für ein paar Worte. Am Tag darauf ging sie zur Polizei und gab eine Vermisstenanzeige auf. Erst Tage später fand man seine Leiche im Gebirge. Er war an einem steilen Pfad abgestürzt.
»Das war kein Unfall«, presste Mama zwischen ihren engen Lippen hervor. Sie sah Nora nicht an, aber die Stimme fand ihr Ziel.
»Woher willst du das wissen?«, fragte Nora den gebeugten Rücken an der Spüle.
Mama hielt in ihren hektischen Bewegungen inne und erwiderte: »Wir wissen es doch alle.« Mit einer Stimme wie ein Peitschenknall.
Einen Tag lang mussten sie Mama helfen, das Haus zu putzen wegen der Gäste, die nach der Beerdigung kommen würden. Lisa war die Einzige, die weinte. Mama schrubbte besessen, und Oma saß in der Küche und wiederholte, dass ihr Gerhard immer schon die Berge geliebt habe und dass es ein schöner Tod in den Bergen sei und dass der liebe Gott doch lieber sie hätte holen sollen als »den Jungen«.
Nora überstand die Beerdigung, indem sie darüber nachdachte, wie sie Tante Hedi dazu bringen könnte, sie bei sich aufzunehmen. Tante Hedi kochte nicht gern. Nora würde ihr anbieten zu kochen. Vielleicht würde Tante Hedi sogar froh darüber sein, jemanden zur Gesellschaft zu haben. An einsamen Abenden und an Sonntagen, wenn es regnete.
Tante Hedi besprach sich mit Mama, und es wurde beschlossen, dass Nora zum nächsten Schuljahr zu Tante Hedi nach Heidelberg ziehen sollte. Lisa sagte nichts dazu. Sie verkroch sich in der Trauer um ihren Vati.
Irgendwann hörte auch das Gerede in der Schule auf.
Ach, Lisa, es tut mir heute noch leid, dass ich Dich damals in diese Nazi-Geschichte mit hineingezogen habe. Du warst ja noch so jung, erst dreizehn. Aber hätte ich es vermeiden können? Wurden wir nicht mitgeschwemmt von den Ausläufern einer kollektiven Flutwelle, die in vielen das Schlechteste nach oben gebracht hat? Vor ihrem Tod fing Mama endlich an zu reden, und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie versucht hat, mir einen Teil meiner Schuld abzunehmen. Sie sagte: Gerhard war ein schwacher Charakter.
Jugendliche Selbstumklammerung des eigenen Ichs. Wie sollte ich mir Gedanken und Gefühle unserer Mutter vorstellen können? Vielleicht ist das immer so in der Jugend. Ich weiß es nicht. Mama war für mich immer die Frau mit den zusammengepressten Lippen. Und da war das Gefühl, dass es an mir lag, weil ich ein schlechtes Kind war und meine Mama deshalb nicht glücklich sein konnte. Dass sie das andere, gute Kind hatte, reichte nicht aus. Die schlechte Nora verdunkelte alles.
Meine Freundin Wangmo sagte, unsere Eltern seien die Manifestation unseres Karma. Das war damals in Zürich, nachdem wir uns kennen gelernt hatten und einander unsere Lebensgeschichten erzählten. Dass sie mit ihrer Familie aus Tibet fliehen und als Kind ihre Mutter verlassen musste, sei ihr Karma, sagte sie. Das komme von schlechten Taten in ihren früheren Leben. Ich fand diese Idee nicht akzeptabler als die Idee von Gottes Prüfungen und Strafen. Vielleicht ein bisschen logischer. Allerdings fiel mir keine bessere Erklärung ein. Ich sagte zu Wangmo: Glaubst du wirklich, dass du dieses harte Schicksal verdient hast? Und sie antwortete: Was heißt verdient? Es ist einfach Ursache und Wirkung, und ich kann von der Wirkung auf die Ursache schließen. Was wir tun, hat Konsequenzen, gleich oder später. Woher willst du wissen, dass das, was jetzt geschieht, nicht die Folge von etwas ist, das du früher getan hast, in einem früheren Leben? Und ich sagte: Woher willst du wissen, dass es eine Folge ist? Aber Wangmo konnte man nicht so leicht zurückweisen. Sie lachte und erklärte, ihre Version sei ihr lieber, sie rege sie dazu an, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Was soll man dazu sagen?
Nora speichert den Text und schaltet den Laptop aus. Unversehens ist es Mittag geworden. Marie in der Parterrewohnung hat sie zum Essen eingeladen. Marie weiß noch nichts vom Todesurteil. Ahnt sie etwas? Niemand weiß davon. Nicht darüber zu reden hat Vorteile. Man kann tun, als wäre alles in Ordnung. Ist der Tod nicht in Ordnung? Wangmo würde sagen, er ist völlig in Ordnung. Die Ordnung der Dinge. Werden, Vergehen. In letzter Zeit denkt Nora oft an Wangmo. Möchte die Verbindung wieder aufnehmen und schämt sich ihres langen Schweigens.
Sie muss Marie ihren Tod zumuten. Vielleicht wird es gar nicht so schlimm sein. Marie ist eine tüchtige, vernünftige Frau. Belastbar, sagt sie selbst. Aber man weiß ja nicht.
Wie gut kennt sie Marie? Wegen Marie zog sie vor sechs Jahren in diese Wohnung. Es ist nicht gut für dich, sagte Marie, so allein zu leben. Die Wohnung im Stockwerk über Marie wurde frei. Ein Mann hatte darin gewohnt, Maries »Beziehung«. Sehr komfortabel sei es gewesen, jeder in seiner Wohnung, aber er wollte richtig zusammenziehen, mit einem gemeinsamen Schlafzimmer. Er gab keine Ruhe. Warum wollen sie nur immer Söhne sein statt Partner, pflegte Marie zu sagen.
Sie ist eine gute Freundin. Manchmal wird es deutlich, dass sie viel jünger ist, kaum über fünfzig. Noch hat sie den erwartungsvollen Blick aufs Leben. Da wartet man so lange auf das Glück, das richtige Glück, das alle Leiden des Lebens wettmacht, also muss es doch kommen. Aber schließlich muss man erkennen, dass es nicht kommt. Ist man dann alt?
Marie denkt, es liege an ihrer rundlichen Figur. Sie sieht hübsch aus, weich und entgegenkommend. Marie glaubt Noras Beteuerung nicht. Sie wäre gern wie Nora, groß und knochig, mit langen Beinen und schmalen Hüften. Ach, Marie, du ahnst ja nicht. Die dummen Kerle damals in der Tanzstunde, Knochengestell haben sie mich genannt. Es tat so weh. Nach dem Krieg fand man dünn nicht schön. Reichlich Busen und geschwungene Hüften und winzige Taille, so musste es sein. Wie Lisa. Diese Wunde schloss sich nie. Bei Tante Hedi musste sie nicht mehr in die Tanzstunde gehen. Und nicht in die Kirche. In mancher Hinsicht war es bei Tante Hedi ganz gut.
»Ich bin noch nicht fertig«, sagt Marie, »mach du die Salatsauce.«
Nora rührt die Salatsauce an, deckt den Tisch, faltet Servietten.
Nora lässt Marie reden, lässt sie wiederholen, was sie schon so oft gesagt hat über Frauen und Männer und das Zusammenleben und die Rollenmuster und die Utopie der Liebe. Sie probt im Geist, wie sie es sagen wird: »Marie, ich sterbe bald.« Ja, so ist es am besten. Ohne Umwege. Ohne Zittern in der Stimme. Nach der Zitronencreme.
»Ich komme zu der Ansicht, dass das Klimakterium ein Geschenk ist«, sagt Marie. »Nicht mehr dieser Druck der Hormone. Ich dachte, das würde ein Verlust sein. Ist es aber nicht. Meinst du, Weisheit ist einfach ein neurochemisches Phänomen?«
Nora schüttelt den Kopf. »Wohl nicht. Meine Großeltern waren nicht weise. Die plagten sich nur mit dem Alter.«
Sie sieht Oma Wallners Kopf oben am Fenster: Seid sofort still da unten, der Opa braucht Ruhe. Das war nach der Anfangszeit im Haus der neuen Großeltern. Die Kinder wurden lästig.
Wie viel Weisheit hat sie gewonnen in ihrem Leben? Eine Frage, die Nora seit Tagen bedrängt. Sie schämt sich ihres Lebens. Schuld und Schande.
»Marie, ich muss dir etwas sagen. Ich habe Krebs.«
Es war zu unvermittelt. Sie hat Marie kaum zu Ende sprechen lassen. Als habe es sie nicht interessiert, was Marie sagte. Es hat sie nicht interessiert. Nicht jetzt.
»Oh Gott, Nora!«, sagt Marie und schlägt die Hand vor den Mund.
»Ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber nicht sehr lang.«
Marie streckt die Hand aus und legt sie auf Noras um die Serviette geballte Faust. Nora leistet schweigend Abbitte für alle Augenblicke, in denen sie Marie nicht ertragen konnte. Marie ist eine liebevolle Person. Ein bisschen hysterisch, ein bisschen redselig, ein bisschen undiszipliniert. Aber lieb. Eine Freundin.
»Wie sicher ist das?«, fragt Marie.
In allen Details beschreibt Nora den Ablauf der Untersuchungen. »Glaub mir, Marie, es ist todsicher.«
»Manchmal geschehen Wunder«, sagt Marie zögernd. »Man weiß doch nicht … Hast du gelesen …? Im Fernsehen hab ich gesehen …«
Nora hört weg. Warum macht es sie wütend, dass Marie den Tod nicht akzeptieren will? Marie will helfen, aufrichten, sie ist stets voller guter Ratschläge. Aber wird sie je begreifen, dass gute Ratschläge oft nichts anderes als Schläge sind?
»Lass es gut sein, Marie. Es lässt sich nicht ändern. Und mach dir keine Sorgen, ich werde alles gut vorbereiten, die Einäscherung und so.« Von ihrer Angst vor dem Abgeschobenwerden ins Krankenhaus, vor den Apparaten und Schläuchen, vor dem Krieg gegen den Tod in der Intensivstation spricht sie nicht.
Marie schweigt erschreckt.
»Tut mir leid«, murmelt Nora. Fast fügt sie hinzu: Ich kann ja nichts dafür.
Ein sanfter Druck um Noras Faust. »Nein, mir tut es leid, Nora. Dass ich so ungeschickt bin. Ich möchte das Richtige sagen, aber ich weiß wirklich nicht, was das Richtige ist.«
Maries Hand ist heiß auf Noras Faust, schwitzt Feuchtigkeit aus. Haut an Haut. In romantischen Filmen sieht es zart und entzückend aus. Da spürt man nicht die feuchte Klebrigkeit.
Du lieber Himmel, was für blödes Zeug schwimmt in diesem Tümpel herum, der mein Geist ist, denkt Nora.
»Ich weiß es auch nicht«, erwidert sie. »Ich habe nicht viel Erfahrung damit. Als meine Mutter Krebs bekam, rief mich ihre Putzfrau an, weil meine Mutter es niemandem sagen wollte. Du hättest meine Mutter kennen sollen, sie bestand nur aus zusammengekniffenen Lippen. Doch dann, als sie fast schon im Sterben lag, wurde sie jemand ganz anderes. Fast so, wie wenn eine Knospe aufgeht. Unglaublich.«
»Das ist schön«, sagt Marie.
Nora lächelt ein wenig. »Vielleicht werde auch ich noch aufgehen.«
Es ist nicht leicht dahingesagt. In den vergangenen Tagen, umklammert von einer alles dämpfenden Lähmung, bewegten sich unterirdische Gedanken. Was hast du aus deinem Leben gemacht?
»Im Augenblick fühle ich mich nicht blumenhaft, eher wie eine Schmeißfliege, weißt du, die dicken Dinger, die blind gegen Fenster knallen.«
In Maries Augen sammeln sich Tränen. »Oh Nora!«
Mit einem lauten Ruck schiebt Nora den Küchenstuhl zurück und steht auf. Sie umarmt Marie. Wer braucht hier Trost?
»Ist ja gut, Marie. Ich sterbe ja nicht morgen. Wir haben noch Zeit.«
Einen Augenblick lang ist Marie ein Kind. Und Nora eine Mutter. Nicht traurig sein, mein Kind, das Leben ist Schmerz und Freude, ich möchte dir nur die Freude geben, aber so ist das nun mal, und es bricht mir das Herz. Einer dieser seltsamen neuen Gedanken. Was soll man nur damit anfangen?
»Bitte, Marie, sag Chantal und Claire Bescheid. Dann muss ich es nicht tun.«
Es wird wohl ein längerer Brief werden, Lisa. Ein paar Tage sind vergangen, in denen ich nicht schreiben konnte. Ich wohne hier über der Wohnung einer Freundin, Marie. Ich musste ihr sagen, dass ich bald sterben werde, es war ja nicht zu umgehen. Sie hat zwei Töchter, eine der beiden ledige Mutter eines Vierjährigen. Maries Reaktion war liebevoll. Aber die Töchter – sie gehen mir aus dem Weg. Ich möchte sagen: Mädels, ich bin nicht ansteckend. Den Tod tragt auch ihr in euch, das ist einfach so. Sogar eure Kinder werden mitsamt ihrem Tod geboren. Aber das kann man ja nicht sagen. Sie würden es mir übel nehmen.
Jetzt kann ich besser verstehen, warum Mama es niemandem sagen wollte. Aber das Erstaunliche war Mamas Verwandlung. Ich habe dir damals nur die Fakten ihrer Biografie geschrieben, die sie mir erzählt hat. Doch diese Verwandlung – es war, als hätten die Schmerzen eine Kruste von ihrer Seele gesprengt.
Eines Morgens fielen plötzlich die zusammengepressten Lippen auseinander, blühten auf in dem hageren Gesicht, zart wie die Blütenblätter des Klatschmohns auf nutzlosem Brachland.
An diesem Morgen tastete sie nach Noras Hand und sagte: »Ich hab nicht mehr lang, Nora. Ich möchte dir von deinem Vater erzählen, von eurem Vater, und ich möchte, dass auch Lisa es erfährt. Es war nicht richtig, dass ich so viel verschwiegen habe. Aber ich musste, weißt du, ich konnte es nicht aushalten, daran zu denken. Ich war so froh, dass seine Eltern nichts mehr von mir und euch wissen wollten, als ich wieder heiratete.«
Nora hielt den Atem an. Selbst die Stimme hatte sich verändert. Sie schnitt und stach nicht mehr. Es war die Stimme einer sehr traurigen Frau. Schwach. Einsam. So unverstellt, dass Nora aufstehen und weggehen wollte, sich verbergen wollte mit ihrer eigenen Härte, die sie nicht einfach abstreifen konnte.
»Möchtest du noch ein Kissen?«, fragte sie, um etwas zu sagen, etwas zu tun.
»Nein, bleib sitzen, hör zu«, sagten die sanften, zitternden Lippen. »Hör zu! Bitte!«
Und Nora hörte zu mit ineinander gekrampften Händen, vorgebeugt auf dem hart gepolsterten Stuhl, den Oma Wallner einst mit fünf anderen hart gepolsterten Stühlen zu ihrer Hochzeit bekommen hatte. Vor dem Ersten Weltkrieg.
»Ich war so jung«, sagte die Mutter, »und Alfred war hinter mir her, und ich wollte endlich geliebt werden.«
»Hinter mir her« nannte man das damals, wie passend. Jäger und Opfer. Obskures Objekt. Der große, blonde, gut aussehende junge Mann, dessen einziges übrig gebliebenes Foto Nora aufbewahrt hat, auf der Jagd nach dem Mädchen im geblümten Kleid. Es gab ein Foto von der achtzehnjährigen Gerlinde, ein schmales, spitzes Gesicht, von honigblonden, welligen Haaren umrahmt, eine Strähne vom Wind gelöst, das Kleid locker tailliert, der leichte Stoff um die hübschen Beine flatternd.
»Er sagte, er würde mich lieben, aber es ging ihm natürlich darum, mich rumzukriegen.«
Arme Mama. Sie wollte ihre Töchter vor den Männern und dem Rumkriegen beschützen, wollte sie festhalten zu ihrem Besten und hat sie doch nur verloren.
»Er hat es natürlich geschafft. Ich wollte nicht, es war ja eine schreckliche Sünde, aber heute frage ich mich, warum eigentlich. Es hat mir ja nicht mal Vergnügen gemacht.«
»Ist Vergnügen eine Sünde, Mama? Warum soll man sich nicht freuen dürfen? Das ist doch absurd.«
Die Mutter seufzte. »Ich wollte ihn behalten, darum gab ich nach. Die anderen Mädchen beneideten mich. Meine Mutter lobte ihn himmelhoch. Mein Vater nicht, er war nicht einverstanden mit Alfreds Nazi-Begeisterung. Aber das hat er natürlich nur hinterrücks gesagt.«
Warum wurde in dieser Familie alles hinterrücks gesagt, dachte Nora. Wenn man überhaupt etwas sagte. Warum konntet ihr nicht miteinander reden?
»Und dann wurde ich schwanger – mit dir, Nora. Es war entsetzlich. Ich versuchte alles, um die Schwangerschaft abzubrechen. Einmal ließ ich mich sogar die Treppe hinunterfallen. Es nützte nichts. Mein Bauch wurde immer dicker. Ich musste Alfred heiraten. Wir wollten einander nicht mehr. Wir waren schon Feinde, als sie uns zum Traualtar schleppten. Ein schönes Paar, sagten alle. Meine Freundinnen beneideten mich.«
»Du wolltest mich nicht«, sagte Nora. »Ich verstehe.«
Plötzlich verstand sie sehr viel. Damals also hatte Mama angefangen, die Lippen zusammenzupressen. Dieses Kind war nie wirklich ihr Kind. Ein Wechselbalg. Aber Lisa kam drei Jahre später. War Lisa kein Wechselbalg?
»Wolltest du Lisa?«
Die Mutter lag mit geschlossenen Augen und antwortete lange nicht. Schlief sie?
»Ein Kind der Liebe war sie nicht«, sagte sie plötzlich. »Ich musste ja hin und wieder meine eheliche Pflicht erfüllen. Alfred war viel unterwegs. Ich wollte nie wissen, was er tat. Er war einer der unteren Parteibonzen. Ein richtiger Herrenmensch. Sie haben ihn damals in Frankreich eingesetzt. Seit die Résistance ihn umgebracht hat, mag ich die Franzosen, Gott verzeih mir.«
»Warum hast du über all das nie geredet, Mama?«
»Man gewöhnt sich daran, nicht zu reden, wenn man es von klein auf gelernt hat.«
»Und wie war das dann mit Lisa?«
Die Lippen der Mutter zitterten. »Sie war so hübsch, schon als Baby. Alle waren bezaubert von ihr. Man mochte Lisa, und deshalb mochte man auch Lisas Mutter. Ich glaube fast, Gerhard hat mich wegen Lisa geheiratet. Er sagte jedenfalls Hals über Kopf, er wolle Lisa adoptieren, gleich nachdem er sie zum ersten Mal gesehen hatte.«
»Und mich nicht?«, entfuhr es Nora.
»Da blieb ihm nichts anderes übrig.«
Eine dünne Hand tastete nach Nora. Doch Nora war damit beschäftigt, Tränen zurückzudrängen. Es gelang ihr nicht, und sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. Du lieber Himmel, nun machte sie der sterbenden Frau eine Szene. Das war nicht richtig. Sterben war doch schwer genug.
Die Mutter streckte bittend die Hand aus, bis Nora sie ergriff.
»Tut mir leid, Mama. Tut mir leid.«
Die Stimme ihrer Mutter war so sanft und unglücklich wie niemals zuvor: »Ich habe alles falsch gemacht. Glaube nicht, dass ich das nicht wüsste. Ich habe mein ganzes Leben verpasst. Alles, was das Leben lebenswert macht.«
Das Herz tat ihr weh. Sie musste etwas tun. Also erhob sie sich, schob das Kopfkissen zurecht, zog die Bettdecke hoch. Dann rückte sie den Stuhl nah ans Bett heran und setzte sich wieder.
»Was macht das Leben lebenswert, Mama?«
Die dünnen, trockenen Hände scharrten auf der Bettdecke. Das faltige Gesicht verzog sich. Tränen sammelten sich in dem abgewandten Blick, liefen aus den Augenwinkeln ins Kissen.
»Ist ja gut, Mama«, sagte Nora und wühlte in der Nachttischschublade nach einem Taschentuch. »Ist ja gut.«
Ich weiß nicht mehr, was ich Dir damals schrieb. Ich glaube, nicht viel. In unserer Familie wurde nie über Liebe gesprochen. Als wäre das etwas Peinliches. Wie hätte ich Dir damals schreiben können, dass sich das Herz unserer Mutter unter Schmerzen öffnete? Es fällt mir sogar noch heute ein bisschen schwer. Aber genau das geschah. Wir umarmten uns, als sie da auf dem Sterbebett lag. Das erste Mal in meinem Leben, soweit ich mich erinnern kann.
2.
Es ist vollkommen dunkel. Ein ungeheuer schweres Etwas, dunkler als alle Dunkelheit, drückt auf ihre Brust. Panik. Sie möchte es wegschieben, aber sie kann den Arm nicht heben. Nicht den kleinsten Muskel kann sie bewegen. Keinen Ton kann sie von sich geben. Sie ist sich nicht sicher, ob sie wach ist oder träumt. Es könnte ein Traum sein, denn wäre sie wach, würde sie das Licht sehen, das durch die Vorhänge am Fenster und an der Balkontür von der Straße hereinscheint. Sie kämpft darum aufzuwachen. Böser Geist, sagen ihre taumelnden Gedanken. Was ist er? Was will er?
Sie ist sich sicher, dass ihre Augen offen sind. Aber nirgendwo Licht. Was ist geschehen? Ist sie schon gestorben? Nein, sagen die Zellen ihres Körpers, wir leben. Spürst du nicht, wie wir atmen?
Plötzlich sieht sie die Umrisse der Balkontüre. Doch die Dunkelheit lastet noch immer auf ihrer Brust. Ist sie wach? Oder doch nicht? Nach wie vor kann sie sich nicht bewegen. Sie hört ein Stöhnen. Ist das ihre Stimme? Sie möchte schreien, konzentriert sich auf den Schrei, aber es sind nur kraftlose Laute.
Dann lockert sich der Druck. Doch das Etwas bleibt ganz nah bei ihr, seine mächtige Dunkelheit verdeckt das Fenster.
»Nein«, flüstert sie, »aufhören! Bitte, das soll aufhören!«
Als sie endlich aufstehen kann, stößt sie sich an dem Tischchen neben ihrem Bett und tritt wütend danach. Es fällt um, und die leere Teetasse, die darauf stand, zerbricht. Nora schreit auf und ist fassungslos über die Wut, die in ihr tobt. Sie möchte etwas zerschlagen. Etwas zerreißen. Gegen die Wand rennen. Eine Stimme in ihr kreischt: Ich will nicht sterben!
»Dumme Kuh«, murmelt Nora und schlurft ins Badezimmer.
»Ich habe von einem Heiler gehört«, sagt Chantal. »Der hat tolle Erfolge. Du solltest mal hingehen.«
Sie rückt den Sonnenschirm auf dem Fleckchen Gras vor dem Haus zurecht, es ist zu warm, die Luft steht schwer zwischen den Büschen. Sie lächelt angestrengt, Maries schöne Tochter, dünn, blond. Zu dünn und zu blond, um zu schwitzen. Kann man Schweißdrüsen weghungern?
Der Bodensatz an Gereiztheit – wer hat den nicht, denkt Nora – sitzt in diesen Tagen locker, wird allzu leicht aufgewühlt. Dabei mag sie Chantal. Diese seifenfrische Kühle. Wie sie ihren kleinen Sohn dirigiert im sanften Dressurton, Marius, geh zu Oma in die Küche, hol ein Glas Wasser für Mama, das tust du doch gern.
Vielleicht wird er sie später hassen. Oder sich selbst, weil er nicht aufhören kann, es gern tun zu müssen.
Nora schüttelt den Kopf. »Lass es, Chantal. Ich habe keine Lust auf falsche Hoffnungen.«
»Aber man muss alles versuchen.«
»Muss man? Das bisschen Weisheit, das ich in meinem Leben zusammengebracht habe, sagt mir, dass Hoffnung nicht viel besser ist als Furcht.«
»Aber Hoffnung ist gut, man gibt nicht auf.«
»Wie die Karotte vor der Nase des Esels? Damit er immer schön rennt?«
Chantal trinkt schweigend ihren Kaffee.
Nora wartet auf Marie. Es wird leichter, wenn Marie alles Ungesagte, Halbgedachte mit Alltagssätzen zudeckt. Sie kann das so gut, dass kaum ein Stückchen Wirklichkeit mehr sichtbar bleibt.
»Es ist schwierig«, sagt Chantal plötzlich. »Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Claire findet das auch.«
Das war schon immer Chantals zweiter Satz: Claire findet das auch. Stichworte auf der Schwesternbühne.
»Und?« Der böse Bodensatz in Nora wallt ein wenig höher auf.
Chantal dreht ihre Tasse mit schmalen, eleganten Fingern. »Es ist nicht mehr so wie früher. Ich meine, du bist jetzt so krank. Man möchte nichts Falsches sagen.«
»Und was wäre falsch, Chantal?«
»Ich meine, taktlos.«
»Oh mein Gott«, sagt Nora, »weil der Tod mit am Tisch sitzt? Denkst du, der hat was gegen Taktlosigkeit?«
»Du machst es einem wirklich schwer, Tante Nora.«
Glücklicherweise kommt Marie mit dem kleinen Marius an der Hand aus dem Haus.
Meine Familie, denkt Nora, das einzige bisschen Familie, das ich habe. Was wäre ich ohne sie.
»Ich benehme mich, Chantal, ich versprech es«, sagt sie und kreuzt die Finger hinter dem Rücken, so auffällig, dass Marius es sehen muss.
»Tut sie nicht!«, schreit das Kind entzückt. »Du benimmst dich nicht wirklich. Tante Nora benimmt sich nicht.«
Ende der Leseprobe