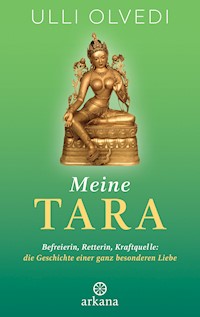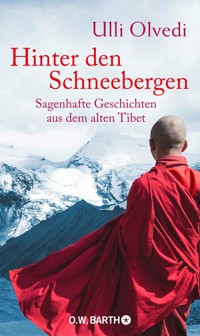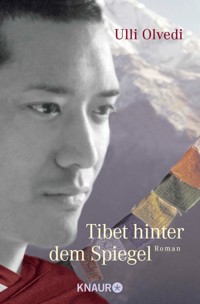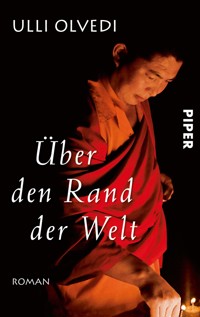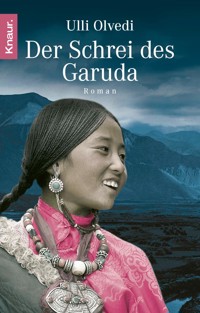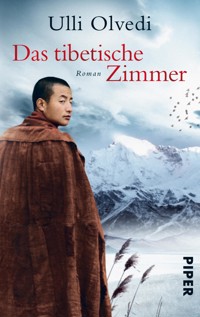
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hochbegabt, hochsensibel, medial – und für die Welt nicht zu gebrauchen. So stellt sich die junge Charlie dar, als sie zufällig in ein tibetisches Kloster im Himalaja gerät. Dort stürzt sie in einen Prozess tief greifender Wandlung, heraus aus ihrer inneren Einsamkeit und Selbstentfremdung, um endlich in Freundschaft mit sich selbst leben zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
7. Auflage 2012
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
ISBN 978-3-492-95574-4
© 2010 Ulli Olvedi und Piper Verlag GmbH, München, erschienen im Verlagsprogramm Pendo Covergestaltung: semper smile Werbeagentur GmbH, München, nach einem Entwurf von Hilden Design München, unter Verwendung von mehreren Motiven von Shutterstock Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Willst du wissen, wer du warst,schau, wer du bist.Willst du wissen, wer du sein wirst,schau, was du tust.
1
Irgendwo unterhalb des offenen Fensters kreischte ein Papagei. Ein durchdringend lauter Ton. Hungrig? Wütend? Gelangweilt? Der Schrei verriet nichts. Er war einfach nur laut.
Erster Gedanke: Papagei. Achte beim Aufwachen auf den ersten Gedanken, hatte Yongdu gesagt. So viel guter Rat. Während der langen, holperigen Fahrt aus dem Kathmandutal hinaus und durch die Vorberge des Himalaya zum Kloster hatte er vom klösterlichen Leben berichtet. Nicht zu viel schlafen, sechs Stunden sind genug. Morgens und abends Texte rezitieren, dazu Niederwerfungen, mindestens einundzwanzig. Alles langsam und achtsam tun.
Er hatte gut reden, so ein Mönch kannte seit seiner Kindheit nichts anderes.
Der Papagei kreischte in unregelmäßigen Abständen. Sehr unordentlich. Nicht klosterfest.
Charlie war bereit, sich Mühe zu geben. Auf dem Weg des Buddha muss man seinen Geist kennenlernen, hatte Yongdu erklärt. Das ist sehr wichtig. Man muss neugierig sein, Forscher sein, muss sich selbst auf die Schliche kommen. Ohne diese Grundlage entwickelt man sich nicht weiter. Oh ja, hatte Charlie gesagt, neugierig bin ich. Bis jetzt fand das niemand gut.
Dass sie irgendwann nicht mehr gewagt hatte, ihre Neugier zu zeigen, war ihr nie in den Sinn gekommen.
Morgens bewusst aufwachen, war Yongdus Anweisung. Nicht einfach so in den Tag hineinstolpern.
Was war vor dem ersten Gedanken gewesen? Ein Wissen von Wachheit. Aber kein Wissen von Ich, kein Wissen von Inhalt. Ein anderes Wissen als das jetzige, nachträgliche Wissen. Darüber würde sie noch nachdenken müssen, später. Auch darüber, dass es vor dem Papageigedanken noch einen anderen gegeben hatte, einen ganz feinen, zarten, feiner und zarter als alle Gedanken, die sie kannte. Nur ein Flackern. Sie hatte ihn nicht rechtzeitig einfangen können. Vielleicht würde sie ihn wiederfinden.
Der offene Rucksack stand mitten im Zimmer, die Kleider lagen verstreut, hingeworfen im Taumel der Müdigkeit. Nie wieder reisen. Warum hatte sie sich darauf eingelassen? Sie mochte keine Abenteuer. Die Bilder der vergangenen Wochen fielen durcheinander. Die Suche nach ihrem Vater. Der Ashram in Goa. Das unberührbare Gesicht des Mannes, der ihr Vater war, vierundzwanzig vaterlose Jahre lang.
Morgenland. Abgrundfremd hatte sie sich gefühlt zwischen den feingliedrigen Frauen und Männern Indiens, archaisch und würdevoll in ihren bunten Tüchern. Erschreckt war sie gewesen von den Bettlern und zu Tränen gerührt von den knochigen heiligen Kühen, die so fragil und abwesend waren dank der Gewohnheit des Hungerns.
Die kleine, dicke Frau neben ihr im wild geschüttelten Flugzeug von Delhi nach Kathmandu hatte sich angstvoll an ihre Hand geklammert. Charlie wunderte sich über sich selbst. Sie kannte Angst so gut. Doch Indien schien alle Ängste erstickt zu haben. Unter dem Ansturm von Farben, Gerüchen, Klängen und der Schärfe der Masalas, im Sog unverhüllter, gefräßiger Blicke war ihre allgegenwärtige Panik zu einem Grundton geworden, den sie kaum mehr wahrnahm.
Draußen vor dem Fenster fiel die Klosterwand ab in die Tiefe und ging nahtlos in einen dicht bewachsenen Steilhang über. Baumspitzen ragten durch den kühlen Morgendunst herauf. Dort unten, schemenhaft, lag das Dorf mit der Bushaltestelle, am Fuß des langen Schotterwegs und grob gemauerter Treppenstufen, dem einzigen Zugang zum Kloster. Jeder Schritt ein Angriff auf Charlies reisemüde Beine. Nur noch ein kleines Stückchen, hatte Yongdu sie am vorigen Abend angefeuert, gleich haben wir es geschafft. Wie selbstverständlich hatte er ihren Rucksack auf den seinen geladen. Und jede einzelne Stufe hatte er mit der Taschenlampe für sie angeleuchtet.
Der Papagei kreischte durchdringend. Vom Tempelbereich des Klosters wehten die wohlklingenden Stimmen der Mönche herüber. Ein Gesang mit seltsamen Tonfolgen, nicht unmelodisch, doch überraschend und ein wenig bodenlos, als kämen Freude und Schmerz ganz nah zusammen, hob die Schwere des Morgens auf. Denn die Morgenstunden waren immer schwer für sie. Nur früher, als sie noch ein Kind war, in der heiligen Zeit vor dem Absturz, war es manchmal schön gewesen, den Tag zu beginnen. Den Tag ohne Ende. Freier Raum. Auf dem kleinen Fahrrad in den Anlagen am Kanal. Gelbe Löwenzahnmorgen, tiefgrüne Kastanientage, blauweiße Schneeabende.
Die Gegenwart war dicht vom satten Geruch des morgendlichen Holzfeuerrauchs. Ob man hier über Holzfeuer kochte? Die Küche war im ersten Stockwerk, hatte Ani Yeshe erklärt, die junge Nonne, die sie in Empfang genommen hatte. Ihr Pidgin-Englisch klang wie der Gesang eines exotischen Vogels. Was hatte sie ins Kloster getrieben? Ihr eigener Wille? Das Diktat der Familie? Ein Mann, den sie sich nicht aufzwingen lassen wollte? Sie war hübsch mit ihren lang gezogenen Augen und dem verhaltenen Lächeln, der porzellanglatten Haut und einem langen, zierlichen Hals. Charlie fühlte sich hässlich neben ihr.
Das Bad lag direkt neben der Tür zum Gästezimmer, ein unverhofftes Glück. Daneben befanden sich mehrere Türen, unbewohnte Räume, Lager für alle möglichen Dinge, und ein Zimmer, das einem Lama gehörte, doch der war in Tibet, sagte Ani Yeshe. Sie sei also ganz allein da oben und hoffentlich sei ihr das nicht unangenehm. Charlie wedelte eifrig mit den Händen, nein, es sei ihr gar nicht unangenehm, im Gegenteil, sie finde es gut. Ani Yeshe hatte matt gelächelt, als könne sie es nicht glauben.
Die leichte Morgenkühle war köstlich nach der Monsunhitze Indiens. Charlie wühlte ihren kleinen Toilettenbeutel aus dem Rucksack. Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, Hautcreme, Lippenpomade. Sie war stolz auf ihre spartanische Ausrüstung. So wenig zu besitzen war ein Quell der Leichtigkeit.
Das Badezimmer war ein gekachelter Kubus. Neben der Tür befand sich ein kleines Waschbecken mit einem einzigen Hahn, hinten die zwei Trittsteine der asiatischen Toilette zum Niederhocken, daneben ein Wassereimer unter einem weiteren Wasserhahn, an der Mitte der Decke die Dusche. Zudem noch der Luxus eines kleinen Warmwasserboilers mit einem Schlauch und Duschkopf, in der Ecke eine Gasflasche.
Ein Besucher mochte den kleinen, runden Spiegel an die Tür gehängt haben. Charlie mochte Spiegel nicht. Spiegel zeigten die falsche Person.
Ein Aufflammen ihrer hellen Haare. Knochenbleich hatte Hannah-Oma sie einmal genannt ohne Hoffnung, dass sie jemals dunkler werden würden zu einem ordentlichen, richtigen Blond. Eine kurze Begegnung mit dem eigenen wasserblauen Blick unter den fast weißen Wimpern. Sie wandte sich schnell ab, hatte sich längst verboten, über ihr Aussehen nachzudenken. Die Inder hatten sie angestarrt, nach ihren hellen Haaren gegriffen und trotz ihres Zurückweichens ihre weiße, kaum je bräunende Haut berührt. Kindermenschen, dumpf berauscht vom Anblick des Ungewohnten. Nur Yongdu hatte sie völlig gleichmütig angeschaut im Buchladen in Delhi. Ein Mensch, der einen Menschen sieht. Er wäre einem Yeti wohl nicht minder gelassen entgegengetreten, dachte Charlie.
Er hatte neben ihr gestanden, in das dunkelrote Tuch der Mönche und einen zarten Weihrauchduft gehüllt, hatte ihr Gespräch mit dem Buchhändler und ihre Frage nach dem Kloster gehört, sich höflich vorgestellt und gefragt, ob er helfen dürfe. Ein ziemlich großer, schmaler Mann, nicht jung, nicht alt. Seine langen Hände ließen Charlie an Reiher denken. In gutem Englisch erklärte er, dass er selbst zu dem Kloster fahre, welches sie suche. Es liege außerhalb des Kathmandutals, er könne sie mitnehmen.
»Sie wollen zur Jetsünma«, sagte er, nicht Frage, sondern Feststellung, als könne es keinen anderen Grund geben, in dieses Kloster zu wollen. Charlie zog die Augenbrauen hoch.
»Oh nein, ich will zu Padmasambhava«, widersprach sie, denn so hatte es der Swami im Ashram erklärt. Sie solle zu Padmasambhava in dieses tibetische Kloster in Nepal fahren, dort sei jemand wie sie am richtigen Ort.
Der Mönch lächelte, ein außerordentlich direktes, entspanntes Lächeln, das sie zornig machte, weil es allen Schmerz zu leugnen schien.
»Ich meine, ist er da, im Kloster?«, fragte Charlie.
»Guru Rinpoche ist immer da«, antwortete Yongdu. »So nennen wir Padmasambhava – Guru Rinpoche. Und Jetsünma, die große Meisterin, ist seine Vertreterin.«
Er war ihr fast vertraut nach der stundenlangen Fahrt im Taxi, dieser unbekümmerte Mann, für den der Unterschied von Kultur, Sprache und Geschlecht nicht zu existieren schien.
Der Flur führte zu einem offenen Treppenhaus, das erfüllt war von einem dunklen, würzigen Weihrauchgeruch nach Ritus und Geborgenheit. Herb, nicht blumensüß wie in Indien. Durch viele Wände gedämpft, drängten der Klang mächtiger Trommeln und schrille Trompetentöne vom Tempelbereich herüber. In diesem vorderen Flügel des Klosters, hatte Yongdu erklärt, wohnten die Übersetzerin und gelegentlich Gäste, ein paar Alte und auch einige Nonnen, Helferinnen der Jetsünma, des Oberhaupts der Klostergemeinschaft. Aber er habe doch gesagt, dies sei ein Männerkloster, hatte sie eingewandt. Yongdus bejahendes Wiegen des Kopfes bot wenig Klärung. Ihm war alles selbstverständlich und ihr so vieles fremd.
Noch mehr Treppen. Auf der Brüstung eines Laubengangs saß der Papagei in einem zu kleinen Käfig. Bunt, jedoch keine Schönheit, ein wenig zerzaust, an manchen Stellen kahl. Er war alt, wirkte angeschlagen und ein bisschen weise.
Der Papagei gurrte. Vorsichtig streckte Charlie einen Finger zwischen den Stäben hindurch und kraulte das weiche, ausgedünnte Halsgefieder.
»Tashi delek«, sagte der Papagei und drückte den Hals gegen den Käfig. Das Tier war tröstlich. Warm, lebendig, bereit zu einem Austausch, mochte er auch noch so gering sein.
»Tashi delek«, antwortete Charlie leise. »Kümmert sich niemand um dich?«
Der Papagei schaute sie aufmerksam mit einem Auge an. Langsam näherte er seinen Schnabel ihrem Finger und gurrte leise. Sie zog den Finger erschreckt zurück, schämte sich dann ihrer Ängstlichkeit und streckte ihn wieder hin. Der Papagei senkte den Kopf, so dass sie seine Stirn streicheln konnte.
»Entschuldige«, sagte sie. »Nimm es nicht persönlich. Das geht mir oft so. Ich bin ein Angsthase.«
Der Papagei gurrte und präsentierte seinen Hals. Charlie kraulte weiter. Sie hatte sich auf ihn eingelassen und konnte nun nicht einfach weglaufen. Dieses Gefühl für Höflichkeit und Rücksicht gegenüber Tieren hatte sie schon als kleines Kind gehabt. Ein »Getue« hatte Hannah-Oma es genannt. Aber Hannah-Oma, dachte Charlie mit unwillkürlichem Lippenkräuseln, tat sich mit Höflichkeit und Rücksicht auch gegenüber Menschen schwer.
Eine Bewegung im Flur schreckte sie auf. In diesem untersten Stockwerk, fiel ihr ein, hatten laut Ani Yeshe die Uralten ihre Behausungen, Mönche und Nonnen, die Hilfe und Pflege brauchten. Das Wesen, das auf leisen Filzsohlen heranschlurfte, war dem Papagei rührend ähnlich. Zerzaustes Haupthaar, lange, wirre Bartfäden, doch dazwischen ein fröhliches Gefältel und Augen wie Kohlen in der letzten Glut. Dem Papagei fehlte die Fröhlichkeit.
»Tashi delek«, murmelte der alte Mann und griff nach dem Käfig.
»Tashi delek«, erwiderte Charlie scheu. Das bedeute so viel wie glückliches Gedeihen, hatte Yongdu erklärt, und so habe man in Tibet einander an Neujahr gegrüßt. Und dann habe es sich zum gängigen Gruß entwickelt. Charlie erinnerte sich an das orthodoxe Osterfest, da sagte man zueinander: »Christus ist auferstanden.« Glückliches Gedeihen ist dem Herzen näher, dachte sie. Eines jeden Menschen äußeres und inneres Leben möge glücklich sein und sich gut entwickeln, so hatte Yongdu erläutert, vor allem das innere. Aber das äußere gute Leben brauche man schließlich auch dazu, mit hungrigem Magen denke niemand an die subtilen Bedürfnisse des Geistes. Mit zu viel drin, hatte er lachend hinzugefügt, allerdings auch nicht. Er konnte wunderschön lachen, mit voller, runder Stimme, von tief unten aus dem Bauch heraus.
Heiter nickend schlurfte der Alte mit dem Käfig in den Flur zurück, langsam, mit tastenden Schritten. Es war eine Sanftheit in diesem Mann, so ganz anders, als sie es von den alten Männern ihres Lebens kannte. Opa war nie sanft gewesen. Sie hatte sich immer ein wenig vor ihm gefürchtet. Bis zu seinem Tod war er der große Fremde in Hannah-Omas Haushalt geblieben.
Sie hätte den Alten nach der Küche fragen, mit dem Finger auf den offenen Mund zeigen sollen. Ob dies ausreichte, um »Küche« deutlich zu machen? Das Globetrotterbüchlein mit Hinduwörtern war überflüssig. Wie hätte sie wissen sollen, dass sie in einem tibetischen Kloster in Nepal landen würde.
Von dem Flur her, in welchem der Alte verschwunden war, roch es nach Essen. Einer der bunten Gerüche Asiens, doch heiterer, leichter als die Gerüche im indischen Flachland. Nun war sie in den Bergen, zu Füßen des Himalaya. Der Gedanke tat ihr wohl. Himalaya, das klang frisch und weise und dem Himmel nah.
Zögernd ging sie in den fensterlosen Flur, folgte dem Geruch, zog vorsichtig einen roten Vorhang zur Seite, hinter dem die Tür offen stand. Feuer streckte kleine, böse Zungen aus einem gemauerten Herd. Töpfe und Kellen drohten von der dunklen Wand herunter. Vor dem Herd kauerte eine Gestalt. Zwiefach beschienen war sie, mit einer feurigen, dem Herd zugewandten Seite und einer morgendlichen grauen Seite zum Fenster hin. Feuerdämon, Schattengeist. In was für ein Reich hatte der Flur sie ausgespuckt?
»Tashi delek«, sagte die Gestalt und erhob sich. Eine junge Frauenstimme, so unerwartet, dass Charlie ein verblüfftes »Oh, sorry, sorry!« entfuhr.
Die Gestalt in ihrer dunkelroten klösterlichen Verpackung lachte, ein hübsches, warmes Lachen. Charlie lächelte zögernd zurück, lächelte in das dunkle Auge einer Zahnlücke hinein. Schnell wandte sie den Blick ab. Gewalt. Schmerz. Ein Elektroknüppel, eine Holzstange, Fesseln, Blut. Sie wollte es nicht wissen. Das Wissen war noch fern, nur ein Funke, sie konnte es zurückweisen, die innere Tür schließen.
»No sovvi«, zwitscherte die Nonne, winkte Charlie heran und zündete ein paar Kerzen an. Ein Deuten zur nackten, lichtlosen Glühbirne an der Decke genügte als Erklärung. Kein Strom. Plötzlich spürte Charlie den Hunger wieder und wies mutig mit dem Zeigefinger auf ihren offenen Mund. Die kleine Nonne sagte etwas Unverständliches, schob Charlie zu einem Hocker neben dem groben Tisch und hantierte geschickt am Herd. Charlie verlor sich im Anblick der einfachen, natürlichen Bewegungen. Als wisse die Nonne nichts von sich selbst oder habe sich vergessen in der unerbittlichen Ordnung des Klosterlebens.
Ob Yongdu sich vergessen hatte? Vielleicht jene Seite in ihm, die nicht mit der Welt umgehen musste? Der Gedanke schmerzte und musste schnell weggeschoben werden. Er komme gerade von der Residenz des Dalai Lama in den indischen Bergen zurück, hatte Yongdu erzählt. Gern hätte sie ihn nach dem Zweck der Reise gefragt, doch sie fragte stets wenig, zu wenig, aus Angst vor Grenzüberschreitungen. Sie mochte auch nicht gefragt werden, obwohl, wie sie längst erkannt hatte, viele Leute gern über sich selbst redeten. Sie nicht. Und sie würde sich auch nicht vergessen können. Wie könnte man solch eine Last je vergessen?
Ani Lhamo hieß die Nonne. Das machte sie deutlich mit einem Klopfen auf die Brust und mehrfachen Wiederholungen. Charlie folgte ihrem Beispiel.
»Tscha-li«, ahmte Ani Lhamo heiter nach. »Tscha-li-la, good, tashi delek, Tscha-li-la, yepo-du.«
Was für ein unmöglicher Name, hatte Hannah-Oma gesagt, damals, als die kleine Charlotte in die Schule kam und darauf bestand, Charlie genannt zu werden. Im Kindergarten hatten die Kindergärtnerinnen ihren unhandlichen Namen zu Lotti abgekürzt. Evi hatte sich nicht gewehrt. Charlie konnte noch so oft sagen, dass sie nicht Lotti heißen mochte. Ach, was du immer magst und nicht magst, pflegte Evi zu sagen. Und hörte nicht zu. Charlie wusste, dass Evis Kopf unglaublich voll war, und hatte ein gewisses Verständnis dafür, dass diese Mutter nicht zuhören konnte.
In der Schule setzte sie den neuen Namen durch. Die Jungen versuchten es mit Cha-Cha, doch sie biss jeden, der sie nicht Charlie nannte. Sie sei ein schwieriges Kind, meinten die Lehrer.
Ani Lhamos Reis mit Linsen und eine Tasse Chai milderten Charlies übliches Unbehagen in der Morgenstunde und die zusätzliche Schärfe der Fremdheit. Tatsächlich fühlte sie sich sogar ein wenig wohl in dieser halbdunklen Küche mit der leise singenden Nonne, nahm das winzige Wohlgefühl dann mit hinaus in den Flur und die Treppe hinauf. Sie wünschte, sie könne Yongdu oder wenigstens Ani Yeshe nach den Wegen im Kloster fragen, auch, wohin man gehen durfte und wohin nicht. Sich allein auf die Suche zu machen wagte sie jedoch nicht. Es war alles so anders als im Ashram in Goa mit den verstreuten Häuschen unter Palmen und den vielen Besuchern aus aller Welt.
Fremdheit machte sie klein, stieß sie in die dunkelsten Ecken wütender Schüchternheit. Das war zu Hause nicht anders. Fremd, das war überall außerhalb ihrer selbst. Auch Hannah-Oma behielt stets ihre vertraute Fremdheit. Sogar Evi. In gewisser Weise stand Evi unter Charlies Schutz. Wenn Charlie heulte und »Mama, Mama!« schrie, wie sie es von den anderen Kindern hörte, dachte sie nicht an Evi. Eine Weile dachte sie an den Schutzengel, der, wie man ihr sagte, immer bei ihr sei. Später dachte sie an gar niemanden mehr. Das Heulen allein genügte, bis sie irgendwann nicht mehr heulte, nicht mehr rief. Da hatte sie die kurze Kindheit verlassen.
Sie befahl sich, nicht an die fernen Fremdheiten zu denken. Die nahen waren bedrohlich genug.
Der Dunst über dem Tal war gewichen und das Dorf lag ausgebreitet vor dem Klosterberg. Unter der aufsteigenden Sonne nahm die Wärme schnell zu. Charlie setzte sich auf die harte Matratze des Betts, dem Fenster gegenüber. Sie konnte hinausschauen auf die Wipfel der Rhododendronbäume, die am Steilhang wuchsen, zu weiteren, von Hochdschungel überzogenen Bergen und dem weiten, zarten, nackten Himmel darüber. Aus den unteren Fenstern stiegen schnelle, helle Trommelklänge und das schrille Klingen klei ner Glocken herauf.
Vielleicht sollte sie meditieren. Im Ashram hatte sie sich mit den anderen in der Schreinhalle hingesetzt, und dann sollte sie sich versenken und alle Sinne verschließen und inneres Licht sehen. Sie wusste nicht, wie sie ihre Sinne verschließen sollte. Sie roch den Schweiß der anderen in der indischen Monsunhitze, sie hörte Schnaufen und Rascheln und Kratzen, sie spürte die Schmerzen in ihren Knien. Sie sah keinerlei Licht.
»Ich war in Indien«, hatte sie zu Yongdu gesagt, »in einem Ashram«, und er hatte »I see« geantwortet, als sei damit alles klar.
Doch wie hätte sie ihm erklären sollen, dass sie die Suche nach ihrem Vater dorthin geführt hatte. Nach dem Mann, der ein Vater hätte sein können, wenn er Evi geliebt hätte. Und wenn er bei dem Baby geblieben wäre, das nie Papa sagen lernte, bei dem Kleinkind, das nie in die Arme des Vaters tapste, als es Laufen lernte, dem Schulkind, dessen Mutter nicht Mama, sondern Evi war und sich vor dem Elternsprechtag drückte. Ein Vater, sagte Evi, müsse zu den Lehrern gehen, der könne sich durchsetzen. Sie könne das nicht. Man nehme sie nicht ernst. Denn Evi sah selbst aus wie ein Schulmädchen, ein schüchternes Mädchen mit einer Tochter, die bereits in der Schule war. Für Hannah-Oma war und blieb diese Geburt, durch die sie allzu früh zur Großmutter geworden war, eine persönliche Beleidigung.
Doch nun verbot sich Charlie noch einmal nachdrücklich, in den Keller der Vergangenheit zu schleichen. Es gab darin nichts, dessen zu erinnern sich lohnte.
Unschlüssig stand sie auf und ging die Treppe wieder hinunter, hinaus in den Vorhof, der durch eine Brüstung gegen den Steilhang gesichert war. Auf einer Seite befand sich die Öffnung zum Weg, der zum Dorf hinunterführte, auf der anderen ein Durchgang zwischen der Klosterwand und nacktem Fels in weitere Höfe und Flügel des Klosters. Geradeaus führte eine steile Treppe im Fels zu einem erhöht liegenden Seitentrakt, ineinander verschachtelte Gebäudeteile, die am Berg klebten. Dort, so spürte sie, hatte sie nichts verloren. Es roch nach Grenze und Verbot. Der Durchgang hingegen schreckte nur durch die überhängende Felswand. Bereit schien sie, sich gegen die Hauswand zu stürzen, von der Macht des Bergs gezwungen. Mit Herzklopfen – schlage nicht, Herz, du weckst die Felsen! – tastete sie sich in den Durchgang, wollte schnell hindurchlaufen und brachte es doch nicht fertig. Sie drückte sich an der feuchten, fleckigen Mauer entlang und atmete auf, als ein kleiner Innenhof sich vor ihr öffnete. Die Sonne fiel auf die Felswand, die sich glatt und unschuldig im weißen Morgenlicht dehnte. Eine Reihe von blank geputzten Gebetsmühlen zog sich am Rand des Innenhofs entlang. Warum nannte man sie so? Mahlten sie die Gebete klein, bis sie genießbar waren? Charlie kicherte leise.
Eine Tür im Fels stand offen, führte in den Fels hinein, dahinter gab es nur Dunkelheit. Bergschoß. Märchenwelt. Sesam öffne dich. Neben der Tür döste ein struppiger Hund. Er öffnete ein Auge, schlug freundlich mit dem Schwanz auf den Boden und schlief weiter. Aus den Tiefen weiterer Klostergebäude drangen Gesänge in wunderlicher Melodik. Dort musste irgendwo der Tempel sein.
Offene Türen laden ein, dachte Charlie und schaute vorsichtig ins dunkle Innere. Eine kaum mannshohe Höhle zog sich wenige Meter weit in den Berg, verengte sich und endete in einem Schrein. Ein paar Butterlämpchen verbreiteten sanftes, gelbes Dämmerlicht. Auf dem Schrein wühlte eine dicke Ratte mit großer Geschwindigkeit in einem der Opferschälchen, Reis flog nach allen Richtungen. Charlie schnalzte mit der Zunge, die Ratte sah sich um, schoss spitze Blicke aus kleinen, aufmerksamen Knopfaugen, schätzte ab, ob es geboten war, den Reis im Stich zu lassen. Nach kurzem Innehalten wühlte sie weiter.
Charlie fand einen kleinen, festen Teppich und ließ sich darauf nieder. Eine zerbrechliche Geborgenheit breitete sich in der Höhle aus. Gedämpft sickerten Geräusche von draußen in die dämmrige Stille. Die Ratte begab sich zum nächsten Reisschälchen, um darin zu wühlen.
»Lass das«, sagte Charlie. »Das tut man nicht. Das ist heiliger Reis.«
Der schnelle Blick der Ratte mochte eine Spur Verachtung enthalten.
»Sorry«, sagte Charlie.
Eine wunderliche Unruhe überfiel sie, als blicke jemand sie an. Doch außer ihr und der Ratte war niemand in der kleinen Höhle.
Hoch über ihr, im ungewissen Dunkel über dem Schrein, sah sie plötzlich die Augen im Flackern der Butterlampen, große, runde, scharf blickende Augen unter schweren Augenbrauen, herausfordernd, durchdringend. Ein Hauch von Panik bannte Charlie auf ihren Platz. Verwunderung mischte sich ein. Sie hatte Angst, und doch vertraute sie dem Kloster. Wie war das möglich? Sie vertraute nie. Fast nie. Dem Swami hatte sie ein wenig vertraut, gerade so viel, um seinen Rat anzunehmen und sich auf die verrückte Reise zu diesem Kloster in Nepal zu machen, zu einem gewissen Herrn Padmasambhava, der ihr helfen sollte. Aus der Angst heraus, aus der schrecklichen Gabe des Wissens, aus dem Leiden an der Welt heraus.
Mit längerem Hinsehen wuchs die in Brokat verpackte Statue aus dem Dunkel hervor. Auf dem Kopf trug sie einen zur Krone geformten Hut, im Arm einen Stab mit aufgespießten stilisierten Köpfen, eine mächtige, wuchtige Gestalt, herausfordernd, bedrohlich. Charlie hatte einen sanften Buddha erwartet mit seinem angedeuteten Lächeln, der entspannten Haltung, weltabgewandt. Doch hier war sie bei den verrückten Tibetern, wie Anna im Ashram gesagt hatte, mit ihrem irren apokalyptischen Donnerkeilbuddhismus.
Aus dem Tempel drangen schrille Trompetentöne, dazu das rhythmische Geschepper von Becken, ein abgrundtiefes, erschreckendes Dröhnen und ein bestürzender Aufruhr mächtiger Trommeln. Töne aus der Unterwelt. Bedrohung. Abgrund. Vernichtung. Der scharfe Blick der Statue machte es nicht besser.
Charlie krampfte die Hände ineinander. »Oh Gott, nein!«, flüsterte sie, wollte die Augen schließen und wagte es doch nicht.
»Hallo?« Die fragende Stimme war nah. Ein Mann. Die Stimme ihres Vaters? Eine Welle von Verwirrung ergriff sie, riss sie aus der Zeit, in den tiefen Raum, in dem Träume gebrütet werden.
Ihr eigenes keuchendes Atmen hielt sie auf. Eine Hand berührte ihre Schulter. »Alles okay?«
Sie sprang auf, drückte sich an dem fremden Körper vorbei, lief hinaus ins beißende Sonnenlicht, zwischen Hauswand und Fels hindurch über den Vorhof und in das schützende Halbdunkel des Durchgangs zum Treppenhaus. Nun war es nicht mehr die Panik, die sie trieb, sondern die Scham. Wie das Mädchen sich aufführt, sagte Hannah-Oma. Es ist peinlich. In unauffälliger Eile versuchte sie, in ihr Zimmer zu gelangen, nur eine Treppenstufe auf einmal, an einer sehr alten Nonne vorbei, oder war es ein alter Mönch? Ihr schneller Blick fing nur das rote Gewand und den geschorenen Kopf auf und die Falten im braunen Gesicht, schwer von Leben.
Die Aufregung der Flucht verlieh ihrem kleinen Zimmer eine unverhoffte Vertrautheit. Sanft schlossen sich die maisgelben Wände um sie. Alles war, wie es sein sollte, die luftigen gelben Vorhänge, der Webteppich auf dem Boden, der massive Bettkasten mit geschwungener Rückwand, daneben das geschnitzte Tischchen, an der Wand der schlicht gerahmte Druck eines Buddha-Bildes. In der Ecke stand der offene Rucksack, und auf der Fensterbank lag das Buch eines tibetischen Autors, das im Pilgrims Bookstore in Kathmandu nach ihr gegriffen hatte. Es sei dies ein ganz außergewöhnliches Buch, hatte Yongdu gesagt, als sie den Laden gemeinsam verließen. Ein geheimes Buch. Es halte sich selbst geheim.
Auf dem Bett sitzend verlor Charlie sich im Labyrinth ihrer unruhigen Gedanken. Warum hatte der Swami sie hierher geschickt? Wie sollte sie sich hier mit ihrem Anderssein versöhnen können? Wie sollte sie hier lernen, so ganz und gar außerhalb der Welt, in die Welt zu passen? Bei den irren Tibetern?
Sie hatte früher vieles gewusst, das andere nicht wussten, hatte Zukünftiges gesehen und auch gehütete Geheimnisse. Das Wissen kam ohne ihr Zutun, und es erschien ihr selbstverständlich. Doch man hatte sie dafür bestraft. Sie sollte nicht wissen, was geschehen würde, und nicht, was andere geheim halten wollten. Es war eine soziale Sünde. In Indien schien es anders zu sein. Vor der Reise hatte sie einiges über Indien gelesen. Offenbar durfte in Indien sein, was in ihrer Welt nicht geduldet wurde. Dort nannte man solche außergewöhnlichen Fähigkeiten Siddhis, und wer sie hatte, wurde sogar verehrt.
Sie schaute auf das träge Dorf hinunter. Die Frage, was sie hier sollte, warum sie hierher geraten war, blähte sich auf, wurde quälend. Hätte sie sich nur nie auf diese Reise begeben. Wozu einen Vater suchen, der sie nie hat haben wollen? Nicht einmal das süße Baby war imstande gewesen, diesen Mann zu halten. Evis Fotoalbum zeigte ein Hochglanzbaby mit weißem Flaum auf dem Kopf, großen feuchten Augen und einem aufgeworfenen Mündchen wie die Puppe, die Hannah-Oma ihr einmal geschenkt hatte. Obwohl sie wusste, dass Charlie keine Puppen mochte.
Man könnte meinen, dachte Charlie, sie verdiene es nicht, geliebt zu werden. Gewiss gehörte sie zu jenen, die man nicht leicht lieben konnte. Das hatte Hannah-Oma später oft genug betont. Doch damals war sie noch klein und niedlich gewesen. Ein angenehmes Baby, mit Evis Worten. Sogar Hannah-Oma hatte sie irgendwie gemocht. Nur er nicht. Er verließ sie. Ein Herumtreiber, hatte Hannah-Oma gesagt. Und dass er es zu nichts brachte, hatte sie fast mit Befriedigung betont, und, na ja, solchen wie ihm müsse man nicht nachweinen, wenn sie sich nach Indien verdrückten, dort passten sie hin. Für seine armen Eltern sei das ja schlimm, fügte sie dann gern hinzu und seufzte, die hätten etwas Besseres verdient. Charlie hatte gespürt, dass Hannah-Oma die Leute nicht mochte, und sie hatte Evi gefragt, warum lügt Hannah-Oma?
Dass er immer noch in Indien sei, hatte die fremde Frau, die irgendwie ihre andere Großmutter war, es aber nicht sein wollte, am Telefon gesagt. Und dass es ihm gut gehe und er dort eine Art Mönch sei. Ein Hindu-Mönch, erklärte die Frau, und es klang sehr, sehr traurig.
Es war ihr als gute Idee erschienen, sich ins Irgendwo zu werfen und den verlorenen Vater zu suchen. Dass er in Indien war, verhieß weite Räume. Denn das war es, was es bei Evi und Hannah-Oma und in der ganzen großen, dichten, vollgestopften Stadt nicht gab. Ebenso wenig wie in den großen, dichten, von lebenswütigen jungen Menschenwesen überquellenden Hörsälen, in denen sie sich vergeblich weite Räume des Geistes erhofft hatte.
Im Ashram sprach dieser Mann, der ihr Vater war, von Liebe, doch da war zugleich immer auch von »göttlich« die Rede. Er sprach von Gott und Licht und Freiheit und innerer Stille und dass alles ganz einfach sei, und immer wieder von Liebe, Liebe, göttlicher Liebe.
Sie war wütend und fühlte sich schuldig.
Im Schutz der Entfernung wagte sie den Gedanken, dass dieser Mann vielleicht niemanden mögen konnte. Natürlich lag es nicht an ihr, war es nicht die Schuld der Kinder, wenn sie nicht geliebt wurden.
Father-Man hatte sie ihn laut im Ashram genannt. Sein Gesicht war starr geblieben wie immer, doch sie hatte sein Unbehagen gespürt. Nur bei der ersten Begegnung war eine Erschütterung in diesem großen, ein wenig teigigen Gesicht zu sehen gewesen, ein Zittern der Lippen, ein feuchtes Blinzeln der mattblauen Augen. Wenn er die Arme geöffnet hätte, wenn er gesagt hätte, meine Kleine, wenn er sich gefreut hätte – was wäre dann gewesen? Hätte es sie verändert? Hätte es ihr Leben verändert?
Ein entfernter Klang von Stimmen. Sie waren fertig im Tempel, fertig mit – wie sollte sie es nennen? Gottesdienst passte wohl nicht. Sie musste sich organisieren, wichtige Wörter aufschreiben, ein bisschen Tibetisch lernen. Sie brauchte Yongdu, brauchte ihn für die Wörter und für ihre Sicherheit. Brauchte ihn. Für sich. In den Höfen des Klosters würde sie ihn vielleicht finden. Doch sie würde sich auch dem Sperrfeuer fremder Blicke aussetzen. Es gab zu viele Blicke auf der Welt. Der Schutz des Zimmers war langweilig, jedoch das geringere Übel.
Mittags würde sie Yongdu suchen. Sie würde sich ihm anvertrauen. Sie würde sich ihm zeigen, die Charlie am immerwährenden Rand des Abgrunds. Vielleicht würde sie die richtigen Worte finden, möglicherweise sogar leichter in der fremden Sprache. Sie wollte ihm sagen, dass es keinen Ort für sie gab auf dieser Welt. Nie gegeben hatte. Dass es nur Fremdheit gab für eine wie sie, solch ein absurdes Wesen jenseits aller Anpassung. Er sollte wissen, dass sie nichts erwartete, dass sie sich keinerlei Erwartung mehr zugestand. Würde er verstehen, dass sie nur deshalb noch lebte, weil die Alternative eine zu große, zu pathetische Aktivität von ihr verlangte? Die Psychotherapeuten hatten es nicht verstanden.
Das Bild vor dem Fenster ließ sich in ihr nieder. Büsche und hagere Bäume, darunter die einfachen Häuser des Dorfs, manche geduckt, daneben roh gemauerte, mehrstöckige Klötze mit den typischen Simsen, die ein Stockwerk vom anderen trennten. Am Dorfrand dann die Hütten, von groben Steinmauern eingeschlossen. Ein Bus fuhr von der Bushaltestelle ab, auf dem Dach saßen gedrängt, klein wie Moskitos, Passagiere zwischen Kartons und zusammengeknoteten Bündeln.
Aus welcher Laune heraus hatte der Swami sie in ein tibetisches Kloster geschickt? Weil er sich keine Anhängerschaft von ihr erhoffte? Und weshalb gerade in dieses? Es gab genügend tibetische Klöster in Indien, wieso denn nach Nepal? Und warum hatte sie auf ihn gehört? Mochte sie ihn? Irgendwie, ja. Und doch erschien er ihr sehr fern, dieser kleine, runde Mann mit seinem runden Kopf und den runden Fingern und seinen großen, runden Lippen. Ein freundlicher Mann mit zwei dicken, mütterlichen Säcken an der Brust, die sich unter dem dünnen Stoff seines Gewands wölbten. Das Gesicht in diese weichen Säcke drücken, dieses Bild kam immer wieder.
Wie gut es tat, von ihrem erhöhten Platz am Fenster aus über die Vorberge hinwegzuschauen, Riesenwellen, die der Erde ihre Schwere nahmen. Hinter dem Klosterberg türmten sich die weißen Riesen des Himalaya auf. Vom Kloster aus waren sie nicht sichtbar, doch glaubte sie den harten Schnee, das ewige Eis zu riechen. Am anderen Ende des Kathmandutals, hatte Yongdu gesagt, gebe es einen Ort, von dem aus man sie allesamt sehen könne, die heiligen weißen Majestäten in all ihrer Pracht. Ehrfürchtig hatten seine Worte geklungen, als spreche er von lebendigen Wesen, von Königen oder Göttern. Doch waren sie nicht eher drohende Götter, mächtig, unbarmherzig? Verschlangen die Menschen, welche sie bestiegen oder nur über die Pässe den Weg in die Freiheit suchten?
Hatte sie jemals über Götter nachgedacht?
Schön beten vor dem Schlafen, sagte Hannah-Oma, damit der liebe Gott dich nicht vergisst. Doch Evis Schutzengel schien vertrauenerweckender und blieb schließlich der Gewinner. Die Entscheidung war zunächst nicht leicht gewesen, welchen anzurufen sicherer war, den allmächtigen Liebengott oder den Schutzengel mit seinem ausdrücklichen Schutzauftrag. Und mochte nicht der eine ihr übel nehmen, wenn sie sich an den anderen wandte?
Niemandem hatte sie je anvertraut, dass sie noch immer mit den Engeln zugange war. Natürlich war es nicht so, dass sie an Engel glaubte. Nicht direkt, aber irgendwie.
Sie mochten noch andere Namen haben, doch das war ohne Bedeutung. Es war ihr immer wohl gewesen mit den Engeln.
Unter den grellen Schlägen eines Gongs schrieb sie in das Ringheft, das sie für Aufzeichnungen und Gedichte in der Seitentasche ihres Rucksacks aufbewahrte:
Einer der in den Himmeln treibenden Engel
hat seine dunklen Flügel gefaltet
und sich im Sturzflug auf den Tag geworfen
Der Raubengel mit goldenem Schnabel
entriss mir alle Sicherheit
von der ich je träumte
2
»Tscha-li-la!«, rief Ani Lhamo heiter.
Ein reicher Duft nach Gemüse und Reis erfüllte die Küche, dazwischen die sanften Wellen eines Geplauders, luftig wie Kinderreime. Auf dem Fenstersims saß ein junger Mann, von der grellen Mittagssonne in Weißgold gehüllt. Als Jakob stellte der Fremde sich auf Deutsch vor. Er wusste schon von ihr, hatte vielleicht gerade von ihr gesprochen. Er befinde sich seit Langem zu einem »eher unstrengen« Meditations-Retreat im Kloster, gehöre schon mehr oder minder zur Einrichtung. Groß und dünn war er, mit Dreitagebart und runden, freundlichen Augen, die langen Haare im Nacken zusammengebunden. Er mochte der Mann sein, der in die Höhle gekommen war. Er trug eine Dunkelheit in sich, eine lauernde Krankheit. Sie wusste es. Da war es wieder, dieses Wissen, das sie nicht wollte und lang unterdrückt hatte. Viele Menschen trugen Krankheiten mit sich herum, man konnte sich nicht mit allen befassen. Doch die gelassene Trauer in seinem Gesicht kroch ihr unter die Haut. Da war eine Offenheit, die der Dunkelheit in seinem Leib Trotz bot. Nein, sie wollte es nicht sehen, dieses drohende Dunkel. Doch es drängte sich auf, warf sich gegen ihre Schutzwände, als durchlöchere die ruhige, durchdringende Atmosphäre des Klosters ihre Abwehr. Denn das Wissen hatte ihr nur Leiden gebracht, immer nur Leiden. Sie bestand auf ihrem Entschluss, mauerte eine Bastion von Gedanken hoch: Ich will es nicht wissen – ich weiß es nicht – es geht mich nichts an.
Eine kleine Wohltat war es, sich wieder in den gewohnten Bahnen der eigenen Muttersprache zu bewegen. Mit all den vertrauten Wendungen und Füllseln, eine willkommene Ablenkung.
»In der Schule war ich nicht besonders gut in Sprachen«, sagte sie. »Ich war immer zu faul zum Auswendiglernen.«
Er liebe Pidgin, erklärte Jakob. Ein bisschen Tibetisch, ein bisschen Nepali, ein bisschen Spanisch, und Englisch nur deshalb, weil er sich schon so lang in Asien herumtreibe. Aber er habe andere Tugenden. »Ich bin das Computer-Faktotum unserer Übersetzer«, erklärte er. »Der unverzichtbare Software-Wichtel. Herr der digitalen Geister.« Er kicherte in sich hinein. »Ich war mal ein ganz guter Hacker.«
Währenddessen war eine junge Nonne in die Küche gekommen und hatte ein Tablett mit gefüllten Schalen beladen.
»Hallo, Ani Jangchub«, sagte Jakob. »Ani-la bringt den Alterchen ihr Essen. Echt gute Typen, diese alten Mönche und Nonnen. Meditieren die ganze Zeit und sind bester Laune. Magst du Löffel oder Stäbchen?«
Charlie hob die Schultern. Mit einem kleinen Nicken wies Jakob auf das Regal an der Wand, in dem sich Essschalen verschiedener Größen und Blechbüchsen voller Löffel und Essstäbchen befanden.
Mit schwungvoller Geste ergriff Jakob ein Tablett und hielt es neben dem Herd bereit. »Wenn du willst, essen wir draußen. Ich erklär dir dann, wie es hier so läuft.«
Er führte sie treppauf und treppab zu einer kleinen Dachterrasse, wo sie sich in den Schatten zweier Solarpaneelen setzten. Der Steinboden war warm, eine andere Sitzgelegenheit gab es nicht.
Im Inneren des Bauwerks kreischte der Papagei in die tauben Ohren der Alten, Wünsche vielleicht oder Klagen. Auch das wollte sie nicht wissen, nicht den Schmerz des Tierseins, auch nicht den Schmerz des Alterns, des Zerbrechens. Und wusste es doch schon.
»Ani Lhamo kocht gut«, sagte Jakob. »Volle Liebe in den Topf.«
Mit gefalteten Händen rezitierte er etwas Tibetisches über seiner Schale. Charlie faltete ebenfalls die Hände, es gefiel ihr, sich für gute Umstände zu bedanken. Wem sollte sie danken? Vielleicht dem Universum. Dazu fühlte sie eine gewisse Beziehung.
»Früher, bei den Punks«, sagte sie, »vergnügten wir uns mit dem Spruch der Simpsons: Ich danke für gar nichts, hab alles selber bezahlt.«
»Habt ihr?«
»Na ja, irgendwie schon. Meistens war es unser erbetteltes Geld. Aber vergnügt war eigentlich keiner. Gelacht haben wir aus Verzweiflung.«
Jakobs langer Blick ließ ihre Nerven zucken. Sie hatte zu viel gesagt, den Schutz vergessen. Eilig lenkte sie ab, erzählte mit mageren Worten von der Reise, vom Ashram, vom Swami. »Er meinte, ich solle hierher gehen, zu diesem Kloster, zu einem gewissen Meister Padmasambhava. Ups, bis ich mir diesen langen Namen merken konnte! Wo ist er eigentlich, der Padmasambhava? Yongdu sagte, er ist immer da. Wo finde ich ihn?«
Jakob lachte. »Du hast ihn schon gefunden. Gestern, in der Höhle. Es ist seine Höhle.«
»Hab ich mich erschreckt! Aber wer …? Außer dir war niemand da.«
»Die Statue«, sagte Jakob, »das ist Padmasambhava.«
Eine Statue! Charlie kicherte hilflos. Der Swami hatte sie zu einer Statue in einer Höhle geschickt.
Ein paar Dohlen tanzten auf der kleinen Brüstung der Terrasse, intelligente Gier in den Knopfaugen.
»Guru Rinpoche«, fuhr Jakob fort, »so nennen ihn die Tibeter. Für sie ist er der zweite Buddha dieses Zeitalters. Er verbrachte einige Zeit in dieser Höhle, als er Buddhas Lehren aus Indien nach Tibet brachte. Heißer Typ. Ist schon mehr als tausend Jahre her. Aber etwas von seiner Energie ist hier geblieben, das kannst du mir glauben.«
Das war es also, was sie in den wilden, herausfordernden Augen gesehen hatte. Die sie ängstigten und anzogen.
»Ist was?«, fragte Jakob. »Dein Essen wird kalt.«
Charlie schob ihre halb geleerte Schale in die Nähe der großen Vögel. »Ich bin noch nicht ganz angekommen«, sagte sie. »Mich verwirrt das alles. Ich dachte, Padmasambhava sei jemand, mit dem ich reden kann.«
Jakobs breites, rückhaltloses Lächeln mit den großen, ein wenig vorstehenden Schneidezähnen tat wohl. Es ließ das Dunkle in ihm fast unsichtbar werden. Doch es war da, unübersehbar. Es wartete, versteckt, sprungbereit. Wartete auf seine Gelegenheit. Wie viel wusste er?
»Dafür gibt’s die Jetsünma. Das heißt, sie redet nur selten.«
»Yongdu sprach auch von einer Jetsünma. Wer ist das?«
»Die Obernonne«, nuschelte Jakob mit vollem Mund, »oder eigentlich keine Nonne. Die Meisterin. Eine Yogini, eine richtige Dakini, verstehst du?«
Charlie schüttelte den Kopf.
Jakob lachte und schob mit dem Löffel eine weitere Ladung Reis in den Mund, bevor er antwortete. »Dakinis sind weise Frauen. So eine Art weise Hexen, Sky dancer, Himmelstänzerinnen. Emily, unsere Übersetzerin, sagt, es sei die Energie der Inspiration, die sich in Frauen verkörpert. Sie muss es ja wissen. Stell dir was darunter vor. Jedenfalls hab ich eine Frau wie die Jetsünma noch nie erlebt. Der Hammer! Wenn ich mir Guru Rinpoches Lieblingsgefährtin vorstellen soll, dann unsere Jetsünma in Jung.«
Und Jakob begann von der Jetsünma zu erzählen, dem Kind der Geliebten eines tibetischen Ministers, das sich mit seiner Mutter vor einem halben Jahrhundert auf der Flucht vor den Chinesen durch Schnee und Eis der Himalaya-Riesen kämpfen musste. Dann von ihrem guten Leben im indischen Kalimpong in der alten Handelsstation ihrer Verwandten und von den Hungerjahren als Nonne in einem armen Kloster in Nepals Grenzgebiet zu Tibet. Und wie sie sich an einen Rinpoche hängte und lernen wollte, was sonst nur Mönchen vorbehalten war – die Philosophie und Psychologie und Metaphysik des Buddhismus, die tantrischen Meditationen und Tsa Lung, die geheimen Energieübungen.
»Und du glaubst es nicht, sie hat sich durchgesetzt«, sagte Jakob, die Augen groß vor ehrfürchtiger Begeisterung. »Ein berühmter Rinpoche hat sie dann sogar geheiratet. Oder sie ihn, wie man’s nimmt. Sie war so eine Wilde. Viele Jahre lang hat sie in einer Einsiedelei in den Bergen gelebt und auch noch ein Jahr im Dunkel-Retreat verbracht. Eingemauert. Essen gab’s nur durch eine Klappe. Stell dir das vor! Ein ganzes Jahr. Da würde unsereins doch total verrückt. Und ihr Kommentar dazu: Gut für die Meditation, nicht so viel Ablenkung. Wow! Sie lebt sehr zurückgezogen und spricht fast gar nicht, aber ihr Input ist unglaublich. Ich sag dir, du hast ein Riesenglück, dass du in ihrem Kloster sein darfst.«
Charlie betrachtete mit Eifer ihre Zehennägel, die geschnitten werden sollten, vor allem der große. Ein ganzes Jahr lang Nacht, ständige Finsternis, ständige Bedrohung. In den Träumen gefangen. Sie wollte nicht daran denken, nicht an so etwas. Der kleine Zehennagel wuchs ein wenig schief. Wenn sie wieder zu Hause war, würde sie ihre hübschen hohen Schühchen wegwerfen. Nach all der Freiheit würde sie ihren Füßen die dunkle Enge modischer Schuhe nicht mehr zumuten können. Wie war Jetsünma in der Finsternis mit ihren Träumen zurechtgekommen?
»Ich möchte meditieren lernen«, sagte Charlie. »Könntest du mir das beibringen?«
Ein amüsierter Blick. Da finde sich schon jemand, erwiderte Jakob. Die Jetsünma würde das entscheiden. Aber er würde ihr gern dies und das über den Buddhismus erzählen. Am besten als Erstes die Geschichte des Buddha. »Ein Wahnsinnstyp«, sagte er, »du wirst ihn mögen.« Und er lachte lauthals, als gäbe es das Dunkle in ihm nicht.
Jakob nannte sich Hobbymeditierer. Es sei eine lockere Klausur, sonst könne er sich ja nicht so einfach dazwischen zum Plaudern hinsetzen. »Weißt du, Strenge ist nicht mein Ding. Vielleicht im nächsten Leben. Oder vielleicht auch gar nicht.«
Charlie hörte den Unterton. Sie war allzu gut im Untertönehören. Dort, wo sie nicht hindenken, nicht hinfühlen wollte, regte es sich, das schlimme Wissen.
»Du denkst ans nächste Leben? Jetzt schon?«
Sie hatte das nicht sagen wollen. Es war wie früher, als sie klein war. Da rutschte das Wissen oft aus ihr heraus, manchmal mit großem Druck, gegen ihren Willen.
»Du nicht?« Jakobs schiefes Grinsen hatte Kanten.
»Oh, weiß ich nicht. Ich dachte nur, weil du das so sagst, ich meine, einfach so: Dann, wenn ich wieder daheim bin. Eben bald. Ich kenne mich nicht aus mit Wiedergeburt. Meinst du, das gibt es?«
Sie war zufrieden mit sich. Das Ablenken gelang ihr, sie hatte es über Jahre hin mit Sorgfalt geübt. Jakob entwickelte mit sichtlichem Vergnügen seine Vorstellung vom Werden und Vergehen und Wiederwerden, vom Kontinuum der Bewusstseinsenergie, von Gewohnheitsmustern der Existenz, von Kausalität und Interdependenz.
Er zog sie mit hinein in dieses Spiel der Gedanken, und es gefiel ihr, mit der Logik zu tanzen. Sie mochte Logik. Man konnte sich einigermaßen sicher damit fühlen. Man würde wiedergeboren und eine neue Identität, ein neues Selbstbild aufbauen. Aus den alten Mustern, wie Jakob sagte, denn die bringe man mit. »Wenn man bedenkt, dass in ein und derselben Familie so unterschiedliche Kinder aufwachsen. Mein Bruder ist Manager einer riesigen Lebensmittelhandelskette. Kannst du dir das vorstellen? Für ihn bin ich ein Spinner, ein Loser. Verloren für die Welt. Tja, eine Frage des Blickwinkels. Für mich ist eher er der Verlorene.« Und er beschrieb ausführlich und nicht ohne Zuneigung den älteren Bruder mit dem frisierten Lächeln, der gestylten Ehefrau und zwei Hunden, die praktischer waren als Kinder.
Die Sonne hatte Charlies Schattenplatz fast erreicht, als Jakob sich zu seiner »Nachmittagssession« begab, in sein Zimmer in einem anderen, älteren Teil des Klosters. Charlie trug die Essschalen in die Küche und wusch sie aus. Ani Lhamo war verschwunden, im ganzen Kloster war es sehr still. Wo war Yongdu? Hätte sie doch nicht vergessen, Jakob nach Yongdu zu fragen!
Die Einsamkeit überfiel sie mit all der Ausweglosigkeit, die zu ertragen das Außenseiterleben sie gelehrt hatte. Dorthin konnte ihr niemand folgen. Niemand hatte es je versucht. Dort war es kalt unter der subtropischen Sonne und finster am wolkenlosen Mittag. Als Kind hatte sie den Kopf gegen die Wand geschlagen, wenn Evi nicht in der Nähe war. Doch Evi hatte sie ertappt, hatte ihren Kopf festgehalten und geschrien: Was machst du da? Hör um Gottes willen auf! Was bist du für ein verrücktes Kind!
Das war noch vor dem Absturz. Danach hatte sie dann andere Mittel gesucht, tiefer in sich, unsichtbar.
Sie lief in dem kleinen Zimmer hin und her, wagte sich nicht hinaus in die bedrohliche, sonnengrelle Stille des Klosters.
»Was tu ich hier?« murmelte sie wütend. »Warum hat mich der Trottel von Swami hierher geschickt? Kannst du mir das sagen, Padmadingsda? Was hab ich hier verloren?«
Irgendwann schlief sie ein, aus abgenützter, alltäglicher Verzweiflung, zusammengerollt auf dem harten Bett.
Er rennt, so schnell er kann. Die Luft liegt schwer in der Nacht, pisseschwer, angstschwer in der langen, zu langen Gasse. Sie kommen von hinten, von vorn, er ist in der Zange. Er könnte springen, mehr als springen. Er könnte den tiefen Atem nehmen und nach oben schnellen. Er könnte es schaffen. Doch wie weit käme er? Nicht bis auf die Dächer. Ihre Messer würden ihm folgen. Die Gasse zwängt ihn ein, drückt die Arroganz aus ihm heraus wie dünne Scheiße. Oh, er weiß um diese Schwäche, die seine Überlegenheit infrage stellt. Vertraue nicht, vertraue niemals, nicht einmal dir selbst. So oft hat er sich dies schon gesagt.
Die Dob-dobs jagen ihn erbarmungslos. Warum? Sie sind nah. Die Gasse zum Barkhor ist so endlos lang. Eine Seitenstraße, noch eine. Er hört das matte Trommeln der Schritte, doch nun nur noch von hinten. Tief, tief atmen, halten, nach vorn explodieren, laufen, ohne den Boden zu berühren. Fliegen.
»Charlie?«
Wo war die Gasse? Die Sonne stürzte blendend in den Raum.
»Ich habe mehrmals geklopft«, sagte Yongdu. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Weißt du, wie Fliegen geht?«, fragte sie schlaftrunken. »Ich meine, so schnell laufen, dass du fliegst?«
Die gleißende Helligkeit schlug in ihre Gedanken ein. Plötzlich war sie sich ihrer wirren Haare und des schlafheißen Gesichts bewusst. Rot wie ein Krebs. Gekochter Albino.
Yongdu stand an der Tür in höflichem Abstand. »Nein, das kann ich nicht«, antwortete er. »Aber ich übe mich in Levitation. Ich habe Hoffnung. Es wäre praktisch. Wir haben hier keine Aufzüge.«
»Dob-dobs«, murmelte sie. Es war schwierig, die dunklen und die hellen Gedanken zu entwirren. »Da waren Dob-dobs.«
»Dob-dobs? Die Mönchspunks? Was ist mit ihnen?«
»Ein Traum. Merkwürdig.«
Was Yongdu auch immer denken mochte, es blieb verborgen.
»Komm, steh auf, Jetsünma möchte dich sehen«, sagte er.
Jetsünma! Die weise Frau! Die Hexe! Sollte sie sich vor ihr fürchten? Würde sie ihr vertrauen können? Doch wie sollte sie vertrauen in all dieser Fremdheit, die noch verwirrender war als die Fremdheit zu Hause? Nicht nur diese seltsamen, wiegenden Kopfbewegungen, die ebenso gut »ja« wie »nein« bedeuten konnten, oder auch »vielleicht«. Mehr noch die Ahnung von Nähe, bestürzender Nähe. Immerwährendes Ertapptwerden. Die Blicke aus den schmalen tibetischen Augen waren so beunruhigend klar.
»Ich warte unten im Hof auf dich«, sagte Yongdu und zog die Tür hinter sich zu.
Sie bürstete die Haare und kramte ein weißes indisches Hemd aus dem Rucksack, sauber, aber voller Knitterfalten. Im letzten Augenblick zog sie am Zipfel eines dünnen indischen Tuchs, das aus dem Rucksack hing, und legte es sich um die Schultern. Eine dünne, orange- und pinkfarbene Wolke. Unzureichender Schutz. Jakob hätte nicht so viel von der Jetsünma erzählen sollen.
Yongdu ging voran durch den Vorhof und die lange Außentreppe zum Nebenbau hinauf. Sie hätte ihm gern gesagt, dass sie dankbar war für sein Kommen, dass sie ihn gesucht hatte, dass sie sehr verwirrt war und sich alleingelassen fühlte ohne ihn. Doch all dies war unsagbar. Als würde sie sich nackt ausziehen und sich ihm zu Füßen legen. Solche Dinge sagte man nicht. In Büchern waren Leute manchmal so mutig, aber nicht im wirklichen Leben.
Es roch nach Räucherwerk und Butterlämpchen, ein weicher, wohliger Geruch, der das ganze Gebäude durchzog. Aus den Eingeweiden der Gebäude drangen tiefe Trommelschläge, rezitierende Stimmen, die Schreie des Papageis. Das Kloster war wieder lebendig.
Auf einer kleinen Terrasse – es bot sich von dort, hoch am Steilhang, ein weiter Blick über die verwinkelten Flügel und Dachterrassen des Klosters – lockerte ein kleiner Nepalese leise singend die graue Erde in einer Reihe von großen Blumentöpfen mit sattgrünen blühenden Pflanzen. Er saß in der Hocke, einen Arm um den Topf geschlungen, als halte er ein Kind, die andere Hand grub und wühlte vorsichtig mit einem kleinen Messer in der Erde. Charlie fühlte sich zum Weinen gerührt und war zugleich ärgerlich über die Gefühlsaufwallung. Verdammte Nerven, sagte sie lautlos.
Ende der Leseprobe