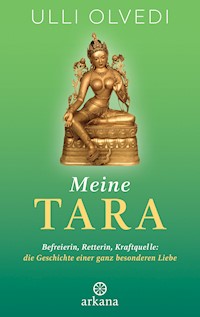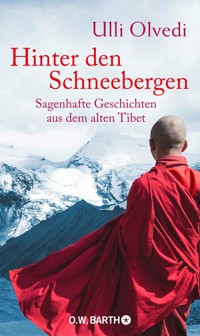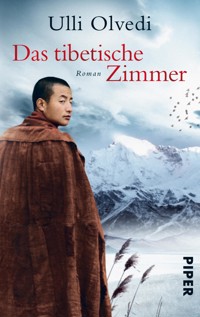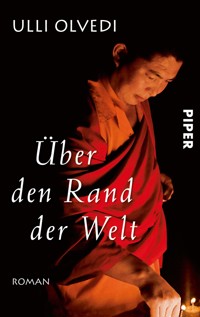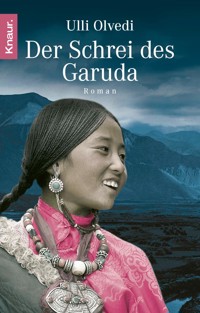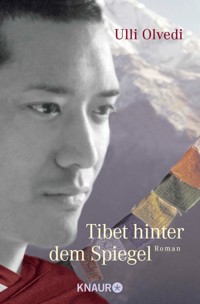
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die bekannte Autorin Ulli Olvedi hält alle ihre Fans mit diesem spannenden buddhistischen Krimi in Atem. Diebstahl, Mord, Verrat – es sind nicht die besten Voraussetzungen, unter denen drei höchst unterschiedliche Menschen in Kathmandu zusammentreffen: der Tibeter Tashi, die deutsche Buddhistin Teresa und deren Enkelin, die Punkerin Joe. Zusammen fliehen sie in die Berge, ins tibetische Grenzgebiet, wo sich ihr Schicksal auf dramatische Weise entscheidet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ulli Olvedi
Tibet hinter dem Spiegel
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein altes, wertvolles Rollbild verschwindet aus einem Kloster in Tibet. Ein tibetischer Maler sakraler Bilder, der in Nepal für die Kunstmafia arbeitet, wird ermordet. Ein Freund des Malers, Tashi, wird verfolgt und findet schließlich Unterschlupf in einem Nonnenkloster.
Diese Ereignisse führen dazu, dass drei sehr unterschiedliche Personen in Kathmandu zusammentreffen: der Tibeter Tashi, der lange im Westen gelebt hat, die deutsche Buddhistin Teresa, die seit vielen Jahren im Osten lebt, und Teresas Enkelin Joe, eine Punk-Göre auf Ferienbesuch.
Teresa hatte nach vielen Enttäuschungen nicht erwartet, sich jemals wieder zu verlieben. Doch Tashi, eingeweiht in die Praktiken der alten Yogini-Tantras, erweist sich als ein Mann, der lieben kann, fähig ist, mit ihr die Liebe in allen – auch den spirituellen – Dimensionen zu erforschen.
Doch Joe vergöttert den Tibeter und verrät, blind vor Eifersucht, sein Versteck. Die Verbindung mit dem verschwundenen Bild zwingt alle drei, in die Berge zu fliehen, an die Grenze zu Tibet – aber auch in die Grenzbereiche ihrer Seelenlandschaften.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
Glossar
Tashi Delek e.V.
Prolog
Der Mond steht als dünne Sichel am Himmel, die tibetische Nacht ist tief und ungeheuer groß. Selbst über die weiße Spitze des fernen Berges, die am Tag leuchtet wie ein kostbares Juwel, hat sich die Dunkelheit gelegt. Der Generator hinter dem Hauptgebäude des Klosters schweigt. Ganz oben am Hang über der Klosteranlage flackert der zarte Schein von Butterlämpchen in der Fensteröffnung einer kleinen Klause. Die Nacht ist kalt, der Sommer geht zu Ende.
Eine Gestalt, bis über den Kopf in das große Tuch der Mönchsrobe gehüllt, tastet sich an der Wand des Hauptgebäudes entlang bis zur Seitentür des Lhakang. Sie ist offen, wird selten geschlossen in diesem abgelegenen Kloster; auf der Schotterstraße am Flüsschen entlang braucht man mit dem Jeep mehr als drei Stunden zur nächsten Ortschaft. Die alten Scharniere der Tür quietschen. Der Mann hält inne, zwängt sich durch den offenen Spalt und drückt die Tür vorsichtig hinter sich zu. Eine große Butterlampe auf dem Hauptschrein gibt ein wenig Licht, die Schatten sind Abgründe.
Zielsicher bewegt sich der Mann zu dem schmalen Raum hinter dem Schrein und entzündet dort eine Butterlampe. Die Figuren der Zornvollen springen aus dem Dunkel. Der Mann hat keinen Blick für sie übrig, will sie nicht sehen, erschauert dennoch in ihrer Gegenwart. Er weiß genau, wo er ihn findet, den Schwarzen Beschützer Mahakala, tanzend im Flammenkranz, mit drei rollenden Augen und funkelnden Reißzähnen, gekrönt mit einer Girlande von Totenköpfen, an Armen und Beinen sich ringelnde Schlangen als Schmuck. Da ist er, schaut herunter, schwingt Messer und Dreizack über dem vor Aufregung schwer atmenden Mann, der mit einer Stange nach der Aufhängung des kostbaren Bildes angelt. Es ist ein großes Thangka; der Brokat, der es einrahmt, vom Alter gedunkelt. Das Bild fällt zu Boden. Der Mann bückt sich mit einem unterdrückten Fluch, rollt es hastig zusammen, ungeachtet der möglichen Beschädigung, löscht die Lampe und eilt hinaus in die Nacht, einem leisen Nachtvogelruf vom Rand des Klosters entgegen. Er strebt zur Klostermauer weiter oben am Abhang, wo sie teilweise eingefallen ist. Niemand hat daran gedacht, sie auszubessern. Längst gibt es keine Überfälle mehr, und wovor sollte man sich fürchten, wachte doch Mahakala in seinem Thangka über das Kloster, seit Jahrhunderten schon.
Die Bildrolle ist wunderlich heiß in den Händen des Mannes, unnatürlich, schmerzhaft heiß. Doch die Sache muss zu Ende gebracht werden, es gibt kein Zurück. Solch eine Abmachung zu brechen hieße Tod. Dennoch, das Schaudern will nicht mehr aufhören, die brennenden Hände zittern, der Hals wird eng, so schrecklich eng, als legten sich würgende Hände darum.
Da kommt wieder ein Vogelruf von der Mauer her, diesmal ganz nah. Der Mann stolpert über den steinigen Grund, geführt von ungeduldigem Flüstern: »Komm schon! Hierher!« Erleichtert reicht er die Rolle über die Mauer. Eine Hand streckt ihm ein dickes Bündel Yüan entgegen, die andere greift nach dem Thangka. Ein chinesischer Fluch, ärgerliches Flüstern: »Warum hast du so lange gebraucht? Ich hänge hier schon eine Ewigkeit rum.«
Doch der Mann ist bereits auf dem Weg zu den Wohngebäuden am steilen Hang hinter dem Lhakang, tastend, stolpernd, von Angstschweiß bedeckt.
In der Morgendämmerung stürmen zwei Mönche, die den Lhakang für die Morgen-Puja vorbereiten sollten, ins Zimmer des Klostersekretärs Döndup. »Das Thangka des Mahakala ist aus dem Gönkang, dem Schrein der zornvollen Gottheiten, verschwunden!«, keuchen sie. Der Sekretär reißt die Augen auf, so rund sind sie wie die der Zornvollen.
»Welch ein Unglück«, murmelt er fassungslos, »welch ein schreckliches Unglück.«
Er geht mit den beiden Mönchen zum Lhakang und erstarrt vor dem hellen Rechteck an der Wand, den das verschwundene Bild zurückgelassen hat.
»Was machen wir jetzt nur?«, jammert einer der Mönche.
Der Sekretär antwortet nicht. Die Vergangenheit hat ihn unvermittelt überfallen.
Er ist wieder neunzehn Jahre alt, zu Hause, weit im Osten; mit all den anderen Dorfbewohnern ist er in das große Kloster am Ende des Tals geflüchtet. Dort glaubten sie sich sicher, in der hoch aufragenden, befestigten Klosteranlage, die keine Chinesenkugel zu durchdringen vermochte. Doch wie lange noch? Zu viele Frauen, zu viele Kinder sind da neben den Mönchen und den tapferen Khampas mit ihren CIA-Gewehren und unzureichender Munition. Zu viele hungrige Menschen, die schon so lange durchgehalten hatten. Dann die chinesischen Bomben, das Schreien, die Leichen. Die Mutter, seine starke, stolze Mutter, erschlagen von stürzenden Mauern. Das Blut der Männer so rot wie der Schmuck aus Seidenkordeln um ihren Kopf, das Blut der Frauen so rot wie ihre Korallenketten.
Da ist das breite, sanfte Gesicht des Abts. Nicht hassen, Döndup, nicht hassen. Weine um deine Mutter, weine ein bisschen, aber lass sie gehen, halte sie nicht fest. Und halte deinen Hass nicht fest.
Warum hilft Mahakala uns nicht?, fragt auf der Flucht der junge Döndup den schwer verletzten Rinpoche auf den Armen des Vaters. Der Rinpoche murmelt lächelnd: Aber er ist doch da. Siehst du ihn nicht?
»Ich muss es melden«, sagt der Sekretär entschlossen und verlässt den Lhakang, geht hinauf zu den Räumen des Klosterleiters, dieses schwachen, ängstlichen alten Mannes, so leicht zu manipulieren von den politischen Monstern in der Hauptstadt. Doch er hat Döndups Leben gerettet, hat für ihn gelogen, hat den halb verhungerten jungen Flüchtling als einen Zögling dieses Klosters ausgegeben und ihn als seinen Sekretär ausgebildet.
»Wie furchtbar«, sagt der Klosterleiter und drückt die verschlungenen Hände an die Brust. »Unser Beschützer …«
Ihre Blicke treffen sich, verhaken sich für einen Augenblick ineinander in verzweifeltem Einverständnis.
»Der Spitzel …«, sagt der Klosterleiter leise.
Döndup nickt. Jeder im Kloster weiß von dem Spitzel; nur der Spitzel denkt, die anderen wüssten nicht, wer er ist. Sie haben gelernt, die Nähe des Spitzels zu fühlen, auf ihre Worte zu achten, mit aufmerksamen Ohren und mit heimlichen Augen im Hinterkopf zu leben.
»Wir können nichts machen«, fügt der Klosterleiter hinzu. Sein hängendes Gesicht zerfließt in tiefer Resignation.
Vor dem Lhakang scharen sich die Mönche, die geflüsterte Nachricht hat bereits die Runde gemacht. Auf den verstörten Gesichtern liegt Furcht. So lange hat das Thangka sie beschützt – seitdem es sich vor Hunderten von Jahren in der Höhle oben auf dem Berg manifestiert hat, kurz vor dem Tod des großen Yogi, der in einem Regenbogen verschwand und von dem man nur noch Haare und Zähne und Nägel fand. Dieser Mahakala würde das Kloster vor allem Unheil beschützen, habe der Yogi damals prophezeit. Und so war es. Nie ist dem Kloster etwas geschehen. Sogar den zerstörerischen Wahn der Kulturrevolution hat es unbeschadet überstanden.
»Der Spitzel«, flüstern die Mönche einander zu. »Nur er kann es gewesen sein, keiner von uns würde das tun.«
Am Mittag wissen alle, dass der Spitzel krank ist. Er liegt mit schweren Krämpfen im Bett und seine Hände sind rot und geschwollen und glühen. Sein Puls sei sehr seltsam, sagt der alte Mönchsarzt, der mehr als zwanzig Jahre im Arbeitslager überlebt hat. Ganz chaotisch, da passe nichts zusammen.
»Könnt ihr einen Unterschied sehen?«, fragt Kunzang die beiden Freunde, die in seinem Atelier vor zwei identischen Thangkas stehen. Zweimal Mahakala im Flammenkranz, wild, erschreckend, von außerordentlicher Ästhetik. Nur die Brokatumrahmungen unterscheiden sich, eine ist sehr alt, die andere neu.
»Ich wette, ihr könnt es nicht.« Er lächelt mit dem ihm eigenen jungenhaft siegesgewissen Ausdruck, der Frauen das Gefühl gibt, eine besonders wertvolle Beute für ihn zu sein, und Männer dazu veranlasst, ihm voller Neid jeden Sieg zuzutrauen. Obwohl er das Alter der leichten Siege längst überschritten hat.
Sherab, schmal und drahtig, rückt seine Brille zurecht und untersucht verschiedene Bereiche der beiden Bilder, hebt sie an und unterzieht auch die Rückseiten einer genauen Prüfung.
»Ich kenne mich zwar mit Statuen besser aus als mit Thangkas, aber so viel kann ich sagen, du bist ein Genie«, erklärt er kopfschüttelnd und streicht nachdenklich eine Haarsträhne aus der Stirn.
Kunzang hört kaum zu. Er deutet auf eine bestimmte Stelle in einem der Bilder. »Schaut her, hier am Original war ein größeres Stück Farbe abgeblättert, das ist wahrscheinlich beim Transport geschehen. Und jetzt schaut hier auf die Kopie – mit dem Vergrößerungsglas sieht man einen ganz feinen Rand.« Er richtet sich auf und fügt befriedigt hinzu: »Ich habe natürlich den originalen Brokat verwendet. Selbst wenn sie Fotos gemacht haben, was ich aber nicht glaube, werden sie nichts merken.«
Der zweite Besucher, Tashi, wie Sherab an der Grenze zwischen Jugend und Reife, schiebt die Hände tiefer in die Taschen seiner Jeans. Über dem wie glatt geschliffenen, kantigen Gesicht liegt Besorgnis. »Es ist ein großes Risiko, Kunzang«, sagt er leise. »Du hast es mit einer Mafia zu tun.«
Kunzang legt die Hand auf die Schulter des Freundes. »Das Kloster braucht dieses Thangka wieder. Der Sekretär hat mir eine Nachricht geschickt, dass der Klosterspitzel, der das Thangka gestohlen hat, nach dem Diebstahl plötzlich gestorben ist. Ich sage dir, das ist kein gewöhnliches Thangka.«
Mit einer zarten, ehrfürchtigen Geste berührt er den Brokatrand des Bildes. »Du warst zu lange im Westen, Tashi. Weißt du nichts mehr von der unsichtbaren Welt?«
Tashi schweigt und zieht die Schultern hoch.
Heiter öffnet Kunzang eine Flasche Whiskey. »Und nicht zu vergessen, sie zahlen mir zweitaused Dollar für die Restauration. Ah la la, wir werden nur noch die besten Marken trinken. Schluss mit Kukri-Rum und Wodka.«
Er füllt drei kleine Gläser, ergreift eines davon, taucht zwei Finger in die goldbraune Flüssigkeit und verspritzt ein paar Tropfen im Zimmer.
»Auf Mahakala!«, sagt er und grinst übermütig.
Sherab hat sich einem anderen Bild zugewandt. »Diese Devi hier, hat sie nicht das Gesicht deiner scharfen Lady?«
»Nicht mehr meine«, wehrt Kunzang ab. »Die Lady nicht und das Thangka auch nicht. Das Bild ist schon verkauft. Und Wangmo – o nein, so ein Khampa-Weib ist nichts für mich. Fordernd, herrschsüchtig, eifersüchtig. Nein, nein, nein. Ich hab was Neues, aus New York, ah la la. Ich hab sie in der Yak-und-Yeti-Lounge kennengelernt. Kühl, blond. Sie betet mich an.«
Tashi hat kaum zugehört, er lehnt sich an den Fensterrahmen und blickt über die Dächer in die Augen der Stupa von Kathmandus Stadtteil Boudhanath. Nein, er hat nichts von dem vergessen, was sein Onkel, der Bön-Meister Ashang, ihn gelehrt hat, als er ein Junge war. Er hat Ashang-la verehrt. Häufig opfert er den vier Klassen unsichtbarer Wesenheiten. Manchmal bringt er Gaben zu den Stätten der Nagas. Er hält sein Ga-U in hohen Ehren, den Schutzbeutel, den Ashang-la ihm geschenkt hat. Es stimmt zwar, dass er nach fast zwanzig Jahren in den Städten des Westens die geistigen Wesen nicht mehr so gut spüren kann, aber er hat sie nie vergessen oder gar verleugnet. Nein, das ist es nicht. Vielmehr hat er Angst um Kunzang. Wie eine Wolke ist diese Angst, sie kriecht in seine Poren, in die Zellen seiner Haut, stellt die feinen Härchen auf und lässt ihn frieren in der schwülen Hitze des Sommertags. Oder sind es nur die heranrückenden dunklen Monsunwolken, der ferne Donner, die furchtsame Projektionen anstacheln? Im Westen reden sie so viel von Projektionen, da wird es schwer, einem Gefühl noch Glauben zu schenken. Er hat lange gebraucht, um zu begreifen, dass das, was sie Gefühl nennen, meist nur Gedanken, Vorstellungen, Konzepte sind, weil ihre Sinne verlernt haben, die Welt aufzunehmen.
Kunzang hat sein ganzes Leben in Kathmandu verbracht und restauriert seit vielen Jahren Thangkas für die Kunst-Mafia. Sie vertrauen ihm. Er hat ihnen nie einen Grund gegeben, ihm nicht zu trauen. Er wird wissen, was er tut. Weiß er es wirklich? Kunzang ist wie eine Weide am Fluss, die der Wind bis zum Boden biegen kann, und dann richtet sie sich wieder auf. Doch auch Weiden können entwurzelt werden.
»Auf unser Genie«, sagt Tashi und hebt sein halb geleertes Glas.
Der nächtliche Schatten einer Backsteinmauer trennt den Straßenrand von der kleinen, in tiefem Dunkel liegenden Gasse, die zu Kunzangs Hauseingang führt. Ein paar Hunde in der Mitte der kleinen Straße heben die Köpfe, doch der Augenblick lauernder, hungriger Aufmerksamkeit verfliegt. Sie kennen den Mann mit dem besonderen Geruch. Es ist der Geruch nach Kräutern und Steinen, aus denen der Maler nach alter Weise seine Farben gewinnt.
Kunzangs Schritte werden langsamer, als sammelten sich Gewichte in seinen Schuhen. Der Schatten ist anders als sonst. Es ist nicht nur der Schatten der trüben Straßenlampe; tiefer ist er, wie ein schwarzes Loch im Weltall, mehr noch, wie der schwarze Bauch Mahakalas, die schwarze Sonne der Verwandlung in Mahakalas Herz.
Nachdrücklicher denn je beruhigt er sich mit dem Gedanken, dass das kostbare Thangka bei Sherab in Sicherheit ist, und sagt sich einmal mehr, dass keinerlei Gefahr besteht.
Dennoch – das bedrückende Gefühl hat ihn schon den ganzen Tag verfolgt. Er schaut zurück und sein Blick begegnet den Buddha-Augen der beleuchteten Stupa zwischen den schwarzen Reihen der Häuser. Namo Buddha, ich nehme Zuflucht zum Erleuchteten, möge er alle meine schwarzen Löcher erleuchten.
Entschlossen biegt er in seine Gasse ein, taucht in das Dunkel und weiß augenblicklich: Sie sind da. Er hat es geahnt, gefürchtet und doch geleugnet. Wie haben sie die Täuschung bemerken können? Kein Thangka-Maler weit und breit hat ein so großes Wissen und ist so geschickt wie er.
Ein harter Arm drückt ihm die Kehle zu, Hände umklammern seine Gelenke. Scharren von Schuhen, ein Keuchen, eine vertraute Stimme hinter ihm, zischend, böse flüsternd. Fassungslosigkeit will ihn lähmen, doch die Panik ist stärker, er stößt mit den Beinen, windet sich, ringt keuchend um Luft. Ein rasender Schmerz in seinem Rücken, er spürt, wie das Messer an einer Rippe abrutscht, ein weiterer Stich, ein Dröhnen in seinem Kopf wie die donnernden Hufe einer ganzen Herde wilder Yaks. »Nein, nicht!«, will er sagen und hört, dass es nur ein Gurgeln ist, unverständlich. Er möchte sprechen, erklären und weiß doch, dass es zu spät ist für jedes Wort. Von fern nimmt er wahr, wie sein Körper sich noch einmal aufbäumt, und einen Augenblick lang hängt der Gedanke klar und still im Raum: Sie bringen mich also um.
Er wird aus der Gasse geschleift. Da ist ein riesengroßer Schmerz, so groß, dass er keinen Platz hat in seinem Körper, so über alle Maßen groß, dass er nicht mehr fassbar ist, auch wenn sich der Gedanke »Schmerz« noch irgendwie formen kann.
Kunzang spürt das Blut in seinem Mund. Tod, sagt das Etwas in ihm, das Gedanken formt und immer weiter Gedanken formen will. Das Entsetzen trifft ihn mit voller Wucht, bis es so überwältigend geworden ist, dass es sein Denken sprengt und alle Gedanken davonfliegen lässt.
Unter sich sieht er seinen erschlafften Körper in den Händen des Mannes und der Frau. Hastig werfen sie ihn in den Kofferraum eines Autos. Sie fahren durch stille Straßen und stoßen dann ihr Opfer in das schwarze Wasser des Bagmati-Flusses. Langsam treibt er davon, ein Schatten, nicht mehr. Die Nacht hat die Farbe aus seinem roten Seidenhemd gesogen.
Er sieht ihre Gedanken. Sie bedeuten ihm nichts. Alles, was wichtig gewesen ist, wird bedeutungslos in der ungeheuren Anstrengung des Sterbens. Der sterbende Körper greift nach ihm und stößt ihn zugleich von sich, holt ihn zurück in die Panik, das Grauen, den überwältigenden Schmerz des endgültigen Abschieds. Doch der Verlust eines jeden Sinnes, begleitet von zischendem Dampf, Funken sprühendem Feuer, wüsten und grandiosen Bildern, lässt weite Öffnungen im Raum entstehen, aus denen schließlich die Dakinis, die göttlichen Schwestern, strömen, so über alle Maßen schön und wild, wie er sie niemals hat malen können.
Dann gibt es eine andere Zeit, in der eine unfassbar helle Sonne glühend rot aufgeht, eine weitere Sonne durchdringend weiß strahlend herniederkommt, bis sie eins werden und er hineingezogen wird in Mahakalas abgrundfinsteren Bauch, aus dem Mahakalas riesiger Vajra ihn ekstatisch hinausschießt in Mahakalis Schoß. EMAHO, ein Fallen, ein ungeheures Fallen in den Tunnel, an dessen Ende Kunzang Namdak davon befreit sein wird, Kunzang Namdak zu sein.
Zwei Tage später wird der aufgedunsene Körper an den Gats von Pashupatinath angeschwemmt, wo die magere Leiche eines Kindes auf ein paar Stücken Holz und einem Polster aus Stroh verbrennt. Der Hüter des Feuers, der das brennende Stroh über der kleinen, in weiße Tücher gehüllten Leiche verteilt, hat das rote Hemd im Wasser entdeckt und fischt den Toten mit seiner Stange heraus. Auf dem Scheiterhaufen knackt laut das Holz, ein dünnes Ärmchen bewegt sich, von der Hitze gelöst, als winke es dem Ermordeten zu.
Doch Kunzang ist nicht mehr da.
1
Ungeduldig wischte Teresa mit einem Ende ihres dünnen Schals den Schweiß von der Stirn. Die großen, weißen Wolkenballen über den Bergen am Rand des Kathmandu-Tals verharrten bewegungslos und die Mittagssonne warf ungehindert ihr hartes, heißes Licht auf die im Monsun dampfende Stadt. Es schien Stunden, seitdem das Flugzeug gelandet war. Sie fragte sich längst nicht mehr, warum hier immer alles so unverhältnismäßig viel Zeit brauchte. Es dauerte und man nahm es hin.
Über die Kluft von fünf Jahren hinweg erkannte sie augenblicklich das junge Gesicht über dem Kofferwagen, vertraut in seiner Rundheit und seiner unsicheren Härte, eingerahmt von halblangen, stacheligen, blauschwarz gefärbten Haaren, die Augen reichlich mit Kajal ummalt, die Lippen dunkel, wie hineingeschnitten in das blasse Fleisch.
»Hallo, Joe, hier bin ich!«, rief Teresa durch die schrillen Stimmen der Kofferkulis hindurch und winkte heftig. Ein Blick verriet, dass das Mädchen sie gesehen hatte, doch sonst veränderte sich nichts in der abweisenden Maske ihres Gesichts.
»Alles okay mit dir?« Beschützend legte sie den Arm um die festen, runden Schultern ihrer Enkelin und steuerte den Kofferwagen durch Trauben dünner junger Männer, die schreiend ihre Dienste anboten, zum wartenden Taxi.
»Steig ein, sonst fressen sie dich«, sagte sie und schob das Mädchen auf den Rücksitz.
»Was für eine Scheiße«, murmelte Joe.
»Danke, mir geht’s auch gut«, sagte Teresa mit halbem Lächeln, während das Taxi losfuhr. »Schön, dass du hier bist.«
»Hat der keine Klimaanlage?« Joe rollte mit schnellen, ärgerlichen Bewegungen ihre Lederjacke auf den Knien zusammen und wischte dann mit einem Papiertaschentuch über Gesicht und Hals. Unter ihren Augen verteilte sich schwarze Farbe. »Das ist ja nicht zum Aushalten.«
Ein Schlagloch ließ sie gegen Teresa prallen. Hastig rückte sie auf ihre Seite des Sitzes zurück.
»Ich halt es schon lange aus«, sagte Teresa. »Viele Jahre. Man gewöhnt sich daran. Es ist mein Zuhause.«
Joe schwieg und schaute hinaus auf die Straße, die überquoll von träger Geschäftigkeit. Teresas Blick verfing sich im Schimmer der silbernen Ringe, die das zarte Mädchenohr zwischen den steifen, schwarzen Haarsträhnen säumten. Teresa seufzte. Sie hatte die Qualen des Jungseins ihr Leben lang nicht vergessen.
Plötzlich sah Joe sie an, misstrauisch, gewappnet. »Bist du auf meiner Seite?«
»Ja, Joe, ich bin auf deiner Seite«, antwortete Teresa ohne Zögern.
»Warum?«
»Großmütter sind so«, antwortete Teresa gelassen und strich ihre pfirsichfarbene Bluse über dem nachtblauen Sarong glatt.
»Wenigstens nennst du mich nicht Johanna. Mam und Pa bestehen darauf. Johanna ist die Schande der Familie, wie du weißt. Sie waren in der Zeitung auf der Promi-Seite, wusstest du das? Die Topanwälte Herr und Frau Dingsbums Juhu. Mam war sauer, weil da stand ›Herr und Frau‹ und nicht ›Frau und Herr‹. Du hättest sehen müssen, wie sie mich angeschaut haben, als ich von England zurückkam. So fantastische Eltern und so ein missratener Nachwuchs.«
»Sagen sie das?«
»Denken sie.«
»Bist du sicher?«
»Ach, Scheiße.«
Während Joe die verlorene Nacht im Gästezimmer nachzuholen versuchte, zog sich Teresa ins Schlafzimmer zurück und setzte sich auf das Bett, ihren bevorzugten Platz des Nachdenkens. Sie gestand sich ein, dass sie sich vor den kommenden Wochen mit Joe fürchtete. Dies war nicht mehr das Kind, das sie gekannt hatte. Dieses wütende junge Mädchen war ihr fremd. Mehr noch, es war fragwürdig, ob sie in der Lage sein würde, Joe zu mögen.
Sie fand die Ringe in Joes Nasenflügeln und Ohren ebenso hässlich, wie einst die bürgerliche Umwelt eine Teresa mit langen Haaren, Zigeunerröcken und indischem Silberschmuck abgelehnt hatte. Nein, ich werde nicht in diese Falle gehen, kleine Joe. Ich werde dich nicht zum Opfer machen, wie sie mich zum Opfer gemacht haben.
Hatte sie die Weichen ihres Lebens möglicherweise ganz falsch gestellt? Hätte sie in der Nähe dieses Kindes bleiben sollen, als sie erkannte, dass es keine liebenden Eltern haben würde? Denn das hatte sie schon vor langer Zeit wahrgenommen. Ihre Tochter Astrid war ihr nie nah gewesen, des Vaters Tochter, groß wie er, intelligent wie er, von kalter Begeisterung für diesen schamlosen und einträglichen Beruf besessen wie er. Wenn sie zu Teresa »Mamá« sagte, dann stets mit der preziösen Betonung auf der zweiten Silbe. Ungeduldig. Mit einem Hauch Verachtung. Der Mann, den sie wählte, war ihr ähnlich. Mit Frösteln erinnerte sich Teresa an seinen eisgekühlten Blick.
Au-pair-Mädchen, Privatkindergarten und dann später teure Internate, englische natürlich, für die kleine Johanna, die Astrid kurz nach dem ersten Staatsexamen geboren hatte. Ein Unfall trotz Pille, behauptete Astrid. Ihr Fehler konnte es nicht sein. Astrid machte keine Fehler.
Teresa machte Fehler.
»Großvater ist krank«, hatte Joe gesagt. »Er ist ganz dünn geworden. Früher hatte ich Angst vor ihm. Jetzt nicht mehr. Ich werde viel erben, hat er gesagt. Hoffentlich stirbt er bald. Er ist ein böser alter Mann.«
Joe hatte die Wohnung verlassen, als Teresa nach einer Stunde ungewohnt schweren Schlafs aus ihrem Zimmer kam. Fünfzehn Jahre alt und längst kein Kind mehr. Nenn mich Teresa, würde sie zu ihr sagen, ich bin keine Oma. Joe hatte jede Anrede vermieden und den Blick gesenkt gehalten, die Schultern ein wenig hochgezogen, sodass der Hals kurz erschien und das feste, kleine Kinn in ein leichtes Doppelkinn eingebettet lag. Es war der Gedanke an diese Haltung, der Teresa Tränen der Schuld in die Augen trieb.
Leise hatte Joe die Haustür gegen die Stille der Wohnung geschlossen und war die Treppe hinunter in den Hof gegangen, in den von Monsunwolken verdunkelten Nachmittag. Sie hatte vergebens versucht zu schlafen. Es war heiß. Ein Moskito hatte einen Angriff nach dem anderen geflogen. Sie hätte vor Unruhe schreien mögen.
Immer mehr Wolkentürme schoben sich am Himmel zusammen und ihr Schatten vertiefte das pralle Grün der Büsche an der hohen Mauer, die das Grundstück umschloss. Eine kleine Tür im rostigen Hoftor führte hinaus in die Welt der Straßen, voller Farben und Lärm und Gerüche. Das Gefühl, darin verloren gehen zu können, hatte Reiz: wilde, verrückte Dinge erleben, die sie sich nicht vorzustellen vermochte, sich frei und lebendig fühlen, jemand ganz anderer sein.
Es war einfach, den Weg zur Stupa zu finden, immer den gemalten Augen nach, die über der weit aufragenden, weißen Kuppel in die Runde blickten. Die Stupa sieht aus wie eine dicke, faule, weiße Katze, dachte Joe, als sie aus einer engen Gasse vor das gewaltige Heiligtum gelangte, und sie musste lächeln. Dicke, faule, weiße, heilige Katze. Das Gefühl eines heimlichen Sakrilegs lief in kleinen Schauern über ihren Rücken.
Die schweren Wolken hatten sich über die Sonne geschoben und der Hitze die Schärfe genommen. Die Besitzer der kleinen Lädchen im Umkreis der Stupa brachten die Tische mit den ausgestellten Waren in Sicherheit, fliegende Händler zurrten Plastikplanen über ihren bescheidenen Schätzen fest.
Joes Blick verfing sich in einer gebückten Gestalt am Eingang der Stupa, durch den man zu den drei Ebenen des Heiligtums gelangte. Vielleicht ein alter Mann, vielleicht eine alte Frau, es war nicht mit Sicherheit zu sagen. Ein Wesen wie ein kleiner, schlecht gewachsener Baum, die Arme dünne Äste, die aus den lumpigen Kleidern ragten. Ein roter Blick legte sich schwer auf Joe, dann begann die Gestalt zu winken, befahl sie nachdrücklich zu sich heran, und Joe konnte nicht anders als folgen, unwiderstehlich angezogen, voller Neugier und Ärger und Furcht. Lange hatte sie sich darin trainiert, möglichst wenig wahrzunehmen, in die Grautöne der Unberührbarkeit abzudriften. Doch dieses wunderliche, bedrohliche Wesen zwang sie in eine grelle, peinigende Wachheit, der sie nicht entkommen konnte.
Die Luft stand still, als wäre alle Zeit aus ihr herausgelaufen. Ein paar Mönche saßen in einem Gelass in der Stupa-Mauer, einer Art winziger Kapelle, und sangen mit tiefer Stimme, die Gänsehaut verursachte, begleitet vom scharfen Ton kleiner Glocken und von schnellen Trommelschlägen. Eine Weihrauchwolke schlängelte sich aus dem Gelass und kreiste um die Gestalt mit dem roten Blick. Ein Zauberer! Das musste ein Zauberer sein! Hier war eine andere Welt als zu Hause. Zauberer, Geister, Dämonen, Magie – vielleicht gab es das hier wirklich. Etwas Bedrohliches geschah, das sie nicht aufhalten konnte. Sie wollte weglaufen, zurück in die Geborgenheit bei Oma Teresa, doch das war unmöglich. Sie hatte sich zu weit vorgewagt.
Die gebückte Gestalt richtete sich plötzlich auf, eine Hand legte sich auf ihren Arm. Joe schaute in Augen, die einen unendlichen, von Feuer und Nacht erfüllten Raum freigaben. Nur dass dies nicht das Feuer war, das sie kannte, das Feuer des großen Kamins im Aufenthaltsraum des Internats, und nicht die vertraute Nacht mit mattem Mondlicht und verbotenen Spielen. Diese andere Nacht tanzte mit Totenköpfen, von Feuer umgeben, mit Messer und Blut. Und die schreckliche, tanzende Nacht hielt einen Mann im Arm, einen Mann in einem roten Hemd mit einem Messer im Rücken, hielt ihn wie ein Baby, wiegte ihn im Tanz und sang ein tiefes, dröhnendes Wiegenlied.
Joe presste die Hände gegen den Mund. Das darf nicht wahr sein! Der Trip kommt zurück. Sie haben gesagt, das käme manchmal vor. Bestimmt ist der Jetlag daran schuld und dieses verdammte fremde Land mit seinen verdammten Zauberern. O mein Gott, warum nur hab ich nicht dran geglaubt? Aber was kann man tun gegen Zauberer, die einen mit dem bösen Blick einfangen?
Der Urururalte, Hunderttausendjahrealte strich sanft über ihren Arm. Eine ihrer Hände wurde vom Mund weggezogen, die Finger um etwas Hartes geschlossen, und in diesem Augenblick schoss der erste Blitz über den Himmel. Schwere Regentropfen zerplatzten wie kleine Säcke auf der Erde. Eine gebeugte Gestalt hoppelte schnell über das Pflaster davon. Schirme wurden aufgespannt, Plastikschlappen klatschten. War der Zauberer eine Halluzination gewesen?
Joe flüchtete in ein kleines Lokal, dessen Front offen stand. Die wenigen Gäste hatten bereits die Tische unter der Sonnenplane verlassen und im dämmrigen Inneren Schutz gesucht. In Panik kämpfte Joe gegen ein unkontrollierbares Schwindelgefühl an. Sie ließ sich auf einen Stuhl an der Wand fallen und streckte die Hände aus, um sich am Tisch festzuhalten. Etwas fiel klappernd zu Boden.
»Scheiße«, sagte sie verzweifelt vor sich hin. »Verdammte Riesenscheiße.«
Es war ihr unmöglich, sich hinunterzubeugen. Selbst aufgerichtet konnte sie den Schwindel kaum ertragen.
»Sie haben etwas fallen lassen«, sagte eine Stimme. Eine braune Hand legte eine kleine, silberne Statuette, kaum größer als ihr Daumen, auf den Tisch. Eine tanzende Figur in einem Flammenkranz. »Alles okay?«
»Mir ist schlecht«, sagte Joe. Sie hob kurz den Blick, senkte ihn jedoch sofort wieder auf die kleine Sicherheit der Tischplatte. »Schwindelig. Jetlag. Oder Flashback.«
Ein Mann, braun, mit schmalen, lang gezogenen Augen, vermutlich ein Tibeter. Warum sprach er Deutsch und zudem mit Schweizer Akzent? Sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken; sie musste sich auf das Glas konzentrieren, das ihr hingehalten wurde.
»Hier, trink Wasser. Ganz austrinken.«
Sie ergriff das Glas, die braune Hand schloss sich um die ihre und half ihr, es zum Mund zu führen. Ein weiteres Glas erschien, nur zu einem Viertel gefüllt.
»Das hier auch. Wodka. Das hilft.«
Sie trank und verzog das Gesicht. Welcher Mensch trank etwas so Scheußliches wie Wodka?
»Gibt’s hier keinen Whiskey?«
Die Stimme lachte. »Nein, Prinzessin, gibt’s nicht. Zu teuer. Jetzt tief atmen. Ein – aus – ein – aus. So ist’s gut.«
Er drückte zwei Finger fest in ihren Nacken, mehrere Minuten lang. Der Schwindel ließ nach.
»Es geht schon wieder«, murmelte sie.
»Ich heiße Tashi«, sagte er und sie ergriff die hingereichte Hand.
»Joe«, antwortete sie und wagte sein Bild ein paar Sekunden lang aufzunehmen. Lange, schwarze Haare, hinten zusammengebunden, das Gesicht wie geschnitzt, nicht hart, eher traurig. Dennoch freundlich. Vertrauen wäre möglich.
Er setzte sich neben sie, nahm die Statuette und betrachtete sie genau. »Woher hast du das?«
»Hat mir ein Zauberer geschenkt, gerade vorhin.«
»Ein Zauberer?«
»Na ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Schräger Typ.«
»Das ist ein Mahakala«, sagte Tashi. »Sehr schöne Arbeit.«
»Was ist das, Mahakala?«
»Eine Schutzgottheit«, antwortete Tashi, während er die Statuette einem Mann am Nebentisch reichte. »Das ist mein Freund Sherab, er kennt sich aus mit Statuen.«
Der Mann nickte Joe zu und unterzog das kleine Kunstwerk einer aufmerksamen Prüfung. Mit beiden Händen reichte er es Tashi zurück, begleitet von ein paar unverständlichen Worten.
»Pass gut darauf auf, es ist wertvoll«, sagte Tashi, öffnete ihre Hand, legte die Statuette hinein und schloss ihre Finger darum, auf die gleiche Weise, wie der Zauberer sie ihr gegeben, nein, aufgedrängt hatte. Das kleine Ding lag schwer in ihrer Handfläche. Ein tanzender Dämon, von Feuer umgeben.
»Rumpelstilzchen«, murmelte sie.
Tashi hörte es und lachte. »Ach ja, war da nicht etwas mit einem Namen?«
»Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.« Sie hatte nicht antworten wollen. Warum hatte sie es dennoch getan? Manchmal plapperte sie einfach los, wie ein Kind. Sie hasste das.
»Ich mag Rumpelstilzchen«, fügte sie hinzu. Warum hielt sie nicht einfach den Mund? Sie hatte es sich so oft schon vorgenommen. Halt den Mund, dann hängt dich niemand an deinen Worten auf.
Hastig erhob sie sich und lehnte Tashis Einladung ab, sich zu ihm und seinem Freund zu setzen. Sie wäre gern geblieben, so gern, doch zwischen diesen Wunsch und sie selbst drängte sich eine erbitterte Unsicherheit, die sie wütend und atemlos den Kopf schütteln ließ.
»Vielen Dank für die Hilfe. Ich mach mich jetzt besser auf den Weg. Es regnet kaum mehr.«
Sie wollte nach Hause. Sie wollte weit weg von verrückten Zauberern, die einen auf den Trip schickten. Sie wollte weit weg von dem Mann mit dem schönen kantigen Gesicht, bei dem sie so gern geblieben wäre. Nach Hause. Wohin? Es gab kein Zuhause. Im Augenblick gab es nur eine Großmutter, die nicht wie eine Großmutter aussah und die sie kaum kannte. Immerhin, die nannte sie nicht Johanna. Vielleicht, vielleicht, vielleicht konnte man ihr vertrauen.
Der Regen endete so plötzlich, wie er begonnen hatte. Den Weg durch die Gassen zu Oma Teresas Haus fand sie ohne Mühe, sie hatte sich die wichtigen Ecken eingeprägt – die Ecke mit dem Video-Shop, die Ecke mit der Werkstatt, deren Türen weit offen standen und den Blick auf eifrig hämmernde Kupferschmiede frei gaben, die Ecke mit der hohen Mauer, deren Grafitti-Botschaft sie nicht lesen konnte. Dann das schwere, angerostete Tor zum Hof mit der kleinen, quietschenden Tür, der faule Hund, der vor dem Schuppen lag und Joe offenbar bereits zum Inventar zählte, die tagsüber unverschlossene Haustür, die enge Treppe zur überdachten Veranda, von der aus man Teresas Wohnung betrat.
»Da bist du ja! Du siehst grün aus«, sagte Teresa. Der Klang von Joes Schritten auf der Treppe hatte sie an die Tür gelockt. »Geht’s dir nicht gut?«
Joe ließ sich in den alten Rattansessel auf der Veranda fallen, versenkte Hals und Kopf tief zwischen die Schultern und murmelte: »Scheiße, Scheiße, Scheiße.« Ein Schluchzen zitterte in ihrer Stimme, unüberhörbar, doch Teresa beschloss, es nicht zu beachten, denn so, das machte die abwehrend eingerollte Haltung des Mädchens deutlich, war es offenbar Joes Wunsch.
»Sita hat uns was Gutes gekocht«, sagte Teresa.
»Wer ist Sita?«
»Meine Didi«, erklärte Teresa.
Joe rieb etwas zwischen ihren Händen. »Ach, stimmt ja. Hier hält man sich ja noch Sklaven.«
»Aber natürlich«, antwortete Teresa und ging in die Küche. Ein Hauch von Gelassenheit blieb zurück, ähnlich einem diffusen Blumenduft, und Joe krampfte die Hände um die Statuette, wütend auf sich selbst, wie so oft.
Die frühe Morgensonne fiel grell auf die Rinde des Baums vor dem Fenster und der Widerschein tanzte durch das Zimmer. Mit einem kleinen Seufzer erhob sich Teresa von ihrem niedrigen Bett. Ein Teil des Seufzers galt ihrem Knie, das sich schmerzhaft bemerkbar machte, doch der größere Teil entsprang dem ersten Gedanken – der Erinnerung an das junge Mädchen im Gästezimmer.
»In ihren Adern fließt mehr Wut als Blut«, hatte sie am vorigen Abend an der Haustür zu Gerda gesagt, ihrer holländischen Nachbarin, deren Namen man ein bisschen keuchen musste, damit er richtig klang. »Ich beginne mich vor den nächsten Wochen zu fürchten. Sie tut mir leid. Aber wie soll ich sie um Himmels willen mögen?«
Jahrelang war der erste Gedanke am Morgen das Mantra des Mitgefühls gewesen, wie es sich für eine gute Buddhistin gehörte. War dies das Ergebnis?
»Sie ist doch dein Enkelkind!«, hatte Gerda gesagt, mit einem kleinen, sauren Unterton, der ihr anhaftete wie die Färbung eines Dialekts.
»Wie viele Punk-Enkel hast du, Gerda?«
Gerdas empörter und verletzter Blick bedurfte keiner Worte.
»Weißt du, ich kann dir die Göre ja mal leihen, dann können wir abwechselnd üben, ein guter Mensch zu sein.«
Mit einer gewissen schamvollen Befriedigung war Teresa hinauf zu ihrer Wohnung gestiegen.
Es war noch still im Haus. Joe würde wahrscheinlich lange schlafen und Sita kam erst im Lauf des Vormittags vom Markt. Teresa zündete die Butterlampe auf dem Schrein an, hielt ein Räucherstäbchen in die Flamme und füllte die silbernen Schalen mit Wasser.
»Auf dass ich allen Wesen eine gute Großmutter sein möge«, murmelte sie, setzte sich auf ihr Meditationspolster, ergriff ihre Mala aus hundertacht gesprenkelten Lotossamen und begann mit den Rezitationen zur Morgenmeditation.
2
Ich geh mich mal umschauen«, sagte Joe zur Wand hinter Teresa und schob ihren halb leeren Teller zurück. »An der Stupa.«
Teresa nickte und lächelte vorsichtig. Sie hatte ein paar Tage freigenommen, um für die Enkeltochter da zu sein, war nicht zu ihrem schlecht bezahlten Vormittagsjob in der Ambulanz gegangen, der ihr einen Daueraufenthalt im Land ermöglichte. Doch Joe hatte geschlafen, volle sechzehn Stunden. Wie konnte ein Mensch so lange schlafen, mit oder ohne Jetlag? Hatte sie selbst jemals so lange geschlafen? War es der Schlaf der Ignoranten oder der Schlaf der Unglücklichen? Sie sah den tief zwischen die Schultern versenkten Hals und entschied, dass dieses Mädchen ziemlich verzweifelt war.
»Die Stupa sieht aus wie eine riesige, fette, faule weiße Katze«, sagte Joe, provokativ vorgebeugt, mit verschleiertem Blick von unten, gewappnet in Erwartung des unvermeidlichen Gegenschlags. Teresa lachte bereitwillig, ein wenig zu bereitwillig, wie sie erkannte. Die gute Großmutter hüllt ihre Irritation in Nettigkeit.
»Irgendwie katzig, ja. Aber faul? Ich glaube nicht. Schau dir die Augen an. Eher aufmerksam, wie die Katze vor dem Mauseloch.«
Der Schleier fiel von Joes Blick. Sie schob versöhnlich die Unterlippe vor. »Okay. Nicht unbedingt faul. Lässig. Cool.«
»Man könnte es vielleicht so sehen«, sagte Teresa. »Eine heilige Katze mit den scharfen Augen des Mitgefühls lauert uns verwirrten Mäusen auf, um uns dem Bauch der befreienden Einsicht einzuverleiben.«
»Mann, du bist vielleicht komisch«, erklärte Joe mit einem leisen Beiklang der Anerkennung.
»Es gibt hübsche Malas an der Stupa«, sagte Teresa, um irgendetwas zu sagen. »Das ist so eine Art Rosenkranz.« Sie deutete auf die Mala, die sie um ihr Handgelenk gewickelt trug. »Aus allen möglichen Samen, aber auch aus Rosenholz und Halbedelsteinen.«
Joe stand auf. Ihre Schultern hatten sich sichtbar gelockert. »Also, ich geh jetzt. Wenigstens regnet’s nicht.«
»Keinen Nachtisch?«
»Nee, ich bin zu fett.« Joe klopfte mit der Handfläche auf den leicht gerundeten Bauch. Enge Jeans und ein weit ausgeschnittenes Hemdchen mit sehr kurzen Ärmeln betonten die kindlichen Rundungen. Backfischspeck nannten wir das früher, dachte Teresa.
»Nimm den Schlüssel mit«, sagte sie und räumte die Teller zusammen. Nicht fragen: Wann kommst du heim? Nicht sagen: Komm nicht zu spät! Oder gar: Sollen wir nicht zusammen gehen? Sie hatte Joe genügend Rupien für kleine Ausgaben neben den Teller gelegt und war mit einem gewohnheitsmäßig missmutigen, aber dennoch milden »Okay!« belohnt worden.
»Bye, Teresa, bye, Sita!« Joe war in der Haustür stehen geblieben und hatte den Abschied in den leeren Flur gerufen, ein beiläufiges Friedenssignal in ihrem allgemeinen Kriegszustand mit der Welt.
»Ist sehr modern, junge Lady«, sagte Sita und lächelte über ihr sanftes, breites Gesicht. »Nicht viel lachen, moderne junge Ladys.«
Wenn Sita etwas als ungewohnt empfand, benützte sie das Wort »modern«. Söhne, Töchter und Enkel waren in ihrem bescheidenen englischen Wortschatz »gut«, »nicht gut« oder »modern«, ebenso wie alle anderen Menschen, die sie kannte. Sita hatte unter ihren Kindern und Enkeln nur einen »Nicht-gut«, Ajit, den Sohn der jüngsten, von ihrem brutalen Ehemann glücklicherweise getrennten Schwester. »Schwester Didi-Job, Ajit allein, immer mit Straßenkinder, schlimme Sachen machen.« Ajit war dreizehn, sah aus wie zehn und hatte das durchtriebene Gemüt eines stadterfahrenen Rhesusaffen. Es ging das Gerücht, dass er sich gewinnbringend verkaufe und über den nötigen Grundwortschatz mehrerer Sprachen verfüge.
»Ich denke, Joe ist gut«, sagte Teresa leise seufzend. »Sie ist unglücklich. Ihre Eltern haben sich zu wenig um sie gekümmert.«
Sita wiegte in besinnlichem Einverständnis den Kopf und seufzte ihrerseits ein wenig. »Wie Ajit. Er weiß nicht, dass unglücklich. Joe weiß. Ein bisschen.« Joe, in diesem Augenblick von einer köstlichen Aufregung ergriffen, eilte auf dem fast schon vertrauten Weg zur Stupa. Sie hatte am Morgen im Dahinträumen mit den Erinnerungsbildern dieses Wegs gespielt. Oma Teresa hatte die Augenbrauen hochgezogen, weil sie so spät aufgestanden war. Wusste sie doch nicht, dass Joe keineswegs geschlafen, sondern angenehme Zeit in einer Tagtraumwelt verbracht hatte, in der man nicht mit zusammengebissenen Zähnen leben musste, in der Beine nicht zu kurz und Jeans nicht zu eng waren, in der Wünsche erfüllt wurden, anstatt dass man an ihnen erstickte und Kopfweh bekam.
Es war überaus angenehm, unter dem leichten, rosa und zartgrün bedruckten Betttuch zu liegen, ganz nah am Rand des Schlafs, der groben Körperlichkeit enthoben, befreit auch von der Wut, die jeden Gedanken eintrübte. Sie konnte die Sonne scheinen oder es regnen lassen. Sie hatte sich für einen Wolkenturm entschieden, der seinen schweren Schatten über die Stupa warf, gerade so wie am Tag zuvor, nur noch dunkler, unheilvoller, bedrohlicher. Eine wilde Gestalt mit rollenden Augen, furchterregend, gefährlich, drohend, kam auf sie zu, die Klauen gespreizt, die Reißzähne entblößt. Doch sie fürchtete sich nicht, denn sie wusste, Tashi würde kommen.
Und da war er, Tashi mit dem zusammengebundenen Haar. Er stieß ein paar drohende Worte aus, legte seinen Arm um Joes Schultern und riss sie mit sich, hinein in die kleine Gasse, in den Schutz eines dämmrigen Hausflurs. Sie spürte die Wärme des Körpers an ihrer Seite und das Gewicht seines Arms und überlegte, wohin er sie führen könne. Doch die Szene verweigerte sich, wünschte nicht weiterzugehen. Sie standen noch ein wenig im Hausflur, dann setzte sie erneut an mit ihren Tagtraumbildern, unter dem Wolkenturm und den Augen der Stupa, gestaltete das Ende ein wenig aus, Tashis Mund an ihrem Haar. Sie würde das viele Haarspray herauswaschen müssen. Nach und nach verschob sich die Szenerie, bewegte sich von der Errettung vor dem Dämon mehr zur Gasse und zum Hausflur hin, und es war eine wunderliche, heimliche Köstlichkeit, dort zu verweilen, eingehüllt in die Nähe dieses sanften Mannes. Eines weiteren Verlaufs der Geschichte hatte es vorerst nicht bedurft.
Sie war am Ende der kleinen Gasse angekommen. Der plötzliche Anblick der weißen Stupa, zart leuchtend unter dem verhangenen Himmel, überfiel sie in diesem Augenblick, in dem die Erinnerung an ihre geheime Welt sie schutzlos machte. So Ehrfurcht erregend, so mächtig erschien ihr das Heiligtum, so weit aufragend über den Banalitäten wertloser Vergnügungen. Joe erhob den Kopf, streckte den Hals, senkte die Schultern. Unvermittelt kam ihr der Gedanke, sie könne sich Joana nennen. So hatte man sie im Internat gerufen. Vielleicht sollte sie ein Tagtraumbuch führen. Joanas Tagebuch. Später würde es gefunden werden, wenn sie tot war – dass sie nicht lange leben würde, dessen war sie sicher –, und dann würde man es veröffentlichen und es würde ein Bestseller werden. Joanas Tagebuch. Das klang gut.
Sie sah sich nach dem Zauberer um, sprungbereit, ihm zu entkommen. Er war nicht zu sehen. Die kleine flache Figur steckte in ihrer Hosentasche.
Das Café war fast leer. Tashi war nicht da, auch nicht der andere Mann vom Tag zuvor. An einem der Tische saß ein junges ausländisches Paar. Joe verzog den Mund angesichts der unmodischen Aufmachung des Mädchens. Ein Blick in ein Schaufenster voller Statuen hatte ihr das beruhigende Spiegelbild ihrer engen Jeans und der hohen Plateausandaletten, des weit ausgeschnittenen, pinkfarbenen Shirts mit deutlich sichtbaren Brustwarzen, der abstehenden, aber nur leicht gelackten schwarzen Haare gezeigt. Wie sehr sie bedauerte, dass es zu heiß war für ihre schwarze Lederjacke!
Sie setzte sich an einen Tisch im dämmrigen Innern des Raums. Die Cola, die sie bestellte, und das vorsorglich mitgebrachte Time Magazine aus dem Flugzeug waren geeignete Blickablenker, die sie schützen sollten vor den Übergriffen fremder Neugier. Gesehen werden wollte sie nur von Tashi.
Unmerklich glitt sie in die Wunschwelt, so greifbar nah hinter den Seiten der Zeitschrift. Tashi sitzt am selben Tisch wie gestern, allein. Sein Gesicht ist nicht wirklich sichtbar, nur eine Ahnung von brauner Kantigkeit, von zusammengebundenen Haaren, ein kurzer Eindruck eines Blicks aus dunklen Augen. Er wendet sich ihr zu, er hat auf sie gewartet. Sie folgt seiner Einladung, sich zu setzen. Er ergreift ihre Hand, hält sie fest. Er beugt sich vor, schaut in ihre Augen, sieht Joana, die Schöne, Joana, die Wilde, die Schutzbedürftige, die Strahlende, eine Geschenk-Joana für Tashi, eine Joana, die Tashi sich immer gewünscht hat.
»Wollen Sie noch was, Ma’m?« Abwesend winkte Joe ab.
Bei der dritten Wiederholung der Szene wurde sie mutiger. Tashi beugt sich vor, streicht mit dem Finger leicht über ihre Nase. Er steht auf. Komm, wir gehen. Er führt sie weg vom Café, den Arm um ihre Schultern gelegt. Wohin?
Joe lächelte und begann von Neuem.
Als sie aufblickte, war er da. Ein Mädchen mit kurzen blonden Locken war gerade dabei, sich zu ihm zu setzen. Joes Herz begann zu rasen. Der Wunsch nach Vernichtung kochte in ihr auf. Die da, die Rivalin, sollte nicht sein, durfte nicht sein, hatte kein Recht, sich einzumischen. Joe wollte diese Person nicht wahrnehmen, nicht ansehen, nichts von ihr wissen. Doch es war ihr unmöglich, wegzuschauen. Die junge Frau legte Papiere auf den Tisch, Tashi beugte sich darüber. Sie berührten einander nicht. Keine Intimität. Joes Herzschlag wurde langsamer. Sie sprachen lang, tranken Lemon-Soda. Dann kam Tashis Freund und setzte sich dazu. Bald danach stand die junge Frau auf. Sie lächelte, nickte Tashi und dem anderen zu und ging, ohne zurückzuschauen.
Joe ließ die Schultern fallen. »Scheiße«, murmelte sie erleichtert. »Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße.«
Sie sollte aufstehen und hingehen. Was sollte sie sagen? Was würde er sagen? Die Wolken teilten sich kurz und eine plötzliche Flut von Sonnenlicht zeichnete harte Schattenränder. Ein Omen. Warum nicht? Wo es Zauberer gab, gab es auch Omen. Entschlossen erhob sie sich und schlenderte zu dem Tisch, an dem die beiden Männer saßen. Nun erst sah sie es: Sie hatten die Köpfe mit ernsten Gesichtern einander zugeneigt, der Freund sprach leise und aufgeregt. Kein guter Augenblick, doch nun war sie schon zu nah, sie musste sich entscheiden, ob sie einfach vorbeigehen oder stehen bleiben sollte. Ein wenig entfernt hielt sie inne, als sei sie überrascht.
»Oh, hallo«, sagte sie.
Tashi schaute auf. »Ja schau, das Rumpelstilzchen. Grüezi.« Ein dünnes, höfliches Lächeln, inhaltslos, die Gedanken anderswo.
»Hallo, der Schweizer Käse. Grüezi«, antwortete sie mit Schärfe, seinen Akzent nachahmend.
Tashi lachte. »Dir geht’s also wieder gut. Freut mich.«
Er hob kurz die Hand und wandte sich dem Freund zu. Hinter sorgfältiger Ausdruckslosigkeit verborgen, schlenderte Joe weiter, an der Stupamauer entlang bis zum Eingang und hinauf auf die erste Plattform, die sich um die riesige weiße Kuppel zog. Der Tag hatte sich wieder verdunkelt unter der langsam atmenden Wolkendecke. Sie fühlte nichts. Es war in Ordnung und grauenvoll, nichts zu fühlen. Sie konnte ebenso gut wieder nach Hause gehen.
Ein kleiner, barfüßiger Junge mit schmutzigem Gesicht, schmutzigen Händen und abgetragenen kurzen Hosen an seinem hageren kleinen Körper lief neben ihr her und streckte die Hand aus. »Rupie!«, sagte er nachdrücklich.
»Blödmann«, murmelte Joe und ging weiter. Der Junge folgte ihr. Die offene Hand am ausgestreckten Arm schwankte neben ihr her im angestrengten Versuch des Kleinen, sich mit seinen kurzen, dünnen Beinen ihren schnellen Schritten anzupassen.
»Hau ab!«, fauchte Joe und erhob die Hand in unmissverständlich drohender Bewegung. Der Junge blieb stehen und jaulte ihr ein klägliches »Rupie!« nach.
Missmutig und vage beschämt legte sie den Weg zu Teresas Wohnung im Laufschritt zurück. Die Sonne kam plötzlich hervor und brannte auf ihren Kopf. In den engen Jeans staute sich dampfend die Hitze. »Scheißsonne«, murmelte sie vor sich hin. »Scheißstadt. Scheißmänner. Scheiß-Joe.«
Mit einer ungeduldigen Geste strich Teresa über die Schulter der Tara-Statue auf ihrem Schrein. Sie sollte Staub wischen. Es war nicht gut, den Schrein zu vernachlässigen. Sie schüttelte ärgerlich den Kopf. Seitdem sie wusste, dass man die Enkeltochter zu ihr schicken würde, war ihr Leben aus der Bahn geraten. Hatte sie sich zu sehr an die Gleichmäßigkeit gewöhnt? Wo war die Gelassenheit, in die sie sich seit der Trennung von Aidan gehüllt hatte? Sie wollte nicht an Aidan denken. All die Jahre hatten nicht genügt, den Abstand zu sichern.
Aus dem Wohnzimmer drangen aufdringlich laute Filmstimmen. Teresa seufzte. Sie war Joes schlechter Laune mit dem Vorschlag begegnet, den großen Videoladen unten an der Hauptstraße zu plündern. Seit Stunden saß die fette kleine Drohne aufgesogen vom Bildschirm im Wohnzimmer und stopfte sich mit Mangos und Schokoladenplätzchen voll.
Man konnte die Türen nicht schließen, denn das hätte bedeutet, auf den kühlenden Windhauch zu verzichten, der durch die Wohnung zog. Schwere, dunkle Wolken verdunkelten die Zimmer, Auftakt zum nachmittäglichen Monsungewitter. Teresa begann entschlossen, den Schrein abzuräumen, die sieben Silberschalen, die Butterlampe, die Padmasambhava-Statue, die Knochen-Mala des alten Yogi – ach ja, sie sollte den alten Yogi-Lama besuchen und vielleicht Joe mitnehmen – und all die persönlichen Gegenstände, mit denen sie diesen Ruhepunkt ihres Geistes ausgestattet hatte. Tun, was getan werden muss. Achtsamkeit. Geist und Körper zusammen. Zen in der Kunst des Schreinputzens. Warum nicht. Das, was getan wird, ganz tun, unabgelenkt. Der dicke Pinsel bearbeitete die Schulter und die Brüste der Statue, die kleinen Metallhände, zwischen denen sich der Staub festgesetzt hatte. Teresas Aufmerksamkeit wanderte zu einem störenden Essensrest zwischen ihren Zähnen. Sie brauchte einen Zahnstocher. Oder die Zahnbürste. Aber dazu müsste sie ins Badezimmer gehen. An der Tür hielt sie inne. Ach, Eigensinn des Geistes, mag er doch so gar nicht beim Körper bleiben. Der Körper beim Schrein, der Geist im Badezimmer.
Mit der zerstreuten Befriedigung lustlos erfüllter Pflicht stellte sie alle Schreinutensilien wieder an ihren Platz. Der Himmel hielt die Luft an, die Stimmen aus dem Fernseher durchbrachen die unfreundliche Stille.
»Das muss laut sein, sonst ist es langweilig, und im Kino ist es noch viel lauter«, hielt Joe knurrend und halslos wie ein Bullterrier Teresas Einwänden entgegen.
Teresa schwieg, zog sich zurück, unentschieden, wie sie sich verhalten sollte. Verwirrt, ärgerlich, peinliche Gefühle wie Nadeln. Sie wollte nicht wütend sein auf das Kind, das sie verlassen hatte, als es ihren Schutz brauchte. Doch da war kein Mitgefühl, lediglich ein paar unruhige, schuldbewusste Gedanken, was ein guter Mensch zu fühlen habe.
Teresa schloss die Schlafzimmertür und ließ sich auf ihrem Bett nieder, dem Schrein gegenüber. Der Schein der Butterlampe flackerte über den glänzenden Körper der Statue. Ein feiner, duftender Rauchfaden stieg vom Räucherstäbchen auf, wankte im heißen Hauch der Flamme, verdrehte sich zu Schnörkeln, verging. Still sein, da sein, nichts halten; den Gedanken keinen Widerstand bieten, die aufsteigen, sich zu Schnörkeln verdrehen, vergehen.
Plötzlich brach der Sturm los. Wenige Augenblicke später zuckte ein greller Blitz über die Stadt, der Donner folgte unmittelbar mit einem trockenen Krachen, als breche der Himmel entzwei. Teresa rannte ins Wohnzimmer, schaltete den Fernseher aus und zog das Hauptkabel aus der Buchse an der Wand.
»He!«, schrie Joe.
»Fernseher und Videorekorder sind hier teuer«, erklärte Teresa ruhig und legte ein gerolltes Handtuch an den unteren Rand des Fensters. »Und Blitzableiter gibt’s nicht. Geh meinetwegen aufs Dach und schau dir das Gewitter an. Toller als Fernsehen.«
Joe rührte sich nicht. Teresa zog sich in ihr Zimmer zurück.
»Was für eine gequirlte Scheiße!«, schrie Joe ihr nach.
»Betrachte alle Erscheinungen als Träume«, murmelte Teresa, »und ist die Welt voller Unheil, so verwandle alles Unglück in den Pfad des Erwachens. Joe ist da und damit basta. Ja, ja, ja, schieb alle Schuld dir selber zu, ja, ja, ja, ich übernehme die Verantwortung für meine eigene Befindlichkeit, niemand ist schuld, es ist meine eigene Angelegenheit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du hast ja recht, alter, weiser Atisha Dipankara. Du hast ja schon tausend Jahre lang recht.«
Und sie setzte sich ergeben auf ihr Sitzpolster, stopfte Kissen hier- und dorthin, um das schmerzende Knie zu entlasten, und murmelte den uralten Text der Zuflucht zur geistigen Gesundheit und des Entschlusses, den Käfig der Egozentrik zu verlassen.
Während der Sturm am Haus zerrte und der Donner dröhnte, überließ sich Teresa nach und nach dem kühlen, klaren Frieden inmitten all der Landschaften und Klimazonen ihres Geistes und nahm alle Schuld, welche die Welt jemals ausgeschwitzt hatte, in den Arm wie einen gierigen, ungeduldigen, hilflosen Säugling.
»Was ist denn das?« Joes Stimme klang gedämpft von der Tür her, ohne den üblichen Ton dumpfen Ärgers. Teresa beendete den Pinselstrich, der einer Flamme ihren flackernden Schwung gab, und wandte sich um.
»Die Tür war nur angelehnt«, sagte Joe, »ich wollte nicht stören. Sita sagt, das Mittagessen ist gleich fertig.«
Teresa schob ihre Brille hoch, riss ein Blatt von einer Toilettenpapierrolle und säuberte den dünnen Pinsel mit langsamen, zarten Bewegungen. »Komm rein, du störst nicht.«
Joe näherte sich mit linkischer Zurückhaltung, als wolle sie andeuten, auf Zehenspitzen zu gehen. Teresa spürte, wie vor Rührung rote Wärme in ihrem Hals aufstieg.
»Was ist das?«, fragte Joe und wies mit dem Kinn auf die Staffelei.
»Eine tibetische Schutzgottheit«, antwortete Teresa. »Mahakala, der Schwarze Beschützer.«
Joe kramte in ihrer Hosentasche und hielt die Statuette hoch. »Wie der da?«
Teresa setzte die Brille wieder zurecht und betrachtete die Figur. »O ja. Woher hast du das? Eine wunderschöne Arbeit.«
»Ein Zauberer oder so was an der Stupa hat’s mir gegeben«, antwortete Joe mit einem Unterton von Abwehr und schloss die Finger fest um ihren Schatz.
»Klingt interessant«, brummelte Teresa, bemüht, ihren Ton ganz flach klingen zu lassen. »Vielleicht magst du mir gelegentlich von ihm erzählen. Jedenfalls ist Mahakala die populärste Schutzgottheit im tibetischen Buddhismus.«
»Du meinst, so was wie ein Schutzengel?« Joe hatte unwillkürlich ihre geschlossene Faust mit der Figur gegen die Brust gepresst und die andere Hand darübergelegt.
Ah, Kind, wenn du dich sehen könntest, dachte Teresa. Die Welle der Rührung verbreitete eine so starke Wärme in ihr, dass sie trotz des kühlenden Ventilatorwinds schwitzte. Mit dem weiten Ärmel des alten T-Shirts – es war tatsächlich noch von Aidan, warum hatte sie es nicht längst weggeworfen? – wischte sie Hals und Schläfen ab.
»So etwas Ähnliches. Der Legende nach ist er ein bekehrter Dämon aus der vorbuddhistischen Zeit Tibets. Es heißt, dass er vor mehr als tausend Jahren den Bau des ersten Klosters in Tibet boykottierte, indem er alles Aufgebaute mit Erdbeben und Stürmen zerstörte. Dann lud der König den großen buddhistischen Gelehrten und Magier Padmasambhava aus Indien ein, weil niemand mit dem Dämon fertigwurde. Padmasambhava besaß so große geistige Macht, dass er diesen gewaltigen schwarzen Dämon bezwang – maha heißt groß und kala schwarz. Und er muss wohl außerdem auch über außerordentliche Überzeugungskraft verfügt haben, denn es gelang ihm, den Dämon als Beschützer des Buddhismus und derer, die ihn praktizieren, zu verpflichten.«
»Heißt das, er beschützt nur Buddhisten?«