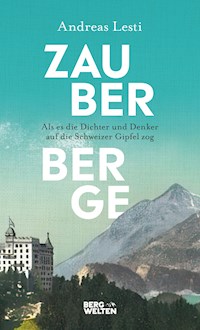
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BERGWELTEN
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren von Thomas Mann, Friedrich Nietzsche und Theodor W. Adorno Krankheit, Wahnsinn, Schönheit und Tod liegen hier nah beieinander: Die spektakuläre Berg-Kulisse der Schweizer Alpen zog die deutschen Dichter und Philosophen in ihren Bann. Was erlebten sie in Davos, Sils Maria, St. Moritz und Zermatt? Und wie prägten diese Eindrücke ihr Schaffen? Der Reisejournalist Andreas Lesti wandelt auf den Spuren seiner prominenten Vorreisenden: Er fährt mit dem Zug in die Schweizer Berge, genauso, wie es Hans Castorp in Thomas Manns Roman »Der Zauberberg« gemacht hatte. Er reist nach Sils Maria, den kleinen Ort am Silsersee südlich von St. Moritz, wo schon der Philosoph Friedrich Nietzsche Ruhe suchte. Er besucht das Hotel Waldhaus, in dem Theodor W. Adorno so oft war und Briefe an Thomas Mann verfasste. Dieser literarische Reisebericht zeigt kenntnisreich, auf welch vielfältige Weise die Orte und Personen miteinander verbunden sind – obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten. - Ein Buch über die Berge, das gleichzeitig ein Stück Philosophie- und Literaturgeschichte erzählt. - Was verraten die Episoden aus dem Leben berühmter Dichter und Denker über die Kulturgeschichte der Alpen? - Eine literarische Schweiz-Reise, die Gegenwart und Vergangenheit verwebt. Faszination Schweizer Alpen – eine etwas andere Reisereportage Der Journalist Andreas Lesti ist Germanist und Alpinist aus Bayern. Er bereist regelmäßig die Gebirge der Welt, immer einen Stapel Bergbücher im Gepäck. Für diese Reise in die Schweiz hat er neben Thomas Manns »Zauberberg« auch »Doktor Faustus«, Kästners »Zauberlehrling«, Adornos »Minima Moralia« und Nietzsches »Also sprach Zarathustra« eingepackt. So ausgerüstet, unternimmt Andreas Lesti eine magische Gratwanderung vor Ort und erklärt nebenbei, was Thomas Mann mit Sherlock Holmes zu tun hat und warum Theodor Adorno am Matterhorn gestorben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Andreas Lesti
ZAUBER
Als es die Dichter und Denkerauf die Schweizer Gipfel zog
BERGE
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2022 Bergwelten Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Zitat S. 73 f. aus: Thomas Mann, Der Zauberberg. © S. Fischer Verlag, Berlin 1924.
All rights reserved by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Zitat S. 129 aus: Friedrich Dürrenmatt: Turmbau. Stoffe IV–IX.
Copyright © 1990, 1998 Diogenes Verlag AG, Zürich.
Der vorliegende Text enthält außerdem Zitate aus:
Theodor Adorno: Minima Moralia und Ästhetische Theorie, Erich Kästner:
Der Zauberlehrling, Katia Mann: Meine ungeschriebenen Memoiren, Thomas Mann: Der Zauberberg und Tristan, Susan Sontag: Krankheit als Metapher.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Gesetzt aus der Palatino, Mrs. Eaves und Madera
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Dr. Arnold Klaffenböck
Umschlaggestaltung & Satz: b3K design, Andrea Schneider, diceindustries
Coverabbildung: Postkarte/privat
Fotos Innenteil: S. 8/9: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH/Alamy Stock Foto, S. 22/23: Quagga Media/Alamy Stock Foto, S. 78/79: akg-images/picturedesk.com, S. 136/137: North Wind Picture Archives/Alamy Stock Foto, S. 176/177: Historic Collection/Alamy Stock Foto
eISBN 978-3-7112-5018-6
»So weit im Leben, ist zu nah am Tod!«
FRIEDRICH HEBBEL(AUS SOMMERBILD)
PROLOG
KRANKHEIT, WAHNSINN, SCHÖNHEIT UND TOD
KAPITEL EINS
DAVOS
KAPITEL ZWEI
SILS MARIA
KAPITEL DREI
ZERMATT
EPILOG
700 TAGE SPÄTER
LITERATURVERZEICHNIS
DANK
PERSONENREGISTER
PROLOG
KRANKHEIT, WAHNSINN, SCHÖNHEIT UND TOD
Alles begann an einem Freitag, dem 13., als ich mich auf den Weg in die Schweiz machte. Es war März und es passierten Dinge, deren Ausmaß noch keiner absehen konnte. Es war, als würde man der Geschichte in Zeitlupe zusehen und nicht fassen können, was gerade passiert. Es war eine Reise mit umgekehrten Vorzeichen, eine Platte, die rückwärtslief. Im fast leeren Zug von Berlin nach München folgte eine Absage-Meldung auf die nächste: Massenveranstaltungen finden nicht statt, Bundesländer machen die Schulen und Kitas zu, Flüge und Züge werden gestrichen, Grenzen dichtgemacht. Präsidenten und Prominente sind in Quarantäne, Firmen ordnen Heimarbeit an, die Fußball-Bundesliga setzt aus, Kinder sollen nicht zu ihren Großeltern. Von einer »schleichenden Naturkatastrophe« war die Rede, wie sie sich keiner vorstellen konnte. Draußen zog die Landschaft vorbei, die Sonne schien auf die Dörfer und Wälder und spiegelte sich auf überschwemmten Feldern. Menschen waren kaum zu sehen. In München stieg ich um, und auf dem Weg nach Innsbruck erfuhr ich, dass Ischgl und St. Anton unter Quarantäne stehen und viele Skigebiete sofort schließen. In Innsbruck stieg ich wieder um, und auf dem Weg nach Landeck sagten sie durch, dass der geplante Stopp in St. Anton ausfallen würde. Das Risiko sei zu hoch.
Ganz langsam wurde mir klar, dass gerade etwas geschah, was vor ein paar Tagen noch keiner für möglich gehalten hätte: dass sich Deutschland, Österreich, die Schweiz, ganz Mitteleuropa im Krisenmodus befindet. Von Landeck aus wollte ich mit dem Bus weiter ins Unterengadin, dort eine Nacht verbringen und dann weiter nach Davos, Sils Maria und Zermatt, um hier etwas über Thomas Mann, Friedrich Nietzsche, Theodor W. Adorno, über Krankheit, Wahnsinn, Schönheit und Tod herauszufinden. Meinen Freunden in Scuol, wo ich übernachten wollte, schrieb ich, dass ich in Landeck bin, und sie schrieben zurück: »Der rasende Reporter berichtet live aus dem Kriegsgebiet.« Wie weit, fragte ich mich, würde ich noch kommen? Mir kam plötzlich der Surf-Film Pororoca in den Sinn: Da fahren Wellenreiter auf einem kleinen Boot im Amazonas einer gefährlichen und tosenden Flusswelle entgegen, und in jedem einzelnen Gesicht der Akteure steht geschrieben: Verdammt, wir fahren gerade in die falsche Richtung. Und obwohl ich nun in Landeck ganz einfach aus einem Eurocity stieg und es wenig unspektakulärere Dinge auf dieser Welt gibt als das, war da so ein vages Gefühl, dass das Schicksal an diesem Freitag, dem 13., merkwürdige Überraschungen parat halten könnte. Würde ich vielleicht aus irgendwelchen mysteriösen Gründen für sieben Jahre in Landeck bleiben? Ich schloss die Augen. Was für ein Albtraum.
Ich hatte geplant, nach einer Nacht in Scuol am nächsten Vormittag weiter nach Davos zu fahren. Also rief ich beim Tourismusverband von Davos an: »Wir rufen morgen den Notstand aus«, sagt mir ein Mann mit nüchterner Stimme.
»Oh.«
»Ja, wir müssen alles schließen.«
So. Game over. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen: Thomas Manns Zauberberg lockte mich nach Davos, ein Roman, dessen Hauptfigur vor 100 Jahren sieben Jahre lang nicht mehr wegkam aus den Schweizer Bergen. Nun lässt mich Davos gar nicht erst hin. Der Grund dafür war damals wie heute der gleiche: eine Atemwegserkrankung. Damals hieß sie Tuberkulose, heute Covid-19.
Auf dem Bahnhof ging es hektisch bis hysterisch zu, und ich kurvte durch das Chaos. Alle hatten Reisekoffer und Skisäcke dabei, und nach einer Weile bemerkte ich, dass es zwei Gruppen mit unterschiedlichen Interessen gab. Die einen kamen aus Ischgl oder St. Anton, hatten vermutlich gestern Abend noch im Kitzloch oder MooserWirt gefeiert, und wollten nach Hause, nach Essen, Dortmund oder Hamburg, nach Amsterdam, Oslo oder Reykjavík. Aber sie hatten offenbar kein Zugticket, zumindest kein für heute gültiges, weil sie geplant hatten, länger zu bleiben. Die anderen kamen aus Hamburg, Oslo oder Reykjavík und wollten nach St. Anton oder Ischgl, sie hatten ein Ticket, aber man ließ sie nicht weiterreisen, weil dort ein Virus wütete, dessen Gefährlichkeit keiner einschätzen konnte. Bei den Rekonstruktionen und Klagen, die später die Geschehnisse des Super-Spreader-Ortes Ischgl aufzuarbeiten versuchten, spielte der Bahnhof Landeck keine Rolle. Dabei hat das, was sich an jenem Freitag hier abspielte, sicher auch seinen Teil dazu beigetragen. Alle, die mit dem Zug von Ischgl oder St. Anton zurück in ihre Heimat wollten, mussten irgendwann in Landeck gewesen sein. Viele der Menschen, die aus den Skigebieten kamen, waren vermutlich schon infiziert und steckten jene an, die gerade ankamen. Mich zum Beispiel, dachte ich mir und zog den Jackenkragen hoch. Maske trug damals noch keiner, und so flog das Virus munter umher und verbreitete sich in ganz Europa, bis nach Island. Ich stand in der Reihe am Schalter, weil ich ein Busticket ins Engadin brauchte. Vor mir verzweifelte ein norddeutscher Familienvater am unerschütterlichen Tiroler Charme des Bahnmitarbeiters.
»Nein, ich kann das Datum auf den Tickets nicht ändern«, sagte er im krachenden Dialekt des Tiroler Oberlandes, der an den Klang eines Altmetallschredders erinnert. »Des choscht 685 Euro«, bellte er, woraufhin der freundliche Norddeutsche erwiderte, das habe er ja schon für die Tickets, die morgen gelten, bezahlt.
»Für 685 Euro solltet ihr auch eine Nacht in einem Hotel in Landeck bleiben können«, sagte ich und lächelte dem Mann zu.
Der lachte fatalistisch, sagte: »Ja, das glaube ich auch«, und ging davon.
Es war noch ein Mann vor mir, ein Norweger, der nach St. Anton wollte und die Dreistigkeit besaß, den Bahnangestellten auf Englisch anzusprechen.
»Also na Leit, jetzt soll i a no Englisch ren«, dröhnte es, und es klang paradoxerweise so, als spräche er einen sehr seltenen, über die Jahrhunderte in Vergessenheit geratenen, angelsächsischen Dialekt. Der Norweger zögerte.
»I am no english reign?«, wiederholte er das oberländische »soll i a no Englisch ren« verunsichert und sagte: »But I just wanna go to St. Anton.«
»Er will nach St. Anton«, sagte ich von hinten.
»Des isch nicht möglich!«, polterte der Bahnangestellte, und das »nicht« klang nun wie das Aufjaulen eines Schwingschleifers. Der Norweger sah mich entsetzt an, auf das Schlimmste gefasst.
»It’s not possible«, sagte ich so ruhig wie möglich und erklärte ihm, dass der ganze Ort unter Quarantäne stünde und niemand mehr einreisen dürfe. Ich glaube, er hat sich dann auch ein Hotel in Landeck gesucht und sich am nächsten Tag irgendwie Richtung Norwegen durchgeschlagen. Nun war ich an der Reihe, und mit gebotener Vorsicht sagte ich:
»Ich will ins Engadin und brauche ein Busticket.« Er musterte mich einen Tick zu lange, ein Moment, in dem ich angespannt seinen Faustschlag erwartete. Dann sprach er: »Des chaufsch im Bus. Im 210er.«
Auf Abstand bedacht ging ich zwischen den Menschen im Bahnhof wieder nach draußen auf den Vorplatz. Dort standen drei Busse, einer davon war der 210er. Der Busfahrer stand vor dem Fahrzeug und rauchte. Außer uns beiden war hier niemand. Er grüßte mich widerwillig und sagte, dass er erst in zehn Minuten losfahre, die Türe öffnete er aber nicht. Es dämmerte mittlerweile, die Sonne strahlte nur noch die höchsten Gipfel an, und pünktlich um 16.48 Uhr verließ ich diesen unheilvollen Ort, von dem aus sich an diesem Freitag die Corona-Viren auf in die Welt machten. Der 210er fuhr hinauf Richtung Nauders und bog dann ab nach Martina, an der Schweizer Grenze. Er folgte dem Inn in eine so dunkle und bedrohliche Bergwelt, dass mir Landeck nun wie eine leuchtende Hochburg der Zivilisation vorkam. Die Berge schienen mich mit ihren schwarzen Wäldern aufsaugen zu wollen, eine unheimliche bleierne Schwere lag über dem Land. Der Busfahrer hatte ein Absperrband zwischen sich und seine Gäste, also mir, gespannt. Er wollte mir kein Ticket verkaufen. »Das darf ich nicht«, meinte er, als würde ihn eine böse Macht kontrollieren. In Martina, einem finsteren und tristen Grenzort, stieg ich aus und in den nächsten Bus ein, der mich weiter nach Scuol im Unterengadin bringen sollte. Die Busfahrer unterhielten sich noch eine Weile in einem hybriden Engadin-Tirolerisch, das ich nur bruchstückhaft verstand. Wie weit, fragte ich mich, würde ich noch kommen?
Es war stockdunkel, als ich in Scuol ankam, wo gerade vier alte Freunde von mir Skiurlaub machten. Sie erwarteten mich in einer Bar im Zentrum dieses kleinen Ortes, dessen Kirche prominent auf einem Felsen über dem Fluss thront. Die rätoromanischen Gemeinden rundherum klangen wie ein Tourettesyndrom: Ardez, Tarasp, Sent und Ftan. Meine Freunde saßen in der stilsicher eingerichteten Bar am Tresen und tranken Rotwein – die Schweizer Antwort auf den Tiroler Après-Ski-Wahnsinn, der an diesem Freitag, dem 13., seine Quittung bekommen hatte. Sie waren schon am Vortag mit dem Auto aus Bayern angereist – da war noch alles in Ordnung gewesen. Die Nachricht über das Virus hatte sich aber auch in Scuol bereits verbreitet. Der Wirt, ein ebenso kerniger wie stylisher Einheimischer, erklärte uns, dass er bald schließen müsse und morgen auch nicht mehr aufmachen dürfe. Nein, wie genau das weitergeht, wisse er auch nicht, sagte er, als er uns die »last order«, eine weitere Flasche Bündner Rotwein ausschenkte. Kopfschüttelnd erzählte ich von den Ereignissen meines Tages. Während des Erzählens merkte ich, was für ein Abenteuer diese Anreise war und dass diese Ungewissheit und allein die Möglichkeit, ein Ziel tatsächlich nicht zu erreichen, zu etwas Besonderem geworden ist. Unsere Leben sind so geplant und durchgetaktet, dass schon eine geringe Abweichung des Erwartbaren zu einer Expedition wird. »Hänge in Landeck fest – Stopp – aussichtslose Lage – Stopp – werde mich irgendwie Richtung Grenze durchschlagen – Stopp.« Vielleicht, dachte ich mir und prostete den anderen zu, ist es ja ganz gut, wenn uns einfach mal der Stecker gezogen wird.
Um 20 Uhr schloss die Bar auf unbestimmte Zeit und wir fuhren hoch in die Ferienwohnung nach Ftan. Vielleicht können wir ja morgen noch Ski fahren. Vielleicht haben ja die Bergbahnen in der Schweiz weiterhin offen. Vielleicht würde sich alles nur als großes Missverständnis erweisen. Oder als ein schlechter Traum. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber nein. Um 1.01 Uhr nachts blinkte auf dem Mobiltelefon die schlichte und unmissverständliche Wirklichkeit auf: »Das Skigebiet Scuol ist ab sofort geschlossen.« Bis jetzt hatte ich noch einen Restfunken Hoffnung, nach Davos und Sils Maria weiterreisen zu können. Einfach mit der Rhätischen Bahn in präzisen 73 Minuten nach Davos-Platz zu fahren. Irgendwie würde es schon gehen. Irgendwer würde mich schon empfangen. Doch dann kam am nächsten Morgen eine E-Mail aus Sils Maria: »Wo schwach du dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren (Adorno)«, lautete die Betreffzeile. Das ganze Zitat aus der Minima Moralia lautet: »Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.« Es kommt nicht so oft vor, dass ein Hotel sich mit einem Adorno-Zitat an seine Kunden wendet. Aber an Premieren, das wurde mir so langsam klar, würde man sich gewöhnen müssen. Der Inhalt der E-Mail war aber vergleichsweise unphilosophisch: Die Saison, stand da, würde vorzeitig beendet, das Hotel Waldhaus, in dem Adorno so oft war, geschlossen. Ich saß in einer Ferienwohnung in Scuol, die Bergsilhouetten schälten sich in Zeitlupe aus den Wolken. Ich blickte auf einen geschlossenen Sessellift, und die Nachrichten bestätigten, dass die Schweiz den Notstand ausgerufen hatte. Dieses unsichtbare und undurchschaubare Virus hatte meine Reisepläne nun endgültig vernichtet.
Eine Ausgangssperre gab es nicht, und da wir alle Tourenski und Felle dabeihatten, beschlossen wir, zumindest eine Skitour zu machen. Gegen zehn Uhr stiegen wir unter den großen Arven durch den Schnee. Durch die Reibung gaben die Felle meditative Geräusche von sich, als würde jemand unaufhörlich einen Reißverschluss auf- und wieder zumachen. Tsch. Tsch. Auf und wieder zu. Tsch. Tsch. Auf und wieder zu. Die Sonne schimmerte irgendwo hinter den Wolken, als wir am Ortsrand das »Hochalpine Institut« passierten, ein Internat mit prachtvoller Zauberberg-Fassade. Die Schweiz, dachte ich mir, ist schon ein eigentümliches Land: In jedem noch so verlassenen Winkel, in jedem noch so entlegenen Tal, immer dann, wenn man nur noch die wilde Bergwelt erwartet, überraschen Reichtum und Exklusivität. Der Jugendstilbau war zumindest ein gewisser Trost für das unerreichbare Davos, die unerreichbare Schatzalp und den unerreichbaren Berghof, wie das Sanatorium im Zauberberg heißt, die von hier aus nur 35 Kilometer Luftlinie weiter im Westen liegen – und doch unendlich weit weg.
Wir waren allein, und wie in vergangenen Zeiten schob sich unsere kleine Expedition langsam hinauf in die alpine Landschaft. Ein unscheinbarer Weg führte uns nach Prui, schon über 2000 Meter gelegen. Nun ging es auf der verwaisten Piste jenseits der Baumgrenze weiter Richtung Schlivera, Clünas und Mot da Ri. Moria, Erebus und Gondor können nicht weit weg sein. Nach zwei Stunden erreichten wir eine Hütte mit dem Namen La Palma Bar. Eine Plastikpalme ragte einsam aus dem Schnee und ein junger Schweizer mottete gerade die Terrasse ein. Er prostete uns mit einem Weißbier zu und sagte kichernd: »Das ist mein fünftes«, und erst da bemerkten wir, dass er ganz schön einen in der Krone hatte. »Ein bisschen Saisonabschluss muss schon sein«, säuselte er, wankte leicht und erzählte, dass er noch gestern mit vier weiteren brummenden Geschäftswochen geplant hatte. Und nun: alles vorbei. Wir blickten hinüber zum Piz Tasna, einem der Dreitausender dieser Gegend, zogen die Felle von den Skiern, klickten in die Bindungen und fuhren hinunter ins Tal. Es ist so: Wenn man weiß, dass man nur eine Abfahrt am Tag hat, dann genießt man sie besonders. Die Beschleunigung, die Kurven-Geschwindigkeit, die kurzen Momente der Schwerelosigkeit, wenn man über eine Kuppe springt, das Schneeaufstauben im Augenwinkel, die Kälte im Gesicht, das Rauschen im Ohr. Es war für lange Zeit der letzte Tag in einem Skigebiet.
Von Scuol fuhr ich mit meinen Freunden in nur drei Stunden zurück nach Bayern, von dort mit dem Zug in fünf Stunden weiter nach Berlin, wo ich abends um halb zwölf ankam. Alles ging viel zu schnell für meine Wahrnehmung, die sich darauf eingerichtet hatte, in der Schweiz die Langsamkeit zu zelebrieren. Im Zug fragte ich mich, was Thomas Mann zu diesem Irrsinn gesagt hätte? Und was Friedrich Nietzsche und Theodor W. Adorno? Genau 40 Stunden nachdem ich gestern Morgen von der Hauptstadt aufgebrochen war, stolperte ich nun, im Skianzug und mit Skiern auf der Schulter, müde durch die Berliner Nacht. Und kam mir vor wie der Gast einer Faschingsparty, der das Motto missverstanden hat. Ich winkte ein Taxi heran und der angemessen irritierte Fahrer fragte mit Blick auf die Skier:
»Wattn ditte?«
»Das ist meine Waffe im Kampf gegen Helvetien«, sagte ich voller Pathos.
»Haste Fieber oder watt?«, fragte der Taxifahrer.
»Diesmal hat Helvetien mich besiegt, aber ich komme bald wieder und werde auf Feuerrädern in die Vergangenheit fahren!«, erwiderte ich unbeirrt.
Der Taxifahrer, offenbar an den Wahnsinn seiner Fahrgäste gewöhnt, schüttelte den Kopf und fuhr los.
KAPITEL EINS
DAVOS
Eineinhalb Jahre waren vergangen, ehe ich mich wieder auf den Weg machte. Ein Zeitraum, in dem sich die Welt verändert hatte. Jener Freitag, der 13., war nur der Anfang, und das Virus kursierte noch immer, mittlerweile mehrfach mutiert. Es gab einen Impfstoff, aber es würde noch lange dauern, bis sich alle Menschen impfen lassen. Selbst die Sprache hatte das Virus befallen. Woche für Woche tauchten neue Begriffe auf: Wellen und Lockdowns, Homeoffice und FFP2-Masken, R-Werte und Inzidenzen, Vakzine und Mutanten, Priorisierungen und Virusvariantengebiete. Und in dieser neuen, von Krankheit bestimmten Welt, wagte ich an einem strahlenden Sommertag einen zweiten Versuch, in die Schweiz zu kommen, nach Davos. »Davos ist ein weißer Vogel, schwebend in der Luft«, schrieb einstmals die russische Autorin Wiktorowa, »ein Tal begossen mit Menschenblut und Tränen, ein ruhiger Friedhof gewesener Freuden und die Wiege neuer Hoffnungen.«
Diesmal vermied ich Landeck, in der Hoffnung, mehr Erfolg zu haben. Ich fuhr wieder mit dem Zug, aber nun genauso, wie es Hans Castorp in Thomas Manns Roman Der Zauberberg gemacht hatte. Dieses überforderte Einzelkind mit Krokodillederhandtasche, dessen Eltern verstorben waren und das in die Schweiz reiste, um seinen Vetter in den Bergen zu besuchen, stimmte sich gerade auf seine Ingenieurslaufbahn ein. Castorp las das broschierte Buch Ocean steamships, während er von Hamburg aus »durch mehrere Herren Länder, bergauf, bergab, von der süddeutschen Hochebene, hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres« fuhr. Am Bodensee setzte er mit dem Schiff über. Von Rorschach aus fuhr er wieder mit dem Zug und kam bald nach Landquart, wo er in eine Schmalspurbahn wechselte. Das dauerte alles seine Zeit, aber beklagen konnte er sich nicht. Denn als Thomas Mann seine Romanfigur 1907 in die Schweiz kommen ließ, hatte das Land eine regelrechte Modernisierungsexplosion hinter sich. Allerorten wurden Straßen, Tunnels, Brücken, Bergbahnen und Hotels gebaut. Hätte er seinen Protagonisten 40 Jahre früher reisen lassen, dann hätte er in Landquart in eine Pferdekutsche steigen müssen und noch mal sechs Stunden nach Davos gebraucht.
Noch heute ist die Zugreise von Norddeutschland nach Davos eine elfstündige Reise, quer durch Deutschland und die Schweiz. Die Züge waren meist nur halb voll, und diesmal erreichten mich während der Fahrt keine neuen Hiobsbotschaften. In Augsburg stieg ich um und folgte nun der Castorp-Route weiter nach Friedrichshafen und von dort mit der Fähre einmal quer über den Bodensee. Das Schiff hatte auch Thomas Mann genommen, als er 1912 in die Schweiz reiste, und wandelte damals selbst schon auf den Spuren eines prominenten Vorreisenden: Richard Wagner, der die Schifffahrt bereits ein halbes Jahrhundert zuvor unternommen hatte, um in die Schweiz zu kommen. Ein grauer Zeppelin schwebte durch die Luft, rote Tretboote schaukelten in den Wellen und zwei symbolträchtige Schwäne schwammen durch den Hafen. Eine Stunde lang pflügte die Fähre über den See, und während auf der rechten Seite das Land flach auslief, reckten sich links die ersten Schneeberge im Dunst auf. Der Säntis mit seiner großen Antenne auf dem Gipfel war deutlich zu erkennen. In Romanshorn legte die Fähre an und ich betrat die Schweiz. Ganz unbehelligt, keiner wollte einen Ausweis, eine Test- oder Impfbescheinigung sehen. Nun brachten mich rote Züge weiter durch Apfelbaumplantagen und durch herausgeputzte kleine Ortschaften nach Rorschach, wo auch Hans Castorp umgestiegen war. Eine Schulklasse stieg ein und wieder aus, zwei Bauarbeiter tranken Bier und unterhielten sich über Gelegenheitsjobs. Wenig später erhoben sich im Rheintal links und rechts von den Gleisen die ersten Berge, einer hatte die Form eines Flaschenöffners, ein anderer die einer Urzeitechse. Dann kündigte der nervtötende Dreiklang der Schweizer Bahn Landquart an.
Ich saß also im Zug und las den Zauberberg und las, wie Hans Castorp im Zauberberg im Zug saß und Ocean steamships las. Vielleicht hatte Thomas Mann davor in diesem Zug gesessen und Wagner gelesen, der seinerseits zuvor hier reiste und vielleicht Nietzsche gelesen hatte. Wird irgendwann, schoss es mir durch den Kopf, jemand mit dem Buch Zauberberge in diesem Zug sitzen und darin lesen, wie ich im Zug sitze und im Zauberberg lese, wie Hans Castorp Ocean steamships liest? Ein literarischer Versailles-Spiegel. Ich hatte einen ganzen Stapel an Büchern dabei, der als ziemlich schwere Kost in meiner Reisetasche lag: neben dem Zauberberg Thomas Manns Doktor Faustus, Kästners Zauberlehrling, Adornos Minima Moralia und Nietzsches Also sprach Zarathustra. Von Landquart aus quälte sich der rote Zug, der mit Skifahrern und Radfahrern bemalt war, hinauf. Auf zauberhafte Weise verschmolz der Roman mit der Wirklichkeit – oder bildete ich mir das nur ein und es bestand Grund zur Sorge um meinen Geisteszustand? Auch im Zauberberg beginnt nun »der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt«, es geht »auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge.« Ich las abwechselnd im Präteritum des Romans und blickte durchs Fenster ins Präsens der Wirklichkeit. Es ging durch Kurven und Bögen und durch Orte, die klangen, als wären sie Figuren in einem Thomas-Mann-Roman: Serneus, Cavadürli und Selfranga. Kurz vor dem Davosersee hatte der Zug endlich das Hochtal erreicht und passierte die Hochgebirgsklinik, nüchterne weiße und graue Zweckbauten zwischen hohen Arven. Hinter diesem Namen verbirgt sich die größte Rehaklinik Graubündens. Es war ein trister Anblick, weil er so gar nichts mit den prunkvollen Jugendstilpalästen zu tun hatte, die Davos zur Jahrhundertwende schmückten. Etwa die Klinik mit dem klangvollen Namen Valbella, deren Fassade es sogar auf das Cover einer Zauberberg-Ausgabe schaffte. Und wenn man liest, wie Thomas Mann den Berghof, das Sanatorium im Roman, beschrieben hat, dann weiß man auch warum: »ein langgestrecktes Gebäude mit Kuppelturm, das vor lauter Balkonlogen von Weitem löcherig und porös wirkte wie ein Schwamm«. Er setzte den »Berghof« allerdings aus verschiedenen Kliniken zusammen: Die Fassade stammte vom Valbella, die Atmosphäre aus dem Waldsanatorium, in dem seine Frau Katia behandelt wurde, das Interieur aus der Schatzalp.





























