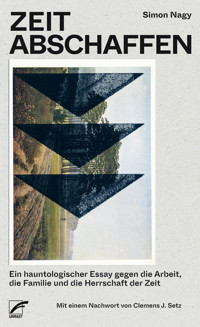
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Ende der Arbeit, die Aufhebung der Familie und die Abschaffung der Zeit treten in diesem Buch als verwandte, einander sogar bedingende Begehren auf. Sie alle drehen sich um das Ziel, der künstlichen Produktion von Gegenwart ein Ende zu setzen und vergangene Kämpfe in kollektiv bestimmte Zukünfte zu transformieren. Es ist 175 Jahre her, dass es erstmals beim Namen genannt wurde: das die Gegenwart heimsuchende, aus der Zukunft flüsternde Gespenst des Kommunismus. In den letzten Jahren tauchen wieder vermehrt solche Gespenster auf, die von radikal anderen Zukünften zu flüstern wissen. Sie erscheinen vor allem in Filmen, Romanen und künstlerischen Arbeiten, sind aber gar nicht so leicht zu erkennen, weil sie sich nicht an althergebrachte Formen des Spuks halten. Es braucht neue Werkzeuge, um sie aufzuspüren, mit ihnen ins Gespräch zu treten und herauszufinden, was sie uns über unsere Zeit, ihre Abschaffung und von möglichen anderen Zeiten berichten können. Der Essay "Zeit abschaffen" tritt mit Gespenstern der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit in einen solchen Dialog. Er sucht das Gespräch mit ihnen mit dem Ziel, ihr Flüstern nicht wie so oft als Drohung, sondern als Versprechen hörbar zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Simon Nagy arbeitet im Kontext diverser Kollektive in der Kunst-, Text- und kritischen Wissensproduktion in Wien. Er ist Mitglied des Büros für Kunstvermittlung trafo.K und der Künstler:innengruppe Schandwache. Gemeinsam mit Lia Sudermann dreht er dialogische Essayfilme, u. a. den mehrfach ausgezeichneten Kurzfilm »Invisible Hands« (2021). Er ist Co-Gründer der Pataphysischen Gesellschaft Wien und schreibt für Zeitschriften, Ausstellungen und online über Kunst, Literatur und Politik. Zeit abschaffen ist sein erstes Buch.
Simon Nagy
Zeit abschaffen
Ein hauntologischer Essay gegen die Arbeit,die Familie und die Herrschaft der Zeit
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Simon Nagy:
Zeit abschaffen
1. Auflage, Oktober 2024
eBook UNRAST Verlag, Dezember 2024
ISBN 978-3-95405-214-1
© UNRAST Verlag, Münster 2024
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Nihal Türkyilmaz, Dortmund
Umschlagbild: Florian Huth, München
Satz: Simon Nagy, Wien
Inhalt
Killing Time
Marks Gespenster
Gespenster austreiben, Ruinen bauen
Nicht jede Stunde ist eine Stunde
Exit the Gespensterhaus
Dank
Texte, Filme, Songs
Die unbeabsichtigte Erschaffung eines Gespensts durch die American Legionim Jahr 1950Nachwort von Clemens J. Setz
KillingTime
Ain’t gonna fight no more
Done fought the kitchen clock
And the master’s clock
And the work clock
And the god clock
And the tax clock
And the witch clock
And I ain’t gonna fight no more
Already fought for the rich clock
The poor clock
The city clock
The country clock
And I ain’t gonna fight no more
Ain’t gonna fight no more
Already fought the
doomsday clock
The clock of hell
The clock of democracy
And I ain’t gonna fight no more
Moor Mother, Clock Fight, 2021
Auf den Tag genau hundertdreiviertel Jahre bevor ich geboren wurde, hat ein Anarchist versucht, die Standardzeit in die Luft zu jagen.
Am Nachmittag des 15. Februar 1894 setzt sich ein sechsundzwanzigjähriger Mann in die Tram von Westminster nach Greenwich. Unter seiner Jacke führt er eine selbstgebastelte Bombe mit. Aus Frankreich nach London gezogen, ist Martial Bourdin regelmäßiger Gast des Club Autonomie, eines unter internationalen Anarchist:innen populären Lokals für Diskussion, Vernetzung und Konspiration.
Bourdins Tagesplan sieht zunächst vor, die Shep-herd Gate Clock am Eingang des Königlichen Observatoriums zu sprengen, die seit zehn Jahren den Nullpunkt für international genormte Zeit repräsentiert. Sie steht stellvertretend für die Linie, die durch den Park in Greenwich gezogen wurde und die dafür sorgt, dass weltweit nicht mehr der Stand der Sonne am Himmel, sondern der Schlag der Turmuhr anzeigt, wann Mittag ist.
Dann, und das ist der viel gewaltigere Plan von Bourdin, soll der gesamte Turm des Observatoriums zum Zusammensturz gebracht werden. Denn die Uhr am Eingangsportal ist zwar die erste Repräsentation der normierten Zeit, die der Öffentlichkeit zugänglich ist, doch ist auch sie nur eine sogenannte Nebenuhr. Wie unzählige andere Uhren weltweit empfängt sie seit 1884 ihre Anweisungen von der Master Clock, die tief drinnen im Observatorium sitzt. Master Clocks, auch Hauptuhren genannt, steuern Nebenuhren, um dadurch Gleichzeitigkeit herzustellen. Um keinen Zweifel an den Machtverhältnissen zu lassen, weder innerhalb der Uhrenlogik noch global, werden Nebenuhren auch ›Slave Clocks‹ genannt. Auch deshalb will Martial Bourdin die Master Clock in die Luft jagen. Nach einem Anschlag eines anderen Anarchisten in einem Pariser Café drei Tage zuvor, bei dem ein Mensch ums Leben kam, möchte er die Propaganda der Tat nun ins Herz der Zeit treiben.
Zeit totschlagen. To kill time. Wie die Revolutionär:innen, die während der Julirevolution 1830 in Paris auf Uhren geschossen haben, nur noch vereinzelter. Der dahinterliegende Unmut überdauert, wenn auch in veränderter Form, ins gegenwärtige Jahrtausend. Auf Twitter zirkulierte unlängst ein Foto einer Hausmauer, auf die gesprayt war: »No Cops, No Jails, No Linear Fucking Time«.
Was ist das, dieses Aufbegehren gegen standardisierte, normierte, lineare Zeit? Woher stammt es und wieso sind seine Ausdrücke oft so verzweifelt? Das Porträt eines Herrschers zu verbrennen ist das eine, Uhren zu bekämpfen das andere. Bei Uhren und Zeit lässt sich das Verhältnis von Repräsentation und Repräsentiertem nicht im Geringsten so klar fassen wie bei Gemälden, und das macht die Geschichten von Revolten gegen Zifferblätter so radikal und zugleich so hilflos.
Martial Bourdin kam gar nicht bis zur Uhr, weder bis zur Shepherd Gate noch bis zur Master Clock. Die Bombe in seiner Jacke explodierte frühzeitig, riss ihm ein Loch in den Bauch und wies ihn darauf an, vom Parkwächter gefunden und ins Krankenhaus gebracht zu werden. Auf dem Weg dorthin starb Bourdin an den Verletzungen, die er eigentlich der Zeit zufügen wollte.
MarksGespenster
Das Gespräch wandte sich den Gespenstern zu. Jeder konnte dazu etwas beitragen, ein Erlebnis, eine Erinnerung oder was man vom Hörensagen weiß. Es war ein Thema, das sich wie kaum ein anderes
dazu eignete, Geschichten
zu erzählen.
César Aira, Gespenster, 1990
César Airas Roman Gespenster spielt auf einem Rohbau in Buenos Aires. Es ist der 31. Dezember und die Bauarbeiter:innen feiern das Jahresende mit einer Mittagsgrillerei. Der Nachtwächter und seine Familie sind die Einzigen, die bereits in dem unfertigen Haus wohnen, und bereiten am Dach ihre private Silvesterfeier vor. Wobei, »die Einzigen« stimmt nicht ganz, denn in dem Rohbau treiben sich auch Gespenster herum. Sie sehen aus wie nackte Menschen, und sichtbar werden sie in erster Linie durch den weißen Staub der Baustelle, der ihre Körper bedeckt. Die bevorzugte Aktivität der Gespenster ist es, sich unter lautem Gelächter von den hohen Stockwerken in die Tiefe zu stürzen.
Der Roman erzählt von den Gespenstern in ziemlicher Beiläufigkeit. Es scheint selbstverständlich, dass die Menschen, die im Gebäude ein und aus gehen, die nackten Figuren sehen können. Sie interessieren sich einfach nicht sonderlich für sie. Nur Patri, die älteste Tochter der Nachtwächter-Familie, fühlt sich zu ihnen hingezogen, in einem immer größer werdenden Zwiespalt zwischen dem Wunsch, Teil ihrer weltlichen Familie zu bleiben, und der Sehnsucht, der Legion der Gespenster beizutreten. Diese unterhalten sich mit ihr und legen ihr die Vorzüge des Gespensterlebens dar. Das tun sie keineswegs aufdringlich, sondern allein deshalb, weil Patri sich ihnen wiederholt nähert und das Gespräch mit ihnen sucht.
Auch der vorliegende Text sucht das Gespräch mit Gespenstern. Die, für die er sich interessiert, haben wenig zu tun mit denen, die uns von Halloween oder aus Schauergeschichten bekannt sind, die auf Friedhöfen ihr Unwesen treiben oder armen Schluckern kühl in den Nacken hauchen. Sie sind näher dran an denen aus Airas Buch, die eher unscheinbar als unheimlich wirken und in deren Sprache doch, sobald man ihnen zuzuhören bereit ist, das Versprechen eines radikal anderen Lebens steckt.
Den Ausgangspunkt meines Interesses an ihnen stellt die Annahme dar, dass unsere Gegenwart voller Gespenster ist. Sie sind großteils gar nicht unsichtbar. Wie bei den Baustellengespenstern gibt es genügend Schichten geschichtlichen Staubs, die ihre Konturen erkennbar werden lassen. Trotzdem verhalten wir uns nicht so recht zu ihnen, tun so, als wären sie nicht da. Weil ihre Präsenz irritierend, ungewohnt und vermutlich auch destabilisierend ist, und weil es gar nicht so leicht ist, sie zum Sprechen zu bringen.
Diesem Buch geht es darum, den eigentümlichen Charakter der Gespenster ein wenig zu greifen zu bekommen. Wer sind sie überhaupt? Wodurch haben sie ihre nicht so recht anwesende, keineswegs aber auch abwesende Körperlichkeit erhalten? Und warum hängen sie so oft auf unfertigen Häusern herum?
Es ist ein Thema, das sich wie kaum ein anderes dazu eignet, Geschichten zu erzählen. Im Folgenden finden Fragmente aus Texten, Filmen und Songs zusammen, die kapitelweise Erzählungen, Lektüren und Reflexionen anstoßen. Gemeinsam kreisen sie um das Ende der Arbeit, die Aufhebung von Familie und die Abschaffung der Zeit. Und sie stellen sich die Frage, was es bedeuten kann, das Flüstern der Gespenster nicht wie so oft als Drohung, sondern als Versprechen zu verstehen.
Bleib verschwunden, dachte er,
dann kann ich dich besser eingemeinden.
Clemens J. Setz, Glücklich wie Blei im Getreide, 2015
Dieser Text hatte, bevor ich ihn zu schreiben begann, eine sehr klare Form. Er wollte ein Gespräch sein mit Mark Fisher, oder genauer: ein In-Beziehung-Setzen dreier Texte von Fisher, die in ihrer neuen Konstellation miteinander und so auch mit mir zu sprechen beginnen sollten.
Mark Fisher hat sich in den Nullerjahren vor allem in linken und popkritischen Kreisen als Blogger einen Namen gemacht. Der Name lautete k-punk und stand für Texte, die Popmusik, britische Clubkultur und marxistische politische Theorie miteinander verknüpften und dabei in lebhaftem Dialog mit anderen Musikblogger:innen standen. Ich selbst habe erst mit großer Zeitverzögerung begonnen, mich mit Fishers Schreiben auseinanderzusetzen, und zwar ausgelöst durch die Nachricht seines Suizids am 13. Januar 2017. Ich begann, Capitalist Realism zu lesen, Fishers erstes Buch, das 2009 in seinem selbstgegründeten Verlag Zer0 Books erschienen war und einen überraschenden Erfolg gelandet hatte. 2014 folgte der Band Ghosts of My Life, der sich um Gespenster, Depression und Erzählungen von Zukunftslosigkeit drehte und seine Thesen anhand von Filmen wie The Shining oder Musiker:innen wie Burial entfaltete. The Weird and the Eerie, eine verhältnismäßig wenig beachtete und auch inhaltlich nicht besonders aufwühlende kulturwissenschaftliche Essaysammlung zum Begriff des Unheimlichen, erschien 2016. Der Kult-Status, der den Namen Mark Fisher inzwischen umweht, rührt also nicht von einer Masse an Theorie-Schmökern her. Er ist eher der recht leichtfüßigen Wechselwirkung zwischen seinen politischen Analysen und den musikkritischen Blogbeiträgen zu verdanken, und vor allem dem Umstand, dass einzelne catchy Zitate und Text-Snippets ihren Weg zurück in die Pop- und Meme-Kultur gefunden haben.
Fishers Texte entfalteten auch für mich eine Sogwirkung, eine Eingängigkeit nicht unverwandt mit jener der Dubstep-Tracks oder der Blockbuster, die sie oft zum Gegenstand haben. Je mehr ich mich in die Texte einlas, mich auf sie einließ, desto mehr bekam ich das Gefühl, dass sie in ihrer Gemeinschaft eine These artikulieren wollen, die sie als Einzelne nie explizit aussprechen. Durch präzise Lektüren und das Gegenüberstellen von Fishers allerersten veröffentlichten Texten mit seinen letzten, Fragment gebliebenen, wollte ich diese These herausarbeiten.
Um sie geht es später im Detail. Vorläufig lässt sie sich folgendermaßen zusammenfassen: Eines der zentralen Projekte des Neoliberalismus war und ist die Einhegung von Zeit. Einhegung verstehe ich dabei als den Prozess, etwas vormals gemeinsam Verwaltetes, Öffentliches in Privatbesitz zu transformieren und damit dem allgemeinen Zugriff zu entziehen. Und Gespenster aus Literatur, Film und Musik können helfen zu erklären, was bei diesen Akten der Zeit-Einhegung passiert, wie sie sich zur Produktionsdynamik des Kapitalismus verhalten und was sie für das Begehren nach radikal anderen Zukünften bedeuten.
Diese These blieb nah bei mir, aber sie löste sich zunehmend von den Texten, von denen sie inspiriert war. Auf das lange Allein-Lesen folgte ein Fisher-Lesekreis, den ich gemeinsam mit einigen Freund:innen abhielt. Wir lasen seine Bücher chronologisch, systematisch und mit vereintem kritischem Blick. Die eingängige Sogwirkung blieb im Modus der gemeinsamen Lektüre aus. Sie wurde ersetzt durch eine Grundskepsis, die sich in abendlangen Diskussionen verdichtete. Die frei flottierenden Referenzen wirkten mit einem Mal weniger catchy als vielmehr irgendwie willkürlich, der Dancefloor von Fishers Theorieproduktion fühlte sich zunehmend nach Glatteis an.
Je mehr ich bei anderen Denker:innen, Schriftsteller:innen und Künstler:innen danach Ausschau hielt, wie sie das Zusammenspiel von Neoliberalismus, Zeit und Gespenstern behandelten, desto uninteressanter schien es mir, mit dieser Frage nah bei Mark Fisher zu bleiben. Je mehr ich den Eindruck gewann, zu verstehen, was Fisher zwischen seinen Büchern und Zeilen zum Ausdruck bringen wollte, desto enger wollte ich diese Gedanken umkreisen und desto mehr schienen mir diese Kreise zugleich etwas einzufassen, das gar nicht mehr bei Mark Fisher selbst lag. Je mehr Zeit ich also mit Fishers Schreiben verbrachte, desto dringlicher schien es mir, Abstand von ihm zu nehmen und über die Themen, die er mir zugesteckt hatte, das Gespräch mit anderen Theoretiker:innen und deren Texten zu suchen.
Etwa mit denen von Clemens J. Setz, von dem es eine Geschichte über eine Ratte gibt. Der Text ist Teil eines Bandes, in dem Setz einige seiner eigenen unveröffentlichten Kurzgeschichten in knapper Form nacherzählt. Die Ratte in den Verhältnissen handelt von einer gespenstischen Ratte, »die angeblich immer dann erscheint, wenn irgendwo die richtige Kombination bestimmter Gegenstände erreicht wird«. Sie ist Gegenstand intensiver Bemühungen, Beschwörungen und Erklärungsversuche der Protagonist:innen, tritt aber im Laufe der Geschichte nie auf.
Die Storys, die in dem Band in knapper Form nacherzählt werden, sind 15 Jahre vor dessen Veröffentlichung entstanden. Einleitend widmet Setz seinem 15 Jahre jüngeren Selbst ein Zitat aus der Rattengeschichte: Die Hauptfigur wünscht sich darin vom gespenstischen Tier, dass es verschwunden bleibe, damit sie es besser eingemeinden könne. Den Wunsch richtet Setz auch seiner eigenen Vergangenheit aus, und mit diesem Wunsch ist auch das Verhältnis von Neoliberalismus zu Gespenstern beschrieben, das dieses Buch als Interesse antreibt: Einhegung durch Abwesenheit.
Die folgenden Kapitel drehen sich in ihrer Gemeinschaft um die Frage, wie das überhaupt geht: etwas noch abwesender zu machen, das ohnehin nur gespenstisch existiert. Und sie erfragen, was die Effekte sind, die diese doppelte Abwesenheit zeitigt.
Dabei stützen sie sich auf die Hoffnung, dass es, wie in Setz’ Geschichte, immer wieder richtige Kombinationen bestimmter Gegenstände gibt, durch die die Gespenster sichtbar werden. Versuche solcher Kombinationen unternimmt dieser Text, indem er jedes seiner Kapitel von einer eingeladenen Stimme anrufen lässt, um ihr zu antworten oder von ihr weg zu schreiben und auf diese Weise eine Art Gespenstergespräch zu erproben.
What does it mean to read Jacques Derrida and abandon Derrida and retain Derrida’s spirit (or specter!)?
Katherine McKittrick, Dear Science and other Stories, 2021
Den Autor zu verwerfen und sein Gespenst beizubehalten: Das ist genau das Verfahren, dem ich Mark Fisher unterziehen möchte. Er selbst hat es mit dem Ur-Gespenstertheoretiker Jacques Derrida ganz ähnlich gemacht. Fishers 2014 erschienenes Buch Ghosts of My Life zieht Derridas Marx’ Gespenster





























