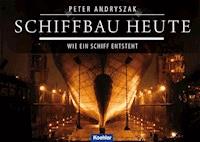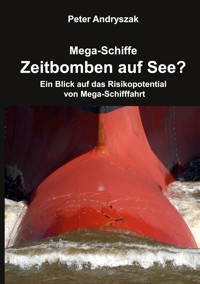
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Seeverkehr macht die expandierende Wirtschaft von heute erst zu dem, was sie ist. Mit ihm wird 90 und mehr Prozent der weltweit transportierten Waren bewegt. Dabei ist allerdings das damit verbundene Risiko für Wirtschaft wie Umwelt zunehmend aus dem Blick geraten. Es ist gut 17 Jahre her, als in Anbetracht der riesigen EMMA MAERSK viele Experten die Grenzen der Schiffbau-Physik als erreicht ansahen. Nur sind insbesondere heutige Mega-Container-Frachter oft noch weitaus riesiger. Und noch mehr: einzelne Großreedereien scheinen diesem immer weiter wachsenden Gigantismus kein Ende bereiten zu wollen. Peter Andryszak will mit diesem Buch versuchen, den Informationsgehalt zu diesem meist nur punktuell beleuchteten Themenfeld zu erweitern. Und das insbesondere mit Blick auf Mega-Containerschiffe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
01 Einleitung
02 Schiff
Größe
Stabilität
Schiffbau
Kosten
Maschine
Feuer
Brandbekämpfung
Flagge
Sicherheit
Autoren-Sicht
03 Container
Konstrukt
Stabilität
Beladung
Inhalt
Gewicht
Ladungstransparenz
Deklarierung
Begasung
Auffindbarkeit
Brandgefahr
Sicherheit
Autoren-Sicht
04 Ladung
Be- und Entladung
Ladungstransparenz
Decksladung
Stauregeln
Stabilität
Gefahrgut
Deklarierung
Brandgefahr
Brandbekämpfung
Ladungsverlust
Sicherheit
Autoren-Sicht
05 Fahrt
Geschwindigkeit
Begegnung
Bremsweg
Wende
Bewegungen
Wind
Wellen
Strömung
Wetter
Technik
Autoren-Sicht
06 Besatzung
Anzahl
Qualifikation
Arbeitsplatz
Verletzung/Krankheit
Brand
Sicherheit
Autoren-Sicht
07 Fahrweg
Fahrstrecken
Begegnungsverkehr
Fahrrinnen/Kanäle
Wendestelle
Baggerung
Verkehrstrennung
Verkehrsüberwachung
Lotsen
Autoren-Sicht
08 Hafen
Häfen
Zugänglichkeit
Leistungsgrenzen
Wettbewerb
Hafenentwicklung
Kooperation
Sedimentmanagement
Sicherheit
Autoren-Sicht
09 Havarie
Situation
Ursachen
Havariemanagement
Bergung
Havarieprophylaxe
Risiken
Autoren-Sicht
10 Havarieliste
11 Folgen
12 Lösungsideen
13 Regelwerke
14 Checkliste Risiken
Schiff
Container
Ladung
Fahrt
Besatzung
Fahrweg
Hafen
Havarie
15 Schlussbemerkung
16 Abkürzungen
17 Quellen
Quellenorte online
01 Einleitung
Die Wirtschaft expandierte global und wird es wohl trotz aller kritischen Umstände auch noch weiter tun. Möglich macht es der Seeverkehr. Mit ihm wird 90 und mehr Prozent der weltweit transportierten Waren befördert. Dabei scheint es, dass das damit einhergehende Risikopotential für Ökonomie wie Ökologie, insbesondere den Lebensräumen der südlichen Nordsee und den Tidebereichen ihrer Zuflüsse, zunehmend aus dem Blick geraten ist – und gerade auch in diesen Tagen keine adäquate Beachtung findet. Es ist gut 17 Jahre her, als in Anbetracht der riesigen EMMA MAERSK viele Experten die Grenzen der Schiffbau-Physik als erreicht ansahen. Nur sind insbesondere heutige Mega-Container-Frachter oft noch weitaus größer. Und noch mehr: einzelne Großreedereien scheinen diesem immer weiter wachsenden Gigantismus kein Ende bereiten zu wollen.
Damit einher geht eine enorme Wertekumulierung und zugleich eine Steigerung direkter und indirekter Gefahren in zuvor nie gekannte Dimensionen. Zwar geht die Zahl der totalen Schiffsverluste seit Jahren zurück, aber zugleich steigen die durchschnittlichen Kosten und Umweltschäden pro Havarie dramatisch an. Allein die Havarie nur eines Schiffes wie EVER GIVEN, INDIAN OCEAN oder MSC ZOE könnte schon reichen, das Leben und auch die Wirtschaft an der Nordseeküste weitgehend zu zerstören!
Von daher gilt es präventiv zu überlegen, womit dieses stete Gefährdungspotential, wenn schon nicht verhindert, so doch zumindest reduziert werden kann. Denn jede Ladung, die auf See nicht über Bord geht und jedes Schiff, das nicht Leck schlägt oder gar zerbricht, verringert gleichermaßen Umweltschäden wie auch Kosten für die Produktions-, Handels-, Transport- und Versicherungswirtschaft. Denn bei aller menschlichen Technikgläubigkeit ist es nun einmal nicht möglich, durch Menschen verursachte Störungen und Schäden auch wieder spurlos zu beseitigen.
Ich möchte im Sinne des Mottos „Prävention statt Reaktion“ versuchen, den Informationsgehalt zu diesem immer wieder nur punktuell beleuchtetem Themenfeld zu erhöhen. Und das insbesondere am Beispiel der Frachtschifffahrt - und hier vor allem mit Blick auf Mega-Containerschiffe. Gerade im Zusammenhang mit ihnen scheinen sich die weltweit größten Veränderungen und Risiken zu zeigen.
Mein Ziel dabei: der öffentlichen Aufmerksamkeit eine weitreichende thematische Übersicht über Komplexität und Folgen menschlicher Selbstüberschätzung im Schifffahrtsbereich zu ermöglichen. Dabei möchte ich versuchen, auch unterschiedliche Sichtweisen zu einzelnen Themen aufzuzeigen. Und das immer wieder einmal, ohne die institutionelle Richtung der Aussage schon auf den >ersten Blick< erkennbar zu machen.
Peter Andryszak / Oldenburg, 15.05.2023
02 Schiff
Interesse, Freude und Begeisterung kommen bei vielen Menschen spontan auf, wenn sie das Glück haben, dass eines oder mehrere dieser riesigen Schiffe an ihnen vorbei fahren. Oder im Hafen von dagegen sehr kleinen Schleppern an die Leine genommen werden. Geradezu spektakulär die scheinbare Ruhe und Leichtigkeit des ganzen Geschehens. Nur so leicht, nur so unkritisch, nur so ungefährlich ist es aber dann doch nicht. Anders als es zumeist wirkt. So bilden schon kleinere Schiffe um die 50, 100 oder 150 Meter Länge stets ein gewisses Risiko, dass etwas >schief< gehen könnte; die Maschine oder das Ruder ausfallen, Strömung, Wind oder Wetter entgegen wirken, ein anderes Schiff quer läuft oder einfach nur einzelne der direkt beteiligten Menschen einen Augenblick nicht aufmerksam genug sind. Und das ist bei den großen und übergroßen Schiffen nicht anders. Allerdings sind bei ihnen die möglichen Auswirkungen um ein Vielfaches größer.
Größe
Die Zunahme der durchschnittlichen Größe von Handelsschiffen ist ein Trend, der nicht erst vor kurzem begann, sondern schon seit Jahrzehnten sichtbar ist. So nahm die Ladekapazität der größten Containerschiffe von 1968 bis 2017 von 1.530 TEU auf 21.000 TEU zu. Gemessen an der durchschnittlichen BRZ überholten Containerschiffe im Jahr 2017 Schüttgutfrachter in ihrer Größe. Bei beiden Schiffstypen stieg die durchschnittliche BRZ pro Schiff in den letzten Jahren kontinuierlich an. Containerschiffe weisen im Jahr 2017 eine durchschnittliche BRZ von ca. 42.000 auf, Schüttgutfrachter von ca. 40.500. Insgesamt liegt die gesamte BRZ aller Schüttgutfrachter (440,6 Mio.) jedoch deutlich über derjenigen aller Containerschiffe (217 Mio.). Öltanker ordnen sich hierbei dazwischen ein (294 Mio.), liegen aber in ihrer durchschnittlichen Größe (29.000) unter den Containerschiffen und Schüttgutfrachtern.(DVW 1/19)
Bei allen drei Schiffstypen lässt sich eine Zunahme der gesamten Ladekapazität der weltweiten Flotte, wie auch der durchschnittlichen Ladekapazität pro Schiff in den Jahren 2011 – 2017 feststellen.(DVW 1/19) Massengutfrachter weisen somit einen Anteil von 43 Prozent am gesamten Frachtvolumen auf, dem weithin größten Geschäftsfeld. Mittlerweile werden weltweit 61 dieser Frachter in Längen von mehr als 350 Metern und einer Ladekapazität (Tragfähigkeit) von rund 400.000 Tonnen eingesetzt. Öltanker machen mit einem Frachtvolumenanteil von 29 Prozent die zweitgrößte Sparte aus.(WOR 2021)
Die Schiffe werden jedoch nicht nur größer – es werden auch immer mehr. Anfang 2020 zählten die UNCTAD-Experten insgesamt 98.140 Fracht-, Container-, Tank-, Fähr- und Passagierschiffe, die weltweit im Einsatz waren. Ihr gemeinsames Frachtvolumen belief sich auf 2,06 Milliarden Tonnen. Im Vergleich zur Handelsflotte aus dem Jahr 2000 (Frachtvolumen 800 Millionen Tonnen) hat sich das verfügbare Frachtvolumen damit innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Um zum Beispiel Lagerkosten zu sparen, bestellten Produzenten ihre Waren und Güter in kleineren Chargen und erwarten die Lieferung zu einem festgelegten Zeitpunkt (just in time). Nach UNCTAD-Angaben wird inzwischen mehr als die Hälfte der Waren, die Firmen mit Sitz in Industriestaaten herstellen, im Ausland produziert und verkauft. Gleichzeitig importieren diese Firmen Rohmaterial und Zwischenprodukte in derselben Größenkategorie aus anderen Ländern.(WOR 2021)
Uwe Schmidt (SPD), Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags, erklärt zur Größenentwicklung: „Sie haben, gerade bei Seeschiffen keine Größenbegrenzungen. Jeder andere Verkehrsträger ist reglementiert, jeder Lkw, von der Länge her, Schienenfahrzeuge, Luftverkehrsfahrzeuge sind alle irgendwie reglementiert und auch streng kontrolliert. Das haben sie in der Seeschifffahrt leider nicht.“(DLF 25.06.21) Die deutsche Handelsflotte steht mit rund 2.000 Schiffen auf Platz 6 der größten Schifffahrtsnationen.(VDR 25.05.22)
Containerschiffe
Containerschiffe haben in den vergangenen Jahren eine Größenordnung erreicht, die auf das Mitwachsen von Erfahrung bei Entwurf, Bau und Betrieb wenig Rücksicht genommen hat. Nachdem sich die ersten Entwürfe von Containerschiffen noch stark an den Formen und Größen von Stückgutschiffen orientierten, kristallisierte sich bald ein eigener Schiffstyp heraus. Anfängliche Längsfestigkeitsprobleme wurden technisch gelöst und schrittweise wurden die Schiffe größer. Ab der Jahrtausendwende begann ein regelrechter Wettlauf der Kapazitäten. Die Schiffe wurden schneller und vor allen Dingen größer. Die hohen Geschwindigkeiten waren ökonomisch nicht sinnvoll, aber über die Schiffsgrößen ließen sich scheinbar wirtschaftliche Vorteile erzielen.(GDV 13.12.21)
Ferenc John von der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) bestätigt: „Mit den gängigen Maßstäben kann man das in der Tat nicht mehr messen, weil die Schiffe sind so groß, so breit, so schwer, dass sich da völlig neue physikalische Bedingungen ergeben.“ Er spricht von „learning by doing“: Es würden immer größere Schiffe gebaut und erst wenn sie in See stechen merke man, „was man für Begebenheiten mit diesen Fahrzeugen zu bewältigen hat.“(BUB 03.07.21) Laut der Allianz hat sich die Kapazität von Containerschiffen in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt und ist in den letzten 50 Jahren um 1.500 Prozent gestiegen.(S&H 9/ 21) Seit den 60er Jahren hat sich die Größe von Containerschiffen versechzehnfacht. Regularien für Ladungssicherung, Schiffsbau und Fahranweisungen – all das blieb unverändert. Die Vorschriften sind im Grunde noch von 1940 und seitdem nie wieder angepasst worden.(BUB 03.07.21)
Diese Schiffe wachsen vor allem in der Länge und marginal in der Breite. Der Tiefgang bleibt meist unverändert. Hinzu kommt, das die Schiffe immer höher werden und damit die Ausleger der Containerbrücken ebenfalls höher geplant werden müssen.(ISL 2014) Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen hatte den ökonomischen Sinn von Schiffen jenseits der 20.000 TEU stets bestritten. Die Kostensenkungen für den Transport je Container zwischen Schiffen mit 14.000 TEU und solchen mit rund 18.000 TEU seien erheblich, argumentierte er. Darüber hinaus ergäben sich kaum noch sinnvolle Effekte. „Zudem reduzieren wir die Umweltbelastung, die wir verursachen.“(WEL 23.12.20) Seit 2019 plant die norwegisch-deutsche Klassifikationsgesellschaft DNV zusammen mit Chinas Hudong-Zhonghua Werft einen Mega-Carrier, der 432,5 Meter lang und 63,3 Meter breit werden und 25.600 TEU tragen können soll.(WAT 29.03.21)
Malchow geht davon aus, dass der Bau der ersten 30.000-TEU-Schiffe (Nennkapazität) bereits im Jahr 2025 beginnen kann. Nach einer aktuellen Veröffentlichung von Alphaliner (2021) könnte die 30.000 TEU-Marke mit Abmessungen von 425 m × 66,1 m erreicht werden, was eine Erweiterung um zwei 40'-Buchten im Vergleich zu den MGX-24-Schiffen und eine Verbreiterung auf 26 Reihen entspräche. Bis dahin würden geeignete Zwischenschritte in Bezug auf Länge und Breite unternommen, zum Beispiel durch eine Verlängerung des Schiffes auf 425 m bei gleichzeitiger Hinzufügung nur einer zusätzlichen Reihe auf insgesamt 25 Reihen.(ISL 2021)
Die Reeder fühlen sich an den Pranger gestellt und verteidigen die Riesenfrachter. „Wer vorschnell Beschränkungen für große Containerschiffe fordert, muss gleichzeitig erklären, wie der globale Warenaustausch unter den gegebenen Bedingungen künftig funktionieren soll“, erklärt Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied beim Verband Deutscher Reeder.(SDZ 03.04.21) Große Containerschiffe sind nötig, um den zunehmenden Welthandel und die Versorgung der Volkwirtschaften so effizient, kostensparend und ressourcenschonend wie möglich zu ermöglichen. gerade große Containerschiffe sind besonders klimafreundlich bei hoher Auslastung, wegen ihrer modernen Motoren und der hohen Tragfähigkeit. Der Markt würde schon selbst die zukünftige Entwicklung der großen Containerschiffe regeln, heißt es weiter. Technisch wäre es laut der Werften jedenfalls machbar und verantwortbar.(VDR 25.05.22) Bezogen auf den Warenwert würden mittlerweile 60 Prozent der weltweit gehandelten Güter in Containern zu über 80 Prozent von drei großen Reederei-Zusammenschlüssen verschifft.(WOR 2021)
Allerdings stellen solche Schiffe natürlich auch immer größere Anforderungen an die Schifffahrtsstraßen, die sie passieren, oder die Häfen, die sie anlaufen. Schon jetzt sind die sehr großen Containerschiffe nur im Fernost-Trade, also zwischen Nordeuropa und Asien, einsetzbar. Zudem müssen Versicherungen bereit dazu sein, die mit einer größeren Ladungsmenge einhergehenden größeren finanziellen Risiken zu versichern.(VDR 25.05.22) „Nur weil es möglich ist, große Schiffe zu bauen, heißt das noch lange nicht, dass wir es tun sollten“, sagt Kapitän Andrew Kinsey, Senior Marine Risk Consultant bei AGCS. „Die verschiedenen Konsequenzen von größeren Schiffen werden jetzt immer deutlicher, einschließlich der Auswirkungen auf die Lieferketten. Große Schiffe und die Häfen, die für ihre Abfertigung benötigt werden, stellen eine massive Anhäufung von Risiken, und die Kosten sind unverhältnismäßig wenn etwas schief geht“.(AGC 2021) Wir gehen davon aus, dass die Schiffsgrößenentwicklung sowohl aus Gründen der Wirtschaftlichkeit als auch der technischen Machbarkeit an ihre Grenzen stößt. Die Entwicklung bei den Schiffen wird sich nach unserer Einschätzung stärker auf umweltfreundliche Antriebe ausrichten. Denn wir gehen davon aus, dass viele Häfen in der Zukunft mehr Wert auf Klima- und Umweltschutz legen und das Nichteinhalten von Grenzen für die Luftreinhaltung mit zusätzlichen Gebühren sanktionieren werden.(HHL 10.06.21)
Die Containerriesen werden vor allem im Linienverkehr zwischen Europa und Asien sowie auf den Routen über den Atlantik und Pazifik eingesetzt.(WOR 2021) Die meisten (dieser) Containerschiffe (...) sind ULCS mit mehr als 18.000 TEU. Die Größe eines ULCS hat praktische Grenzen, nur einige wenige Häfen können sie aufnehmen. Die Möglichkeiten des Hafens hinsichtlich der Liegeplatzlänge, der freien Höhe unter der Containerbrücke oder des Freiraums, der zum Drehen innerhalb des Hafens erforderlich ist, sind begrenzende Faktoren.(BSU 25.06.20) Die Grenzen sind noch lange nicht erreicht: „Bis zu einer Länge von etwa 430 Meter gibt es heute nichts, was uns technisch ausbremsen würde“, Jan-Olaf Probst, Bereichsleiter Schiffsneubau beim Germanischen Lloyd (GL).(WEL 09.05.11) Im März 2023 hat das Mega-Containerschiff, die MSC IRINA, mit 24.346 TEU Ladekapazität, 400 Metern Länge und 61 Metern Breite seinen Dienst aufgenommen.
Tatsache ist: Auch die Möglichkeiten der Brandbekämpfung auf Großcontainerschiffen hinken dem allgemeinen Größenwachstum der Frachter weit hinterher. Es hat daher nichts mit ideologiegeschwängerter Fortschrittsverweigerung zu tun, wenn man diesen Schiffen attestiert, dass sie einfach zu groß sind.(THB 07.04.21) „Große Schäden durch Brände und Grundberührungen von Containerschiffen sowie der Verlust von Tausenden von Containern auf See, haben alle eines gemeinsam, die zunehmende Größe der Schiffe“, sagt Khanna.(AGC 2021)
Massengutschiffe
Doch nicht jede neue Schiffsgröße hat sich am Ende tatsächlich durchgesetzt: Bei Tankschiffen hatten Riesen mit 400.000 Tonnen Ladekapazität keinen Erfolg am Markt. In vielen Hafenanlagen konnten sie nicht gelöscht und beladen werden. Einige dieser Neubauten waren kaum in den Dienst gestellt, da wurden sie schon wieder in einem norwegischen Fjord geparkt. (WEL 09.05.11) Öltanker werden durchschnittlich nach 20 Jahren ausrangiert, da Öl die Metalle des Schiffsrumpfes stark angreift.(STE 02.09.07)
Schon einmal musste die Schifffahrt lernen, dass es Grenzen bei der Größe gibt. Die größten Supertanker für den Transport von Rohöl wurden in den 1970erJahren gebaut. Die „Jahre Viking“ mit 458 Metern Länge und 564.000 Tonnen Tragfähigkeit war der größte jemals gebaute Tanker. Das Schiff konnte weder den Panama- noch den Suezkanal durchfahren und wegen seiner schlechten Manövrierfähigkeit noch nicht einmal den Ärmelkanal. Die „Jahre Viking“ konnte nur sehr wenige Häfen anlaufen. Allein der Anhalteweg betrug sechs Kilometer. In den letzten Lebensjahren wurde das Schiff als schwimmendes Rohöllager genutzt und 2010 verschrottet. Moderne Tanker sind immer noch sehr groß, aber nicht mehr ganz so riesig wie die Schiffe vor 40 Jahren. Hinsichtlich der Parallelen zwischen der Größen-Entwicklung von Containerschiffen und Tankschiffen stellt sich die Frage, ob noch größere Containerschiffe sinnvoll sind oder ob die Nachteile überwiegen.(MML 15.08.16)
LNG-Tanker
Moderne LNG-Tanker sind etwa 300 Meter lang und 50 Meter breit. Ein durchschnittlicher Stahlkoloss nimmt 150.000 Kubikmeter verflüssigtes Erdgas auf. Diese Menge reicht aus, um 34.000 Haushalte für ein Jahr mit dem Rohstoff zu versorgen. Die Giganten können von den Reedereien 40 bis 50 Jahre betrieben werden. Deutlich länger als ein Öltanker, der durchschnittlich nach nur 20 Jahren ausrangiert werden muss, da Öl die Metalle des Schiffsrumpfes deutlich stärker angreift als verflüssigtes Methangas. Gelagert wird LNG auf den Schiffen auf zwei Arten: in so genannten Kugeltanksystemen (sphärische Lagerräume) oder in Membransystemen.(STE 02.09.07)
Die Kugeltankschiffe sind teure Spezialanfertigungen, sogenannte Moss-Rosenberg-Tanker. An Deck befinden sich bis zu fünf mindestens 40 Meter durchmessende und gut isolierte und den Schiffsraum unvorteilhaft nutzende Kugeln, die mit LNG betankt werden. Auf Membrantankern sind die Tanks in die Schiffsstruktur eingepasst und füllen den gesamten Laderaum aus. Sie werden unter anderem aus hauchdünnem Invarstahl gefertigt, der problemlos minus 162 Grad erträgt und sich trotz extremer Temperaturunterschiede (...) nicht verformt. Da die Kühlung nicht ohne Verlust gelingt, wird ein Teil des Gases an Bord abgefackelt oder als Antriebsenergie genutzt.(SPI 04.01.10) Im direkten Vergleich zum Kugeltanksystem nimmt ein Schiff mit Membrantechnik acht Prozent mehr verflüssigtes Erdgas auf.(STE 02.09.07)
Während der Befüllung und auch im Verlauf der Verschiffung vergast ein geringer Teil des flüssigen Methans, täglich etwa 0,2 Prozent. Dieses so genannte „Boil of Gas“ wird gesammelt, abgeführt und in der Regel verbrannt.(STE 02.09.07) In modernen LNG-Tankern wird überschüssiges BOG (Boil of Gas) rückverflüssigt und wieder in den Kreislauf geleitet, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Unter bestimmten Umständen blasen LNG-Motoren unverbranntes Gas in die Atmosphäre – überwiegend in Form von Methan.(VDR 3/21b)
Wie sicher der Transport von LNG ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Gerd-Michael Würsig, LNG-Experte des Germanischen Lloyds, einer Art TÜV für Schiffe, gibt Entwarnung: „LNG-Tanker sind keine schippernden Bomben.“ Eine Explosion sei extrem unwahrscheinlich, weil dafür viele Faktoren zusammenkommen müssten. Das verdampfte LNG entzünde sich nur dann, wenn es sich in einem ganz bestimmten Verhältnis mit dem Sauerstoff in der Luft mische. „Die Sicherheitsstatistik von LNG-Tankern ist hervorragend, bisher gab es keine Totalverluste.“(SPI 04.01.10) Mit zunehmendem Einsatz von LNG häufen sich die schweren Unfälle an LNG-Terminals. Bei einem Unfall in den USA 2014 wurde eine Evakuierung in einem Umkreis von über 3,3 km (2 Meilen) für erforderlich gehalten. Damit wären neben Brunsbüttel und der kritischen Infrastruktur des Atomkraftwerks, des Chemieparks und der Sondermüllverbrennungsanlage auch die Schleusen, die Deiche und die Fahrrinne der Elbe gefährdet. Erst im Herbst 2020 gab es einen schweren Unfall im norwegischen Hammerfest, der eine ernsthafte Gefährdung der in der Nähe befindlichen Ortschaft sowie des Flughafens darstellte. Laut einem Untersuchungsbericht hätte sich dieser Vorfall zum schlimmsten Unfall der norwegischen Ölindustrie entwickeln können.(DUH 7/21) „Wir haben viele Neulinge in der LNG-Schifffahrt“, sagt SIGTTO-Präsident Mark Ross (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators), „und wir müssen dringend dafür sorgen, dass sie das Geschäft ebenso sicher betreiben wie die alten Hasen.“(SPI 04.01.10)
In den vergangenen drei Jahren wurden 134 LNG-Tanker in Dienst gestellt, die Zahl der Schiffe, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, stieg damit auf über 600. Gut zehn Prozent der aktuellen Flotte ist vor der Jahrtausendwende in Dienst gestellt worden, also mehr als 20 Jahre alt.(VDR 3/21b) Mindestens 142 LNG-Tanker, die kürzlich bestellt wurden, kommen zwischen 2021 und 2025 in Fahrt, 46 davon noch in diesem Jahr, gefolgt von 38 Schiffen im Jahr 2022.(THB 17.05.21)
Aktuell befasst sich die deutsche Politik mit einer schnellen Installation von Erdgasanlieferungen per Schiff an die deutsche Küste. Dabei gerät etwas aus dem Blick, dass dafür die maritime Umwelt stellenweise noch deutlichen Veränderungen unterzogen wird. So wäre am geplanten Terminal Brunsbüttel eine weitere Vertiefung des Flusses für den Hafen und die Zufahrt notwendig. Zudem würde sich, wie auch in Stade, wegen der zusätzlichen Hafenanlagen die Breite der Unterelbe verringern. Gleichzeitig müssten riesige Flüssiggas-Tanker häufige Wendemanöver in der Fahrrinne der ohnehin bereits stark befahrenen Elbe durchführen – ein nicht hinnehmbares Gefahrenpotenzial für den Schiffsverkehr. Bereits 2017 hatte die Potenzialanalyse-Studie für ein LNG Terminal in Deutschland ergeben, dass die nautischen Herausforderungen am Standort Stade zu schwerwiegend seien, um die Ansiedlung eines LNG Terminals zu erlauben.(DUH 7/21) Über einige Jahre verschärft sich diese Situation noch durch den Einsatz von „Schwimmenden Einheiten für Lagerung und Rückvergasung“; abgekürzt FSRU für „Floating Storage and Regasification Units“. Diese ebenfalls um die 300 Meter langen Spezialschiffe liegen fest vertäut an Spezialpiers mit Pipeline-Anschluss zum Land. Die LNG-Tanker legen bei ihnen seitlich an und pumpen ihre Gas-Fracht zum Speichern, zum Erwärmen mittels Meerwasser und zur Gas-Weitergabe an Land auf sie über.
Für die neuen Standorte zur Zeit geplant sind die FSRU: TRANSGAS FORCE (IMO: 9861811/83.300 dwt/294 m Länge/47 m Breite/aus 2021) und TRANSGAS POWER (IMO: 9861809/94.414 dwt/294 m Länge/47 m Breite/aus 2021) sowie die HÖEGH ESPERANZA (IMO: 9780354/92.217 dwt/294 m Länge/46,03 m Breite/aus 2018) und evtl. die S188 (IMO: 9757694/19.510 dwt/120 m Länge/33 m Breite/aus 2017).(KZW 18.05.22 und MTC 08.06.22)
Kreuzfahrtschiffe
Ein Kreuzfahrtschiff ist ein Passagierschiff, das für Vergnügungsreisen genutzt wird, bei denen die Reise selbst und die Annehmlichkeiten an Bord ebenso als Teil des Erlebnisses gelten wie die angelaufenen Häfen unterwegs.(CTD 04.09.22 + Wikipedia) Neue Schiffe warten gerne mit Superlativen auf. Je nach Sichtweise ist mal das eine, mal das andere Schiff größer, besser, imposanter. Generell ist es eine Herausforderung zu definieren, welche Schiffe eigentlich „die größten“ sind. Setzt man die Tonnage als Messgröße an, ist die Frage leicht zu beantworten. Leider ist die Bruttoraumzahl (BRZ) aber eine recht abstrakte Größe, unter der sich kaum jemand etwas Konkretes vorstellen kann. Dabei ist es gerade einmal gut hundert Jahre her, dass selbst die größten Passagierschiffe nur etwa ein Fünftel der heutigen Größe hatten. Um ein Gefühl für die Dimensionen zu bekommen: Die 1912 gebaute Titanic hatte eine Tonnage von 46.329 BRT. Bis in die späten 1980er-Jahre hinein waren reine Kreuzfahrtschiffe gemessen an der Tonnage nicht größer als die Titanic. Heutige Schiffe erreichen zunehmend Dimensionen von weit über 300 Meter Länge, 40 bis 60 Meter Breite und acht bis neun Meter Tiefgang mit Platz für bis zu 7000 Passagiere und 2300 Besatzungsmitglieder. Und das alles in weiter steigender Tendenz.(CTD 04.09.22)Die internationale kreuzfahrttouristische Nachfrage stieg im Zeitraum von 1990 bis 2018 von 3,8 Millionen auf 28,5 Millionen Passagiere.(WOR 2021) Insgesamt besteht die globale Flotte derzeit aus etwa 600 Kreuzfahrtschiffen.(NAB 2015)
Eine solche schwimmende Stadt zu betreiben hat seinen ökologischen Preis. Zumal die meisten Kreuzfahrtschiffe Schweröle für den Antrieb verwenden, ein Restprodukt aus Raffinerien, das hohe Anteile an Schwefel, Asche, Schwermetallen und viele weitere giftigen Substanzen enthält. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Müll. Insgesamt stammt ein Viertel der festen Abfälle des weltweiten Seeverkehrs von Kreuzfahrtschiffen.(PWI 18.03.21) Massen an Lebensmittel-Resten werden als „biologischer Müll“ direkt ins Meer entsorgt, was problematisch ist, weil sie Algenwachstum und Sauerstoffmangel im Meer begünstigen. Auch das Abwasser aus Duschen, der Wäscherei und Toiletten wird oft einfach ins Meer geleitet – dies ist ab 12 Seemeilen Entfernung von der Küste tatsächlich legal.Zudem ist die Luftverschmutzung in Hafenstädten durch die Schiffsabgase extrem hoch. (vgl. LDW 31.08.22)
Ein weiteres ökologisches Problem, das häufig übersehen wird, ist das sogenannte Ballastwasser. Da Kreuzfahrtschiffe viele verschiedene Orte anfahren, ist der Effekt bei ihnen deutlich größer als beispielsweise bei Containerschiffen. Darüber hinaus können Kreuzfahrtschiffe in ökologisch sensiblen Gebieten, wie zum Beispiel Korallenriffen, großen Schaden anrichten. Und die angefahrenen Städte leiden oftmals unter den Kreuzfahrtreisen. Das Geld fließt nicht in die lokale Wirtschaft, sondern in die Hände des Kreuzfahrt-Veranstalters. Die Häfen mussten zudem häufig für viel Geld angepasst und vergrößert werden, um die Schiffe überhaupt aufnehmen zu können. Auch die Situation der Mitarbeiter an Bord ist oft prekär. (PWI 18.03.21)
Und wohl ganz besonders bemerkenswert: Gerade hat die dänische Schifffahrtsbehörde (DMA) die offizielle Zulassung für das LifeCraft-Rettungsboot als „Novel Life-Saving Appliance“ beschlossen. Damit können konventionelle Rettungsboote in Zukunft durch aufblasbare Rettungsinseln ersetzt werden. Die Meyer-Werft plant bereits heute Kreuzfahrtschiffe ohne Rettungsboote. Das ist eine rein wirtschaftlich getriebene Innovation, die keine Verbesserung der Sicherheit im Notfall herbeiführt. (SPI 11.08.19)
Stabilität
Mit Stabilität eines Schiffes beschreibt man die Fähigkeit des Schiffes sich nach einer seitlichen Störung des Gleichgewichts wiederaufzurichten. Ist viel Stabilität vorhanden, richtet es sich schnell wieder auf, man spricht von einem „steifen“ und bei wenig Stabilität von einem „weichen“ Schiff. Das Optimum für Mensch, Schiff und Ladung liegt immer in einer gesunden Mitte. (GDV 13.12.21) Die Merkmale eines steifen Schiffes sind eine sehr kurze Phase des Rollens, was bedeutet, dass sich das Schiff nach dem Rollen sehr schnell und ruckartig wieder aufrichtet, was zu einer sehr ruckeligen und unbequemen Fahrt führt. Wenn der GM-Wert klein ist, handelt es sich um ein sogenanntes Tender-Schiff, das ausgedehnter, aber langsamer schwingt, sodass es angenehmer ist, darauf zu reisen. (BSU 25.06.20)
Mega-Containerschiffe sind aufgrund ihrer großen Breite relativ „steif“. Sie sind damit „überstabil“, weshalb sie zur Aufrechterhaltung der Stabilität auch kaum noch Ballastwasser benötigen. Letzteres allenfalls noch zum Trimmausgleich. Die Frachter sind sogar so „steif“, dass schwere Container nicht mehr zwangsläufig ganz unten gestaut werden, sondern auch an Deck gefahren werden, um so den Gewichtsschwerpunkt wieder anzuheben, das heißt, um das Schiff „weicher“ zu machen. Denn es gilt: Je „steifer“ ein Schiff ist, desto schneller sind die Rollbewegungen und damit die Rollbeschleunigungen als Winkelbeschleunigung um seine Längsachse. Der Absolutwert der Beschleunigung in m/s2nimmt mit dem Abstand vom Drehpunkt zu – also mit der Höhe.(THB 03.01.19) Große Containerschiffe sind besonders anfällig für parametrisches Rollen, bei dem ein Schiff aufgrund der Position von Wellenbergen und -tälern ein größeres Rollverhalten zeigt als erwartet.(AGC 2021) Und wenn sie 15 Sekunden von der einen Seite auf die andere Seite rollen, dann haben sie bei den großen Schiffen derartige Querbeschleunigungen, dass die Container auf jeden Fall runterfliegen“, so Prof. Dr.Ing. Stefan Krüger, Technische Universität Hamburg.(BUB 03.07.21)
„Die Containerschiffe überleben nur, weil sie Container abwerfen und deshalb nicht kentern“, so Krüger. „Unheimliche Beschleunigungswerte“, so Krüger, würden bei um die 400 Meter langen Frachtern auftreten. „Wenn man das Problem erkennt, ist es meistens zu spät, um noch etwas tun zu können“, berichtete der Experte für Schiffssicherheit und Schiffsentwurf. Sein Tipp: Mehr Fahrt wagen und so für mehr Rolldämpfung sorgen. „Wäre die ‚MSC Zoe‘ ein bischen schneller gelaufen, wäre wohl nichts passiert“, meint Krüger. „Wir müssen den Stand der Wissenschaft in den Stand der Technik überführen“, sieht er einen Ansatz, um das Problem in den Griff zu bekommen.(THB 22.10.21) Die Reaktion von Maersk auf den Containerverlust der MAERSK ESSEN zeigt, dass die Reederei dies nicht für einen Einzelfall hält. Die Reederei betrachtet es als „…eine sehr ernste Situation, die sofort und gründlich untersucht wird”.(VEU 29.03.21) Dieses so genannte „Rollen“ kann nicht nur heftiges Vibrieren und Verformen des Schiffskörpers verursachen, sondern entfaltet auch beträchtliche zerrende und beschleunigende Kräfte auf Ladung und Ladungsbefestigung.(WAT 28.06.20) Große Bilgenkiele reduzieren die Beschleunigungswerte. Die TUHH kommt zu dem Schluss, dass Containerschiffe wie die MSC ZOE in Situationen mit hoher Stabilität möglicherweise eine unzureichende Rolldämpfung aufweisen. Diese Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses von Geschwindigkeit und Größe der Bilgenkiele tragen weiter zu dem Problem der Rollbewegungen von Schiffen mit hoher Stabilität in Wellenperioden bei, wie sie im Falle der Fahrtrouten nördlich der Watteninseln auftreten.(BSU 25.06.20)
Große Tanker und Bulkcarrier haben diese Probleme nicht, mitentscheidend ist ... die Schiffsform unter Wasser.(S&H 1/04) Ein wenig drängt sich der Vergleich zu den Bulkern, aber auch Tankern in den 70er und 80er Jahren auf. Unbeschichtete Ballastwassertanks haben diesen Schiffen infolge innerer Korrosion reihenweise regelrecht das Rückgrat gebrochen. Über 120 Bulker gingen verloren, teilweise mit Mann und Maus. Daraufhin hat die IMO auf bedeutende bauliche Verbesserungen und auf die Einrichtung der „Memoranden of Understanding“, z.B. Paris MoU und Tokio MoU gedrängt. Die dadurch eingeführten Hafenstaatskontrollen oder PSC („Port State Control“) sind heute eine tragende Säule, wenn es um die Schiffssicherheit und deren Kontrolle geht.(GDV 13.12.21)
Die Bauweise des Containerschiffes ist durch eine große Decksöffnung gekennzeichnet. Dies und die immer größer werdende Länge und Breite der ULCS führen zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Torsions- und horizontalen Biegebelastungen. Containerschiffe sind nicht starr, sie reagieren auf die welleninduzierten periodischen Belastungen. Die dynamischen Kräfte, die durch die Wellen, die Bewegung des Schiffes und die Ladung entstehen, wirken in verschiedener Art und Richtung auf den Rumpf.(BSU 25.06.20) Damit diese Kolosse aber bei hohem Wellengang nicht auseinander brechen, dürfen sie sich um bis zu einem Meter dehnen: fünfzig Zentimeter nach oben und fünfzig Zentimeter nach unten.(WEL 09.05.11)
Die auf Ladungssicherungssysteme wirkenden Kräfte wurden wohl, ob der schieren Größe, von allen maßgebenden Institutionen vernachlässigt. Somit erhebt sich die Frage, ob in Zukunft in gleicher Weise die Ladungssicherungsvorschriften für Containerschiffe überprüft und ggf. anpasst werden sollten.(GDV 13.12.21) Die ganzen Berechnungsgrundlagen, die Bemessungslasten krankten laut Krüger daran, „dass wir sie viel zu schnell auf die großen Schiffe extrapolieren, ohne zu überprüfen, ob das überhaupt funktioniert.“(BUB 03.07.21)
Schiffbau
ULCVs, d.h. Containerschiffe, die aufgrund ihrer Größe nicht mehr durch die neuen Schleusen des Panamakanals passieren können, haben seit ihrer Einführung im Jahr 2006 eine dominierende Rolle innerhalb der weltweiten Containerschiffflotte. Während diese Schiffe anfänglich über Nennkapazitäten im Bereich von 15.000 bis 16.000 TEU verfügten, wurde seit 2019 kein ULCV mit weniger als 19.000 TEU in Dienst gestellt. Es hat sich gezeigt, dass das Größenwachstum prinzipiell fortgesetzt werden kann und dass die ULCV-Klasse der MGX-24-Schiffe von Schiffen mit bis zu 30.000 TEU übertroffen werden könnten, die deutlich länger und breiter sein könnten als die größten heute in Betrieb befindlichen Schiffe. Mit diesen Schiffen hält die Ära der Langsamfahrt auch in den Konstruktionsplänen der ULCV Einzug. Vergleich der Maschinenleistung der Triple E-Klasse mit der der Maersk A-Klasse aus dem Jahr 2003 zeigt, dass sie fast identisch ist, bei einer fast doppelt so hohen Tragfähigkeit (CRSL 2021b).(ISL 2021)
Seit 2010 ist zu beobachten, dass die Zahl der Containerschiffe nur noch relativ langsam zunimmt, während die durchschnittliche Schiffsgröße in Bezug auf die Nennkapazität weiterhin fast linear ansteigt. Seit 2012 ist eine Segmentierung in lediglich drei Größensegmente zu beobachten. Das erste Segment besteht aus kleineren Einheiten bis 5999 TEU, wobei Feeder- und Feeder-Max-Schiffe den größten Anteil ausmachen. Das zweite Segment umfasst große Einheiten mit Nennkapazitäten zwischen 11.000 und über 16.000 TEU, die aufgrund ihrer Abmessungen noch die Neo-Panamax-Schleusen passieren können. In diesem Segment ist zu beobachten, dass insbesondere bei den Einheiten im aktuellen Auftragsbuch Schiffe über 15.000 TEU die größte Untergruppe in Bezug auf die Kapazität darstellen. Das dritte Segment besteht seit 2020 ausschließlich aus Schiffen mit einer Nennkapazität von über 23.000 TEU. Das bedeutet, dass seit 2020 kein Schiff mit einer Nennkapazität zwischen 17.000 und 22.999 TEU mehr ausgeliefert oder bestellt wurde, so dass mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass das künftige Flottenwachstum ausschließlich über 23.000 TEU erfolgen wird. Wenn alle Einheiten im Auftragsbuch bis 2023 wie geplant ausgeliefert werden, wird sich dieses Größensegment bis dahin mehr als verdoppeln.(ISL 2021)
Konsequenterweise empfiehlt der Untersuchungsbericht (BSU/MSC ZOE) daher nachdrücklich die Entwicklung von „Industriestandards …, die die Sicherheit von Containertransporten erhöhen“, sowie eine „Initiative für Neuerungen in der Schiffskonstruktion“, die „besser für die … beschriebenen Bedingungen geeignet“ seien. Zuständig auch für diese Fragen ist – die IMO.(WAT 28.06.20) Containerschiffsreeder und Schiffbauingenieure, die Containerschiffe entwerfen, sollten die mit dem Sichern von Containern verbundenen Gefahren bedenken; sie werden dringend aufgefordert, Containersicherungssysteme zu entwickeln und zu verwenden, die vom Entwurf her sicher sind. Dabei muss das Ziel sein, die Notwendigkeit der nachstehenden Tätigkeiten zu vermeiden oder wenigstens auf ein Minimum zu verringern:
1 das Arbeiten auf Containerdächern;
2 das Arbeiten an sonstigen ebenso gefährlichen Stellen, sowie
3 die Verwendung schwerer oder schwierig zu handhabender Zurrmittel. (CSS 15.12.14)
Mit dem stark gestiegenen Orderbook kommen bis zum Jahr 2024 allein über 50 Großcontainerschiffe aus dem Segment über 23.000 TEU in Fahrt. Trotz immer längeren Docking-Intervallen zeigt sich, dass die Werftkapazitäten für Überholungen oder kurzfristige Reparaturen für Carrier in dieser Größenordnung knapp werden. »Die Großdocks werden von den Werften in der Regel ausschließlich für den lukrativen Serienbau freigehalten - und nicht für Inspektionen oder Reparaturen«, meint Ingmar Loges/Maritime Research Partners (MRP).(HAN 2/22) Der Nachfrageschub in der Schifffahrt, verbunden mit der Pandemie, hat die Werften unter Druck gesetzt, so Heinrich weiter. „Wir sehen einen Anstieg der Kosten für Kasko- und Maschinenschäden aufgrund von Verzögerungen bei der Herstellung und Lieferung von Ersatzteilen, sowie eine Verknappung der verfügbaren Werftfläche, die knapp ist.“(AGC 2021) Die nächste Werft, die ein Schiff dieser Größe aufnehmen kann, liegt auf Malta.(HAB 06.02.16)
Kosten
Die Transportkosten je Container sinken, je mehr Boxen an Bord sind. Und beim Verbrauch gibt es – ab einer bestimmten Größe – kaum mehr Unterschiede: Der Dieselverbrauch liegt dann nicht wesentlich höher. Das hängt mit der Effizienz neuer Motoren, verbesserten Schiffsrümpfen und dem gedrosselten Tempo zusammen. Denn eines werden die neuen Kolosse nicht sein: schnell. Aus der jüngsten Schifffahrtskrise haben die Reedereien nämlich gelernt, dass eine reduzierte Geschwindigkeit viel Kraftstoff spart. Deshalb haben die meisten Linienreedereien das Fahrtempo von 25 auf 22 oder noch weniger Knoten gesenkt. Das sind gut 46 und knapp 41 Stundenkilometer. Solch eine Verringerung senkt den Verbrauch aber um bis zu 30 Prozent. Doch auch die Personalkosten steigen mit der neuen Schiffsgröße nur unwesentlich: Containerschiffe ab einer Größe von 9.000 TEU Kapazität fahren mit etwa 20 Mann Besatzung. Das wird auch bei den 18.000-TEU-Riesen ausreichen. „Wir gehen von einem nahezu identischen Treibstoffverbrauch und derselben Mannschaftsstärke aus“, sagt GL-Manager Probst.(WEL 09.05.11)
Der aus dem Economies-of-Scale (EoS) resultierende Kostenvorteil pro TEU wird (...) mit wachsender Schiffsgröße immer geringer, während sich die Schiffsbetreiber immer größere Nachteile einhandeln, zum Beispiel nautische Beschränkungen, weniger Dockungsmöglichkeiten, größere Havarierisiken und -schäden sowie längere Hafenliegezeiten, (…) . Die heute gängigen Schiffsgrößen im Nordeuropa-Fernost-Verkehr liegen also deutlich über der aus einfachen physikalischen und geometrischen Zusammenhängen hergeleiteten Schiffsgröße, bei der die Brennstoffmenge und damit auch die CO2-Emissionen pro TEU ein Minimum einnehmen. Die gegenwärtig größten Schiffe von annähernd 24.000 TEU weisen demnach einen „Fuel/TEU-Indikator“ auf, wie er auch bei kleineren Schiffen zu erwarten ist.(ISL 2021)
Max Johns/VDR-Geschäftsführer: „Wir sind in einer sehr unglücklichen und in der Wirtschaft extrem untypischen Lage, dass Schiffe sich rentieren erst bei einer sehr, sehr hohen Auslastung. Bei den Containerfrachtern konkret muss man meistens mit einer Auslastung von weit über 90 Prozent rechnen. Das gibt es eigentlich in keinem anderen Wirtschaftszweig.“(DLF 16.08.16) Professor Ulrich Malchow/ Hochschule Bremen zum selben Thema: Die Rechnung der Reedereien – je mehr Ladung, desto größer der Gewinn – sei längst an ihre Grenzen gestoßen, beziehungsweise gehe nicht auf. Und vor allem funktioniere die Theorie der Kostenvorteile auch nur, wenn das Schiff voll beladen über die Weltmeere fahre. Bei geringerer Auslastung verkehrten sich die Economies-of-Scale, also die Skalenerträge, sogar in ihr krasses Gegenteil.(WK 12.08.16)
Ob, wann und in welchem Umfang der Gigantismus in der Containerschifffahrt fortgesetzt wird, hängt weitgehend davon ab, ob die Linienreedereien noch in der Lage sein werden, mit immer größeren Schiffen von Skaleneffekten zu profitieren und inwieweit externe Skalennachteile von den jeweiligen Akteuren, wie z.B. der breiten Öffentlichkeit, toleriert werden. Heute gibt es Stimmen, die sogar eine Begrenzung der Schiffsgrößen fordern, um zu verhindern, dass Häfen unrentabel werden und die öffentliche Hand übermäßige Ausgaben für Infrastrukturen ohne nennenswerten Ausgleich durch die Schiffsbetreiber tätigen (WorldCargo News 2021b; Malchow 2017).(ISL 2021)
Solche Schiffe bringen den Schiffseignern Größenvorteile, aber die Kehrseite sind unverhältnismäßig höhere Kosten, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Die Bewältigung von Vorfällen mit großen Schiffen – das können Brände, Grundberührungen und Kollisionen sein – wird immer komplexer und teurer.(AGC 31.03.21) „Wenn die Exponierung zunimmt, müssen sich die Versicherer fragen ob sie in der Lage sind, bestimmte Arten von großen Schiffen zu versichern, oder ob sie nur als Teil einer gemischten Flotte gezeichnet werden können.“(AGC 2021) Die P&I Clubs befinden sich in einer schwierigen Lage. Sie halten die Prämienniveaus [...] für zu niedrig angesichts der Großschäden, mit denen sie sich konfrontiert sehen. Die Schaden- und Kostenquote, die angibt, wieviel der Club von einem eingenommenen Prämieneuro für Schäden und Verwaltungskosten ausgeben muss, liegt mit durchschnittlich 120 außerhalb des profitablen Bereichs. Besonders teuer wird es für die Besitzer von Containerschiffen. Sie müssen um 55 Prozent höhere Prämien zahlen. Denn darin schlagen sich Vorfälle wie Brände und Ladungsverluste in den vergangenen Jahren wieder. (VDR 1/22)
Der öffentliche Druck gegen den Größenwahn in der Containerschifffahrt muss steigen, so wie einst bei den Supertankern. Die Reedereien setzen immer größere Schiffe ein, um ihre Position im Wettbewerb zu verbessern. Für die Verbraucher hat das, angesichts ohnehin minimaler Transportkosten, keinen spürbaren Effekt. Den Preis dafür zahlen vor allem die Hafenstädte – und damit am Ende die Steuerzahler.(WEL 05.02.16)
Maschine
Schiffe wie die „Ever Given“ haben als Antrieb nur jeweils einen riesigen Dieselmotor, der – in direkter Kraftübertragung, ohne Getriebe – für eine gleichmäßige Vorwärtsfahrt ausgelegt ist. Für Manöver auf engem Raum sind diese Riesenfrachter, trotz ihres Bugstrahlruders, komplett auf Schlepper angewiesen. Anders als zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe, die über schwenkbare, elektrische und von mehreren Dieselaggregaten mit Energie versorgte Propellersysteme verfügen.(WEL 24.03.21) Bei den angestellten Untersuchungen habe sich herausgestellt, dass gerade Tanker und Bulkcarrier schnell ein Problem mit dem Kurshalten bekommen, wenn die See von schräg vorne kommt. Aus Sicht von Prof. Krüger, der sich die BSU vorbehaltlos anschließt, ist damit zweifelsfrei nachgewiesen, dass die Hauptmaschine / der Propeller der GLORY AMSTERDAM technisch nicht in der Lage waren, die Driftbewegung des Havaristen unter den gegebenen äußeren Umständen wirksam aufzuhalten. Die Hauptmaschine des Havaristen verfügt gemäß den technischen Angaben des Schiffes über eine Leistung von 9326 kW. Demgegenüber haben Vollcontainerschiffe, die mit den Abmessungen und der Bruttoraumzahl der GLORY AMSTERDAM annähernd vergleichbar sind, regelmäßig Maschinenleistungen, die etwa viermal so groß sind.(BSU 06.03.19)
Zwar ist die deutlich stärkere Motorisierung von Containerschiffen gegenüber derjenigen von Bulkcarriern und Tankern hauptsächlich dadurch begründet, dass der Markt an Containerschiffe höhere Geschwindigkeitsanforderungen stellt. Gleichwohl leuchtet es ein, dass eine stärkere Motorisierung Frachtschiffen nicht nur eine größere Geschwindigkeit ermöglicht, sondern sie auch in die Lage versetzt, sich manövriertechnisch besser gegen die von außen angreifenden Kräfte (Seegang, Strom, Wind) behaupten zu können. Der international anerkannte Schiffbauexperte Prof. Dr.-Ing. Stefan Krüger betonte in diesem Zusammenhang (…) die grundsätzliche Sorge um die Steuerfähigkeit der Schiffe generell und in der Zukunft. Das Problem verstärke sich noch dadurch, dass wegen der Notwendigkeit, den so gen. CO2-Index (EEDI) zu beachten, die Motorenleistung der Schiffe immer weiter reduziert werden müsse. Dies bedeute, dass das Kurshaltevermögen der Schiffe zwangsläufig immer schlechter werden würde.(BSU 06.03.19)
Der Einsatz niedrigschwelliger Brennstoffe führte im letzten Jahr zu mehr Problemen mit den Schiffsmotoren. AGCS beobachtet generell einen Anstieg der Maschinenschäden im Zusammenhang mit Kraftstoffen.(S&H 7/16) Die Versicherer haben eine Reihe von Schadenersatzansprüchen für Maschinenschäden im Zusammenhang mit Scrubbern festgestellt, die SOx aus den Abgasen von Schiffen mit schwerem Schiffskraftstoff entfernt haben.(AGC 03.08.21) Der weltweite Seeschiffsverkehr trägt durch den Einsatz von Schweröl als Treibstoff und fehlende Abgasreinigungsanlagen eine erhebliche Mitschuld an der Klimaerwärmung. Große Mengen Stickoxide, Schwefeloxide und Feinstaub/Ruß werden verursacht, obwohl der Einsatz von deutlich sauberen Schiffsdiesel die transportierten Waren nur unwesentlich verteuern würde. Auch bei den immer beliebter werdenden Kreuzfahrten kommt nach wie vor Schweröl zum Einsatz, wenn es nicht durch lokale Regelungen (...) verboten wird.(BUN 05.08.21/2)
Generell hat sich die Energieeffizienz von ULCVs verbessert. Allerdings erfolgten die Verbesserungen der Energieeffizienz in den letzten Jahren in eher kleinen Schritten. Das liegt zum Teil daran, dass die Hauptmotoren bereits hochoptimiert sind und sehr niedrige spezifische Heizölverbräuche erreichen, d. h. die Masse Kraftstoff, der zur Erzeugung einer bestimmten Energiemenge benötigt wird. Aufgrund dieser bereits Optimierung der Schiffsmotoren ist der Spielraum für weitere Verbesserungen gering und betriebliche Maßnahmen wie Wetterrouting oder Slow Steaming gewinnen an Relevanz, da sie immer noch einen Hebel auf den Kraftstoffverbrauch eines Schiffes darstellen (Faber et al. 2020).(ISL 2021)
Feuer
„Bei Feuer droht immer auch der Totalverlust“, sagt Schieder, der selbst als Kapitän zur See fuhr.(GDV 26.03.19) Laut einer Untersuchung des Ladungsversicherers TT Club kann man alle 60 Tage einen Brand auf einem Containerschiff verzeichnen. Bei RoRo-Schiffen und Fähren sind Brände vor allem im Ladungsbereich relativ häufig.(HAN 2/19b) Bei einer vertiefenden Analyse wird ersichtlich, dass der Brand im Laderaum auf einem Containerschiff verhältnismäßig selten auftritt. Die wenigen bekannt gewordenen und bedeutenden Brände auf Containerschiffen haben aber deutlich werden lassen, dass solche Brände aufgrund ihrer Spezifik die Schiffsbesatzung vor besonders anspruchsvolle Aufgaben stellen. Brände in Laderäumen werden weitestgehend von der Art der Brandstoffe bestimmt. Die speziellen Unterschiede der Räume wirken sich in der Regel nur sekundär aus. Es können alle Arten von Bränden auftreten (Flammen-, Schwelbrand, u.a.). Daraus ergibt sich die Möglichkeit größerer Zeiträume für die Branddauer. Neben dem immer in den Rauchgasen vorhandenen Kohlenmonoxid ist darum immer mit einer Vielzahl weiterer gefährlicher Gase zu rechnen.(BSU 28.02.14)
Brände an Bord großer Containerschiffe sind recht häufig, und solche Vorfälle können leicht zu hohen Schadenssummen im dreistelligen Millionenbereich führen, wenn nicht sogar mehr. Ein hypothetisches Worst-Case-Schadensszenario, bei dem zwei große Containerschiffe oder ein Containerschiff und ein Kreuzfahrtschiff kollidieren und auf Grund laufen, könnte zu einem Verlust von 4 Milliarden Dollar führen, wenn man die Kosten für eine komplizierte Bergung und Wrackbeseitigung sowie etwaige Umweltschäden einbezieht.(AGC 26.03.21) Es gibt drei Hauptursachen: Der häufigste Grund sind falsch deklarierte Gefahrgutcontainer. Das Gefahrgut kann zur Selbstentzündung neigen, die sich explosionsartig entwikkeln kann. Der Brand ist dann mit Bordmitteln kaum oder gar nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. Der zweite Grund kann „normale“ Ladung wie zum Beispiel Holzkohle sein, die zu feucht ist. Sie neigt ebenfalls zur Selbstentzündung, der Brand entwickelt sich aber langsamer und kann, wenn er entdeckt wird und der Container zugänglich ist, auch gelöscht werden. Die dritte Möglichkeit sind defekte elektrische Aggregate, zum Beispiel von Kühlcontainern. (GDV 09.01.19)
Die Feuergefahr auf Autofähren ist deutlich höher als auf allen anderen Schiffstypen. Das zeigen die Schadenbilanzen der internationalen Transportversicherer. „An Bord einer Autofähre sind oft mehrere hundert Passagiere, die bei einem Brand in Lebensgefahr sind – aber anders als auf Kreuzfahrtschiffen gibt es in der Regel keine Seenot-Rettungsübung“, sagt Uwe-Peter Schieder vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Eine Analyse der International Maritime Organisation (IMO) der Vereinten Nationen kommt zu dem Ergebnis, dass die eigentliche Gefahrenquelle auf Autofähren die Fahrzeuge sind. Fast 80 Prozent der untersuchten Brände auf Autofähren zwischen 1994 und 2011 gingen von einem Fahrzeug an Deck aus. Allein in Brand geratene Aggregate von Kühltrailern waren für mehr als 25 Prozent der Vorfälle verantwortlich. (GDV 15.02.17)
Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die generelle Brandgefahr nicht größer ist als bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen. Aber ein Vollbrand eines Elektrofahrzeugs birgt neue Herausforderungen hinsichtlich der Brandbekämpfung. Zersetzt sich eine Lithium-Ionen-Batterie aufgrund eines technischen Defekts, kann dies einen „thermal runway“ auslösen – ein thermisches Durchgehen, bei dem sich das Feuer in einem Dominoeffekt von einer Batteriezelle zur nächsten ausbreitet. Bei der unaufhaltsamen Kettenreaktion können Temperaturen von bis zu 800 °C erreicht werden. Besonders problematisch ist, dass dabei auch hochentzündliche Stoffe freigesetzt werden. Im Kontakt mit Wasser bilden sich die hochgefährliche Flusssäure und Phosphorsäure.(VSM 1/22)
„Der Brandschutz auf Containerschiffen ist bislang ein blinder Fleck in der Schadenverhütung und ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Schiffe und Besatzung“, sagt Schieder. (GDV 23.11.15) Auf Brände entfielen 18% des Werts der analysierten Schiffsschäden (entspricht etwa 1,65 Mrd. €), verglichen mit 13% im Fünfjahreszeitraum bis Juli 2018. Ein Faktor, der zu diesem Anstieg des Brandrisikos an Bord von Schiffen beigetragen hat, ist häufig die Falsch- bzw. Nichtdeklaration (gefährlicher) Ladung, während die jüngste Zunahme von Bränden im Maschinenraum möglicherweise auf mangelnde Kompetenzen der Besatzung hindeutet. Zudem drohen potenzielle Brandgefahren durch den wachsenden Transport von Lithium-Ionen-Batterien auf Schiffen. (HAN 22.11.22) Doch hier ist Besserung in Sicht. Die Internationale Schifffahrtsorganisation IMO plant neue Regeln für besseren Brandschutz auf Schiffen.(SDZ 03.04.21)
Brandbekämpfung
Die größten Frachter haben heute ein Fassungsvermögen von bis zu 21.000 TEU. Der Brandschutz stammt von seiner Struktur her aber noch aus den 1960erJahren. Die Systeme wurden zwar an die Größe der Schiffe angepasst. Dass diese nun überwiegend Container transportieren und kein Stückgut mehr, darauf hat man nicht reagiert. Es beginnt schon bei den Brandmeldern. Die unter Deck sind völlig unzureichend und erkennen keine Entstehungsbrände, weshalb oft schon zu viel Zeit vergeht, ehe ein Feuer bemerkt wird und bekämpft werden kann. An Deck gibt es heute überhaupt keine Brandmeldeanlage. Die Besatzungen verlassen sich einzig auf ihre Augen und ihre Nase. Dabei gäbe es Infrarot-Scanner, mit denen sich die Temperaturen in den Containerreihen überwachen ließen.(GDV 09.01.19) Grundsätzlich geht man heute weiterhin so vor (...): Bricht ein Feuer an Deck aus, versucht die Mannschaft die Flammen mit Wasser aus Schläuchen und Strahlrohren zu löschen. „Angesichts der Größe eines modernen Containerschiffes ist das vollkommen aberwitzig“, sagt Uwe-Peter Schieder (GDV).(GDV 23.11.15)
Zusammenfassend kann [...] festgehalten werden, dass bei Ladungsbränden an oder unter Deck das primäre Ziel der Abwehrhandlungen nur die Verhinderung der Brandausbreitung ist und sein kann. Die direkte Brandliquidierung steht nicht im Vordergrund. Unter Berücksichtigung aller Bedingungen kann nur in Ausnahmesituationen davon ausgegangen werden, dass [...] Brände direkt gelöscht werden können [...].(BSU 28.02.14)
Die International Union of Marine Insurance erläuterte in einer Stellungnahme 2016, dass jedoch die Strategie der Unfallbekämpfung unter Deck mit dem Einsatz von CO2 (Kohlendioxid) auf Containerschiffen nur selten erfolgreich gewesen sei. Daher wurden für eine erfolgreiche Havariebekämpfung in der Regel die Laderäume - soweit möglich - geflutet.(UEG 17/19) „An Bord von Container-Riesen gibt es heute schlicht keine ausreichenden Möglichkeiten, einmal in Brand geratene Ladung wieder zu löschen. Wir müssen die Mannschaft in die Lage versetzen, jede Stelle auf dem Schiff mit Wasserwerfern zu erreichen und das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Container zu verhindern“, so Schieder.(GDV 13.05.15)Wenn auf einem Mega-Schiff in einer oberen Lage an Deck Feuer ausbricht, hat die Besatzung praktisch keine Chance, die Situation ohne Hilfe von außen in den Griff zu bekommen.(THB 07.04.21) Zudem stellt auch die hohe Freibord- und Beladungshöhe der immer größer werdenden Schiffe zunehmend ein Problem für die maritime Brandbekämpfung dar, da ein ungünstig liegender Brandherd evtl. gar nicht mehr erreicht werden kann. (UEG 17/19) Ein weiterer Faktor sind die Fähigkeiten zur Branderkennung und Löschkapazitäten im Verhältnis zur Größe des Schiffes.(AGC 2021) Der GDV setzt sich seit Jahren für fest installierte Wasserwerfer, Sprinkleranlagen zwischen den Containerreihen und Infrarotsensoren als Frühwarnsysteme ein. Doch passiert ist bislang wenig.(GDV 26.03.19)
Um die Feuerrisiken in den Griff zu bekommen, ist eine Modernisierung der Brandschutzmaßnahmen an Bord notwendig. Sowohl auf als auch unter Deck könnten zeitgemäße Brandschutzmaßnahmen die Ladung besser vor Feuer schützen. In verschließbaren Luken beispielsweise sollte der Brandherd durch aktives Kühlen mit Wasser, von der restlichen Ladung abschirmt werden können. Die besondere technische Herausforderung dabei: Die Luken selbst müssen mit Wasser gekühlt werden, damit der Stahl durch die Hitzentwicklung nicht seine Stabilität verliert. Ist der Brandherd isoliert, kann er durch weiteres Kühlen kontrolliert abbrennen und sich nicht weiter ausbreiten. Das Fluten der entsprechenden Luke mit Kohlenstoffdioxid (CO2), entzieht dem Feuer den Sauerstoff um es zu ersticken. An Deck könnten Sprühwasservorhänge zwischen den Containerbays die Ausbreitung eines Brandes verhindern. Zusätzlich sollen fest installierte Wasserwerfer, sogenannte Monitore, an Deck das Feuer schnell in den Griff bekommen. Jede Stelle auf dem Schiff sollte dabei von den Wasserwerfern erreicht werden können. Wasserdruck und Wurfweite müssen dabei stark genug sein, um auch bis zu Windstärke 9 auf dem ganzen Deck löschen zu können oder das Übergreifen des Feuers auf den nächsten Containerstapel zu verhindern. Damit sinkt auch das Risiko, dass die komplette Ladung oder gar das ganze Schiff abbrennt.(GDV 09.01.15)
Die Transportversicherer haben daher ein System entwickelt, mit dem Brände an und unter Deck zukünftig beherrschbar werden sollen – und zwar ausschließlich mit Bordmitteln und ohne Hilfe von außen. „Unser System sieht vor, die Ladung in einzelne Brandabschnitte von jeweils circa 3.000 Containern zu unterteilen. Bricht an Deck ein Feuer aus, kann die Ausbreitung der Flammen auf weitere Brandabschnitte durch automatische Wasservorhänge verhindert werden“, erklärt Schieder.(GDV 23.11.15) Es geht darum, brennende Container kontrolliert abbrennen zu lassen und ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Schiff zu verhindern. Dafür braucht es unter Deck mit Wasser kühlbare Lukenwände und Sprinkleranlagen an den Lukendeckeln. Die Sektionierung des Schiffes sollte zugleich an Deck erfolgen. Dafür eignen sich sogenannte Lashbrücken, die mit Düsen bestückt sind und einen geschlossenen Wasservorhang bilden können. Und zuletzt muss die Besatzung in der Lage sein, einen Brand mit fest installierten, ferngesteuerten Wasserwerfern gezielt zu bekämpfen. Die Monitore sollten so ausgelegt sein, dass jeder Punkt an Deck von zwei Monitoren erreicht werden kann. (GDV 09.01.19)
Vielfältige Erfahrungen führen zu zahlreichen allgemeingültigen Erkenntnissen, wie:
Nur Flammenbrände lassen sich mit den meistens in Laderäumen vorhanden CO2-Feuerlöschanlagen beherrschen. [...]
Zur Verhinderung der Brandübertragung auf anliegende Bereiche ist Kühlen eine wirksame Methode.
Nach Flammenbränden in Verbindung mit Glutbildung und wegen heißer Teile ist das Vorhandensein einer löschfähigen CO2-Konzentration im Laderaum eine wirksame Möglichkeit, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
(BSU 28.02.14)
Flagge
90 Prozent des weltweiten Warenverkehrs wird über Handelsschiffe abgewickelt, mehr als eine Million Seeleute arbeiten dafür an Bord der Frachter. Oft über 300 Stunden im Monat, Ruhetage gibt es nicht, die Gehälter sind gering. Denn die Flagge bestimmt das Arbeitsrecht an Bord und Reedereien ziehen dorthin, wo es am günstigsten ist. Beispiel Deutschland: Von den 2.140 Frachtschiffen – eine der größten Flotten der Welt – segeln laut des Verbands Deutscher Reeder gerade einmal 178 unter deutscher Flagge. 85 Prozent dagegen fahren unter anderen Flaggen, die meisten sind im Inselstaat Antigua und Barbuda oder in Liberia registriert, wo es das weltweit größte Schiffsregister gibt.(A&W 23.04.20)
„Billigflaggen dienen dazu, Sozialstandards zu umgehen. Die Flagge bestimmt das Recht an Bord: Arbeitszeit, Bezahlung, Ansprüche im Krankheitsfall“, erklärt Maya Schwiegershausen-Güth von Verdi. Die Gewerkschaft ist Teil der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF), die die Rechte der Seeleute weltweit vertritt. „Es gibt den philippinischen Seemann, der für 300 Dollar auf einem Containerschiff arbeitet. Nach internationalen Seearbeitsabkommen müsste er für die Arbeit auf See mindestens 900 Dollar, mit ITF-Tarifvertrag sogar 1670 Dollar im Monat bekommen“, sagt Schwiegershausen-Güth. Zudem seien viele Seeleute nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hätten nach neun Monaten am Frachtschiff weder Renten- noch Arbeitslosenversicherung. – die Billigflagge kann lebensgefährliche Folgen haben.(A&W 23.04.20)
Weltweit gelten derzeit die Nationalflaggen von 35 Staaten nach Definition der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) als Billigflagge. Grundsätzlich unterliegt jedes Schiff den Gesetzen des Staates, dessen Flagge es führt. Reeder haben aber die Möglichkeit, ihre Schiffe unter der Flagge zu führen, die ihnen passt – Billigflaggenstaaten bieten Vorteile u. a., indem sie Sozialdumping und ungeregelte Arbeitsbedingungen dulden. Das Verwerfliche an diesem System ist, dass die Billigflaggenstaaten sich nicht selten um die Verwaltung „ihrer“ Schiffsregister gar nicht kümmern und die hoheitlichen Aufgaben an private Firmen übertragen. Eine Liberia-Flagge bekommt man beispielsweise in Vienna im US-Bundesstaat Virginia, eine Antigua-Flagge sogar im nordwestdeutschen Oldenburg! Ist das Schiff „umgeflaggt“, gelten die Tariflöhne des Herkunftslandes nicht mehr. Selbst Mindeststandards der Internationalen Arbeits-Organisation oder der ITF werden häufig unterschritten.(WAT 2018)
Sicherheit
„Die Statistik belegt eindeutig: Von großen Schiffen geht keine größere Gefahr aus als von kleineren. Sie sind technisch beherrschbar und keineswegs unsicherer“, sagt Hans Gätjens, Nordeuropa-Chef von Bureau Veritas. „Beim Rollen oder Stampfen werden Schiffe immer gutmütiger, je größer sie werden“, sagt Experte Probst/Germanischer Lloyd (GL). Das heißt: Der Frachter schaukelt bei Sturm, er neigt sich und taucht auch in Wellen ein. Aber das macht er nicht so hektisch wie ein kleineres Schiff. Wegen seiner gewaltigen Länge fällt er nicht in jedes Wellental hinein. Das ist doch beruhigend.(WEL 09.05.11) „Größere Schiffe bedeuten besondere Risiken. Die Reaktion auf Zwischenfälle ist komplexer und teurer. Die Zufahrtskanäle zu bestehenden Häfen wurden zwar tiefer ausgebaggert und die Liegeplätze und Kaianlagen erweitert, um große Schiffe aufzunehmen, aber die Gesamtgröße der Häfen ist gleich geblieben. Infolgedessen kann ein Versehen häufiger zu einem Unfall für sehr große Containerschiffe werden“, sagt Anastasios Leonburg, Senior Marine Risk Consultant bei AGCS. (S&H 9/21)
Seit einigen Jahren warnen die Versicherer vor den zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit größeren Schiffen, darunter das Problem der Brände auf großen Containerschiffen, sagt Justus Heinrich, Global Product Leader Marine Hull bei AGCS. „Die Gefährdung nimmt weiter zu, da immer mehr große Containerschiffe und Kreuzfahrtschiffe in die weltweite Schiffsflotte aufgenommen werden.“(AGC 2021)