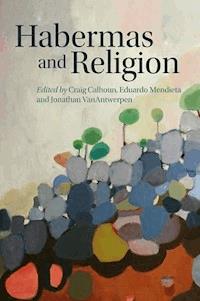28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Vielfach wird die Krise der westlichen liberalen Demokratien auf den Aufstieg populistischer und autoritärer Bewegungen zurückgeführt. Drei herausragende Theoretiker argumentieren nun dafür, sie als Ausdruck einer tieferliegenden Problematik zu begreifen.« Foreign Affairs
Mit analytischer Schärfe zeichnen Craig Calhoun, Dilip Parameshwar Gaonkar und Charles Taylor in diesem Buch aus unterschiedlichen Perspektiven die Aushöhlung unserer Demokratie nach. Sie beleuchten, wie die herrschenden Eliten versuchen, ihre Privilegien zu sichern, und wie individuelle Freiheit zum Feind von Gleichheit und Solidarität wurde. Aber sie zeigen auch Wege einer möglichen demokratischen Erneuerung auf: Zum einen gilt es, die Idee des Gemeinwohls wiederzuentdecken und an republikanische Traditionen anzuschließen, zum anderen könnten soziale Bewegungen wie Black Lives Matter oder der Green New Deal als Kompass dienen. Ein Weckruf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
3Craig Calhoun
Dilip Parameshwar Gaonkar
Charles Taylor
Zerfallserscheinungen der Demokratie
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien erstmals 2022 unter dem Titel Degenerations of Democracy bei Harvard University Press.Herausgegeben vom Institut für die Wissenschaft vom Menschen
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2419
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© 2022 by the President and Fellows of Harvard College
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77716-9
www.suhrkamp.de
Widmung
5Wir widmen dieses Buch dem Center for Transcultural Studies und seinem Vorläufer, dem Center for Psychosocial Studies, die es uns ermöglicht haben, mehr als dreißig Jahre lang gemeinsam zu lernen.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung
1. Zerfallserscheinungen der Demokratie
2. Widersprüche und Doppelbewegungen
3. Kompromisse mit dem Kapitalismus
4. Authentizität und Meritokratie
5. Machen wir den ›demos‹ sicher für die Demokratie?
6. Die Struktur demokratischer Zerfallserscheinungen und das Gebot der direkten Aktion
7. Was tun?
Schluss
Danksagung
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
9Einleitung
Die Zukunft der Demokratie scheint immer düsterer zu werden. Wir wollen dem entgegenhalten, dass sich die Demokratie erneuern lässt, dass sie florieren kann, dass sie inklusiver, egalitärer und mit mehr Macht ausgestattet werden kann. Wir müssen allerdings einräumen, dass dies eine Umkehr der Entwicklungen bedeuten würde, die wir um uns herum beobachten.
Die Amerikaner könnten Hoffnung schöpfen aus der bemerkenswert hohen Wahlbeteiligung im Jahr 2020. Zumindest konnte die langjährige politische Apathie abgebaut werden. Doch dann weigerten sich der unterlegene Präsidentschaftskandidat und Millionen seiner Anhänger, die Ergebnisse zu akzeptieren. Im Zuge vielfältiger Bemühungen, die Wahl rückgängig zu machen, kam es sogar zur Erstürmung des US-Kapitols. Die Extremheit, Bösartigkeit und sogar Gewalttätigkeit der Spaltung zwischen den Parteien sind nach wie vor alarmierend.
Uneinigkeit und Konflikte sind freilich nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Die Demokratie ist weltweit unter Druck geraten. Ähnliche Fragen und Emotionen bestimmten 2016 das Brexit-Votum in Großbritannien und lasten seither schwer auf dem Land. Ängste mit Blick auf Veränderungen, die Macht der Bürger und nationale Identitäten sind in Frankreich, Deutschland, Polen, Ungarn und den meisten anderen europäischen Ländern weit verbreitet. Russland ist offiziell, nicht aber in der Praxis demokratisch. Trotz beeindruckender Widerstandsfähigkeit ist die größte Demokratie der Welt in Indien durch Polarisierung und majoritären Nationalismus bedroht. Und dort, wo die Demokratie Wurzeln zu schlagen schien, zerfällt sie stattdessen wie in Äthiopien oder wird wie in Südafrika und weiten Teilen Mittelamerikas immer problematischer. China schwankt seit langem zwischen der Behauptung, eine Form von Demokratie aufzubauen, und der Kontrastierung des eigenen Modells – das wahlweise als konfuzianisch, kommunistisch oder einfach chinesisch bezeichnet wird – mit dem, was es als zunehmendes Versagen der westlichen Demokratien ansieht. Während liberalere Demokratien unter der Corona-Pandemie lit10ten, wurde China immer autoritärer und rühmte sich zugleich, eine »funktionierende Demokratie« zu verkörpern.
In diesem Buch konzentrieren wir uns nicht auf schwierige oder gestoppte Übergänge zur Demokratie. Vielmehr geht es um Zerfallserscheinungen in Ländern, die lange Zeit als starke Demokratien galten. Natürlich gibt es zwischen beiden Aspekten einen Zusammenhang. Der Zerfall der Demokratie in Ländern wie den Vereinigten Staaten lässt sie für angehende Demokraten in anderen Ländern weniger vielversprechend erscheinen. Die ethno-nationalistische Herrschaft und die zunehmende Missachtung von Verfassung und Recht machen Indien weniger zu einem Vorbild.
An Büchern und Artikeln über die Krise und den möglichen Verlust der Demokratie herrscht kein Mangel. Dieses Buch hebt sich dadurch ab, dass es die langfristigen Zerfallserscheinungen der Demokratie von innen heraus betont, im Gegensatz zu Angriffen von außen und den Verheerungen, die schlechte Politiker anrichten; dass es gleichzeitig aber auch die Bedeutung sozialer und kultureller Grundlagen – und nicht nur rein politischer Reformen – für die Erneuerung der Demokratie deutlich macht.
Zweifellos wird die Demokratie durch korrupte und eigennützige Politiker geschädigt, die die soziale Spaltung aus machttaktischen Gründen bewusst voranreiben. Sie wird durch die Manipulation ihrer Regeln, die Unterdrückung von Wählerstimmen, Gerrymandering und Versuche, Wahlen zu diskreditieren, geschwächt. Die »Rettung« der Demokratie erfordert jedoch mehr als nur prozessuale oder technische Reparaturen.
Die Erneuerung muss sich mit zwei Arten von Grundlagen für die Demokratie befassen, die nicht gänzlich in der politischen Demokratie als solcher enthalten sind: erstens mit republikanischen Verfassungen und Normen der Bürgertugend und zweitens mit den sozialen Voraussetzungen für eine wirkmächtige Bürgerschaft, zu denen auch gesellschaftliche Solidarität und Grenzen der Ungleichheit gehören. Ohne die Wiederherstellung dieser Grundlagen kann die Demokratie nicht gedeihen.
Die Grundlagen sind zum Teil kultureller und moralischer Natur. Der Wiederaufbau muss das Engagement für bürgerliche Tugenden und das Gemeinwohl wiederherstellen; er muss die kollektive Identität erneuern und die Korruption eindämmen. Der verfassungsmäßige Schutz der Rechtsstaatlichkeit, der guten Regie11rungsführung und der Rechte aller Bürger darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss auch verinnerlicht und geachtet werden. Entscheidend sind dafür nicht zuletzt materielle Faktoren. Die Ungleichheit hat dramatisch zugenommen – beim Einkommen, beim Vermögen und während der Corona-Pandemie sogar bei der Qualität der Gesundheitsversorgung. Das bedeutet, dass in vielen Ländern ganze Gruppen von Bürgern sehr unterschiedliche Erfahrungen mit politischen Maßnahmen und sozialen Veränderungen gemacht haben; sie sitzen buchstäblich nicht »in einem Boot«. Aber auch die Ungleichheit ist nicht die ganze Geschichte. Mindestens genauso wichtig ist die Erosion sozialer Bindungen – auf kommunaler und übergreifender Ebene –, die die Bürger über alle Unterschiede hinweg zusammenschweißen. Gesellschaftliche Solidarität ist nicht nur ein Gefühl, sondern auch eine Struktur sozialer Beziehungen. Sie muss auf der Ebene der lokalen Gemeinschaften, der nationalen Institutionen und der vielen dazwischenliegenden Vereinigungen wiederhergestellt werden.[1]
Dimensionen des Zerfalls
In Kapitel 1 skizziert Charles Taylor drei Faktoren, die für die jüngsten Abwärtsspiralen des Zerfalls von zentraler Bedeutung sind: die Entmächtigung der Bürger, das Scheitern der Inklusion und das hyperparteiische und majoritäre Streben nach politischen Siegen auf Kosten einer gemeinsamen Zukunft. Das sind nicht die einzig möglichen Komponenten des Zerfalls, aber sie sind entscheidend, und wir kommen in diesem Buch immer wieder auf sie zurück.
Eine robuste Demokratie ist eine Möglichkeit, alle Bürger und Bürgerinnen zu »ermächtigen«, sowohl in der Politik als auch in ihrem sonstigen Leben. Ein solches Empowerment ermutigt zu Kontroversen und bringt Spannungen zwischen öffentlichen und 12privaten Interessen zum Vorschein. Es führt zu Widerstand seitens einiger Eliten. Es bringt aber auch die Fähigkeit zur Mobilisierung mit sich, um gemeinsam Probleme zu lösen und das Zusammenleben weiter zu verbessern. Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind keine bloßen Abstraktionen, sondern von praktischer Bedeutung für das Leben der Bürger einer Demokratie. Sie können aber auch degenerieren.
Die Demokratie hängt von der Ermächtigung (empowerment) der Bürger ab – und zerfällt mit ihrer Entmächtigung (disempowerment). Letztere untergräbt sowohl die Möglichkeit, sich wirksam in öffentliche Angelegenheiten einzumischen, als auch die Bemühungen, persönliche Herausforderungen zu bewältigen. Die Entmächtigung erfolgt nicht nur durch explizite Blockaden wie z.B. Wahlbeschränkungen, sondern auch durch den Verlust der sozialen Voraussetzungen für wirksames Handeln. Um im Alltag von der Demokratie zu profitieren und für mehr Demokratie zu kämpfen, sind nicht nur individuelle, sondern auch soziale Fähigkeiten erforderlich. Bürger werden durch Gemeinschaften und Nachbarschaften, Organisationen wie Gewerkschaften, in Kirchen, Moscheen und Synagogen gebildete Netzwerke, Eltern-Lehrer-Vereinigungen, Jugendsportvereine und Sozialverbände gestärkt. Soziale Bewegungen ermächtigen die Menschen, die sie mobilisieren, indem sie auf bestehenden Verbindungen aufbauen und neue entwickeln. Und sie können selbst dann ermächtigend wirken, wenn sie ihre expliziten Ziele nicht erreichen.
Verstärkt wird die Entmächtigung durch extreme wirtschaftliche wie auch durch politische Ungleichheit. Die Regierung ist intransparent und distanziert, für den Normalbürger unzugänglich und wird von einer scheinbar eigenen politischen Klasse geführt. Die Mitglieder dieser Klasse als privilegierte Eliten zu bezeichnen heißt nicht, dass es sich um dieselben privilegierten Eliten handelt, die den Unternehmens- und Finanzkapitalismus beherrschen. Es handelt sich um verschiedene Fraktionen der herrschenden Klasse, die nicht immer völlig auf einer Linie liegen.[2] Die so genannten popu13listischen Bewegungen, für die beispielhaft die Brexiteers in Großbritannien und der Trumpismus in den Vereinigten Staaten stehen, haben gezeigt, dass selbst relativ gutsituierte Menschen das Gefühl haben können, keine politische Macht zu haben. Dabei geht es nicht nur darum, dass sie in Washington oder Westminster kein Gehör finden; es geht auch darum, dass sie nicht in der Lage sind, für eine funktionierende Müllabfuhr zu sorgen oder die Straßen in ihrer Gegend ausbessern zu lassen.
Eine weitere Dimension der Demokratie ist die politische Inklusion. Dabei geht es nicht um mehr oder weniger Macht, sondern um ein stärkeres oder schwächeres Gefühl der Zugehörigkeit und Beteiligung. Die Demokratie wurde häufig durch Restriktionen bei der formalen politischen Teilhabe eingeschränkt – wie zum Beispiel durch die Vorenthaltung des Wahlrechts für Sklaven, Frauen und Männer ohne ausreichenden Besitz in den Vereinigten Staaten. Die US-Demokratie hat sich mit der Ausweitung des Wahlrechts weiterentwickelt und zerfällt, wenn versucht wird, dieses zu beschneiden, wie es nach der Reconstruction geschah und heute in vielen US-Bundesstaaten geschieht. Und die Wahlunterdrückung ist nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt.
Aber auch die informelle Einbeziehung ist wichtig. Erkennen sich die Bürger gegenseitig als gemeinsame und gleichberechtigte Mitglieder des Gemeinwesens an? Wird die formelle Anerkennung durch den Staat ergänzt durch die informelle Anerkennung unter den Mitbürgern? Race, ethnische Zugehörigkeit, Religion, Einwanderungsstatus und andere Unterscheidungen können die politische Inklusion fragmentieren und einschränken. Dabei geht es nicht nur um die Rechte von Minderheiten; wir müssen uns fragen, inwiefern manche Menschen als Mehrheit anerkannt werden, während andere als Minderheiten behandelt werden, oder was passiert, wenn Menschen, die sich für die rechtmäßige Mehrheit halten, sich mit der zunehmenden Bedeutung anderer Gruppen konfrontiert sehen. Der Mehrheitsstatus ist eine Frage der Kulturpolitik, nicht nur der Zahlen.[3]
14Ein beträchtlicher Teil der US-Bürger wehrt sich gegen eine Neudefinition der amerikanischen Identität, die Schwarze, Indianer, Latinos/as, Asiaten und andere einschließt. Einige halten an der alten Vorstellung einer weißen, christlichen Nation fest.[4] Sie wollen nicht zur Minderheit werden. Ähnliche Fragen stehen im Raum, wenn Kanada versucht, anglophone und frankophone Bürger gleichzustellen, den First Nations volle Staatsbürgerrechte und Anerkennung zu gewähren und neue Einwanderer zu integrieren. Eine ängstliche »Englishness« bildete die Grundlage für den Brexit und untergräbt eine integrativere britische Identität. Dominante ethnische Gruppen scheinen offensichtlich in der Mehrheit zu sein – sie werden oft als »legacy nations« bezeichnet. Doch nationale Mehrheiten sind immer konstruiert – sowohl durch materielle Veränderungen als auch durch den Diskurs –, in Frankreich oder Ungarn nicht anders als in Ländern, die sich explizit durch ihre Vielfalt auszeichnen, wie Kanada, die Vereinigten Staaten und Großbritannien.
Wenn die Bekundung »Wir, das Volk« nicht mehr das Ganze einschließt und stattdessen die Feindseligkeit einer realen oder imaginären Mehrheit gegenüber allen Minderheiten zum Ausdruck bringt, ist das Ergebnis eine verzerrte, schädliche Ausdrucksform des echten Bedürfnisses nach Solidarität unter demokratischen Bürgern. Solidarität ist nicht Konformität und beinhaltet selten Einstimmigkeit. Demokratie ist fast immer streitbar und strittig. Die Bürger, die ihre unterschiedlichen Vorstellungen durchsetzen wollen, sind agonistisch, aber nicht unbedingt antagonistisch. Sie wollen argumentative Auseinandersetzungen gewinnen, aber nicht unbedingt auf Kosten des anderen. Anders verhält es sich, wenn eine extreme politische Polarisierung die Parteinahme in den Vordergrund stellt. Die Demokratie zerfällt, wenn die Bürger zuerst fragen, was die Menschen in meinem eigenen Lager glauben oder denken oder tun – und nicht, was für die gesamte Gesellschaft gut ist.
15Parteilichkeit kann konstruktiv oder zumindest handhabbar sein, solange sie der Sorge um das Gemeinwohl untergeordnet ist. Die Befürworter der jeweiligen Seite dürfen sich gerne darüber streiten, was das Beste für alle ist. Es ist jedoch nur ein kleiner Schritt von dem Versuch, einen Streit zu gewinnen, zu der Einschätzung, dass der Sieg wichtiger ist als das Streben nach dem Gemeinwohl. Kein Wunder, dass Parteigänger nach taktischen Vorteilen suchen. Wie Ezra Klein gezeigt hat, verleiten verschiedene Anreize rationale politische Akteure leider regelmäßig dazu, auf eine Art und Weise nach kurzfristigen Vorteilen zu streben, die eine gute Regierungsführung untergräbt und die Polarisierung fördert.[5] Extrem oder übermäßig parteiische Menschen stellen den Sieg über alle anderen Überlegungen – und das ist ein Problem. Extreme Parteigänger finden sich nicht nur in Konfrontationen wieder, sondern suchen sie geradezu und arrangieren sie, weil sie Kooperation als Verrat an ihrer parteipolitischen Sache ansehen. Sie blockieren eine effektive Regierung, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen können, und sie steigern damit Groll und Frust der Öffentlichkeit. Sie machen sich die kulturellen Gräben zunutze, damit die Wahlinteressen einzelner Kandidaten mit den Präferenzen der polarisierten Wähler übereinstimmen. Sie verlangen die uneingeschränkte Befolgung extremer Parteipositionen und hindern gewählte Amtsträger daran, unabhängig zu handeln. Extreme Parteilichkeit kann eine Partei nicht nur mit anderen Parteien, sondern auch mit den Präferenzen der meisten Bürger in Konflikt bringen – und es ihr dennoch erlauben, kurzfristig wählerwirksam zu bleiben. Kurz gesagt: Extreme Parteilichkeit kann ein wichtiger Faktor für den Zerfall der Demokratie sein.
Eine solche extreme Parteilichkeit lässt sich nicht einfach mit den Einstellungen des Einzelnen erklären. Sie wird durch den Karrierismus der Politiker gefördert, aber auch das ist keine ausreichende Erklärung. Vielmehr spiegelt extreme Parteilichkeit gesellschaftliche Spaltungen wider. Sie entstehen, wenn die sozialen Grundlagen der Demokratie nicht geteilt werden. Wenn die Verbindungen zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen schwach sind, können ihre Mitglieder leichter stark unterschiedliche Auffas16sungen darüber entwickeln, was in der Gesellschaft vor sich geht, widersprüchliche Erzählungen darüber, wie die Dinge so geworden sind, wie sie sind, und schrille Schuldzuweisungen für die Entstehung von Problemen und das blockierte Vorankommen. Und die Extreme der Parteilichkeit sind in der Regel reaktiv. Es handelt sich nicht einfach um stabile Meinungsverschiedenheiten, sondern um Bewegungen, die durch destabilisierende Veränderungen – große Transformationen – ausgelöst werden.
Die Spaltung der Gesellschaft in sich gegenseitig nicht verstehende Fraktionen wird durch die Geographie, durch unterschiedliche Positionen mit Blick auf den ökonomischen Wandel und ökonomische Sicherheit sowie auf ethnische und religiöse Zugehörigkeit und durch die Politik beeinflusst. Sie überschneidet sich mit den oft beschworenen Echokammern der verschiedenen Mediennetzwerke. Eindimensionale, abgeschottete Medien verstärken die soziale Spaltung. Sie machen aus der Parteilichkeit eine beinahe epistemologische Divergenz, wenn das primäre Kriterium für die Wahrheit das ist, was diejenigen auf meiner Seite glauben. Auf jeder Seite bleiben die Menschen nicht nur bei ihren bevorzugten Kanälen oder Feeds, sondern sie filtern auch abweichende Nachrichten und Belege heraus. Die Ansichten über die »Realität« werden sowohl durch emotionale als auch intellektuelle Bemühungen, die kognitive Dissonanz zu verringern, verzerrt. Das heißt, die Menschen erkennen die Fakten, die mit ihren etablierten Denk-, Fühl- und Handlungsweisen übereinstimmen, und widersetzen sich den Fakten, die nicht dazu passen, oder ignorieren sie.[6] Jahrzehntelang 17haben hochmobile Eliten die Globalisierung mit Freude betrachtet und geglaubt, dass »wir alle kosmopolitisch werden«. Nicht-Eliten waren angesichts der Veränderungen eher frustriert und glaubten lieber an QAnon oder andere Verschwörungstheorien. Unterschiedliche Medien verbreiten und verstärken solche Überzeugungen, verursachen sie aber nicht selbst.
Polarisierung bedeutet also mehr als extreme Meinungsverschiedenheiten; sie meint eine Divergenz in der Art und Weise, wie die Welt gesehen wird. Sie resultiert nicht nur aus dem taktischen Opfern des Gemeinwohls, sondern aus grundlegend unterschiedlichen Auffassungen von Öffentlichkeit und Gemeinwohl. Diese unterschiedlichen Auffassungen von der Welt beruhen auf unterschiedlichen sozialen Positionen mit unterschiedlichen materiellen Aussichten sowie auf unterschiedlichen Lebensweisen. Und diese Unterschiede korrelieren in der Regel mit dem Wahlverhalten: ländlich versus urban, mehr versus weniger gebildet, beruflich hochqualifiziert oder nicht, religiös oder nicht, rote Staaten versus blaue Staaten.
Die Demokratie ist nicht nur ein Projekt des rationalen Diskurses. Auch Emotionen, Identitäten und Interessen spielen bei ihr eine Rolle. Wo die Demokratie robust ist, werden unterschiedliche Identitäten anerkannt und konkurrierende Interessen ausgehandelt. Das Gefühl der politischen Ausgrenzung und der Ohnmacht kann manchmal zur Resignation und zum Rückzug aus der Politik führen. Aber zu anderen Zeiten ruft das Gefühl, vernachlässigt oder ausgeschlossen zu werden oder bei politischen Entscheidungen immer den Kürzeren zu ziehen, Wut, Ressentiment und parteiische Bemühungen hervor, Schuldige zu finden, die dafür verantwortlich gemacht werden können.
Die Frustration wächst, wenn Menschen in ihrem Leben und in ihren Gemeinschaften Verwerfungen oder Verschlechterungen er18leben, wenn sie das Gefühl haben, ihren Kindern nicht versprechen zu können, dass die Dinge in Zukunft besser werden, wenn, kurz gesagt, »das System« für sie nicht gut funktioniert. Noch zusätzlich verstärkt wird der Frust, wenn die politischen Eliten es versäumen, auf den Schmerz oder die Wut der Bevölkerung einzugehen. Ungleichheit wirkt sich unter anderem darauf aus, wie die Globalisierung, neue Technologien und die Rolle des Finanzwesens erfahren werden. Politische Ausrichtungen spiegeln jedoch nicht einfach und unmittelbar materielle Interessen oder Nöte wider.
Entmächtigung, fehlende Inklusion und extreme Polarisierung zeigen sich öffentlich am deutlichsten, wenn sie in politischen Bewegungen zusammenkommen, die behaupten, den von der konventionellen Politik vernachlässigten »echten Menschen« eine Stimme zu geben. Diese Bewegungen, die häufig als »populistisch« bezeichnet werden, sind Reaktionen auf eine wahrgenommene (und vielleicht auch tatsächliche) Vernachlässigung. Ihre Motivation ist weniger ideologisch als emotional und spiegelt Ressentiments und Frustration wider. Befeuert durch die Zerfallserscheinungen der Demokratie, können solche Bewegungen zu weiteren Verwerfungen, aber auch zu einer neuen Beteiligung am demokratischen Prozess führen.
Wütende und ressentimentgeladene Populisten müssen nicht zwangsläufig am Rand der Gesellschaft stehen. Natürlich sind einige von ihnen direkte Opfer des ökonomischen Wandels. Viele leben außerhalb der Großstadtregionen, die die meiste öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Einige fühlen sich tatsächlich abgehängt; bei anderen werden einfach ihre Erwartungen nicht erfüllt. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht zu ihrem Recht kommen, selbst wenn sie in Vororten der oberen Mittelschicht leben und ihre Kinder auf Privatschulen schicken. In der Überzeugung, dass sie doch eigentlich das Volk sind, ärgern sie sich, wenn »zu viele« Chancen an Einwanderer oder ethnische Minderheiten vergeben werden. Einige verteidigen traditionelle Geschlechterrollen. Sie sind in Sorge wegen gesellschaftlicher Veränderungen – sogar Veränderungen in den intimen Beziehungen –, die ihnen ihre Länder als fremd erscheinen lassen oder so, als würden sie nicht mehr ganz ihnen gehören.
19Überrumpelt
Jahrelang gingen die Menschen, die in den älteren liberalen Demokratien lebten, einfach davon aus, dass diese die Zukunft der Menschheit darstellen. Diese Demokratien als »liberal« zu bezeichnen bedeutet, dass sie die Rechte des Einzelnen, von Minderheiten und offene politische Meinungsverschiedenheiten schützen – im Gegensatz zur Demokratie, die als Streben nach Gleichheit oder anderen potenziellen Fortschritten mit autoritären Mitteln verstanden wird. Wie wir insbesondere in Kapitel 2 zeigen, ist es die Ergänzung der Demokratie durch den Republikanismus, die ihre liberale Spielart hervorbringt.
Früher oder später, so die Annahme, würde sich jeder für diese Regierungsform entscheiden. Dieser Glaube wurzelt in einer optimistischen Lesart der Geschichte der modernen Demokratie im Allgemeinen, so als wäre sie seit der Magna Charta oder der Amerikanischen Revolution gut gewesen und stetig besser geworden, während sie in Wirklichkeit in Schüben verlief und mit der Überwindung erheblicher Hindernisse zu kämpfen hatte. Die Amerikaner zum Beispiel erzählten sich (und lehrten ihre Schulkinder) die Geschichte einer Republik, die trotz Sklaverei und Bürgerkrieg, trotz brutaler Behandlung der Indianer und langem Ausschluss der Frauen vom Wahlrecht immer demokratisch war.
Gestärkt wurde dieses optimistische Narrativ durch die aufeinanderfolgenden Demokratisierungswellen des 20.Jahrhunderts: nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Fall der Berliner Mauer 1989. Diese Zuversicht überlebte sogar das Scheitern und den Zusammenbruch einiger der neuen Demokratien, die auf jede Welle folgten. Aber jetzt ist sie ins Wanken geraten.
Wenn man bedenkt, wie extrem die Krisen von Großer Depression, Weltkrieg und Entkolonialisierung waren, ist es beeindruckend, dass in der Folge so viele Menschen in verschiedenen Ländern der Meinung waren, die Demokratie sei quasi unvermeidlich. Die Demokratie wurde zu einem Leitprojekt der einzelnen europäischen Länder und schließlich der Europäischen Union, aller drei nordamerikanischen Länder, Japans, Australiens und Neuseelands. Die postkolonialen Staaten machten sich die Demokratie zu eigen, obwohl sie erkannten, dass die heuchlerischen Kolonial20herren im eigenen Land oft demokratisch, fern der Heimat hingegen imperialistisch gewesen waren. Indien sticht dabei heraus, steht aber nicht allein. Bemerkenswerterweise ist Südafrika eine multirassische Demokratie, trotz all der Schwierigkeiten, die aus der Vergangenheit der Apartheid herrühren. Nach 1989 kam die Demokratie nach Osteuropa und in einige Teile der ehemaligen Sowjetunion. Es gab eine kurze Welle der Beinahe-Euphorie – und allzu oft auch der Selbstzufriedenheit.
Optimisten vertraten die Auffassung, dass die Demokratie unmittelbar mit dem angeborenen Wunsch der Menschen nach Freiheit und der offensichtlichen Gerechtigkeit der Gleichheit zu tun habe. Wenn die Menschen die Demokratie in Aktion erlebten, würden sie sie für sich und ihr Land wollen. Das ist nicht völlig falsch, aber doch stark vereinfacht und irreführend. Demokratie ist nicht einfach eine statische, im Voraus festgelegte Reihe von Verfahren, die übernommen werden können wie eine neue Technologie oder die Praxis, westliche Businessanzüge zu tragen und sich bei Begegnungen die Hand zu geben. Demokratie lediglich als ein Gefüge formaler Verfahren oder rechtlicher Mindestgarantien wie die Pressefreiheit zu betrachten, greift viel zu kurz. Sie kann nur durch Transformationsprozesse hergestellt werden. Und wenn erst einmal ein Paket demokratischer Verfahren vorhanden ist, wird sich der Wandel zwangsläufig fortsetzen. Demokratie gedeiht, wenn sie als Projekt angegangen wird.
Die Demokratie selbst weckt Erwartungen, die die bestehenden Strukturen nicht erfüllen können. Bürger, die über ein gewisses Maß an Demokratie verfügen, wollen in der Regel mehr und bessere Demokratie – und haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was das konkret bedeutet. In dem Maße, wie sich die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ändern, ändern sich auch die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger sowie ihre Fähigkeiten zu kollektivem Handeln. Beide Tendenzen erinnern uns daran, dass Demokratie nicht einfach an- oder ausgeknipst wird wie ein Lichtschalter, vorhanden oder nicht vorhanden oder gar auf einer linearen Bewertungsskala mehr oder weniger vollständig verwirklicht ist.
Demokratie, so behaupten wir, ist notwendigerweise ein »telisches« Konzept. Es bezeichnet nicht nur eine Reihe von Bedingungen, sondern auch Verpflichtungen und Bestrebungen; es definiert sich durch Ziele, auch wenn diese nie vollständig erfüllt werden. 21Nicht nur ihre Routineabläufe, sondern auch ihre Veränderungen sind von Idealen geleitet. An der Demokratie teilzuhaben bedeutet, sich für mehr und bessere Demokratie einzusetzen. In diesem Sinne ist die Demokratie mehr als die unmittelbarste Ausdrucksform des Volkswillens. Auch in dieser Hinsicht ist die republikanische Tradition eine wichtige Quelle für die Vorstellung, dass die Demokratie besser sein kann, aber sie ist nicht die einzige. Die Berücksichtigung des Wohlergehens künftiger Generationen kann schlicht eine Erweiterung der demokratischen Idee des Volkes sein. Damit die Demokratie jedoch Bestand hat und gedeihen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie auf die Zukunft ausgerichtet und offen für Bewertung und Verbesserung ist.
Da die Demokratie jedoch von Natur aus Erwartungen weckt, kann sie auch Frustration in Bezug auf bestehende Beschränkungen hervorrufen. Die Grenzen der Demokratie ergeben sich nicht nur aus politischen Mechanismen, die ihre Ideale (oder die Ideale einer bestimmten demokratischen Verfassung) nur unvollständig verwirklichen. Sie ergeben sich größtenteils aus ökonomischen und anderen gesellschaftlichen Veränderungen, die demokratische Prozesse nicht vollständig kontrollieren können, auf die sie aber reagieren müssen, wie z.B. technologischer Wandel, zunehmende Größendimensionen sowie die Ungleichheit und Volatilität des Kapitalismus. Diese Entwicklungen können auch positive Aspekte haben, etwa größeren Wohlstand und eine höhere Lebenserwartung. Aber sie verursachen auch Umwälzungen in Gemeinschaften und gesellschaftlichen Institutionen und eine zumindest vorübergehende Entmächtigung der Bürger. Entscheidend ist, wie die Demokratien darauf reagieren.
Karl Polanyi hat einen solchen Prozess der »großen Transformation« während der ersten 150 Jahre des Industriekapitalismus beschrieben. Einfriedungen schränkten den gemeinschaftlichen Zugang zu Land ein, landwirtschaftliche und handwerkliche Arbeit wurden entwertet, neuartige Eigentumsrechte verabsolutiert, Unterstützungsleistungen für Arme und Arbeitslose abgeschafft. Es entstand eine neue Marktgesellschaft, die zwar neuen Reichtum brachte, diesen aber ungleich verteilte und stets von großer Instabilität und Unsicherheit begleitet war.[7] Nach zwei Weltkriegen und 22einer Weltwirtschaftskrise wurde die »Doppelbewegung« von Disruption und Reaktion durch aktives staatliches Eingreifen und den Aufbau neuer Institutionen der öffentlichen Wohlfahrt gebändigt.
Wir sind der Auffassung, dass seit den 1970er Jahren eine neue »große Transformation« im Gange ist. Sie brachte Finanzialisierung und Globalisierung, aufeinanderfolgende Krisen und als Reaktion darauf eine brutale Sparpolitik. Sie hat dazu geführt, dass Hochschulbildung wichtiger ist als je zuvor, teurer ist als je zuvor und ungleicher ist als je zuvor. Für einige war sie befreiend und brachte neuen Respekt für kulturelle Vielfalt. Für Angehörige der industriellen Arbeiterklasse hat sie jedoch zu einer deutlichen Entmächtigung geführt und viele Bürger vor neue Herausforderungen gestellt. Sie hat eine populistische Reaktion hervorgebracht, aber noch nicht den notwendigen Wiederaufbau von Institutionen und Gemeinschaften.
Selbst wenn ein politisches System formal demokratisch bleibt – zum Beispiel durch das Abhalten von Wahlen und friedliche Machtwechsel –, kann die Demokratie zerfallen. Die Bürger können sich entmächtigt fühlen, und Gemeinschaften verlieren womöglich die Fähigkeit, das kollektive Leben zu organisieren. Anstatt schrittweise ein breiteres Spektrum von Bürgern in die volle Teilhabe einzubeziehen, kann eine demokratische Nation Ausgrenzung und Hierarchie zulassen. Eine parteipolitische Polarisierung kann nicht nur die Politik, sondern auch die normale gesellschaftliche Solidarität zersetzen.
Wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, müssen die Demokratien ihre politischen Institutionen erneuern. Allzu oft jedoch haben die Eliten stattdessen abseits gestanden, haben randständige Probleme beklagt, aber auch von Veränderungen profitiert, die für andere disruptiv oder sogar zerstörerisch sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Globalisierung. Sie ist ökonomisch vorteilhaft für Unternehmen, ihre Aktionäre und ihre leitenden Angestellten. Sie ist von Vorteil für die Verbraucher, denen eine neue Produktvielfalt geboten wird und die angesichts des Wettbewerbsdrucks mit niedrigen Preisen rechnen können. Sie bringt einen Steuervorteil für diejenigen, die ihren Reichtum in ausländischen Steueroasen 23und Briefkastenfirmen verstecken können. Aber sie ist kein Vorteil für Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren oder gezwungen sind, an einen anderen Ort zu ziehen, oder für andere, die in Kommunen leben, die durch den Verlust von industriellen Arbeitgebern benachteiligt werden. Jahrzehntelang haben die Eliten die Vorteile genossen und sich über die Verluste hinweggesetzt. Das hat zu einer schwachen politischen Reaktion geführt, nicht nur auf die Globalisierung, sondern auch auf die Veränderungen der Globalisierung, der Finanzialisierung, der neuen Technologien und der neu strukturierten Unternehmensmacht.
In der Tat können wir heute feststellen, dass die Zerfallserscheinungen der Demokratie die Reaktionen nicht nur auf wirtschaftliche Veränderungen und Verwerfungen bestimmen, sondern auch auf drängende globale Probleme, die von der Corona-Pandemie bis zum Klimawandel und zur Migration reichen. Diese Herausforderungen sind eindeutig grenzüberschreitend. Die Reaktion darauf erfordert transnationales kollektives Handeln. Stattdessen erleben wir eine Renaissance des kompetitiven und manchmal kriegerischen Nationalismus. Die Bürger stehen diesen Krisen mit wenig Vertrauen in die Regierung gegenüber. Die Institutionen sind zu oft beschädigt oder dysfunktional. Und die tatsächliche Geschichte der Führungselite gibt denn auch eher Anlass zu Ressentiments als zu Vertrauen.
Ein typisches Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie. Die Hoffnung auf Besserung hat viele dazu verleitet, von einer Rückkehr zur »Normalität« zu sprechen. Das ist nicht nur deshalb irreführend, weil die Pandemie länger dauerte, als viele sich vorstellten, und ihre sozioökonomischen Folgen noch länger zu spüren sein werden. Im Grunde genommen wird die Erholung keinesfalls eine Rückkehr zu irgendwelchen imaginären stabilen Verhältnissen früherer Zeiten sein. Wir werden uns von der Pandemie nur durch einen Wandel erholen. Dabei geht es nicht nur um das öffentliche Gesundheitswesen, sondern auch um systemische Fragen, von Lieferketten über die Neugestaltung von Beschäftigung bis hin zur globalen Zusammenarbeit. Ebenso schwierig ist es, sich vorzustellen, was in Fragen der globalen Migration mit einer Rückkehr zur Normalität gemeint sein könnte. Und was den Klimawandel betrifft, so ist dies bestenfalls ein Hirngespinst.
Um diese Herausforderungen ohne weiteren Zerfall der De24mokratie zu bewältigen, müssen wir uns sowohl von den Degenerationen der letzten fünfzig Jahre erholen als auch die sozialen Grundlagen der Demokratie wiederherstellen. Von entscheidender Bedeutung dabei ist, republikanische politische Normen zu erneuern und dies durch den Wiederaufbau von Solidaritätsstrukturen von den Kommunen bis zu den staatlichen Institutionen zu ergänzen. Und während wir uns noch von jeder dieser Krisen erholen, werden wir schon wieder vor neuen Herausforderungen stehen.
Ohne einen solchen Wandel wird es nicht möglich sein, die demokratischen Freiheiten, die Verfassungsprozesse und den politischen Zusammenhalt zu retten. Dies erfordert die Wiederaufnahme historischer Kämpfe zur Vertiefung der Demokratie; es erfordert das Engagement für neue Agenden.
In diesem Buch nähern wir uns diesen Herausforderungen aus zwei Blickwinkeln. Craig Calhoun und Charles Taylor konzentrieren sich vornehmlich auf die Vereinigten Staaten und andere westliche Demokratien, die durch einen Kompromiss mit dem Kapitalismus zu Wohlstand gekommen sind. Sie untersuchen tiefreichende Probleme und beharren dennoch darauf, dass diese gelöst werden können und die Demokratie ihre telischen Verbesserungen wieder fortsetzen kann, wenn auch in nichtlinearen Transformationen. Dilip Gaonkar konzentriert sich auf Indien, wo eine beeindruckende demokratische Geschichte mit massiver Ungleichheit und großer Heterogenität zu kämpfen hat. Er bietet ein Gegengewicht zu Calhouns und Taylors entschlossenem Optimismus und verweist auf die »Politik der Straße«, in der der Wille des Volkes zum Ausdruck kommt, ohne vollständig in republikanische oder andere telische Verbesserungspläne integriert zu sein. Er erinnert an die griechischen Annahmen, wonach die Demokratie notwendigerweise instabil sei.
Die Fälle sind nicht diametral entgegengesetzt. Indien zeigt, dass republikanische Institutionen und das telische Streben nach einer besseren Demokratie außerhalb des Westens und in einem Land, das mit enormer Armut und Spaltung zu kämpfen hat, Wurzeln schlagen können – auch wenn der Erfolg dieser Errungenschaft jetzt in Frage steht. Umgekehrt gibt es in den Vereinigten Staaten und in Europa auch eine Politik der Straße, eine Mobilisierung der Bürger, die ihre Wut oder ihren Unmut zum Ausdruck bringen, ohne klare Ziele für Verbesserungen zu verfolgen. Calhoun und 25Taylor betonen zwar die Bedeutung einer inklusiveren Demokratie, erkennen aber auch an, dass eine solche Demokratie eine enorme Herausforderung ist und auf absehbare Zeit unvollständig bleiben wird. Gaonkar befürchtet eine Phase der »hässlichen Demokratie«, hofft aber, dass eine Erneuerung des Republikanismus und der gesellschaftlichen Solidarität diese Phase abmildern kann.
Konventionelle Geschichten und Vorstellungen über die Demokratie können anfällig für Illusionen sein. Viele Amerikaner erzählen sich zum Beispiel Geschichten von unschuldigen Ursprüngen, die die Bedeutung von Ausgrenzungen und Unterdrückungen, nicht zuletzt in Gestalt der Sklaverei, herunterspielen. Oder sie räumen zwar ein, dass es Probleme gab, glauben aber, dass diese im Zuge einer linearen Fortschrittsgeschichte beseitigt wurden, wobei sie den Bürgerkrieg und andere Rückschläge vergessen. Und es gibt Inder, die eine Geschichte erzählen, in der das Mogul- und das britische Weltreich Verwerfungen in ein im Wesentlichen hinduistisches Land brachten, das eine blühendere Demokratie und stärkere Nation wäre, wenn sie beseitigt würden, und die dabei sowohl die Notwendigkeit von Kämpfen gegen Ungleichheit als auch deren Teilerfolge vergessen.
Wir sollten diese Illusionen überwinden, sie aber nicht durch Zynismus ersetzen. Es wäre ein Fehler, Ungerechtigkeit und Unterdrückung als Konstanten zu betrachten und zu verkennen, wie sehr Demokraten nicht nur für mehr Freiheit, Gleichheit und Solidarität gekämpft, sondern manchmal auch viel erreicht haben. Zerfallserscheinungen der Demokratie haben das, was diese demokratischen Kämpfe errungen haben, untergraben, aber der Blick auf die vergangenen Kämpfe zeigt, dass Erfolge möglich sind. Tatsächlich gab es sogar bemerkenswerte Erfolge. So werden wir zum Beispiel auf Misserfolge und Schwierigkeiten bei der sozialen und politischen Integration von Migranten hinweisen. Das ist eine ernsthafte Herausforderung. Selbst berühmte Einwanderernationen wie die Vereinigten Staaten und Australien haben sich immer wieder schändlich verhalten. Die historische Bilanz zeugt jedoch nicht von unablässigem Versagen, sondern von einer beeindruckenden Leistung, die trotz Rückschlägen und Hindernissen erbracht wurde. Nach langen Kämpfen haben die Frauen das Wahlrecht erlangt. Die Ungleichheit wurde verringert und die Möglichkeiten sozialer Mobilität wurden verbessert, als ein allgemeines öffentliches Bil26dungswesen mit expandierenden Arbeitsmärkten und der Unterstützung der Gewerkschaften einherging. Heute haben viele den Eindruck, dass diese Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind. Dem stimmen wir nicht zu.
Die Grenzen des Liberalismus
Fünfzig Jahre lang haben die herrschenden Eliten in den Industrieländern im weitesten Sinne liberale Agenden verfolgt. Diese betonten zwar Freiheit und Rechte, setzten aber sehr unterschiedliche Prioritäten. Der klassische Liberalismus und später der »Neoliberalismus« basierten auf dem »Besitzindividualismus« und konzentrierten sich darauf, den Besitzern von Eigentum ein Maximum an Rechten zu gewähren und staatliche Regulierung sowie Staatseigentum so gering wie möglich zu halten. Die andere Agenda war ein »expressiver Liberalismus«, der darauf abzielte, das Ausmaß, in dem Individuen ihre eigenen Identitäten und Ziele wählen und ungehindert verfolgen können, zu erweitern.[8] Beide haben individu27elle Freiheiten gefördert, auch wenn diese unterschiedlich ausgelegt wurden. Sie konnten sich bei der Anerkennung eines ähnlichen Rechts aus unterschiedlichen Gründen annähern – zum Beispiel bei der Religionsfreiheit mit der Begründung, dass Glaube und Gewissen Formen von Privateigentum sind oder weil Religion eine Form des Selbstausdrucks ist. Doch wie Calhoun und Taylor in Kapitel 4 zeigen, kann die Betonung individueller Freiheit auf Kosten von Gleichheit und gesellschaftlicher Solidarität gehen. In den letzten Jahrzehnten haben die beiden Formen des Liberalismus gemeinsam dazu beigetragen, das für eine lebensfähige demokratische – und wahrhaft liberale – Gesellschaft notwendige Gleichgewicht zu kippen.
Der Neoliberalismus hat eine Wirtschaft mit Chancen und Belohnungen für Unternehmer geschaffen. Zusammen mit der Finanzialisierung hat er dazu beigetragen, dass Kapital aus den reichsten Ländern in mehrere historisch unterentwickelte, aber schnell wachsende Länder floss, und insbesondere den Aufstieg Chinas begünstigt. Im Inland hat er eine dramatische Zunahme der Ungleichheit mit sich gebracht, Gemeinschaften zerrüttet und die Umwelt geschädigt. Der expressive Liberalismus hat zu einer erheblichen Ausweitung der individuellen Freiheit geführt. Er hat sich für die Rechte der zuvor unterrepräsentierten und benachteiligten Menschen eingesetzt – aber nur so lange, wie diese Rechte nicht mit einer wirtschaftlichen Umstrukturierung oder Umverteilung einhergehen.[9] Allzu oft war die Inklusion deshalb eher symbolischer 28als materieller Natur. Gemeinsam haben Liberale beider Richtungen den Kosmopolitismus, aber nicht die Gemeinschaft propagiert und den technologischen Wandel begrüßt, ohne sich ausreichend um diejenigen zu kümmern, deren Leben prekärer wurde.
In diesem Kontext blühte der Rechtspopulismus auf. Mochte er auch von oben beeinflusst oder durch finanzielle Zuwendungen gesteuert worden sein, so war er doch Ausdruck einer Reaktion der Bevölkerung. Erstens reagierten die Populisten auf fünfzig Jahre Deindustrialisierung und neoliberale Globalisierung, die Gemeinschaften zerstört, gute Arbeitsplätze vernichtet, Arbeitnehmern mittleren Alters die Aussicht auf einen glücklichen Ruhestand genommen und verheerende Opioidabhängigkeiten verursacht hatten. Zweitens reagierten die Populisten auf das, was sie als Respektlosigkeit der politischen Eliten empfanden, und auf das Gefühl, dass weniger berücksichtigenswerte Minderheiten, Zuwanderer oder Frauen auf ihre Kosten gewannen. Für einen außenstehenden Beobachter mag das wie Panik vor dem möglichen Verlust von Privilegien aussehen, aber viele empfanden es als Bedrohung ihrer berechtigten Ansprüche. Im Extremfall befürchteten sie, dass sie, obwohl sie die »echten« Bürger und »wahren« Vertreter der legitimen Nation waren, ersetzt werden würden.
Ursprünglich mehr von Wut, Frustration und Ressentiments gegenüber den Eliten als von Ideologie geprägt, wurden diese populistischen und basisdemokratischen Mobilisierungen mit Hilfe der neuen Medien erfolgreich von Demagogen und Verschwörungstheoretikern vereinnahmt. Rassismus und Feindseligkeit gegenüber Einwanderern werden im Namen des »Volkes« und damit der demokratischen Bürger geäußert, auch wenn sie gegen das demokratische Versprechen der Inklusivität verstoßen. Nicht zuletzt führen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auf nationaler und internationaler Ebene zusammen mit 29Unternehmen, Märkten und Finanzwesen zu einer dramatischen Ausweitung der soziotechnischen Systeme, die den Einzelnen in immer mehr indirekte Beziehungen einbinden, welche nur schwer zu erkennen, geschweige denn zu steuern sind. Die Bürger, die mit all diesen Veränderungen konfrontiert sind, erhalten zu wenig gesellschaftliche Unterstützung durch Gemeinschaften, intermediäre Vereinigungen und Institutionen des Wohlfahrtsstaats; viele haben diese als zutiefst entmündigend erlebt. Die kollektive Identität, das Zugehörigkeitsgefühl und das Wohlbefinden haben gelitten, während gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die politische Mitsprache abgenommen haben.[10]
Ein Beispiel dafür ist die Reaktion auf die Corona-Pandemie. Reiche Länder kümmerten sich darum, Impfstoffe zu produzieren, nicht darum, sie in ihren Gesellschaften zu verteilen – geschweige denn in der ganzen Welt. Das schwächte ihre Wirksamkeit und ermöglichte immer neue Virusvarianten und Infektionsausbrüche. Die durch den Neoliberalismus verschärften Ungleichheiten manifestierten sich in unterschiedlichen medizinischen Behandlungen und Todesraten für Arm und Reich. Die Aktien- und anderen Vermögensmärkte erlebten einen Boom und haben Milliardäre noch reicher gemacht; Millionen ihrer Mitbürger hingegen haben ihren Arbeitsplatz verloren oder waren gezwungen, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, um unbezahlte Carearbeit zu leisten. Andere haben prekäre Beschäftigungen als Fahrer, Reinigungskräfte und Krankenpfleger angenommen. Der Aufruf zum »social distancing« hat die tatsächliche soziale und ökonomische Distanz zwischen denjenigen, die sich in komfortablen Häusern und gut bezahlten Berufen gut anpassen konnten, und denjenigen, die gezwungen waren, unter problematischeren Bedingungen zu arbeiten, verschleiert. Die Reaktion auf die Pandemie war weder egalitär noch einheitlich.
Trotz ihres Reichtums waren die Vereinigten Staaten anfangs nicht in der Lage, das Gesundheitspersonal mit der erforderlichen Schutzausrüstung auszustatten und die Patienten auf den Inten30sivstationen mit Beatmungsgeräten zu versorgen. Experten für das öffentliche Gesundheitswesen hatten seit Jahren vor den Risiken gewarnt, aber Planung und Vorbereitung hielten nicht Schritt. Im Gegenteil, das Streben allein nach Effizienz in den Einrichtungen des Gesundheitswesens war der Feind von Einsatzbereitschaft und Widerstandsfähigkeit, da die Einsparung von Geld durch den Verzicht auf Lagerhaltung zur Abhängigkeit von langen Lieferketten führte, die die Ausrüstung »just in time« liefern sollten – Lieferketten, die dann aber nicht funktionierten. Die Institutionen waren nicht nur überfordert, sondern der Widerstand gegen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wurde auch politisiert. Führende Politiker haben Konflikte verschärft, wo Zusammenhalt und ein gemeinsames Ziel nötig gewesen wären. Die Bürger haben sich hilflos gefühlt, unfähig, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ohne Einfluss auf die nationale Politik oder die globale Ausbreitung der Krankheit. Die Vereinigten Staaten sind nicht die einzige Demokratie, die nicht in der Lage ist, regionale, klassen- und berufsbedingte Ungleichheiten – und politische Polarisierung – zu überwinden. In Deutschland beispielsweise haben die Landesregierungen ebenfalls gegen die Beschränkungen des Bundes rebelliert. In Großbritannien und Frankreich stießen notwendige Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf politisierten Widerstand und Ablehnung. Wie viele andere Länder schwankte auch die indische Regierung zwischen Selbstgefälligkeit und erratisch verhängten Notmaßnahmen, die die Armen am härtesten getroffen haben.
Ein zunehmend autoritäres China hat den Eindruck erweckt, dass westliche (sprich: liberale) demokratische Gesellschaften zu schwach seien, um mit Herausforderungen wie Covid-19 fertig zu werden. Das ist in dreifacher Hinsicht eine verzerrte Wahrnehmung. Es ignoriert erstens, welche Rolle die Pathologien der autoritären Regierungsführung Chinas beim ersten Auftreten von Covid gespielt haben, nicht zuletzt die Tatsache, dass die lokalen Behörden wichtige Informationen verheimlichten, weil sie Angst davor hatten, was passieren würde, wenn sie sie an höhere Stellen weitergaben – von den Bürgern ganz zu schweigen. Es ignoriert zweitens, wie gut einige Demokratien – zum Beispiel Neuseeland – den Umgang mit Covid-19 gemeistert haben und dass Demokratien bei der Entwicklung von Impfstoffen weltweit führend sind. 31Und es übertreibt drittens das Ausmaß, in dem bestimmte Regime, wie das von Donald Trump in den Vereinigten Staaten, ein Versagen der Demokratie als solcher und nicht »bloß« eine degenerierte Form darstellen. Dennoch muss die Frage nach den demokratischen Fähigkeiten gestellt werden, ebenso wie die Frage nach dem Klimawandel und anderen Notlagen jenseits der Pandemie.
Amartya Sen hat bekanntlich behauptet, eine der Tugenden der Demokratie bestehe darin, Hungersnöte zu verhindern.[11] Seuchen, Überschwemmungen und Missernten haben im Laufe der Geschichte zu katastrophalen Einbrüchen bei der Nahrungsmittelversorgung geführt. Die Frage, wer hungern musste, hing jedoch nicht nur davon ab, wie viel Nahrung vorhanden war, sondern auch davon, wie sie verteilt wurde; der Anspruch auf einen Anteil daran war eine Grundvoraussetzung für das Überleben. In Demokratien hatte jeder Anspruch auf die verfügbaren Lebensmittel, und selbst die Armen und sozial Schwachen mussten kaum Hunger leiden.[12] Man hätte deshalb meinen können, dass ein ähnliches Engagement für das Wohlergehen – und sei es nur das Überleben – aller Bürger die Zahl der Todesopfer während der Corona-Pandemie, die Ende 2019 begann, in den demokratischen Ländern niedrig gehalten hätte. Das war jedoch nicht der Fall. Die Vereinigten Staaten, Brasilien, Indien und mehrere europäische Demokratien waren mit am stärksten betroffen. Die Demokratie mag gut darin sein, Hungersnöte zu minimieren, aber sie hat sich nicht als ähnlich gut darin 32erwiesen, Seuchen zu verhindern – zumindest nicht, wenn sie von Zerfallserscheinungen geprägt war.
Wie sich die Folgen der Pandemie auswirken werden, ist noch nicht ganz klar; es können immer noch verschiedene Entscheidungen getroffen werden. Wie Calhoun und Taylor in Kapitel 7 darlegen, ist eine Schlüsselfrage dabei, inwieweit diese Entscheidungen auf der Grundlage eines egalitären und einheitlichen Strebens nach dem Gemeinwohl getroffen werden. Klar ist, dass Covid-19 es unmöglich gemacht hat, das zu ignorieren, was einst als »soziale Frage« bezeichnet wurde. Während der Industriellen Revolution bezog sich dieser Begriff auf Herausforderungen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Nahrungsmittelknappheit, Umweltverschmutzung und unzureichenden Wohnraum. Heute zeigt sich, dass die alten Übel nicht einmal aus den reichen Ländern verschwunden sind, geschweige denn aus den ärmeren Ländern.[13] Ungleichheiten in Bezug auf Vulnerabilität, Impfungen und Pflege sind zu einer neuen sozialen Frage geworden.
Die Demokratien sind bei der Bewältigung der Pandemie weniger deshalb gescheitert, weil es ihren Regierungen an Ressourcen, Macht oder politischen Fähigkeiten mangelte, sondern weil es ihnen an sozialem Zusammenhalt und Verpflichtung auf das Gemeinwohl fehlte. Das Problem ist nicht, dass die Demokratie zwangsläufig schwach ist. Das Problem ist, dass die Demokratie Zerfallserscheinungen zeigt.
Ursachen des Zerfalls
Der Zerfall der Demokratie wird nicht einfach durch schlechte Politiker verursacht, auch wenn zu viele von ihnen entweder kindisch oder korrupt sind, oder durch »technische« Mängel der Wahlsysteme. Er ist auch nicht ausschließlich auf äußere Einflüsse zurückzuführen, obwohl diese durchaus real sind: massive wirtschaftliche Umwälzungen, geopolitische Verschiebungen, Destabilisierung nationaler Institutionen, Scheitern globaler Zusammenarbeit, heimtückische Manipulation von Medien und Informationssystemen, Verschärfung der Ungleichheit.
33Die Demokratie zerfällt, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht in der Lage sind, sich und ihren Familien ein gutes Leben verschaffen zu können. Sie verfällt, wenn Gemeinschaften nicht in der Lage sind, ihre eigene Zukunft auf demokratische Weise zu gestalten, weil sie so sehr von den Entscheidungen ferner Mächte und den unpersönlichen Mechanismen kapitalistischer Märkte oder anderer groß angelegter Systeme bestimmt wird. Sie degeneriert, wenn einige Bürger versuchen, andere an den Rand zu drängen, indem sie nicht nur ihre Stimmen bei Wahlen blockieren, sondern auch ihren Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und sogar zu öffentlichen Räumen einschränken. Die Demokratie verkommt, wenn die Bürger sich gegenseitig nicht mehr mit grundlegendem Respekt und Anerkennung behandeln und wenn sie sich weigern zu akzeptieren, dass sie wirklich zusammengehören.
Die Zerfallserscheinungen spiegeln die Erosion der sozialen Grundlagen der Demokratie wider. Die Bürger haben stabile Gemeinschaften, unterstützende und befähigende Institutionen und politische Parteien verloren, die in der Lage sind, wirksame interne Koalitionen und externe Allianzen zu schmieden, um sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Wir sind über Gemeinschaften hinweg durch abstrakte und unpersönliche Systeme verbunden – vor allem durch Märkte. Aber wir haben zu wenige Gelegenheiten, über die Entfernungen persönlichere Verbindungen zwischen uns zu knüpfen. Die massenhafte Beteiligung am Militär hat dies bei den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg bewirkt. Im miserabel geplanten Vietnamkrieg, der die Gesellschaft entzweite, wurde weniger Solidarität erreicht. Doch im Gefolge dieses Konflikts ersetzten die Vereinigten Staaten den selektiven, aber obligatorischen Militärdienst leider nicht durch ein faires Modell eines allgemeinen nationalen Dienstes, sondern durch eine »freiwillige« Rekrutierung, die die Beteiligung zu einer Frage der Klassenposition, einer kastenähnlichen innerfamiliären Kontinuität und für einige eines hochgradig politisierten Patriotismus machte. In ähnlicher Weise kann die Teilnahme an religiösen Aktivitäten das Lokale mit größeren Netzwerken, nationalen Konfessionen und internationalen Missionen verbinden. Aber selbst in den Vereinigten Staaten, wo die religiöse Partizipation lange Zeit viel höher war als in den meisten Industrieländern, ist sie in den letzten Jahrzehnten um mehr als ein Drittel zurückgegangen (und die lokale Kirchenmitgliedschaft ist hier sel34tener in nationale Konfessionen integriert).[14] Die alten Medien – Zeitungen, Fernsehen – haben den öffentlichen Diskurs einst zum Teil dadurch unterstützt, dass sie solche übergreifenden Verbindungen und einen gemeinsamen Wissenshintergrund geschaffen haben. Durch den Verlust ihrer wirtschaftlichen Grundlagen im Zeitalter der neuen elektronischen Medien sind sie jedoch deutlich geschwächt. Die neuen Medien haben zwar die demokratische Teilhabe erweitert, aber noch keine angemessenen Wege gefunden, um auf wahrheitsgetreues Wissen und Zusammenarbeit statt auf Täuschung und Konflikt ausgerichtet zu sein.
Demokratien haben schon früher tiefe Krisen überstanden, aber manchmal sind sie auch daran zerbrochen. Das berühmteste Beispiel ist das Ende der Weimarer Republik in Deutschland, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen.[15] Das Ende der deutschen Demokratie spiegelte Zerfallserscheinungen der Art wider, wie wir sie hier beschreiben, kombiniert mit einer Wirtschaftskrise, ungünstigen internationalen Beziehungen und einer effektiven, organisierten und rücksichtslosen Bewegung, die die Macht an sich riss. Die Demokratie wurde erst wiederhergestellt, nachdem Deutschland einen fürchterlichen Krieg verloren hatte, und auch das nur in der einen Hälfte des nunmehr geteilten Landes.
Dennoch kann die Demokratie auch nach dem Niedergang überleben und sogar gedeihen – wenn den Zerfallserscheinungen mit energischen konstruktiven Maßnahmen begegnet wird. Wir legen unsere Darstellung der Zerfallserscheinungen der Demokratie in der Hoffnung vor, dass sie solche Projekte der Erneuerung und Regeneration fördern kann. Wir fügen aber sogleich hinzu, dass diese Projekte mehr beinhalten müssen als bloße Reparaturen oder Versuche, zu einem alten »Normalzustand« zurückzukehren. 35In Kapitel 7 skizzieren wir einige Möglichkeiten. Entscheidend ist, die Demokratie als ein Projekt zu betrachten – um eine stärkere Demokratie und ganz allgemein eine bessere Zukunft zu schaffen.
36Kapitel 1 Zerfallserscheinungen der Demokratie
Charles Taylor
Lassen Sie uns zunächst einige weithin bekannte Dinge über die Geschichte des Wortes »Demokratie« wiederholen, denn sie können Dilemmata, in denen wir gegenwärtig stecken, verdeutlichen.
»Demokratie« ist, wie jeder weiß, erst seit zweihundert Jahren kein abwertender Begriff mehr. Ihr schlechter Ruf geht auf Aristoteles zurück. Für Aristoteles war Demokratie die uneingeschränkte, gleichsam unkontrollierte Macht des demos – der demos gedacht als die Nicht-Elite der Gesellschaft – über alle anderen, einschließlich der Eliten, d.h. der Aristokraten und derjenigen mit Geld. Auf der anderen Seite bedeutete Oligarchie die uneingeschränkte Kontrolle durch die Reichen und Adligen. Für Aristoteles war die beste Gesellschaft also das, was er eine politeia oder Politie nannte, ein Gleichgewicht zwischen beiden, ein Gleichgewicht der Macht.
Hätte man bis ins 18.Jahrhundert hinein unter anderem den Verfassern der amerikanischen Verfassung die Demokratie vorgeschlagen, so hätten sie gesagt: »Das wollen wir doch gar nicht.« Auch sie dachten in Kategorien des Gleichgewichts und nannten ihr neues Gemeinwesen »Republik«, was eine mögliche Übersetzung von Aristoteles’ Begriff ist: Politeia lautet schließlich der Originaltitel von Platons großem Werk, der sich auch als res publica oder Republik übersetzen lässt. Aber Demokratie war im späten 18.Jahrhundert tatsächlich eine schlechte Nachricht.
Und dann wird sie plötzlich zu unserem Wort für die erstrebenswerteste Gesellschaft. Oder anders gesagt: Der Begriff, der zuvor im Gegensatz zu einem »Gemeinwesen« oder einer »Republik« definiert wurde – nämlich »Demokratie« –, bemächtigt sich plötzlich deren Ansehen und Legitimität. Er wird zu unserem Wort für das, wofür wir kämpfen, um die Welt dafür sicher zu machen (»make the world safe for democracy«), für die höchste Form des politischen Lebens.
Diese Verschiebung hinterlässt jedoch eine gewisse Zweideutigkeit, wie wir an der Doppeldeutigkeit der Wörter erkennen können, die wir für die Übersetzung von demos verwenden, also Volk, 37peuple, people, popolo und so weiter. Sie haben immer einen zweifachen Sinn. Einerseits bezeichnen sie die gesamte Bevölkerung einer Nation oder einer politischen Einheit, wie zum Beispiel das französische Volk oder das niederländische Volk, die 1944/45 von der nationalsozialistischen Besatzung befreit wurden. Andererseits verwenden wir den Begriff oft für das, was die Griechen den demos nannten, d.h. die Nicht-Eliten, so wie die frühe Neuzeit »demotische« Sprachen vom Lateinischen und den Sprachen der oft als Eroberer aufgetretenen Eliten unterschied, oder wie heute, wenn politische Führer behaupten, dass das Volk von den Eliten betrogen, ausgebeutet oder anderweitig übel behandelt wird.
Demokratie ist ein telisches Konzept
Diese Doppelbedeutung ist nicht zu eliminieren, denn sie spiegelt den Anspruch wider, der hinter dem Wort »Demokratie« steht. Im Idealfall würden die beiden Bedeutungen des Wortes miteinander verschmelzen: Es gäbe eine Gesellschaft, die vom ganzen Volk regiert wird, aber ohne eine Elite, die es schafft, den Rest der Bevölkerung in den Hintergrund zu drängen und zu dessen Nachteil zu handeln. Mit anderen Worten: Die Demokratie wäre eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft. Denn die Demokratie ist ein telisches Konzept, das notwendigerweise von Zielen und Idealen abhängt und nicht nur von Voraussetzungen oder Kausalbeziehungen. Sie wird durch Standards definiert, die niemals erfüllt werden können.
Es gibt also verschiedene Arten, Demokratie zu definieren: Wir sprechen davon, dass bestimmte Länder eine Demokratie haben, weil sie zum Beispiel über einen Rechtsstaat verfügen oder weil sie Wahlen abhalten, an denen alle Menschen teilnehmen können. In diesem Fall ist das allgemeine Wahlrecht der Schlüssel, zusammen mit dem Erfordernis »freier und fairer« Wahlen, was wiederum voraussetzt, dass die Medien frei sind. Oftmals aber fällen wir auch ein ganz anderes Urteil über bestimmte Gesellschaften, die den Test »frei und fair« bestehen, nämlich dass sie sehr »undemokratisch« sind, weil sie Ungleichheiten – in Bezug auf Einkommen, Vermögen, Bildung, Klasse oder Rasse – aufweisen, die durch eine unverhältnismäßig große Macht der Eliten verursacht sind, gleichzeitig diese enorme Machtfülle aber noch zusätzlich befördern.
38Das Wahlkriterium ist eine Art Ein/Aus-Kriterium: Entweder erfüllt ein Land die Anforderung allgemeiner »freier und fairer« Wahlen oder es erfüllt sie nicht. (Die Welt ist natürlich viel unschärfer, aber unsere Urteile sind kategorisch.) Der zweite Demokratiebegriff ist jedoch telisch.
Gemeint ist damit eine Vorstellung davon, was das Ideal sein sollte, was die Demokratie ganzheitlich verwirklichen sollte. Das wäre so etwas wie ein Zustand idealer Gleichheit, in dem alle Klassen und Gruppen, Eliten und Nicht-Eliten gleichermaßen, im Verhältnis zu ihrer Anzahl über die Macht verfügten, die Ergebnisse zu beeinflussen und zu bestimmen.[1] Das aber definiert einen Zustand, den wir nie ganz erreichen – oder vielleicht erreichen wir ihn für kurze Zeit, und dann gleiten wir wieder davon ab. Und das verschafft uns den Schlüssel zu einer sehr wichtigen Dynamik in der Demokratie, die für meinen ersten Aspekt, meinen ersten Weg zum Zerfall, entscheidend ist.
Es gibt Phasen, in denen wir uns auf die Demokratie zubewegen – Befreiung von fremder Herrschaft, Befreiung von diktatorischer Herrschaft –, so wie es 1989 in Osteuropa geschah, so wie es nach dem Tahrir-Platz während des Arabischen Frühlings zu geschehen schien. Und etwas Ähnliches geschieht, wenn die Macht des demos in etablierten Demokratien (die das Kriterium »Wahlen« erfüllen) geltend gemacht wird.
Dann herrscht ein Gefühl großer Begeisterung, das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen.
Und dann gibt es Zeiten, in denen die Stimmung sinkt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns von der Demokratie entfernen. Betrachtet man die zweihundert Jahre dessen, was wir heute als »westliche Demokratie« bezeichnen, so stellt man fest, dass es viele Bewegungen gab, die scheinbar einen Schritt nach vorn darstellten; die Jackson’sche Revolution in den 1820er Jahren in den Vereinigten Staaten beispielsweise war eine Art demokratische Revolution gegen eine bestimmte Klasse von Eliten, gegen mächtige 39Landbesitzerinteressen. Später dann im 19.Jahrhundert setzten sich jedoch neue und mächtige Interessen durch – beispielsweise die »Räuberbarone« im Gilded Age, gegen die die Progressiven und später Theodore Roosevelt mit Kartellgesetzen vorgingen.
Ab den 1930er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in einigen Ländern einen weiteren Vorstoß gegen die unkontrollierte Macht der Industrie, diesmal mit der Schaffung von Wohlfahrtsstaaten, der Stärkung der Arbeitnehmermacht, einer Politik der Vollbeschäftigung und anderen sozialdemokratischen Elementen. Und dann, seit etwa 1975, sind wir in die andere Richtung gerutscht. Es ist dieses wichtige Merkmal – zuerst demokratische Ermutigung, Begeisterung und Vorwärtsbewegung, dann demokratische Entmutigung und Rückwärtsbewegung –, auf das ich aufmerksam machen möchte.
Hinter dem demokratischen Zerfall verbirgt sich zum Teil das Festhalten am ersten Konzept, dem Ein/Aus-Konzept. Es wird weithin mit dem berühmten Ökonomen Joseph Schumpeter in Verbindung gebracht, für den das Volk (zumindest theoretisch) aus gleichen Individuen besteht. Sie alle haben das Wahlrecht. Tatsächlich regieren Eliten von Experten und selbst ausgewählten Politikern.[2] Doch das Volk wählt regelmäßig, und diese Wahlen sind frei und fair. Es besteht also die reale Möglichkeit, dass die Amtsinhaber abgewählt werden können, und es gibt immer eine alternative Elite, die bereit ist, die Macht zu übernehmen, wenn die derzeitigen Machthaber ins Wanken geraten.
Nennen wir dies das »Kontingenzmerkmal«.
Dieses Merkmal hat noch weitere Voraussetzungen. Es erfordert freie Medien, offene Foren des Austauschs, das Recht, sich zu organisieren, und so weiter. Diese tragen zu freien und fairen Wahlen bei; ohne sie ist die Kontingenzbedingung nicht erfüllt. Und in einigen Varianten (z.B. in der US-Verfassung) wird versucht, einen Ausgleich zum ungezügelten und direkten Volkswillen zu schaffen (beispielsweise durch ein Wahlmännerkollegium, das aus lokalen Eliten besteht und den Präsidenten wählt).
Heute gibt es im liberalen Denken des Westens zudem das Erfordernis, dass alle gleich und gerecht behandelt werden müssen. 40Die Forderung lautet, alle einzubeziehen, auch die Menschen, die sich von der Mehrheit unterscheiden, ob nun ethnisch, kulturell oder religiös.
Diese Inklusivität ist natürlich ein weiteres telisches Konzept, ein Standard, den wir nie ganz erreichen, dem wir uns aber je nachdem zu jedem Zeitpunkt annähern oder von dem wir uns entfernen können. In diesem Abschnitt werde ich mich jedoch mit dem Standard befassen, der verschlüsselt unmittelbar im Begriff »Demokratie« enthalten ist: die Herrschaft des Volkes, die Forderung, dass Nicht-Eliten eine bedeutende Rolle in der Regierung spielen. Auf die Frage der Inklusion gehe ich im nächsten Abschnitt ein.
Heute glauben wir nur allzu gerne, dass das soeben beschriebene System letztendlich die Zustimmung zumindest der meisten Menschen garantieren wird. Und dieser Konsens wird zu einer in der Geschichte noch nie dagewesenen Stabilität führen (und hat in einigen Fällen auch tatsächlich dazu geführt). Eine solche qua Konsens erzeugte Stabilität ist wie gesehen eine große Umkehrung gegenüber der klassischen Periode und auch noch im Vergleich zum späten 18.Jahrhundert. Die amerikanischen Gründerväter waren der Demokratie gegenüber misstrauisch. Sie vertraten immer noch die Ansicht, die auf Aristoteles zurückgeht: Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, im Sinne von Nicht-Eliten. Eine solche Herrschaft würde eine gefährliche Instabilität mit sich bringen, ja sogar die Enteignung der Besitzenden, von denen Wohlstand und Zivilisation abhingen.
Aber diese Angst verschwindet in der quasi-Schumpeter’schen Sichtweise, zusammen mit dem telischen Konzept. Und hinter der optimistischen Prognose des etablierten liberalen Denkens steht die Erkenntnis, dass Demokratien stabil sind. Das Geheimnis der Attraktivität der Demokratie liegt dieser Auffassung zufolge darin, dass sie Rechtsstaatlichkeit bietet. Die Menschen können in Sicherheit leben, weil ihre Rechte geachtet werden, und wenn dies nicht der Fall ist, können sie vor Gericht Rechtsmittel einlegen. Gleichzeitig wird durch die Abhaltung regelmäßiger Wahlen mit allgemeinem Wahlrecht sichergestellt, dass die Interessen zumindest der Mehrheit nicht völlig außer Acht gelassen werden können.
Aus dieser Sicht können Demokratien also auf eine Weise stabil sein, wie es andere Regime nicht können. Darüber hinaus werden diese anderen Systeme aufgrund der weit verbreiteten Merkmale 41