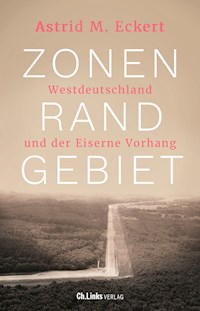
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wirkte die innerdeutsche Grenze auf den Westen?
Das »Zonenrandgebiet« – entstanden mit der deutschenTeilung, verschwunden mit der Wiedervereinigung. Dieser 40 Kilometer breite Gebietsstreifen, der sich entlang der innerdeutschen Grenze von der Lübecker Bucht bis nach Bayern erstreckte, war die sensibelste Region der alten Bundesrepublik. Er hinkte dem »Wirtschaftswunder« hinterher, sollte aber zugleich im ideologischen Konflikt mit der DDR als Schaufenster die Vorzüge des bundesdeutschen Systems veranschaulichen. Hier wird seine Geschichte zum ersten Mal erzählt.
»Ein nuanciertes und scharfsinniges Buch mit subtilem Humor, das die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert meisterhaft neu bewertet.« GERMAN HISTORY
»Klar und fesselnd geschrieben … Ein Meilenstein der Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte des Nachkriegsdeutschlands.« GERMAN STUDIES REVIEW
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Astrid M. Eckert
ZONENRANDGEBIET
Astrid M. Eckert
ZONENRANDGEBIET
Westdeutschland und der Eiserne Vorhang
Aus dem Englischen von Thomas Wollermann, Bernhard Jendricke und Barbara Steckhan
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel West Germany and the Iron Curtain. Environment, Economy, and Culture in the Borderlands bei Oxford University Press.
Die Übersetzung ins Deutsche wurde durch eine Förderung der Emory University in Atlanta/Georgia ermöglicht.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Marke
der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
www.christoph-links-verlag.de
entspricht der 1. Druckauflage von 2022
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,
unter Verwendung eines Fotos von der innerdeutschen Grenze bei
Travemünde an der Ostsee vom 8. Juni 1989 (© IMAGO/sepp spiegl)
Karten: Bill Nelson
ISBN 978-3-96289-151-0
eISBN 978-3-86284-515-6
Inhalt
Auf der Westseite des Eisernen Vorhangs
1 Die Entstehung des westdeutschen Grenzlandes
Wirtschaftsleben mit Demarkationslinien
Die Demarkationslinie und die örtliche Wirtschaft
Grenzlandbildung und die Formierung von Interessengruppen
Die Folgen der Grenzschließung von 1952
Im Schatten des »Wirtschaftswunders«: Bundeshilfen für das Grenzland
Ideologisch abwehrbereit – Kulturförderung am Zonenrand
»Echte« Grenzen produzieren ein Grenzland
2 Der Osten vom Westen: Ein wirtschaftliches Randgebiet an der Grenze
Raumplanung und Zonenrandförderung
Imageprobleme: Westdeutsches Entwicklungsland
Gegen den Status quo: die 1970er und 1980er Jahre
Offene Grenze und neue DMark-ationslinien
Teilungsbedingte (Alt-)Lasten: Das Ende der Zonenrandförderung
Vom Rand in die Mitte?
Verteidigung von Subventionen
3 »Grüße von der Zonengrenze«: Der Eiserne Vorhang als Touristenattraktion
Wie man die Grenze zu betrachten hat
Die Gefahren eines Grenzbesuchs
Grenztourismus als politische Propaganda
Besucher und Besuchte
Der westliche Grenztourismus aus DDR-Sicht
Urlaub am Eisernen Vorhang
Der westliche Blick
4 Salze, Abwässer und schwefelhaltige Luft: Grenzüberschreitende Umweltverschmutzung
Alle Flüsse fließen nach Westen
Der Kalibergbau an der Werra
Innerdeutsche Umweltdiplomatie
Cum grano salis: Die Werra-Gespräche
Es liegt was in der Luft
Grenzenlose Umweltverschmutzung
5 Grenzgeprägte Naturräume: Der Eiserne Vorhang und sein Einfluss auf die Landschaft
Grenzbefestigungen und Niemandslandschaften
Tiere am Eisernen Vorhang
Der Drömling
Naturbeobachtung entlang des Eisernen Vorhangs
Im Westen erdacht, im Osten verworfen: Die Idee grenzüberschreitender Naturschutzgebiete
Der Ausverkauf des Schutzstreifens
November 1989: Von jubelnden Menschen und bedrohten Tieren
Das Grüne Band wird geknüpft: Naturschutz in Zeiten des Übergangs
Die Geschichtlichkeit von Landschaft
6 Der nukleare Brennstoffkreislauf im Grenzgebiet: Gorleben und die Energiezukunft der Bundesrepublik
Die globale Dimension von Gorleben
Standortkämpfe: Der Gorleben-Konflikt
Gorleben und die DDR
Am Verhandlungstisch: Die Rolle des Landkreises
»Gorleben soll leben«: Protestkultur an der Grenze
Abfall für die Ewigkeit
Westdeutschland vom Rand her betrachtet
Anhang
Anmerkungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Archive
Gedruckte Quellen
Literatur
Personenregister
Ortsregister
Abbildungsnachweis
Danksagung
Die Autorin
Auf der Westseite des Eisernen Vorhangs
»Friedemann Grün« stand auf dem Lkw, der am 3. August 1984 auf das Gelände des Kohlekraftwerks Buschhaus bei Helmstedt rollte. An vier Polizeisperren und am Werkschutz vorbei. Der fingierte Firmenname ergab erst im Nachhinein Sinn: Peaceman Green, besser bekannt als Greenpeace. Innerhalb weniger Minuten setzten Greenpeace-Aktivisten eine Leiter aus Alustangen zusammen, erklommen den Kühlturm und entrollten ein Transparent, das die Luftverschmutzung durch das Kraftwerk anprangerte. Buschhaus löste eine akute politische Krise in der Bundesrepublik aus, weil es auf dem Höhepunkt der öffentlichen Debatte über sauren Regen und Waldsterben ohne Entschwefelungsanlage in Betrieb gehen sollte. Obwohl eine Rauchgasentschwefelung für neue Kraftwerke seit 1983 gesetzlich vorgeschrieben war, pochte die niedersächsische Landesregierung auf eine Ausnahme, weil Buschhaus bereits Jahre vor dieser Neuregelung genehmigt worden war. Die Befürworter des Kraftwerks argumentierten mit Arbeitsplätzen, die Gegner mit Schadstoffemissionen. Zeitgenossen begriffen Buschhaus als einen klassischen Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie. Der Streit ging als Indiz für das neu entwickelte Umweltbewusstsein der Bundesrepublik in die Geschichte der westdeutschen Umweltpolitik ein.1
Doch was den Konflikt verschärfte, war der Standort des Kohlekraftwerks. Buschhaus befand sich im westdeutschen Grenzgebiet direkt an der innerdeutschen Grenze. Es gehörte zu einem Unternehmen, den Braunschweigischen Kohlen-Bergwerken (BKB), deren Tagebaufelder 1952 durch die Demarkationslinie geteilt worden waren. Ohne Zugriff auf den vollen Umfang seiner Kohlevorkommen war die Existenz der BKB langfristig gefährdet. Die Belegschaft sah in Buschhaus deshalb eine Arbeitsplatzgarantie.
Am 17. Juni 1985 protestierte die Umweltgruppe
Robin Wood
gegen das Kohlekraftwerk Buschhaus direkt an der innerdeutschen Grenze mit einem Wachturm als Hintergrund.
In der politischen Ökonomie der Bundesrepublik hatten die Regionen entlang der innerdeutschen Grenze einen besonderen Status: Das »Zonenrandgebiet«, in dem sich die BKB befanden, galt als wirtschaftlich benachteiligt und erhielt entsprechende politische Aufmerksamkeit. In die Grenzbezirke flossen staatliche Subventionen zur Schaffung und Bewahrung von Industriearbeitsplätzen. Daher rührte die verbissene Unterstützung der Landesregierung für das dreckschleudernde Projekt. Die Grenznähe vergrößerte aber nicht nur die politische, sondern auch die ökologische Dimension von Buschhaus. Die Rauchschwaden des Kraftwerks waren nicht irgendein Umweltproblem, sie waren ein grenzüberschreitendes Umweltproblem. Zu einer Zeit, als die Bundesrepublik die DDR für ihre beispiellosen Schwefeldioxid-Emissionen rügte, war es diplomatisch unklug, ein Kohlekraftwerk ohne Filtertechnik direkt an der Grenze zum Nachbarn in Betrieb zu nehmen. Die Umweltaktivisten wussten das Stichwort der Grenzüberschreitung für ihre Zwecke zu nutzen. Am 17. Juni 1985, dem Tag der Deutschen Einheit, protestierte die Organisation Robin Wood an der Grenze. Ihr Banner, an Ballons über der Demarkationslinie schwebend, verkündete, dass Luftverschmutzung nun einmal keine Grenzen kenne – ein DDR-Wachturm bildete die Kulisse. Der Konflikt um Buschhaus war weit mehr als ein Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie. Er war geprägt von der Nähe zur innerdeutschen Grenze und erinnerte daran, dass Deutschland nach wie vor ein geteiltes Land war.
Dieses Buch untersucht die Bedeutung der innerdeutschen Grenze für das westliche Deutschland. Es betrachtet die Geschichte der »alten« Bundesrepublik und des Wiedervereinigungsprozesses aus der räumlichen Perspektive der westdeutschen Grenzgebiete, die entlang der Demarkationslinie des Kalten Krieges entstanden. Im Gegensatz zur Berliner Mauer verlief die 1393 Kilometer lange innerdeutsche Grenze vornehmlich durch ländliche Regionen – schier endlose Sperranlagen schlängelten sich über Wiesen und Felder. Doch in den westlichen Grenzregionen befanden sich auch Städte wie Lübeck, Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Göttingen, Kassel, Fulda, Coburg und Hof. Je nach wirtschaftlichem Profil entwickelten diese Städte und Landkreise aufgrund ihrer neu definierten geografischen Lage ihre je eigenen Defizite.
Die Regionen entlang der innerdeutschen Grenze waren der sensibelste geografische Raum der alten Bundesrepublik.2 Hier traf Westdeutschland in einer konkreten und alltäglichen Weise auf den ideologischen Gegner des Kalten Krieges, die DDR. Wollte der neue Weststaat erfolgreich sein, mussten die Segnungen seiner wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ordnung jeden Winkel der Bundesrepublik erreichen. Im Grenzland mussten sich die westdeutschen Behörden mit den praktischen Folgen der Teilung auseinandersetzen, wollten sie diese Räume fest in das neue Staatsterritorium integrieren – Folgen, die sich in der lokalen Wirtschaft und Infrastruktur bemerkbar machten, sich als ideologische Konkurrenz im kulturellen Bereich manifestierten und die, wie die Buschhaus-Episode zeigt, in Umweltbeziehungen greifbar wurden. Hier spiegelten sich die längerfristigen Entwicklungslinien der Bundesrepublik nicht nur wider, hier wurden sie mitgeformt.
Das Buch folgt neueren Forschungen, die gezeigt haben, dass die Geschichte der innerdeutschen Grenze nicht allein aus der Diplomatie des Kalten Krieges oder im einseitigen Fokus auf die DDR verstanden werden kann. Vielmehr wurde sie durch Aushandlungsprozesse zwischen den beiden deutschen Staaten und dem alltäglichen Mit- und Gegeneinander der Deutschen auf beiden Seiten, durch das Geben und Nehmen, das sich sowohl in der »hohen« Politik als auch in lokalen Begegnungen entfaltete, wesentlich mitgeformt.3 Als sich die Grenze in den späten 1940er Jahren zuerst in der politischen Rhetorik und dann auch physisch verfestigte, schuf sie auf beiden Seiten neue Randgebiete. Auf DDR-Seite etablierte die SED-Führung 1952 eine fünf Kilometer tiefe Sicherheitszone nach sowjetischem Vorbild. Das Alltagsleben der Bewohner dieses Sperrgebiets wurde bis ins kleinste Detail reguliert und überwacht. Bis auf wenige Ausnahmen war es für Nichtansässige tabu und wurde als Pufferzone vor der eigentlichen Demarkationslinie zu einem integralen Bestandteil der Grenzbefestigungen.4 Von der engmaschigen und wenn nötig gewaltsamen Überwachung der »Staatsgrenze West« ausgehend, übertrug sich das Grenzregime wellenartig in den Sozialraum der DDR-Gesellschaft. Die konkrete »Grenzverletzung« am Eisernen Vorhang hatte ein Pendant im DDR-Alltag. Auch hier konnten Grenzen durch Nonkonformität und eigensinniges Verhalten »verletzt« werden. »Das Wissen um die Existenz dieser unsichtbaren Grenzen, und um die Risiken, sie unbedacht oder wissentlich zu ›verletzen‹«, schreibt der Historiker Thomas Lindenberger, »war praktisches DDR-Bürgerwissen.« Auf diese Weise erwies sich das Grenzregime als konstitutiv für die DDR. Lindenberger charakterisiert den SED-Staat deshalb als eine »Diktatur der Grenzen«.5
Auch in der Bundesrepublik entstand ein Grenzgebiet, allerdings wurde es den Menschen nicht von oben aufgezwungen, sondern entwickelte sich aus den wirtschaftlichen Konsequenzen der Demarkationslinie. Die Städte und Gemeinden entlang der Trennlinie zur sowjetischen Besatzungszone hatten zwar durchaus unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, litten aber alle auf die eine oder andere Weise an der immer undurchlässiger werdenden Grenze. Um auf ihre Misere hinzuweisen, fanden sich gewählte Vertreter aus Bund, Ländern und Gemeinden sowie Repräsentanten aus Wirtschaft und Handel zusammen und verschafften sich als »Grenzlandfürsprecher« bei der frisch konstituierten Bundesregierung Gehör. Damit ihre Regionen nicht weiter ins Hintertreffen gerieten, forderten sie, als Ausgleich für die durch die Grenze verursachten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, staatliche Unterstützung. Zwar ließ Hilfe aus Bonn auf sich warten, doch als Mitte der 1950er Jahre erste Hilfsmaßnahmen in Gang kamen, wurde der Landstrich entlang der innerdeutschen Grenze in Westdeutschland als »Zonenrandgebiet« bekannt. Dabei kamen nicht nur Regionen entlang der Landgrenze mit der DDR in den Genuss von »Zonenrandförderung«. Zum Fördergebiet gehörten auch die schleswig-holsteinische Ostseeküste sowie der bayerische Grenzraum zur Tschechoslowakei. Mit einer Tiefe von 40 Kilometern umfasste das Zonenrandgebiet fast 20 Prozent des Territoriums der Bundesrepublik, knapp 12 Prozent der westdeutschen Bevölkerung lebten hier.6
Die innerdeutsche Grenze bei Rasdorf (Hessen) und Buttlar (Thüringen) in den 1960er Jahren.
»Zonenrandgebiet«: Der sperrige Name dieser Grenzregionen war selbst ein Produkt des frühen Kalten Krieges. Lange hielt sich in der Bundesrepublik die Gewohnheit, die DDR als »Zone« zu titulieren. Der Begriff implizierte, dass sich die DDR nicht wesentlich von der sowjetischen Besatzungszone unterschied, die sie bis Oktober 1949 gewesen war. Die Staatsgründung, so unterstellte der Ausdruck, könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass der ostdeutsche Staat ein sowjetisches Marionettenregime bleibe. Die westdeutschen Regionen entlang der Demarkationslinie »Zonenrandgebiet« zu nennen, erinnerte die Bürger der Bundesrepublik gleichzeitig daran, dass dieser Landstrich als Produkt der Teilung unverschuldet in eine Abseitsposition geraten war und deshalb einen moralischen Anspruch auf die Solidarität des ganzen Landes hatte.7
Dieses Buch erklärt erstmals, wie die Bedingungen des frühen Kalten Krieges das Zonenrandgebiet hervorbrachten. Es zeigt, welche Rolle das Grenzland in der Geschichte der »alten« Bundesrepublik spielte und wie es im wiedervereinigten Deutschland nachwirkt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf umwelthistorischen Fragen. Die Grenzregionen sind aber nicht nur ein Ort, den das Buch untersucht. Sie eröffnen auch räumliche Perspektiven, von denen aus sich die Nachkriegsgeschichte und der Prozess der Wiedervereinigung neu betrachten lässt.
Die Grenzgebiete entlang des Eisernen Vorhangs haben wenig mit den lebendigen Kontaktzonen und kulturell hybriden Räumen gemein, die in der Regel im Mittelpunkt von Borderland Studies stehen.8 Das DDR-Grenzregime hatte das genaue Gegenteil im Sinn. Obwohl der innerdeutschen Grenze nie die hermetische Abriegelung gelang, die der Metapher »Eiserner Vorhang« innewohnt, sollte sie Alltagskontakte unterbinden, die gegnerische Ideologie abwehren, Mobilität regulieren und schließlich die Abwanderung vollständig verhindern.9 Der sich wandelnde Charakter der Grenze von einer relativ offenen, dynamischen »grünen Grenze« zur tief gestaffelten, militarisierten Grenzzone blieb nicht ohne Folgen für die grenzübergreifenden Beziehungen: Sie verkümmerten so lange, bis sich die Menschen aus den Grenzgebieten schließlich »entfremdet« gegenüberstanden.10
Dennoch blieben diese Regionen auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze spezifische Kommunikationsräume. Hier trafen ost- und westdeutsche Grenzsoldaten aufeinander, patrouillierten alliierte Truppen, beackerten Bauern ihre Felder, liefen westdeutsche Touristen auf und kamen Staatsgäste zu Besuch. Hier bestanden zudem naturräumliche Beziehungen fort, die selbst diese hochgerüstete Grenze nicht abschneiden konnte. Schließlich spielten sich hier auch menschliche Dramen ab. Die innerdeutsche Grenze wurde zu einem tödlichen Bauwerk, das gemeinsam mit der Berliner Mauer das Kernstück der Gewaltgeschichte des SED-Regimes bildet. Früh erlangte die Demarkationslinie traurige Berühmtheit als ein Ort der Gewalt und des Todes. Während der militärischen Besatzungszeit herrschten an der Schnittstelle zwischen den Besatzungszonen Willkür und Chaos, gleichsam als Spätausläufer des Krieges.11 Als sich die SED-Führung darauf verlegte, ihren Macht- und Herrschaftsanspruch an der Grenze gegenüber den eigenen Bürgern auch gewaltsam zu verteidigen, wurden die Sperranlagen zu einer tödlichen Falle. Nach neuesten Forschungen kamen an der innerdeutschen Grenze gut dreihundert Ostdeutsche durch Staatsgewalt ums Leben.12 Nicht zuletzt wegen der Grenzopfer blieb sie bis zu ihrer Öffnung im Herbst und Winter 1989 politisch umstritten und behielt als Teil des metaphorischen Eisernen Vorhangs ihre zentrale Symbolkraft als Frontlinie des globalen Kalten Krieges.
Dementsprechend wurden alle Aktivitäten in Grenznähe unweigerlich mit politischer Bedeutung aufgeladen, auch wenn es sich um Vorgänge handelte, die in anderen Kontexten harmlos und alltäglich gewesen wären. Zum Beispiel nahmen die DDR-Grenzbehörden Sonntagsausflüge von Westdeutschen an die Grenze als eine Form psychologischer Kriegsführung wahr, die die DDR delegitimieren sollten. Auch die Verschmutzung grenzquerender Flüsse war nicht nur ein Umweltproblem wie jedes andere, sondern wurde zu einem brisanten Thema in den innerdeutschen Beziehungen, weil Schadstoffe aus der DDR in die Bundesrepublik schwappten. Durch die Grenze hatte diese Umweltverschmutzung neben der rein ökologischen Dimension sofort auch eine politische. Grenzüberschreitende Luft- und Gewässerverschmutzung brachten in den 1970ern und 1980ern einige Orte im westdeutschen Grenzland in Verruf, doch dieselben Jahrzehnte markierten eben auch deshalb eine »Wiederentdeckung« des Grenzlandes als eines vermeintlich authentischen ländlichen Raums mit angeblich intakten Landschaften, weil die beschleunigte Modernisierung der bundesdeutschen Wiederaufbaujahre trotz Zonenrandförderung an diesen Regionen vorbeigegangen war. Was in den 1950er und 1960er Jahren noch als Makel der »Unterentwicklung« galt, wandelte sich in den 1970er und 1980er Jahren zu einem touristischen Pluspunkt. Schließlich spielte das Zonenrandgebiet auch eine Schlüsselrolle, als es um die zukünftige Energieversorgung der Bundesrepublik ging. Im Jahr 1977 wurde ausgerechnet ein grenznaher Standort – die niedersächsische Gemeinde Gorleben an der Elbe – für eine nukleare Wiederaufbereitungsanlage und Endlagerstätte für Atommüll ausgewählt. Die Entscheidung galt als wegweisend für die weitere Entwicklung der deutschen Atomindustrie. Gorleben wäre die bis dahin größte industrielle Investition der Bundesrepublik geworden. Doch anstatt die Zukunft der Atomenergie zu sichern, löste die Standortwahl eine nachhaltige Protestbewegung aus. Durch die Zugkraft des Gorleben-Protests wurde die Peripherie buchstäblich zum Zentrum des bundesdeutschen Widerstands gegen Atomkraft.13
Als geschichtswissenschaftliches Thema tritt die innerdeutsche Grenze langsam aus dem Schatten der Berliner Mauer heraus. Neuere Arbeiten haben zudem unterstrichen, dass die Grenze und das Grenzland nicht nur eine Politik- und Militärgeschichte, sondern auch eine Sozial-, Kultur- und, wie dieses Buch zeigt, eine Umweltgeschichte haben.14 Eine der wegweisenden Studien hat die Perspektive von den Hauptstädten in die benachbarten Grenzstädte Neustadt (Bayern) und Sonneberg (Thüringen) verlegt. Sie zeigt, dass die Grenze »nicht einfach von den Supermächten des Kalten Krieges auferlegt wurde, sondern auch ein improvisierter Auswuchs der verunsicherten Nachkriegsgesellschaft war«. Aus Moskau, Washington, Ost-Berlin und Bonn kamen zwar die Rahmenbedingungen, aber ihre »Form und Bedeutung erhielt die Grenze von den misstrauischen Anwohnern, die mit ihr leben mussten«.15 Das soziale Verhalten im Alltag, die Wahrnehmungen der Nachbarn, die plötzlich auf einer »anderen« Seite zu stehen schienen, verfestigten die Grenze bereits, als sie noch gar nicht physisch markiert war. Bevor die Grenze überhaupt im Gelände sichtbar wurde, war sie bereits in den Köpfen der Menschen real.16
Wie beeinflussten staatliche Vorgaben, veränderte Lebensbedingungen und wirtschaftliche Eigeninteressen entlang der Demarkationslinie den Alltag in den Grenzregionen? Wie viel Handlungsspielraum blieb den Bewohnern der Grenzregionen, als der Kalte Krieg ihre Heimat erfasste? Die Antworten auf diese Fragen fallen regional unterschiedlich aus. Zwischen den Provinzstädten Sonneberg und Neustadt entwickelte sich eine andere Dynamik als im geteilten Eichsfeld, wo das soziale Gefüge oft an Landbesitz gebunden war und die Grenze Landwirte von ihren Feldern trennte. Während die Bauern eine Zeit lang noch versuchten, die Landverluste durch Tausch-, Kauf- und Pachtverträge untereinander auszugleichen, nahm ihr Handlungsspielraum im Laufe der 1950er Jahre ab. Die staatlichen Strukturen in Ost und West festigten sich und damit auch die Durchsetzung der Grenze.17 Dass die Zustände entlang der Grenze nicht einheitlich waren, zeigt auch die Sondersituation des geteilten Dorfs Mödlareuth an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Hier war die Lage noch einmal verschärft, denn der östliche Teil des Dorfs befand sich im sogenannten Schutzstreifen direkt an der Demarkationslinie und war damit einer Hyper-Überwachung ausgesetzt. Für dieses Umfeld liegt der Schluss nahe, dass der Eiserne Vorhang sehr wohl »von oben nach unten« auf die Dorfgemeinschaft herniederging, und zwar in einem Prozess, »in dem die Dorfbewohner den Staat als eine externe Kraft ansahen, der [ihnen] die Teilung aufzwang«.18
Der deutsche Abschnitt des Eisernen Vorhangs bestand nicht nur aus der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze, sondern umfasste auch die Grenze zwischen Bayern und der Tschechoslowakei, die eine historisch etablierte Staatsgrenze war und als solche in der Zwischenkriegszeit in den Nationalitätenkonflikten zwischen Deutschen und Tschechen eine Rolle spielte.19 Nach 1945 wurden die deutschstämmigen Einwohner der böhmischen Länder größtenteils über diese tschechisch-deutsche Grenze vertrieben – eine Erfahrung, die diesen Abschnitt des Eisernen Vorhangs entscheidend mitprägte.20 In der Bundesrepublik ansässige Vertriebene eigneten sich den bayerisch-tschechischen Grenzraum durch oft religiös konnotierte Gedenkorte wie Kapellen, Holzkreuze und Schreine an, um dort an ihre verlorene Heimat zu erinnern. Während die innerdeutsche Grenze in Westdeutschland zu einem wirkmächtigen Symbol des Kalten Krieges wurde, trug der bayerisch-tschechische Teil des Eisernen Vorhangs die zusätzliche Last der Erinnerung an die Vertreibung.21 Studien zum Eisernen Vorhang außerhalb Deutschlands bestätigen die ungleiche Entwicklung der Teilungserfahrung während des Kalten Krieges. Von Finnland bis an die Adria spielten lokale Kontexte und frühere Erfahrungen mit dem Leben entlang von (Staats-)Grenzen eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit der Teilung des europäischen Kontinents nach dem Zweiten Weltkrieg.22
Seit Winston Churchill im März 1946 von einem Eisernen Vorhang gesprochen hatte, der sich von Stettin bis Triest über den europäischen Kontinent senkte, war die Trennlinie zwischen den Gegnern des aufziehenden Kalten Krieges auch eine Propagandazone geworden.23 Beide deutsche Staaten instrumentalisierten die Grenze und ihre Opfer, um das jeweils eigene Staatswesen zu festigen und zu legitimieren und die Gegenseite zu diskreditieren.24 Die SED-Führung rechtfertigte das rigide Grenzregime als defensive Maßnahme gegen die Aggressionen des »faschistischen« und »imperialistischen« Westens, während sich für die Bundesrepublik an der Grenze die Möglichkeit eröffnete, den Antikommunismus der Gründungsjahre an einem konkreten Ort zu artikulieren.25 Dabei entwickelte die Bundesrepublik in ihren Propagandaschriften eine offizielle Bildpolitik, in der die Verantwortung für die deutsche Teilung und die hochgerüstete Grenze allein der DDR zugeschrieben wurde, eine Sichtweise, die sich nach 1989 auch in der Erinnerungskultur im wiedervereinten Deutschland fortsetzte.26
Trotz aller gegenseitigen Abgrenzungsversuche blieb die innerdeutsche Grenze eine geteilte Last in einem geteilten Land. Sie brachte Probleme hervor, die beide Seiten regelrecht zur Zusammenarbeit zwangen. Von der Wasserwirtschaft und Stromversorgung über die genaue Bestimmung des eigentlichen Grenzverlaufs bis hin zum Katastrophenschutz blieb Deutschland während des Kalten Krieges politisch zwar »geteilt, aber nicht unverbunden«.27 Auch wenn die Grenze wegen der dort verübten Staatsgewalt im zeitgenössischen westdeutschen Diskurs und in der Erinnerungskultur nach 1990 als eine Grenze ohnegleichen verabsolutiert wurde, hatte sie in ihren Anrainerregionen dennoch wirtschaftliche, soziale und, wie dieses Buch zeigt, ökologische Konsequenzen, die sie mit anderen Grenzen vergleichbar macht.28 Zudem war die Grenze das Produkt der Neugründung zweier konkurrierender Staaten. Beide waren bemüht, das ihnen durch den Kriegsausgang zugewiesene Territorium zu vereinnahmen und durch administrative, wirtschaftliche, infrastrukturelle und symbolische Aneignung des Raums und der dort lebenden Menschen zu durchdringen.29 Die Formen dieser Vereinnahmung wandelten sich im Laufe der Zeit und jene der Bundesrepublik unterschieden sich von denen der DDR. Die DDR-Führung stellte ihren politischen Handlungsraum letztlich unter Rekurs auf Gewalt her, indem sie die eigenen Bürger daran hinderte, sich ihrer Herrschaft durch Migration zu entziehen. Aber auch die Bundesrepublik war auf Territorialität bedacht und suchte ihr Staatsgebiet »bis an den letzten Zentimeter«, wie es der SPD-Politiker Herbert Wehner 1952 ausdrückte, zu erschließen.30 Die Entstehung des Zonenrandgebiets ist dafür beredtes Beispiel.
Dieses Buch ist nicht rein chronologisch angelegt, sondern gliedert sich in thematische Kapitel. Es betont die Bedeutung der innerdeutschen Grenze für die alte Bundesrepublik und erfasst die grenzbedingten Wechselwirkungen zwischen West und Ost. Zwei Kapitel betrachten die wirtschaftlichen Folgen der innerdeutschen Grenze für die Bundesrepublik. Aus dieser Perspektive zeigt sich, dass das Zonenrandgebiet sich aufgrund wirtschaftlicher Prozesse überhaupt erst als räumliche Einheit formierte, nicht zuletzt dank der geschickten Lobbyarbeit von Vertretern der lokalen Politik und Wirtschaft. Die Entstehung des Zonenrandgebiets war dabei Teil eines umfassenderen Prozesses, in dem sich die Bundesrepublik an die neue Wirtschaftsgeografie der Nachkriegszeit anpasste. In einem weiteren Kapitel wird das Phänomen des Grenztourismus untersucht, wobei der Eiserne Vorhang selbst als »Sehenswürdigkeit« fungierte. Grenzfahrten boten den westdeutschen Besuchern die Möglichkeit, die globalen Entwicklungen des Kalten Krieges durch lokale Aktivität erfahrbar zu machen. Was in den frühen 1950er Jahren als Schaulust begann, wurde nach dem Mauerbau von staatlicher Seite in politische Bildung umgemünzt und prägte westdeutsche Sichtweisen auf die Grenze.
Drei Kapitel befassen sich mit Umweltthemen. Die grenzüberschreitende Umweltverschmutzung avancierte in den 1970er Jahren zu einem neuen Aspekt in den bereits komplexen innerdeutschen Beziehungen. Der massive Anstieg der Verschmutzung ging auf den wachsenden Verschleiß der ostdeutschen Industrie und Infrastruktur zurück und kündigte so gesehen den Zusammenbruch der DDR an. Allerdings erkannten die Verantwortlichen in der Bundesrepublik diese Zusammenhänge nicht und verhandelten weiter mit der DDR, als gäbe es auf östlicher Seite noch die Möglichkeit, Verhandlungsergebnisse (so spärlich diese ohnehin waren) überhaupt umzusetzen. Gleichzeitig fiel der Grenzstreifen Naturschützern erstmals durch seinen Artenreichtum auf. Vögel, Lurche und Pflanzen, die in der industrialisierten Agrarlandschaft selten geworden waren, konnte man entlang der innerdeutschen Grenze noch antreffen. So befasst sich ein weiteres Kapitel mit dem ökologischen »Fußabdruck« des Grenzregimes und seinen Folgen für Landschaft, Tiere und Menschen. Es historisiert gleichsam das »Grüne Band«, ein Naturschutzprojekt der Nachwendezeit. Schließlich greift ein letztes Kapitel die Kontroverse um die Standortentscheidung für ein »nukleares Entsorgungszentrum« in Gorleben auf. In der Gemeinde an der Elbe wollte die Bundesrepublik den nuklearen Brennstoffkreislauf schließen. Die unmittelbare Nähe Gorlebens zur innerdeutschen Grenze formte die Standortkontroverse auf allen Ebenen. Zusammen bilden diese drei Kapitel die erste Umweltgeschichte der innerdeutschen Grenze.
Obwohl dieses Buch den Blick bewusst auf die westlichen Grenzregionen lenkt, ist es dennoch tief in der Geschichtsschreibung sowohl der Bundesrepublik als auch der DDR verwurzelt. Seine Ergebnisse stützen sich auf Recherchen in neunzehn Archiven mit Materialien aus beiden deutschen Staaten. Ich habe zudem private Sammlungen, zeitgenössische Zeitungen und Zeitschriften, Regierungspublikationen sowie Ephemera wie Flugblätter, Broschüren und Postkarten mit herangezogen. Letztere konnte ich oft auf Internetauktionen erwerben, wo Memorabilien zum Eisernen Vorhang nach wie vor angepriesen werden.31 Interviews und Korrespondenzen mit Zeitzeugen runden die Quellenbasis ab.
Mir war es zudem wichtig, die jeweiligen Perspektiven auf die innerdeutsche Grenze, die ich in diesem Buch eröffne, über die Zäsur von 1990 hinaus zu entwickeln und so die »lange« Nachkriegszeit mit den Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung zusammen zu denken. Nach wie vor bleiben viele zeitgeschichtliche Studien dem Zeitraum von 1945 bis 1990 verhaftet, während die Forschung zur Wiedervereinigung nicht frei von einer Jahrestagskonjunktur ist.32 Vielversprechend ist die Wiederaufnahme der Transformationsforschung, die zeitlich im Spätsozialismus ansetzt und zumindest die erste Dekade des wiedervereinigten Deutschlands mit erfasst, dabei freilich die Vorstellung einer »Transformation« zu oft allein auf Ostdeutschland anwendet, ohne auch nach den Folgen der Wiedervereinigung für die alte Bundesrepublik zu fragen.33 In jedem Fall erscheint es mir gut dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung immer weniger gerechtfertigt, das Jahr 1990 als End- oder Ausgangspunkt historischer Darstellungen zu akzeptieren,34 und ich versuche in diesem Buch aufzuzeigen, wie man über diese Zäsur hinwegschreiben kann.
Ich bin auf der westlichen Seite der innerdeutschen Grenze aufgewachsen. Geboren in den frühen 1970er Jahren in einer niedersächsischen Gemeinde, war es für mich »normal«, dass die Landstraßen eine halbe Stunde weiter östlich endeten. Auf dem Schulweg kam ich täglich an unserem Kleinstadtbahnhof vorbei, wo regelmäßig NATO-Militärfahrzeuge darauf warteten, auf Güterzüge verladen zu werden. Ich schlängelte mich zwischen Panzern, Lastern und Kübelwagen hindurch, auf denen holländische, französische oder britische Fahnen prangten. Bei einem Ausflug in den lokalen Forst stolperte ich einmal regelrecht in einen getarnten Unterstand. Junge Rekruten mit geschwärzten Gesichtern und Grünzeug auf dem Helm hoben die Köpfe und signalisierten mir, dass ich in ihrem Manöver nichts zu suchen habe. Mitte der 1980er Jahre hatte meine Gesamtschule französische Austauschschüler zu Besuch – aus Paris! Was hatten wir Landeier diesen Teenagern aus Paris zu bieten, die uns beim Gegenbesuch sicherlich zum Louvre, auf den Eiffelturm und nach Versailles führen würden? Uns blieb fast nichts anderes übrig, als sie zum Eisernen Vorhang mitzunehmen, dem Ort, an dem unsere ländliche Region plötzlich einen Hauch von Weltpolitik verströmte. Oft fuhr ich auch mit meiner Familie auf Besuch in die DDR. Wenn meine Brüder mit den entfernten Cousins ihre militärische Ausbildung verglichen, scherzten sie gern darüber, wer zuerst den Stützpunkt des anderen erreichen würde. Ein gewisser Fatalismus war uns zu eigen – gut möglich, dass »die Russen kommen« oder ein nuklearer Sprengkopf im Grenzgebiet herniederging, wo jeder Gully auch ein Sprengschacht war.35 Dieses Buch ist also auch mein Versuch, die Absurditäten zu verstehen, mit denen ich aufgewachsen bin, und warum ich sie damals nicht absurd fand.
1 Die Entstehung des westdeutschen Grenzlandes
Im tiefsten Winter des Jahres 1957 reiste die Journalistin Barbara Klie nach Oberfranken. Die eisigen Winterwinde aus Böhmen hatten der Region den Spitznamen »Bayerisch-Sibirien« eingetragen. Sie galt einst als geschäftiges Handelszentrum mit einer florierenden Textil-, Porzellan- und Bierindustrie, jetzt lag sie direkt am Eisernen Vorhang. Klie war beauftragt, den Menschen im Grenzland zwischen Hof und Travemünde auf den Puls zu fühlen. In ihren daraus entstandenen Reportagen für die protestantische Wochenzeitung Christ und Welt bestätigte sie die einschlägigen Vorstellungen über die Grenzregionen, die sich bis Mitte der 1950er Jahre in Westdeutschland etabliert hatten: Es war eine Gegend, »wo alle Straßen enden«, wo die Äcker auf der anderen Seite unbestellt blieben und von wo die Menschen fortzogen, sodass sie sich allmählich entvölkerte.1 Das Grenzland entlang des Eisernen Vorhangs, es galt als Ende des Westens, als letzter Vorposten der Freiheit und als trostloser und unterentwickelter Landstrich – das Armenhaus der ansonsten prosperierenden Bundesrepublik.2
Klie begegnete einer Bevölkerung, die nicht recht wusste, wem sie sich zugehörig fühlen sollte. Die Bewohner der Grenzregionen meinten sich von ihren Landsleuten vergessen. Der Bürgermeister einer Kleinstadt erklärte ihr, wie seine Mitbürger ihr Verhältnis zu dem Land sahen, in dem sie lebten. »Ist es Ihnen aufgefallen, wie unsere Leute hier sprechen?«, fragte er. »Wenn sie von Frankfurt und Essen sprechen, dann sprechen sie von ›Westdeutschland‹ – so als ob wir nicht auch Westdeutschland wären, sondern in der Zone lägen. Wenn sie ›Drüben‹ sagen, dann meinen sie nicht die Zone, sondern sie meinen das reiche westliche Deutschland hinter den Bergen, das uns so wenig von seinem Reichtum zu kosten gibt.«3 Es schien der Bevölkerung, als wolle das neue Land zwischen Rhein und Elbe sie materiell ausgrenzen. So entfremdet fühlten sich einige von ihnen, dass die DDR – obwohl abwertend als »Zone« bezeichnet – zu einer möglichen Alternative für ihr Zugehörigkeitsgefühl wurde.
Die junge Bundesrepublik hatte an ihrer östlichen Peripherie ein Problem. Seit Ende der 1940er Jahre entstand durch den Eisernen Vorhang ein Grenzland, wo es bis dahin keines gegeben hatte. In den frühen 1950er Jahren lebten in den Landkreisen entlang der neu gezogenen innerdeutschen Grenze noch Hunderttausende deutscher Flüchtlinge, die nach Kriegsende aus Ost- und Mitteleuropa vertrieben worden waren.4 Dazu kam eine große Anzahl Zuwanderer aus Ostdeutschland. Mit beiden Gruppen konkurrierten die Alteingesessenen um knappe Ressourcen, und die Umwandlung ihrer Heimat in ein Grenzgebiet brachte weitere Verunsicherung mit sich. Örtliche Amtsträger warnten bald, die wirtschaftliche Not der Alteingesessenen und der mittellosen Neuankömmlinge könnte zu politischer Instabilität führen, eine Situation, die dem sozialistischen Nachbarn jenseits der Grenze nur allzu recht käme. In dieser frühen Phase des Kalten Krieges formte sich in Westdeutschland die Ansicht, dass man sich einen solchen Schwebezustand und schwankende Loyalitäten unter den Anrainern dieser sensiblen Grenze nicht leisten könne. Aus diesem Grund begann 1953 die Planung eines wirtschaftlichen Hilfsprogramms. Es war darauf ausgerichtet, die Folgen der deutschen Teilung vor Ort zu kompensieren und die Grenzgebiete finanziell zu stützen, um ihren Bewohnern das Gefühl zu geben, dass auch sie am wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes teilhaben konnten.
Die Entstehung der westdeutschen Grenzregionen als sogenannte Zonenrandgebiete war vor allem die Folge agiler Interessenpolitik derer, die von den wirtschaftlichen Folgen der Grenze negativ betroffen waren. Die Demarkationslinien zwischen den militärischen Besatzungszonen stellten zwangsläufig ein Hindernis für den Fluss von Arbeitskräften, Zulieferungen und Handelswaren dar. Sie behinderten das ausgeklügelte System interregionaler Arbeitsteilung, das die deutsche Wirtschaft Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmte.5 Je nach örtlichem Profil entwickelten Städte und Kreise spezifische Defizite in ihrer Wirtschaftsstruktur. Zeitweise gelang es den Grenzanwohnern, aus den neuen Bedingungen Nutzen zu ziehen, doch war dies meist nur von kurzer Dauer. Besonders destabilisierend wirkte sich die Währungsreform von Juni 1948 im Grenzland aus. Die Einführung der D-Mark schuf entlang der Demarkationslinie einen Währungsdualismus, der eine Schattenwirtschaft aus Schmuggel und Niedriglohnarbeit beförderte. Während die Währungsreform für die industriellen Zentren im Westen des Landes den Startschuss für Wiederaufbau und wirtschaftlichen Aufschwung gab, wirkte sich das »Wirtschaftswunder« im Grenzland zuerst nachteilig aus. Denn als an Rhein und Ruhr die Motoren des ökonomischen Aufschwungs auf Touren kamen, zogen sie Kapital, Firmen und Arbeitskräfte aus den grenznahen Regionen ab: Bevor die westdeutsche Industrie Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben begann, lag das Arbeitskräftereservoir der Bundesrepublik im Grenzland. Von hier aus wanderten Vertriebene und Flüchtlinge in die Industrieregionen im Westen des Landes ab.6 Als die grenznahen Landkreise Fachkräfte und sogar ganze Betriebe durch Umsiedlungsangebote verloren, empfanden die Bewohner der Grenzgebiete das Wirtschaftswachstum im Westen bald als »Beschuss von der eigenen Seite«.
Die Grenzlandkreise – bezeichnenderweise zunächst vertreten durch die regionalen Industrie- und Handelskammern – reagierten darauf, indem sie bei der neu gebildeten Bundesregierung um ein umfassendes Hilfspaket ersuchten, das die negativen Folgen der Grenze für ihre Standorte ausgleichen sollte. Freilich litten nach dem Krieg nicht nur die Grenzregionen unter Entbehrungen. In einem Land, das Kriegszerstörungen und massive Bevölkerungsverschiebungen verarbeiten musste, konnte fast jeder Landstrich für sich in Anspruch nehmen, ein Not leidendes Gebiet zu sein.7 Angesichts der Konkurrenz um staatliche Ressourcen erforderte das Eintreten für die Belange der Grenzregionen ein systematisches Vorgehen. Im Zuge dieser Interessenpolitik formierte sich das Grenzland zu einer erkennbaren räumlichen Einheit, die bald einen eigenen Namen erhielt: das »Zonenrandgebiet«. Um sich von anderen Regionen abzuheben, verlegten sich die Grenzlandfürsprecher darauf, ihr Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben: die Grenze zum ideologischen Gegner des Kalten Krieges. Auch andere Regionen mochten wirtschaftliche Probleme haben, so ihre Argumentationslinie, jene entlang der Grenze aber habe die kommunistische Aggression verursacht. Der Antikommunismus der frühen Bundesrepublik bot den Fürsprechern des Grenzlandes eine geeignete Rhetorik und Bildsprache, um ihrem Anliegen die nötige politische Aufmerksamkeit zu sichern. Sie trugen mit dazu bei, die Demarkationslinie auf der mentalen Landkarte ihrer Landsleute zu fixieren, noch bevor die ostdeutschen Behörden das Grenzregime verschärften und die Übergänge im Mai 1952 abriegelten. Als kurz vor der Bundestagswahl 1953 aus wahltaktischen Gründen ein erstes Hilfspaket zustande kam, waren es die Vertreter der Grenzregionen selbst, die die räumliche Dimension des Grenzlandes definierten. Ein 40 Kilometer breiter Streifen von der Ostsee im Norden bis zum Bayerischen Wald im Süden sollte in den Genuss staatlicher Förderung kommen. Zusammen mit der Hilfe für West-Berlin wurde die Zonenrandförderung zum langlebigsten regionalen Hilfsprogramm in der Geschichte Westdeutschlands. Damit wurden fast 20 Prozent des Staatsgebiets der alten Bundesrepublik als ein vom Kalten Krieg geschaffener Raum anerkannt.
Wirtschaftsleben mit Demarkationslinien
Deutschlands neue Grenzen waren eine Folge des Zweiten Weltkrieges und wurden von den Alliierten auf den Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam ausgehandelt. Nachdem die alliierten Truppen Deutschland im Frühjahr 1945 besetzt hatten, versuchten die örtlichen Befehlshaber oft in letzter Minute noch, Abgleichungen ihrer Grenzverläufe zu erreichen, etwa wenn es um die Einbeziehung eines abgelegenen Dorfs oder eine wichtige Straßenverbindung ging.8 Am 1. Juli 1945 zogen sich die amerikanischen, sowjetischen und britischen Truppen in ihre jeweiligen Zone zurück, während der »späte Sieger« Frankreich ein aus der amerikanischen und der britischen Zone herausgelöstes Gebiet im Südwesten Deutschlands zugesprochen bekam. Bis zur Fusion der amerikanischen und der britischen Zone in eine Bizone (Januar 1947) und deren Erweiterung durch den französischen Beitritt zur Trizone (März 1948) leiteten die alliierten Militärgouverneure die Wirtschaft ihrer jeweiligen Besatzungszone nach eigenem Ermessen. Die auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 vereinbarte Absicht, das besetzte Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu behandeln, ließ sich zu keinem Zeitpunkt umsetzen.
Davon abgesehen, wurde die wirtschaftliche Aktivität in der unmittelbaren Nachkriegszeit wesentlich durch die zerstörten Verkehrswege, die in alle Winde zerstreuten Arbeitskräfte, die Nahrungsmittelknappheit und die Demarkationslinien behindert.9 Da die Besatzungsmächte die Schnittstellen ihrer Besatzungszonen nicht einfach als Verwaltungsgrenzen behandelten, sondern sie auch überwachten, kamen sie im Alltag bald politischen Grenzen gleich und warfen praktische Probleme auf, die aufwendig verhandelt werden mussten. Alltäglichkeiten wie der Weg zur Arbeit konnten zu einem »interzonalen« Vorgang werden und mussten vom Alliierten Kontrollrat geregelt werden. Wo immer möglich, versuchte die Ortsbevölkerung derartig sperrige Vorschriften zu ignorieren.10
Handelswaren, die für einen Ort außerhalb der Zone des Produzenten bestimmt waren, galten auf einmal als Exportgüter.11 Ein legaler Interzonenhandel war zunächst unmöglich und wurde, nachdem sich der Alliierte Kontrollrat damit befasst hatte, umfangreich reglementiert und mit zunehmenden politischen Spannungen zwischen den Besatzungsmächten immer weiter instrumentalisiert. Selbst Unternehmen, die die begehrten Warenbegleitpapiere ergattern konnten, wurden mitunter mit unvorhersehbaren Vorwänden abgewiesen. Da einzelne Firmen kaum in der Lage waren, sämtliche bürokratischen Hürden zu überspringen, schlossen die neu gegründeten Länder und sogar einige Städte miteinander Tauschhandelsabkommen: Bayern belieferte Sachsen mit Rindfleisch und erhielt von dort Saatkartoffeln, Lübeck exportierte Kochgeschirr und Pferde nach Mecklenburg und bekam im Gegenzug Holz und Stroh.12 Zeitgenössische Kommentatoren fühlten sich angesichts der wirtschaftlichen Rückentwicklung an die Zeit vor dem Zollverein von 1834 erinnert.13
Da ein legaler Handelsverkehr nahezu ausgeschlossen war, verlegten sich die Deutschen auf Schmuggel und Schwarzmarkt. Der Umfang des illegalen Handels war mindestens doppelt so groß wie der des legalen.14 Viele hatten aus den letzten Kriegsjahren noch reichlich Erfahrung mit den Finessen einer Schattenwirtschaft. Der Schwarzmarkt wurde zu einem Kennzeichen der deutschen Trümmergesellschaft und blühte vor allem entlang der Demarkationslinien, an den deutschen Außengrenzen und zwischen den vier Sektoren Berlins.15 Ungleich verteilte wirtschaftliche Chancen entlang politischer Grenzen haben schon immer umtriebige Menschen angezogen. »Man kann an der Grenze von der Grenze leben«, berichtete der Leiter einer Herberge in Schöningen bei Helmstedt westlich der sowjetischen Demarkationslinie, der Schmugglern und anderen Grenzgängern Betten zur Verfügung stellte. Das spezielle Schmuggelgut im Umland von Schöningen war Hering. Händler aus Sachsen schafften Naturalien nach Bremen und Bremerhaven und deckten sich dort mit dem Fisch ein. Zurück in Sachsen, brachte sein Verkauf genügend Geld und neue Tauschwaren für die nächste Reise ein. Die Zugverbindung über Schöningen wurde wegen des Geruchs in den Waggons als »Heringsbahn« bekannt.16 Solange aus dem Schmuggel und dem Hamstern keine professionelle »Schieberei« wurde, betrachteten alle Beteiligten die Sache durchaus verständnisvoll: ein Ärgernis vielleicht, aber auch eine Frage des Überlebens.17
Die Nachkriegsdeutschen lernten schnell, dass keine ihrer Binnen- und Außengrenzen der anderen glich. Die Demarkationslinien zwischen der britischen, amerikanischen und französischen Zone verschwanden im Frühjahr 1948. Es entstand ein Gebilde, das von den Deutschen als »Trizonien« bezeichnet wurde. Die von Frankreich und der Sowjetunion kontrollierten Demarkationslinien blieben jedoch Konfliktherde, und jene zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz wurde schnell zu einer streng überwachten Grenze mit 1200 Zollbeamten, die nach Schmuggelware fahndeten und Personen ohne Ausweispapiere die Einreise verweigerten. Diese Grenze beeinträchtigte das wirtschaftliche Gefüge der Region und schnitt Produktionsstätten von Zulieferern und Märkten ab. Damit bezweckte Frankreich, das Saarland aus dem deutschen Territorium herauszulösen und es dem eigenen Staatsgebiet anzugliedern. Allerdings verhinderten Briten und Amerikaner diesen Plan, sodass das Saarland nach rund zwölf Jahren Zugehörigkeit zum französischen Wirtschaftsraum 1959 der Bundesrepublik beitrat.18
Das Dreiländereck westlich von Aachen war eine weitere berüchtigte Nachkriegsgrenze und wurde als Hochburg des Schmuggels bekannt. Zwischen 1945 und 1953 gelangten durch dieses »Loch im Westen« Tausende Tonnen Kaffee und andere Waren aus Belgien und den Niederlanden heimlich über die Grenze. Jede dritte Tasse Kaffee im Rheinland wurde mit geschmuggelten Bohnen gebrüht, bis die Bonner Regierung 1953 die Kaffeesteuer senkte und damit dem profitablen Handel ein jähes Ende bereitete. Bis dahin aber blieb das Schlüpfen durch das Loch im Westen eine lukrative, wenngleich gefährliche Unternehmung. Deutsche Zollbeamte töteten bei Schießereien mehr als 50 Schmuggler. Dennoch hatten die Rheinländer nicht die Absicht, den Schmuggel über den ehemaligen Westwall zu kriminalisieren, nicht zuletzt, weil er ihnen selbst zugutekam.19
Während die Lage an allen Demarkationslinien ungewiss blieb, erschien Beobachtern jene zur sowjetischen Besatzungszone von Anfang an anders gelagert. Der Journalist Josef Müller-Marein bereiste Ende 1948 die Grenzen der Trizone und veröffentlichte seine Eindrücke in der Wochenzeitung Die Zeit. Darin schilderte er die östliche Demarkationslinie in emotionsgeladenen Worten. Seine Vergangenheit als Nazi-Propagandist mag seine Wortwahl beeinflusst haben, als er behauptete, dass diese Linie »den Lebensraum eines Volkes durchschneidet«. Hier würden »zwei Weltanschauungen, zwei Lebensformen« aufeinanderprallen und eine »Grenze des Misstrauens quer durch Deutschland« bilden. Müller-Marein berichtete von Mord und Totschlag durch russische Wachposten, die auf Grenzgänger schossen, und von Schleusern, die ihre Schutzbefohlenen eher ausraubten und ermordeten, statt sie sicher auf die andere Seite zu bringen. Die Demarkationslinie entlang der sowjetischen Zone, so Müller-Marein, färbe auf die Menschen auf beiden Seiten ab. Schon 1948 meinte er festzustellen, die Zonengrenze habe »neue Typen unter den Deutschen geschaffen … östliche und westliche Typen«. Die Ostdeutschen würden sich von den Westdeutschen im Stich gelassen fühlen, während die Westdeutschen versuchten, die Ostdeutschen abzuwehren, wo es nur ging.20 Sein Fazit: »Im Westen ist es der Schmuggel, der Trizonien gefährdet … im Osten ist es der ständig wachsende Flüchtlingsstrom.«21 Der Westen verkörpere die Hoffnung, der Osten die Angst.22 Aus dem Westen würden die Menschen dringend benötigte Güter schmuggeln, aus dem Osten nur sich selbst. Anders als die übrigen Grenzen Trizoniens begann die sowjetische Demarkationslinie, Unterschiede zwischen den Deutschen hervorzubringen.
Zwei Ereignisse trugen wesentlich zur wachsenden Divergenz zwischen der Trizone und der sowjetischen Zone sowie einer grundlegenden Veränderung der Spielregeln des legalen und illegalen Handels an dieser Demarkationslinie bei: die Währungsreform vom Juni 1948 und die Blockade West-Berlins durch die Sowjetunion. Die sowjetischen Behörden hatten bereits vor Einführung der D-Mark die Grenzsicherung erhöht und den Verkehr auf den Transitstrecken behindert. Dies setzten sie auch nach der offiziellen Beendigung der Berlin-Blockade im Mai 1949 fort.23 Als die Westalliierten im Juni 1948 in den drei Westzonen die wertlose Reichsmark durch die neue D-Mark ersetzten, konterten die Sowjets, indem sie zunächst den gesamten Eisenbahntransport nach West-Berlin und anschließend auch alle Straßen und Wasserwege blockierten.24 Zur Bestürzung der westdeutschen Handelsbehörden antworteten die westlichen Alliierten im Juli 1948 mit einer weniger bekannten Gegenblockade. Beginnend mit Kohle und Stahl, kamen alle Lieferungen aus den Westzonen in die Ostzone zum Erliegen.25 Wer die schwer zu erlangenden Genehmigungen für den Versand von Waren in die sowjetische Zone erhalten hatte, musste nun feststellen, dass sie null und nichtig waren. So teilte die Braunschweiger Handelskammer ihren Mitgliedern mit, es sei sinnlos, die Ausfuhr von Waren überhaupt zu versuchen.26 Lieferungen aus der Sowjetzone an Empfänger im Westen und der Tauschhandel mit ihnen wurden ebenfalls unterbunden. Der Interzonenhandel, der in der ersten Hälfte des Jahres 1948 einen Aufschwung erlebt hatte, brach drastisch ein.27 Das Wechselspiel von Blockade und Gegenblockade hatte verheerende Auswirkungen für das Wirtschaftsgeflecht entlang der Demarkationslinie.
Zwar glich der illegale Handel einen Teil des Vakuums aus, aber das damit verbundene Risiko hatte sich erhöht. Es begann eine heikle Phase des Währungsdualismus, die von den Verlockungen der westlichen D-Mark geprägt war. Als die Sowjets Mitte 1948 die Demarkationslinie abriegelten, taten sie dies auch, um zu verhindern, dass Ostdeutschland von der dort noch im Umlauf befindlichen, inzwischen aber wertlosen Reichsmark überflutet wurde.28 Die Folge war eine grundlegende Änderung der Dynamik entlang der Demarkationslinie.
Trotz eines sprunghaften Anstiegs der Arbeitslosigkeit legte die Einführung der D-Mark den Grundstein für den Wirtschaftsaufschwung im Westen.29 Im Einzelhandel wanderten lange gehortete Waren und Lebensmittel aus dem Schattenmarkt in die Geschäfte. Die Westdeutschen, die dieses neue Geld ihr Eigen nannten, hatten es von da an kaum mehr nötig, sich auf dem Schwarzmarkt zu versorgen. Kleinere Tauschgeschäfte – Seidenstrümpfe aus dem Osten gegen Heringe aus dem Westen – brachen zusammen. Der grenzüberschreitende Schmuggel hingegen nahm exponentiell zu und wurde nun vorwiegend von Osten aus betrieben. Durch den Verkauf von Waren im Westen konnte man nicht nur Einnahmen in D-Mark erzielen, sondern beim Umtausch in Ostmark auch einen Kursgewinn abschöpfen.30 Allerdings wurde der Schmuggel nun zunehmend als Geschäftemacherei kriminalisiert, ein Stigma, das nun vor allem Ostdeutsche traf, obwohl auch Westdeutsche in solche Transaktionen verwickelt waren oder davon profitierten.31
Eine Praxis, die als Grenzgängertum bezeichnet wurde, nahm ebenfalls zu: Arbeiter mit Wohnsitz auf der östlichen Seite überquerten ohne Passierschein die Grenze und akzeptierten selbst Niedriglöhne, solange sie nur in der begehrten Westwährung bezahlt wurden. Sowohl die westlichen als auch die östlichen Behörden versuchten, das Grenzgängertum zu unterbinden, zuweilen in harmonischer Zusammenarbeit. Die westlichen Stellen bekämpften diese Praxis, weil sie den ohnehin schon angespannten Arbeitsmarkt in den grenznahen Landkreisen weiter belastete und die Verdienstmöglichkeiten ortsansässiger Arbeitskräfte schmälerte. Abgesehen davon konnten Beschäftigte aus dem Westen, die in umgekehrte Richtung pendelten, nicht von ihren Ostlöhnen leben und drängten daher auf Ausgleichszahlungen von westlichen Stellen.32
Die östlichen Behörden hingegen bekämpften das Grenzgängertum, weil es die Schwäche der Ostwährung und damit der sozialistischen Wirtschaft verdeutlichte. Sie stigmatisierten die Grenzgänger als »Schmarotzer«, weil sie in einer subventionierten sozialistischen Wirtschaft von kapitalistischem Geld lebten.33 Unter den Schmugglern und Grenzgängern befand sich auch eine beträchtliche Zahl von Migranten, die ihre Übersiedung auf die westliche Seite planten. Die Währungsreform gab der Abwanderung aus dem Osten, die bereits nach Kriegsende eingesetzt hatte, einen zusätzlichen Schub. Bezeichnenderweise verweigerten die zuständigen Behörden diesen Zuwanderern die Anerkennung als »echte Flüchtlinge« und warfen ihnen vor, aus rein wirtschaftlichen Gründen zu kommen.34
Seit ihrer Einführung im Sommer 1945 war die Demarkationslinie von beiden Seiten missachtet worden, doch nach der Währungsreform wurde es für Menschen aus dem Osten ungleich dringlicher, sie zu überschreiten. Angesichts der Begehrlichkeiten, die die neue Währung jenseits der Grenze weckte, verhielten sich die Deutschen im Westen zunehmend protektionistisch, wenn es um »ihre« heimische Wirtschaft ging. Plötzlich waren es westliche Polizisten und Zollbeamte sowie britische und amerikanische Militärangehörige, die die Grenzkontrollen verstärkten und Sperren errichteten, um den Schmuggel einzudämmen und die Gegenblockade durchzusetzen.35 Müller-Mareins Beobachtung, dass die Grenze »Ost- und Westtypen« von Deutschen hervorbrachte, wird von der Historikerin Edith Sheffer bestätigt: »Westler erwarteten bereits, dass die Menschen im Osten bedürftig erschienen, und die Ostler waren sich dessen durchaus bewusst.« Die ersten Ost-West-Stereotypen entstanden »nicht nur infolge von Ideologie, sondern auch aufgrund materieller Ungleichheit«.36 Die Währungsreform von 1948 stellt den Moment dar, in dem sich die östliche Demarkationslinie in eine »DMark-ationslinie« verwandelte. Erst die zunehmende wirtschaftliche Asymmetrie machte sie zu einer Grenze.37 Dies war auch der Moment, in dem der Westen zum »goldenen Westen« wurde.
Die Demarkationslinie und die örtliche Wirtschaft
Je nach Wirtschaftsprofil durchliefen die Städte und Gemeinden auf der Westseite der Demarkationslinie unterschiedliche Entwicklungen. Während etwa die Hafenstadt Lübeck auf den Ostseehandel spezialisiert war, stellte Hof ein Zentrum der Textilindustrie dar. Vor dem Krieg hatte zwischen den Gebieten, die später zu West- und Ostdeutschland wurden, ein Warenaustausch von beträchtlichem Umfang stattgefunden: Im Jahr 1936 hatte der westliche Teil 36,5 Prozent seiner Produkte in das künftige Ostdeutschland geliefert und 39,9 Prozent seiner Waren von dort bezogen.38 Die Grenze unterbrach nicht nur die Handelswege, sie teilte auch die Braunkohlefelder bei Helmstedt sowie die Kali- und Schiefervorkommen entlang der Werra zwischen Hessen und Thüringen. Und über viele Kilometer verlief die Demarkationslinie durch rein ländliche Regionen, wo sie Bauern von ihren Feldern trennte.39 Vor allem die Mittelgebirge wie der Harz, die Rhön und der Bayerische Wald galten schon lange als wirtschaftlich schwach und randständig.40 Bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa dem Silber- und Erzbergbau im Harz, hatte in diesen Landstrichen kaum eine Industrialisierung stattgefunden, die über das Niveau von Hausindustrie hinausging. Wenngleich die Lage solcher ohnehin strukturschwachen Regionen durch die Demarkationslinie nicht einfacher wurde, war die Grenze zu keinem Zeitpunkt die Ursache der schwachen lokalen Wirtschaft. Die folgenden Momentaufnahmen von Städten, Kreisen und Gemeinden entlang der innerdeutschen Grenze vermitteln einen Eindruck ihrer wirtschaftlichen Heterogenität und zeigen die Bandbreite ihrer Probleme auf.
Lübeck
Die Architektur Lübecks lässt noch heute erahnen, welchen Reichtum diese alte Hansestadt dank ihres seit dem Mittelalter florierenden Handels einst genoss. Thomas Mann hat in seinem Roman Buddenbrooks Fluch und Segen dieses Wohlstands literarisch verewigt. Vor 1945 war Lübeck ein bedeutender Ostseehafen für den Umschlag von Wein, Getreide, Holz, Fisch, Salz, Erz, Altmetall und Arzneimitteln gewesen. Über die Ostsee hinweg bestanden Handelsbeziehungen zu Häfen in Skandinavien, Russland, Polen und den heutigen baltischen Ländern Lettland, Litauen und Estland. Obwohl Waren aus Lübeck über ein Netz aus Flüssen und Kanälen bis weit in den Süden Deutschlands gelangten, war Lübeck vor allem auf Nordeuropa ausgerichtet. Im 20. Jahrhundert hatte die Stadt als Handelsplatz etliche Rückschläge zu verkraften, die ihre Reichweite stark einschränkten. So wurde sie 1913 in ihrem Kerngeschäft, dem Ostseehandel, von Hamburg übertrumpft, nachdem der 1895 eröffnete Nord-Ostsee-Kanal Hamburg Zugang zu Lübecks Heimatgewässern verschafft hatte. Zwar traf die im Ersten Weltkrieg von den Alliierten verhängte Blockade alle deutschen Häfen, doch nach der Russischen Revolution ging der Handel mit Russland und den baltischen Hafenstädten massiv zurück, was sich auf Lübeck besonders negativ auswirkte. Anschließend litt das Großhandelsgeschäft unter der Weltwirtschaftskrise, und erst 1938 erreichte Lübeck wieder das Handelsvolumen der Zeit vor 1914. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt vom sechsten auf den zehnten Platz unter den Ostseehäfen zurückgefallen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war der Lübecker Hafen nur noch von regionaler Bedeutung. Immerhin hatte die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den allmählichen Niedergang als Handelsplatz wettgemacht: Im Jahr 1907 stellten Schiffbau, produzierendes Gewerbe und verarbeitende Industrie fast 60 Prozent aller Arbeitsplätze. Lübeck wandelte sich von einer Hafen- zu einer Industriestadt, wenn auch nur zu einer provinziellen.41
Die innerdeutsche Grenze leitete ein neues Kapitel in Lübecks Sinkflug ein. Anfang der 1950er Jahre zeichnete die Lübecker Handelskammer ein düsteres Bild von den Auswirkungen der Grenze auf ihren Bezirk.42 Alle Branchen hatten ihre traditionellen Einzugsgebiete verloren: Bedeutende Ostseehäfen rückten in den Einflussbereich der Sowjetunion, sodass die skandinavischen Häfen zu Lübecks primären Handelspartnern wurden. Der wirtschaftliche Rückgang erfasste nicht allein den Ostseehandel, er brachte auch davon abhängige Betriebe wie Werften in Not und schränkte den Handlungsradius von Schiffsagenten ein. Nicht nur der internationale Handelsverkehr schrumpfte, sondern auch Lübecks Rolle als Binnenhafen. Der Elbe-Lübeck-Kanal, den die Stadt im Jahr 1900 auf eigene Kosten fertiggestellt hatte, um sich der Konkurrenz durch den Nord-Ostsee-Kanal zu erwehren, verband sie mit Lauenburg an der Elbe. Doch seit die Elbe östlich von Lauenburg hinter dem Eisernen Vorhang verschwand, verlor der Kanal als Zulieferungsweg an Bedeutung. Mit erheblichem finanziellen Aufwand musste die Lübecker Industrie einen Großteil ihrer ein- und ausgehenden Güter von der Binnenschifffahrt auf die Schiene verlagern.43
Zudem hatte der Lübecker Großhandel bedeutende Märkte in Mecklenburg, Vorpommern und darüber hinaus verloren. Nach Aufhebung der Berlin-Blockade hofften die Lübecker Handelsfirmen kurzzeitig, ihre Beziehungen zu den Kaufleuten auf der anderen Seite wiederaufnehmen zu können. Doch sie mussten feststellen, dass die Interzonenverbindungen nach wie vor unbeständig und die ehemaligen Geschäftspartner in ihren Entscheidungen nicht mehr frei waren.44 In der Folge ging beispielsweise das Geschäft mit Wein, ein typisches Lübecker Handelsgut, um 50 Prozent, bei einigen Großhändlern sogar um 80 Prozent zurück. Die Bemühungen, neue Märkte zu erschließen, zahlten sich nur bei wenigen Waren aus, zumal solche Versuche größtenteils von Händlern in Süd- und Westdeutschland abgeblockt wurden, die sich nun für Lübecks früheren Protektionismus revanchierten.45 Die schleswig-holsteinische Landesregierung sah sich veranlasst, Lübecks Situation mit der von Triest und Hongkong zu vergleichen. Über die Wirtschaft der Hansestadt sei eine regelrechte »Blockade« verhängt worden.46 Wie nach einem Schlaganfall sei die Stadt »sozusagen rechtsseitig gelähmt«.47
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg
Ein charakteristisches Merkmal des entstehenden Grenzlands war die Anwesenheit einer großen Zahl von Vertriebenen und Flüchtlingen. Bei Kriegsende waren sie aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches in diese überwiegend ländlichen Gebiete eingewiesen worden, weil man dort im Gegensatz zu den Städten noch einen intakten Wohnungsbestand vorfand. Solange die Demarkationslinie durchlässig blieb, nahmen die grenznahen Landkreise auch weiterhin Zuwanderer aus der sowjetischen Besatzungszone auf.48 Der Landkreis Lüchow-Dannenberg, auch als Hannoversches Wendland bekannt, bildete hierbei keine Ausnahme. Der im ostniedersächsischen Elbbogen gelegene Landkreis wuchs von 41 399 Einwohnern im Jahr 1939 auf 73 106 im Jahr 1950 an, das heißt um gut 76 Prozent.49 Der Zustrom überforderte die überwiegend agrarisch geprägte Wirtschaft, sodass 1951 die Arbeitslosenquote auf 25 Prozent stieg.50
Im Wendland hatte man ohnehin kaum jemals Wohlstand erlebt. Über lange Zeit war die Landwirtschaft das ökonomische Rückgrat des Kreises gewesen, doch die Bauern hatten immer wieder unter den Folgen der Hochwasser von Elbe und Jeetzel gelitten, die häufig Acker- und Weideflächen überschwemmten.51 Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert verschaffte der Anbau von Flachs zur Herstellung von Leinen den Ortsansässigen eine kurze Atempause, bis sich um 1850 die billigere Baumwolle durchsetzte.52 Aufgrund der fehlenden Anbindung an das überregionale Schienennetz ging, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Industrialisierung fast spurlos am Wendland vorbei. Da Lüchow-Dannenberg im toten Winkel des Schienendreiecks Hamburg – Berlin – Hannover lag, beschränkten sich die eigenen Zugverbindungen auf die unmittelbare Region.53 Die wirtschaftliche Stagnation löste eine Landflucht aus, bis 1910 verlor der Landkreis rund 30 000 Menschen. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges arbeiteten nach wie vor zwei Drittel der Bevölkerung in der Landwirtschaft, andere fanden Arbeit in Molkereien, Ziegeleien, Sägewerken oder Möbelfabriken. Im Krieg wurde zwar ein Teil der ländlichen Arbeitskräfte in Munitionsfabriken beschäftigt, aber als die Vertriebenen ankamen, gab es im Landkreis nur noch rund tausend Arbeitsplätze in der Industrie.54
Durch die Abriegelung der Demarkationslinie verschlechterte sich die ohnehin schon dürftige Verkehrsanbindung von Lüchow-Dannenberg noch mehr. Die durch einen Luftangriff zerstörte Dömitzer Elbbrücke wurde erst 1992 wieder aufgebaut, die Zugverbindungen nach Salzwedel und Wittenberge auf der Ostseite waren eingestellt und der einzige Kontrollpunkt für den Autoverkehr in Bergen-Dumme wurde im Juni 1952 von der DDR aus geschlossen. Der Landkreis war nun auf drei Seiten vom Eisernen Vorhang umgeben, hier war praktisch die Welt zu Ende.55 Abgesehen von einem Zollamt in Schnackenburg und den Touristen, die sich bei Bootsfahrten auf der Elbe die Sperrzäune auf der Ostseite ansahen, war mit der innerdeutschen Grenze kein Geschäft zu machen. Bereits 1951, noch bevor von einer systematischen Förderung für das Zonenrandgebiet die Rede war, erhielt der Landkreis Mittel für regionale Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Als die Zonenrandförderung anlief, entstanden mithilfe der staatlichen Subventionen Anfang der 1960er Jahre einige Arbeitsplätze in der Industrie.56 Doch trotz dieser Bemühungen und Investitionen in einem Umfang von 120 bis 150 Millionen DM (von 1951 bis 1968) zur Unterstützung der Landwirtschaft, für wasserbauliche Projekte und zur Tourismusentwicklung verlor Lüchow-Dannenberg immer mehr Einwohner und wurde schließlich zum Landkreis mit der bundesweit geringsten Bevölkerungsdichte. Die Beschäftigten mussten zu ihren Arbeitsplätzen pendeln, und die jungen Leute, die sich weiterbilden wollten, zogen fort.57 Trotz hoher Transferleistungen von Bund und Land forderten Kreispolitiker mit verlässlicher Regelmäßigkeit weitere staatliche Unterstützung. Im Jahr 1977 benannte der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht den abgelegenen Landstrich an der Elbe zum Standort für das bis dahin teuerste Industrieprojekt der Bundesrepublik: Für 11 Milliarden DM sollte ein »nukleares Entsorgungszentrum« für etwa 4000 Beschäftigte errichtet werden.58 Doch wie wir in Kapitel 6 sehen werden, entstand in und um die grenznahe Gemeinde Gorleben kein Projekt mit dauerhaften Arbeitsplätzen, sondern die am längsten anhaltende Anti-Atomkraft-Bewegung in der deutschen Geschichte.
Braunschweig
Die Stadt Braunschweig und ihr Umland bildeten eines der industriellen Zentren im ansonsten überwiegend agrarisch geprägten Niedersachsen. Während des Krieges spielte Braunschweig eine bedeutende Rolle in der Rüstungsproduktion und wurde daher Ziel alliierter Luftangriffe. Bei Kriegsende lag die Innenstadt zu 90 Prozent in Trümmern, 52 Prozent des Wohnungsbestands waren zerstört. Trotz der verheerenden Situation wurde Braunschweig vorübergehend zum Schnittpunkt mehrerer Bevölkerungsbewegungen: Ehemalige Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge bemühten sich, die Stadt und ihr Umland zu verlassen, während Wehrmachtssoldaten sowie ausgebombte und evakuierte Bewohner versuchten zurückzukehren. Hinzu kam der bei Kriegsende charakteristische Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen.59 Gemäß dem von den Alliierten auferlegten Reparationsprogramm wurde Braunschweigs Industrie teilweise demontiert. Dies betraf vor allem die ehemaligen Hermann-Göring-Werke in Salzgitter-Watenstedt, deren Belegschaft in die Arbeitslosigkeit entlassen wurde.60
Die traditionellen Braunschweiger Unternehmen nahmen die Produktion relativ früh wieder auf. Zu den Branchen der Region gehörten die Metall- und Nahrungsmittelindustrie, der Fahrzeugbau (Büssing), der Maschinen- und Anlagenbau und die Fotoindustrie, die mit führenden Marken wie Voigtländer und Rollei vertreten war. Ähnlich wie in anderen Wirtschaftszentren bedeutete die undurchlässiger werdende Demarkationslinie auch für Braunschweig einen Verlust des Hinterlandes. Nach Schätzung der örtlichen Industrie- und Handelskammer hatten sich 60 bis 70 Prozent aller wirtschaftlichen Verbindungen der Vorkriegszeit auf das Gebiet der späteren DDR konzentriert. Allein die Konservenindustrie hatte 40 Prozent ihrer Produkte nach Ostdeutschland geliefert und die Hälfte der für ihre Produktion benötigten landwirtschaftlichen Erzeugnisse von dort bezogen.61 Die Braunschweiger Unternehmer litten aber auch unter mangelnden geografischen Kenntnissen der Deutschen und fühlten sich von ihren weiter westlich angesiedelten Geschäftspartnern ins Abseits gestellt. Die Brunsviga Maschinenwerke AG wandte sich sogar an ihre Kundschaft und erteilte ihr Nachhilfe, wo Braunschweig auf der Landkarte zu finden sei: »Weder in den U.S.A. noch hinter dem Eisernen Vorhang … Einkauf in Braunschweig ist weder genehmigungspflichtiger Warenverkehr, noch devisenraubender Import.«62 Kurzum: Lieferungen aus Braunschweig bedeuteten nicht, sich auf den Interzonenhandel einzulassen – »Warum kaufen Sie dann nicht?«, lautete der unausgesprochene Vorwurf.
Doch bei keinem Unternehmen hingen Wohl und Wehe so sehr von der Grenze ab wie bei den Braunschweigischen Kohlen-Bergwerken (BKB) in Helmstedt. Die Demarkationslinie verlief mitten durch ihre Produktionsstätten: Das Kraftwerk, eine Brikettfabrik und zwei Tagebaustätten lagen auf der östlichen Seite. Da sowohl die Briten als auch die Sowjets ein vitales Interesse an der Lieferung von Kohle und Strom hatten, nahm die BKB den Betrieb rasch wieder auf und blieb einige Jahre lang ungestört, obwohl die Sowjets die östlichen Unternehmensteile sozialisierten.63 Die Produktion fand jedoch am 26. Mai 1952 ein jähes Ende, als sowjetische und ostdeutsche Truppen begannen, die Grenze abzuriegeln. An diesem Tag verlor die BKB durch das neue Grenzregime der DDR mehr als 30 Millionen DM, weil ein Großteil der Maschinen und 60 Prozent der Braunkohlevorräte auf der Ostseite geblieben waren.64 Zu den vielen Geschädigten des BKB-Desasters gehörte auch der Landkreis Helmstedt, der dadurch 3,2 Millionen DM an Unternehmenssteuern einbüßte.65 Ging es den Betrieben des Grenzlandes schlecht, zog dies auch ihre Kommunen in Mitleidenschaft.
Die Industrie- und Handelskammer Braunschweig machte die Landesregierung in Hannover auf eine weitere Dimension des Grenzlandstandortes aufmerksam: die Gefahr vor kommunistischer Unterwanderung. Ostdeutsche Behörden, so berichtete die Kammer, würden häufig Braunschweiger Facharbeiter und ihre Familien zum Urlaub in die DDR einladen und die Gelegenheit nutzen, diese Personen in kommunistischer Agitation zu schulen. Zu Hause in ihren Braunschweiger Betrieben würden die zurückgekehrten Arbeiter dann die ihnen antrainierte Propaganda verbreiten. Schlimmer noch, die DDR habe es auch auf Kinder aus Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit wie Salzgitter-Watenstedt abgesehen. Diese »unkritischen Kinder« würden »mit wirkungsvoller kommunistischer Propaganda vollgestopft« und in ihre »politisch empfindlichen Notstandsgebiete« zurückgeschickt. Je weniger die Grenzgebiete am wirtschaftlichen Aufschwung teilhätten, so warnte die Kammer, desto empfänglicher seien sie für eine solche Unterwanderung.66
Hof
Die oberfränkische Stadt Hof lag bis 1990 im Dreiländereck zwischen der Bundesrepublik, der DDR und der Tschechoslowakei. Zu den Haupterzeugnissen der Hofer Industrie gehörten Textilien und Bier. Wie andernorts in West- und Mitteleuropa war die Textilherstellung im 19. Jahrhundert der Motor der Industrialisierung gewesen. Die aus dem frühneuzeitlichen Tuchhandel hervorgegangene Hofer Textilproduktion hatte sich von einem Heimgewerbe zu einer industriellen Massenproduktion entwickelt. Im Verlauf der Industrialisierung fächerte sich die Textilproduktion regional auf. Hof wurde zur Stadt der Spindeln und Webstühle. Von hier aus wanderten Garne, Zwirne und Stapelware ins benachbarte Sachsen zur weiteren Verarbeitung in Spitze, Gardinen, Segeltuch, Kleider- und Möbelstoffe.67 Auch die Hofer Brauindustrie war hinsichtlich der Braugerste und des Bierabsatzes auf den Nordosten angewiesen. Über ein Netz von Schankwirtschaften, Großhändlern und Geschäften setzten die Hofer Brauereien 75 bis 90 Prozent ihrer Biere in Sachsen und Thüringen ab.68 Ein weiterer wichtiger Ort für den Bierverkauf war der Bahnhof, wo das Bier auf den Bahnsteigen verkauft wurde. Hof verfügte über einen bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt für den Personen- und Güterverkehr mit Direktverbindungen nach Berlin, München, Dresden und Frankfurt, von wo alle elf Minuten ein Zug eintraf oder abfuhr.69
Als die Demarkationslinie undurchlässiger wurde, verlor die Hofer Industrie ähnlich wie die in Lübeck und Braunschweig ihre Märkte und Zulieferer. Die Stadt hatte in ihren Bemühungen um eine Neuorientierung Richtung Westen mit den gleichen Problemen wie andere Grenzlandorte zu kämpfen: Etablierte Unternehmer verteidigten ihr Revier. Zusätzlich waren die Folgen der gestiegenen Transportkosten für ein- und ausgehende Waren in Hof besonders gravierend. Zwar litten alle Grenzlandorte darunter, aber die oberfränkischen Städte sahen sich nicht nur im Osten (Tschechoslowakei, Sachsen/DDR), sondern auch im Norden (Thüringen/DDR) vom Umland abgeschnitten. Der Verkehrsfluss reduzierte sich im Vergleich zur Vorkriegszeit auf ein Rinnsal. Dies machte sich zunächst bei der Versorgung mit Braunkohle aus der Tschechoslowakei und Sachsen bemerkbar. Angesichts der Unzuverlässigkeit der Energieversorgung mussten die Hofer Textilfabriken Kohle aus dem Ruhrgebiet anliefern lassen, was mit 30 Prozent erhöhten Transportkosten zu Buche schlug. Die Entfernung zum Bremer Hafen, wo die Baumwolle für Hof ankam, wuchs von 481 auf 675 Kilometer, da der Verkehr um Thüringen herumgeleitet werden musste.70
Die Fürsprecher von Hof und Oberfranken betonten oft und gern den durch die innerdeutsche Grenze bewirkten Schaden für ihre Region.71 Über jene Schäden, die die Auflösung der traditionellen Wirtschaftsbeziehungen auf der anderen Seite, in Sachsen und Thüringen, anrichtete, wo privaten Unternehmen außerdem die Verstaatlichung drohte, fanden sie wenig zu sagen. Auch war es politisch nicht opportun zu erwähnen, wie Hof und Coburg zeitweilig von der Grenze profitierten. Schließlich verdankte die Hofer Wirtschaft den vielen Fabrikanten aus Sachsen und Böhmen, die als Flüchtlinge bzw. Vertriebene nach Hof und Umgebung übersiedelten, einen kurzen Aufschwung: Statt der üblichen 90 000 Arbeitsplätze in der Industrie, die die Stadt 1939 und erneut nach dem Krieg aufzuweisen hatte, zählte sie im Jahr 1951 satte 145 000, ein Plus von 61 Prozent.72 Mithilfe der neu angesiedelten Fabrikanten gelang es der Textilindustrie in und um Hof, den Produktionskreislauf zu schließen und Fertigprodukte anzubieten, anstatt Garne und Stoffe wie bisher andernorts weiterverarbeiten zu lassen.73 Die Grenze hatte auch den willkommenen Nebeneffekt, dass Konkurrenten ausgeschaltet wurden. Vor allem die im Hofer Umland ansässigen Produzenten von Spielzeug, Weihnachtsschmuck und Kinderwagen in und um Coburg und Neustadt profitierten von der Unterbrechung der Lieferwege. Die Korbmacher um Coburg, die bis dahin nur Kinderbetten gefertigt hatten, wären nie auf die Idee gekommen, auch Kinderwagen zu produzieren, wären sie nicht von der Verbindung zur Hauptfabrik in Zeitz südwestlich von Leipzig abgeschnitten worden.74 Solche Vorteile gerieten schnell in Vergessenheit. Weit mehr Beachtung fand die Tatsache, dass in Bayern bis 1954 jeder dritte Konkurs in Oberfranken angemeldet wurde.75
Grenzlandbildung und die Formierung von Interessengruppen
Im Jahr 1949 hielt der Bundesminister für Verkehr, Hans-Christoph Seebohm (CDU), vor der Industrie- und Handelskammer Braunschweig eine Rede über »Braunschweig als Grenzland«. Die Wahl dieses Themas war bemerkenswert, denn wie Seebohm richtig feststellte: »Braunschweig war nie Grenzland«, sondern von jeher mehrere Hundert Kilometer von allen deutschen Außengrenzen entfernt gewesen. Doch durch die Berlin-Blockade und die damit verbundene Unterbrechung des Handels und des Reiseverkehrs sah Seebohm den Braunschweiger Wirtschaftsbezirk von einer ökonomischen Verödung bedroht, da die dortigen Betriebe nun »an ein[e] tote Grenze gedrück[t]« seien. Einstweilen sei die Situation »unabänderlich«, man könne nur Notfallpläne schmieden.76 Überall entlang der innerdeutschen Grenze wurden die Handelskammern aktiv und befragten ihre Mitglieder zu den Folgen der unberechenbaren Grenze. Im Laufe des Jahres 1950 häuften sich entsprechende Berichte.77 Der Zeitpunkt dieser Bestandsaufnahme lässt vermuten, dass man in dem Zusammentreffen dreier Faktoren – die Erfahrungen mit der Berlin-Blockade und der Gegenblockade, die Vereinigung der Wirtschaftsräume in den drei Westzonen und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 – eine günstige Gelegenheit dafür gekommen sah. Die Gründung des westdeutschen Staates war jedoch die wichtigste Voraussetzung für ein interessenpolitisches Engagement, da hiermit die politische Verantwortlichkeit geklärt war. Die Vertreter der Grenzlandwirtschaft wussten nun, an wen sie ihre Forderungen richten konnten.
Die Interessenpolitik bildete sich auf drei Ebenen heraus: In den Industrie- und Handelskammern, in den Landkreisen sowie in den der DDR benachbarten Bundesländern. Dort traten überall Arbeitsgruppen zusammen und formulierten ihre Positionen.78 Zwischen 1950 und Mai 1952 reichten sie eine Flut von Denkschriften bei der Bundesregierung ein und stimmten ihre Botschaften sowohl auf die Realitäten der westdeutschen Wiederaufbaugesellschaft als auch auf die Entwicklung des westdeutschen Föderalismus ab.79





























