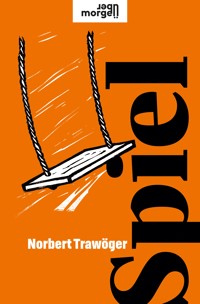Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: WASSER Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Stromschnellen
- Sprache: Deutsch
"Ob meine Großeltern glücklich waren, weiß ich nicht. Mir, dem erstgeborenen Enkelsohn, ist in Glückshinsicht nichts aufgefallen, weder in die eine noch in die andere Richtung." Leben ist Bewegung. Von allen Bewegungen treibt Norbert Trawöger die zu den Menschen an, zum Gemeinsamen hin am meisten. Starre Zustände sind seine Sache nicht, dem Wehklagen über Unmöglichkeiten und Schlaglöcher der Gegenwart stellt er eine leidenschaftliche Mischung aus Ruhe und Forscherdrang entgegen. Doch wer die Leichtigkeit der Bewegung liebt, braucht starke Wurzeln, ruhige Tage mit Zuckerbutterbrot und Musik. Norbert Trawöger gewährt sich diese Pause. Er sitzt und schaut, lässt Gedanken kommen und gehen: an gütige Großeltern, an Erkenntnisse im Stau und auf dem Fußballplatz, an kleine Gesten mit großer Wirkung. Und so entsteht fast wie von selbst ein tragfähiges Netz aus Momenten der Verbundenheit und des Staunens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 56
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Trawöger
Zuckerbutterbrottage
Ein Zuruf
Norbert Trawöger
ZuckerbutterbrottageEin Zuruf
Inhalt
Aus der Vogelperspektive
Klare Verhältnisse
Im Zwischenreich
Meine Felder
Mittendrin dafür dagegen
Ich bin der Stau
Der Faden in unseren Händen
Luft und Nähe
Dank
Allen Luftgeistern, Drachen und Windgöttinnen.
Allen.
Aus der Vogelperspektive
Die Haustür hinaus. Die Wiese hinauf. Bei der Stadltür rein. Quer durch den Hof des Vierkanters. 23 Stufen. Den Gang zurück. Nach rechts. Dort, wo der Schuhkasten steht, der in wiederkehrenden Albträumen meiner Kindheit eine unpassierbare Schlangengrube beherbergt hat. Schnell weiter. Zur Glastüre hinein. Im Licht, mit dem Rücken zum Fenster, saß Großmutter, die ich nie so nannte. Oma mit ihren zwölf Dioptrien, als ob ihre gütigen Augen der Vergrößerung bedurft hätten.
Schräg gegenüber thronte Opa neben dem Fernseher, der auf einem Tisch stand, in dessen Lade sein Aluminiumlöffel klebte. Mit dem löffelte er seinen picksüßen Kaffee aus der weißen blaurandigen Emailschüssel. Darin schwammen Riesenwürfel, die er aus einem Geisensheimer Brotlaib geschnitzt hatte, indem er ihn zur Brust nahm und das Messer durch ihn an sich heranzog. In der für uns Kinder verbotenen Richtung. Körperabgewandt war die Regel. Der Bäcker höchstselbst brachte jeden Freitag diese archaischen Laibe, deren Kümmelgeruch mir so abrufbar ist wie der Duft der frisch beackerten Felder rund um den großelterlichen Hof. Der lag nur einige Höhenmeter über meinem Elternhaus, das früh zu meinem Mutterhaus geworden ist. Der Großvater, den ich als aufrechten Riesen in Erinnerung habe, war laut seinem Pass zehn Zentimeter kleiner, als ich es heute bin. Die Nächte hat er, der Kleinbauer, in seinem Bett verbracht. Lesend. Den Kopf auf drei Polster hochgebettet. Daneben brannte die schirmlose Nachtkastenlampe gleich einem ewigen Licht, nicht rot, aber grell blendend.
Warum ich das weiß, kann ich nicht sagen, da ich nie bei Nacht im Schlafzimmer meiner Großeltern war. Aber ich erinnere mich daran. Auch auf meinem Bett finden sich drei Kopfpolster, daneben Berge von Büchern, nur hat meine Lampe einen Schirm. Heute kann ich fast nicht mehr Opa sagen, zu lange ist er weg, und doch da. Großvater lehrte mich, in Spannung zu gehen und wieder loszulassen. Er baute mir und meinen Brüdern aus Hollerstaude, Kälberstrick und Trattnachschilf Bogen und Pfizipfeil. Unsere Pfeile landeten treffsicher auf Dächern oder blieben im Geäst hoher Bäume hängen. Großvater sorgte für Nachschub, solange er konnte, bis er im letzten Sommer nur mehr in der Sonne saß. Mit Hut auf dem Kopf zerdrückte er ohne Brille mit seinem Gehstock punktgenau die Ameisen am Boden. Trotz „Verkalkung“, so nannte man früher Demenz, wusste er bis zu seinem gänzlichen Verschwinden die Hauptstädte von Ländern, die ich bis heute nicht kenne.
Während Oma unablässig den Apfelstrudel über den Tisch zog. Große Augen, noch größeres Herz. Und Zuckerbutterbrot für uns Kinder. Meine Brüder mochten es. Ich nicht, aber der Gedanke daran ist süß. Ich hasste den Kindergarten, blieb lieber bei Oma. Mit meinem weißen Fahrrad, seinem roten Sattel und der Furcht vor den Schafen. Später, größer, rannte ich in der Finsternis oft noch schnell hinauf zu ihr. Es ging um nichts, doch sie schaltete im Gegensatz zur Linzer Oma den Fernsehapparat ab. Sie war da, auch mit dem nicht gerade üppigen Taschengeld von 2000 Schilling an monatlicher Pension. Sie hängte ihren linken Arm ein, am Heimweg vom Sonntagmittagessen bei uns zu Hause zu ihr nach Hause. Noch heute spüre ich das Kribbeln ihrer Fingerkuppen auf meinem Unterarm. Noch höre ich ihre Aufregung bei einem der Telefongespräche, als ich ein Jahr fern der Heimat lebte. Sie wartete, bis ich zu Weihnachten zurückkam, freute sich und ging selbst kurz nach den Feiertagen.
Es ist einer der ersten hellen Sommertage. Ich sitze auf der Parkbank vor der Magdalenabergkirche, die hundert Höhenmeter über meinem Heimatort Bad Schallerbach liegt. Von oben, aus der Vogelperspektive, blicke ich auf das Trattnachtal. In der Ferne sind der Bauernhof meiner Großeltern und das Haus meiner Herkunft zu sehen. „Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben“, denke ich in Erinnerung an Jean Améry, den als Hans Mayer in Wien geborenen Schriftsteller, Essayisten, Widerstandskämpfer.
Wie viel Heimat braucht der Mensch? Man muss keine Heimat haben, um sie nötig zu haben, heißt es im logischen Umkehrschluss. Welch ein Glück, sie nicht nötig zu haben, eine Heimat zu haben. Wenn ich sie verorten, sie einem Ort zuweisen müsste, dann liegt sie nicht vor mir, sondern ist die Kirche hinter mir. Ihre erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1423. Schon im fünften Jahrhundert haben sich auf dem Magdalenaberg Menschen versammelt, um den Missionar Severin von Noricum predigen zu hören. Seit eineinhalbtausend Jahren zieht dieser Kraftort Menschen an.
Mein Vater hat gemeinsam mit meinem verehrten Lehrerfreund Horst Eibl und meinem leidenschaftlichen Organistenfreund Rudi Markgraf – beide sind sie heute weit über 90 Jahre alt – in den 1970er-Jahren an diesem Ort eine Konzertreihe begründet, die bis heute besteht. In dieser Kirche bin ich zum Musiker geworden und werde es immer noch. An diesem Ort ist garantiert, dass ich mich treffe, den Klang meiner Flöte nicht überhöre. Der alte Kirchenraum hilft mir dabei, er erinnert mich an meine Wurzeln, verwurzelt mich auf merkwürdig wundersame Weise. Hunderte Konzerte habe ich im Laufe der letzten Jahrzehnte in dieser gotischen Kirche gespielt. Als Kind habe ich den Blasebalg der kleinen Orgel getreten, da sie noch keinen Motor für die Luftversorgung hatte. Heute ist sie längst motorisiert. Hier bin ich zum Kalkanten, zum Bälgetreter, zum Luftversorger meiner Flöte geworden. Hier bin ich, hier werde ich immer wieder. Musik entfaltet sich im Augenblick, im Zusammenspiel, in der Nähe zu anderen. Das Eigentliche bleibt ein flüchtiges Versprechen, das wir nur im Miteinander erahnen können, niemals ganz besitzen und das in der unbeschreiblichen Erfahrung doch unauslöschlich ist. Musik verbindet, Orte schaffen und bereiten Raum, über Jahrtausende im Jetzt, auch zu sich selbst. Hier bin ich, hier werde ich. Die Musik ist mein Leben(smittel).
Klare Verhältnisse
Meine Großeltern heirateten im Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mein Großvater, der zehn Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs geboren wurde, war in seinen Vierzigern immer noch Junggeselle. Der Krieg an der Front blieb ihm erspart, als Jüngster musste er den Hof bewirtschaften und seine todkranke Mutter pflegen. Seine drei Brüder zogen in den Krieg, wo zwei ihr Leben auf den Schlachtfeldern ließen. Während Großmutter, die acht Jahre jünger als er war, mit zwei unehelichen Kindern dreißig Kilometer entfernt den Hof ihres Bruders führte. Dabei half ihr eine „Ukrainerin“, die ihr vom Nazi-Regime als „ausländische