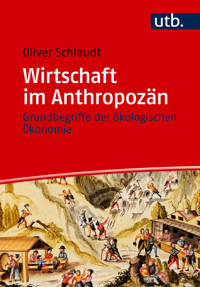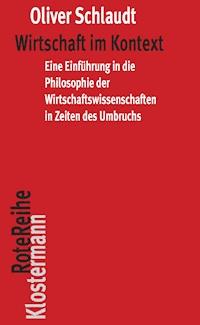16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die weltweit größte Untertagedeponie für gefährliche Abfälle im hessischen Heringen, ein gigantischer Abwasserkanal bei Essen, eine Tierkadaververwertungsanlage im schönen Moseltal: Oliver Schlaudt hat sich auf eine eigentümliche Deutschlandreise begeben, um verborgene, aber spektakuläre Wahrzeichen unserer Müllkultur aufzusuchen. Sein genauso verblüffender wie wunderbar erzählter Reisebericht liest sich allerdings nicht nur wie ein Fremdenführer durch deutsche Abfalllandschaften. Inmitten ihrer besonderen Müllgeschichten entwickelt Schlaudt zugleich eine Philosophie, die sich die Hände buchstäblich schmutzig macht. Menschheitsgeschichtlich haben wir den Punkt erreicht, an dem unser Müll überall ist und wir uns allmählich mit ihm selbst vergiften. Zugleich geben wir uns sehr viel Mühe, seine beunruhigende Allgegenwart aus unserem Gesichtsfeld zu verbannen. Es wird daher Zeit, der drastischen Wirklichkeit unserer zumüllenden Lebensform ins Auge zu blicken – und mit Oliver Schlaudt eine müllphilosophische Deutschlandreise zu unternehmen. Wir besuchen unter anderem die unscheinbare, aber rettungslos zerstörte Mülllandschaft von Bitterfeld (wo Marx’ Einsicht sinnfällig wird, dass der Müll der «unheilbare Riss» im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur ist), die BASF-Sondermülldeponie auf einer künstlichen Rheininsel (wo wir erkennen, dass wir in Sachen Müll «Cartesianer» geblieben sind, Bewohner zweier getrennter Welten) und die charmante Wurmkiste im eigenen Zuhause. Es wird klar: Der Müll ist das ungewollte Erbe, das wir nicht ausschlagen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Oliver Schlaudt
Zugemüllt
Eine müllphilosophische Deutschlandreise
Illustriert mit Werken von Swaantje Güntzel
C.H.Beck
Über das Buch
Die weltweit größte Untertagedeponie für gefährliche Abfälle im hessischen Heringen, ein gigantischer Abwasserkanal bei Essen, eine Tierkadaververwertungsanlage im schönen Moseltal: Oliver Schlaudt hat sich auf eine eigentümliche Deutschlandreise begeben, um verborgene, aber spektakuläre Wahrzeichen unserer Müllkultur aufzusuchen. Sein genauso verblüffender wie wunderbar erzählter Reisebericht liest sich allerdings nicht nur wie ein Fremdenführer durch deutsche Abfalllandschaften. Inmitten ihrer besonderen Müllgeschichten entwickelt Schlaudt zugleich eine Philosophie, die sich die Hände buchstäblich schmutzig macht.
Menschheitsgeschichtlich haben wir den Punkt erreicht, an dem unser Müll überall ist und wir uns allmählich mit ihm selbst vergiften. Zugleich geben wir uns sehr viel Mühe, seine beunruhigende Allgegenwart aus unserem Gesichtsfeld zu verbannen. Es wird daher Zeit, der drastischen Wirklichkeit unserer zumüllenden Lebensform ins Auge zu blicken — und mit Oliver Schlaudt eine müllphilosophische Deutschlandreise zu unternehmen. Wir besuchen unter anderem die unscheinbare, aber rettungslos zerstörte Mülllandschaft von Bitterfeld (wo Marx’ Einsicht sinnfällig wird, dass der Müll der «unheilbare Riss» im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur ist), die BASF-Sondermülldeponie auf einer künstlichen Rheininsel (wo wir erkennen, dass wir in Sachen Müll «Cartesianer» geblieben sind, Bewohner zweier getrennter Welten) und die charmante Wurmkiste im eigenen Zuhause. Es wird klar: Der Müll ist das ungewollte Erbe, das wir nicht ausschlagen können.
Über den Autor
Oliver Schlaudt, geboren 1978, ist Professor für Philosophie und Politische Ökonomie an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit Fragen der Technik-, Kultur- und Wissenschaftsphilosophie mit einem besonderen Interesse an Ökonomie und kognitiver Archäologie. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Das Technozän. Eine Einführung in die evolutionäre Technikphilosophie» (2022) und «Die politischen Zahlen. Über Quantifizierung im Neoliberalismus» (2018).
Inhalt
Vorwort
1:Willkommen!
Mit Josefa in B.
Paradoxe Effekte
Ingenieure geben auf
Jupiter und Venus in Konjunktion
Gegen den Ikonoklasmus
Seistu verflucht – Sapere aude, think we must
2:Der unheilbare Riss
Kunde von der Neuen Welt
Der Fluss unter dem Fluss
Blumige Wiesen, üppiges Gras, Quendel, Thymian, Salbei
Biß er sich ißt gantz und speyt, sich tödt und das Leben schafft
Wie die Gipfel eines schneebedeckten Gebirges
Abschied aus Nova Atlantis
3:Palläste der Nacht im Schooße der Erde
Blick über Europa
Lazurblau
Das Blutwunder in den Rheinauen
Cartesianische Ökonomie
Auf dem Grunde des Zechsteinmeeres
Die Zukunft der Schönheit
Gegebenenfalls aufsammeln
Die künftigen Stelen unserer Zivilisation des Mülls
4:Unser täglich Müll
Wir bleiben zuhause
Gestatten, maître composteur
Eiter und Blut von dem verfaulten Schaden deß Krebs getruncken
Madame beschwert sich
Sully nimmt ein Bad
Von des Weibes Gesundheit und Schönheit
Zimmer mit Aussicht
Matter out of place?
Finsterniß
5:Denn du bist Erden
Die äthiopische Zibetkatze
Das verachtete Wasser der Salmona
Sie baden Ihre Hände drin!
Von der Flora der Mittelmeerinseln
E-Abfälle
Ein Grab am indischen Ozean
Himbeerroter Porphyr am Onegasee
Einige Fälle von Kannibalismus
Koth bistu, in und vom Koth lebestu
6:Kompostmoderne
Hitler ante portas
Schwerelosigkeit im freien Fall
Und kam gar wenig Guts darvon, dann daß es alles verbrannt
Die Oekonomie der Exkremente der Produktion
Captain Swing hat verloren
Das ideale Dorf des Bürgermeisters Petit
Mit Scheiße hört es auf
Danksagung
Auswahlbibliografie
Müll: Allgemeines, Daten und Nachschlagewerke
Philosophie des Mülls
Kulturtheorie des Mülls, Waste Studies
Historisches zum Müll und zur Abfallentsorgung
Dreck, Schmutz, Sauberkeit
Kot und Humus
Müllsoziologie, Abfallleben
Müll, Konsumgesellschaft, Müllsammeln
Müll und Kunst
Anmerkungen
Willkommen!
Der unheilbare Riss
Palläste der Nacht im Schooße der Erde
Unser täglich Müll
Denn du bist Erden
Kompostmoderne
Bildnachweis
Personenregister
Vorwort
Wir stellen uns frühere Zeiten oft als dreckig vor. Die Menschen lebten mit und in ihrem eigenen Unrat, denn sie hatten weder Müllabfuhr noch ein Klosett mit Wasserspülung. Wir haben beides. Allein, wo gehen der Kot und die Abfälle hin? Was ist ihre letzte Bestimmung, wenn der Deckel wieder auf der Tonne liegt und die Spülung gezogen ist? Wir wissen es nicht, zumindest nicht so genau, und dieses Unwissen enthält schon in nuce ein irritierendes Paradox der Moderne: Keine Zeit vor uns war so sauber, ja, so besessen von Sauberkeit, wie wir es sind. Die Dinge glänzen und duften, sind glatt und rein, wollen klar und eindeutig sein. Zugleich gilt: Keine Zeit vor uns war so dreckig. Nicht nur stopfen wir alle Täler und jeden versteckten Winkel der Landschaft mit Abfall voll. Nein, der Müll ist inzwischen wirklich überall. Die fernsten Gletscher des Himalayas schwitzen Quecksilber und Pestizide aus, in Luft, Boden und Meeren verteilt sich das Mikroplastik über den gesamten Erdball und jedes Neugeborene hat schon im Mutterleib seine Giftdosis abbekommen. Aber auch die Sauberkeit, so eine These dieses Buches, kriecht viel tiefer in unsere Diskurse und unser Selbst, als sie es sollte, und richtet dort großen Schaden an.
Noch nie waren wir so sauber, noch nie waren wir so dreckig. Dies ist die paradoxe Verfassung der Gegenwart. Um sie geht es in diesem Buch. Sie muss etwas mit Vergessen und Verdrängen zu tun haben. Wir können uns so sauber wähnen, weil wir den Müll vergessen, und wir können ihn vergessen, weil wir uns so sauber wähnen. Was wir heute, im mutmaßlichen Anthropozän, dementsprechend erleben – und davor hat uns schon Sigmund Freud gewarnt –, ist die Rückkehr des Verdrängten. Was mithin nottut, ist eine Art Psychoanalyse unseres gemeinschaftlichen Unbewussten. In diesem Sinne befragt das vorliegende Buch den Müll philosophisch – darüber, was er über uns selbst aussagt, über unser heutiges Handeln und das Leben in einer Zukunft, aus der der Müll nicht mehr wegzudenken ist.
Müllphilosophie ist indes ein heikles Unterfangen. Sokrates bestritt ihre Möglichkeit, weil Philosophie es nur mit Ideen zu tun habe, mit den bloßen Formen und Bestimmtheiten der Dinge, während Dreck, Kot und Abfall auf eine Formlosigkeit und Unbestimmtheit zutreiben, womit sie für die Philosophie irrelevant werden. Parmenides hat über Sokrates’ Haltung milde gelächelt – und auch wir werden sehen, dass die philosophische Bedeutung des Mülls eigentlich in die Augen springt. Sehr schnell führt er uns zu fundamentalen Fragen darüber, wer wir eigentlich sind, wie wir uns selbst, den Kosmos und unsere Geschäfte darin verstehen, wie wir uns zu den Bedingungen des menschlichen Lebens verhalten und was ein gutes Leben ausmacht.
Freilich sollten wir Sokrates’ Bedenken nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn was, wenn das «abstrakte» Philosophieren einen komplizenhaften Anteil an unserem kollektiven Verdrängen des Mülls hat – dieses Mülls, der ja das Konkrete schlechthin zu sein scheint und uns mit unserer eigenen Körperlichkeit, Unreinheit und Endlichkeit konfrontiert? Was, wenn sich auch das Philosophieren durch seine Fixierung auf das Begriffliche und Abstrakte in das Arsenal der raffinierten Mechanismen der Verdrängung einreiht?
Für mich lautete die Konsequenz, dass ich die Konfrontation mit dem wahren, wirklichen Müll suchen musste, dass ich also entgegen den Regeln meiner Zunft den Schreibtisch zu verlassen und den Müll dort aufzusuchen hatte, wo er sich befindet. Ich habe eine Reise unternommen, und von ihr erzählt dieses Buch. Es handelt eine philosophische Frage ab, aber nicht in Form einer Abhandlung. Vielmehr berichte ich, was ich gesehen habe, und versuche, das Gesehene zu verstehen. Der Müll wird dabei in einem doppelten Sinne konkret. Wir begegnen ihm als sinnlichem Ding, als welches er durchaus seine Tücken hat. Aber er konkretisiert sich auch in einem wissenschaftlichen Sinn, insofern er peu à peu in seiner ganzen «épaisseur», wie Foucault sagte, also seiner ganzen «Dicke» sichtbar wird – in seiner Überlagerung von natürlichen, kulturellen, technologischen, sozialen, politischen und juristischen Schichten.
Herausgekommen ist bei diesem Experiment eine Art Reisebericht, was für mich selbst anfangs nicht absehbar war, im Rückblick aber auch nicht als bloßer Zufall erscheinen will. Der Reisebericht nimmt eine Mittelstellung zwischen Literatur und Wissenschaft, zwischen subjektivem Erleben und objektiver Feststellung ein. Er bildet damit eine Hybridgattung, wie sie, so scheint mir, das Anthropozän von uns verlangt, um dieser neuen Situation der Menschheit gerecht zu werden. Das Anthropozän drückt eine naturwissenschaftliche und erdgeschichtliche Tatsachenbehauptung aus, stellt damit zugleich aber die großen Narrative von Kultur und Natur infrage: die Erzählungen von ihrer Trennung und Trennbarkeit, vom Fortschritt der Kultur vor der unwandelbaren Kulisse der Natur und schließlich auch von der Objektivität und Unschuld der Naturwissenschaften selbst, die von der Warte der Kultur auf die sich ihr darbietende Natur blicken.
Diese neue Situation verlangt von uns neue Gattungen und Formate, Experimentierlust und bisweilen auch ein wenig Anstrengung. Der Text hat sich, wie im Laufe des Buches deutlich werden wird, gleich einem Fluss selbst seinen Weg gesucht. Er verlangt von den Leserinnen und Lesern, sich ihm anzuvertrauen, sich treiben zu lassen, in den Stromschnellen nicht den Mut und in den Abschnitten des ruhigen Strömens durch einförmigere Ufer nicht die Geduld zu verlieren. Nicht jede Biegung und Wendung wird immer verständlich und willkommen sein, uns aber gleichwohl dem Ziel allmählich näher bringen.
Aufgrund einer glücklichen Fügung findet diese gedankliche Auseinandersetzung mit dem Müll im Medium des Wortes eine Ergänzung in den künstlerischen Bildarbeiten von Swaantje Güntzel, die ich auf einer meiner Müllreisen kennenlernte. In ihrer schon viele Jahre währenden Auseinandersetzung mit dem Müll hat sie ihrerseits eine eigene Formsprache entwickelt, um diesem besonderen Phänomen gerecht zu werden. Durch ein meisterhaftes Spiel mit dem Formenschatz der Kulturgeschichte arbeitet sie das Ikonische an den Müllobjekten heraus, um so die Konfrontation zu erzwingen, auf deren absolute Vermeidung unser ganzes Müllregime eigentlich ausgelegt ist. Ein Kampf von David gegen Goliath, fürwahr, der indes, bei aller Ironie des Formenspiels, mit jenem Ernst geführt wird, der der wirklich großen Kunst niemals fehlt. Gottseidank gibt es sie, denn wir brauchen sie als Verbündete. Jedem Kapitel steht eines von Swaantje Güntzels Werken voran, und auf dem Cover haben Sie, liebe Leserin und lieber Leser, schon eines ihrer Bilder kennengelernt.
Eine solche Konfrontation mit dem Müll in Wort und Bild, so möchte ich abschließend ergänzen, kann durchaus unangenehm sein und uns zu Überlegungen zwingen, die uns nicht behagen. In der Psychoanalyse versteht man indes den «Widerstand» von Patient oder Patientin als einen Hinweis, dass man auf dem richtigen Weg ist, und so habe auch ich es bei meiner Reise in den Mülllandschaften des Anthropozäns gehalten. Dieses heuristische Prinzip mag nicht unfehlbar sein, sich unterm Strich aber doch als fruchtbar erweisen.
Aber nun los, denn anders als der Müll haben wir nicht ewig Zeit!
Swaantje Güntzel, Sterntaler, 2022
Zeitgenössische Interpretation des Märchens «Sterntaler» aus den Kinder und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Die Künstlerin schaut in den Abendhimmel, in dem neben stilisierten Sternen eine in Reihe fliegende Kette von Starlink-Satelliten der Firma SpaceX zu sehen ist. Das Werk ist eine Kollaboration von Swaantje Güntzel und dem Darmstädter Fotografen Andreas Zierhut und während einer Artist-in-Science-Residenz der Künstlerin bei der European Space Agency (ESA/ESOC) im Jahr 2022 entstanden.
1
Willkommen!
Mit Josefa in B.
«Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate – Ihr, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren!» Diese Inschrift ließ Dante Alighieri in seiner Göttlichen Komödie nach antikem Vorbild über dem Tor zur Hölle prangen, dem Tor, welches sein Alter Ego im Versepos durchschreiten musste, um nach langer Wanderung durch alle Untiefen des menschlichen Händels endlich im Paradies seiner lang entbehrten Beatrice wieder zu begegnen. «Jedem das Seine» lautete bekanntlich die zynische Inschrift über dem Eingangstor zum Konzentrationslager Buchenwald. Die SS beauftragte den im Lager inhaftierten Kommunisten und gelernten Schlosser Franz Ehrlich mit der Anfertigung des schmiedeeisernen Schriftzugs. Dem perfiden Befehl konnte er sich nicht widersetzen, aber er fand einen Weg, seine Würde zu behaupten, indem er – von seinen Schergen unbemerkt – in der Wahl der Schrifttype eine versteckte Hommage an seine Lehrer am einst im benachbarten Weimar ansässigen Bauhaus einschmuggelte. Tore sind symbolträchtige Orte. Ihre Inschriften müssen gut gewählt sein. Was steht wohl auf dem Tor, das sich zur Welt des Mülls öffnet?
Die Inschrift kennen wir noch nicht, aber zumindest wissen wir, wo das Tor steht. Wir betreten diese Welt in B. «B. ist die schmutzigste Stadt Europas.» Mit diesem Satz ließ vor über vierzig Jahren Monika Maron in ihrem ersten Roman Flugasche die Protagonistin Josefa, eine Journalistin der Illustrierten Woche, eine gewagte Reportage beginnen, die nie gedruckt werden wird.[1] «B.» stand für Bitterfeld, ein Zentrum der Chemieindustrie der DDR im «Chemiedreieck» Leuna-Buna-Bitterfeld. Schreiben durfte man über die Verhältnisse, die an diesem Ort herrschten, nicht. Gleichwohl war der Skandal für alle sichtbar, schließlich führt die Bahnlinie Berlin–Leipzig durch den Ort. Bei der Durchfahrt schlossen die Fahrgäste die Fenster, um sich vor Staub und Gestank zu schützen. Sichtbarstes Zeichen der Verschmutzung war die für den Roman titelgebende Flugasche aus dem Braunkohlekraftwerk, das aus dem anliegenden Tagebau mit Brennstoff gespeist wurde.
Bitterfeld liegt im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Um seine Müllgeschichte in all ihren Dimensionen und Verästelungen verstehen zu können, müssen wir einen Abstecher in die Erdgeschichte machen.[2] Die Braunkohle ist ein geologisch relativ junges Sedimentgestein aus der sogenannten Epoche des Tertiär. Die Bitterfelder Vorkommen haben sich mitten in dieser Epoche, vor 10 bis 40 Millionen Jahren gebildet. Die Dinosaurier sind schon seit langem ausgestorben, und es bildet sich gerade die enorme Vielfalt von Pflanzen und Tieren aus, wie wir sie heute kennen. Auch die Kontinente nehmen zu dieser Zeit ihren uns gewohnten Platz ein, und die großen Gebirge der Welt, insbesondere die Alpen, heben sich infolge von Plattenkollisionen in den Himmel. Wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt noch lange vor der Eiszeit. Das Klima ist weltweit deutlich wärmer. Die Pole sind eisfrei, weshalb der Meeresspiegel höher liegt und auch die Nordsee weit in die norddeutsche Tiefebene vordringt. An ihren Gestaden wächst im feuchten, subtropischen Klima eine üppige Vegetation von Farnen und Schachtelhalmen. An der Luft verrottet oder verwest organisches Material normalerweise ziemlich schnell (die sogenannte «Mineralisierung», also vollständige Zersetzung zu unorganischem Material). Aber hier, in Ufernähe, finden sich riesige Sümpfe. Ihr stehendes, fast sauerstofffreies und übersäuertes Wasser bremst die Verrottung und lässt durch die mikrobiologische Humifizierung des eingetragenen Pflanzenmaterials – Schilf, Moose, Blätter, Baumstämme – eine dicke Schicht Torf entstehen, reiner, kohlenstoffreicher und wassergesättigter Humus, der sich unter Luftabschluss nicht vollständig zersetzen kann. Auch Tiere geraten bisweilen in den Sumpf und bleiben als Zeugen der damaligen Fauna im Torf erhalten: Insekten, Amphbien, Schildkröten, Urpferde. Wo die Sümpfe durch gelegentliche Überflutungen ihrerseits von Feinmaterial überdeckt werden, vornehmlich von marinen Sanden bei der Rückkehr des Meeres, setzt der Prozess der sogenannten «Inkohlung» ein. Unter dem zunehmenden Druck der sich aufhäufenden Sedimente wird das Wasser aus dem Torf gepresst und es verdichtet sich der Kohlenstoff. Unter noch höherem Druck würde irgendwann die energetisch hochwertigere Steinkohle und schließlich sogar Anthrazit entstehen. Hier bleibt es bei der Braunkohle.
Die Braunkohlevorkommen um Bitterfeld wurden schon im 17. Jahrhundert entdeckt. Das Flussbett der Mulde hat sich in den Flöz eingeschnitten, so dass an ihren Ufern die seltsame, brennbare Erde offen zutage liegt und gelegentlich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung geweckt haben muss. Diese Vorkommen in großem Maßstab auszubeuten war allerdings erst im späten 19. Jahrhundert möglich, da man wegen des hochstehenden Grundwassers dampfbetriebene Pumpen benötigte, um die Gruben trocken zu halten. Die Braunkohle um Bitterfeld enthält relativ viel Schwefel in Form von Pyrit (Eisendisulfid oder «Katzengold»). Diese Schwefelverbindung ist ein weiteres Produkt der Aktivität von Bakterien in den vorzeitlichen Sümpfen, die in ihrer sauerstofflosen, anaeroben Atmung die organischen Sulfate aus den Pflanzen zu Sulfiten vergären (alle Organismen enthalten Schwefel, der menschliche Körper ca. 200 g).[3] Bei der Verbrennung wird der Stoff als Schwefeldioxid frei und verursacht auch eine stärkere Rußbildung. Die ungefilterten Kraftwerksabgase bedeckten die ganze Gegend mit Staub:
Diese Schornsteine, die wie Kanonenrohre in den Himmel zielen und ihre Dreckladung Tag für Tag und Nacht für Nacht auf die Stadt schießen, nicht mit Gedröhn, nein, sachte wie Schnee, der langsam fällt, der die Regenrinnen verstopft, die Dächer bedeckt, in den der Wind kleine Wellen weht. Im Sommer wirbelt er durch die Luft, trockener, schwarzer Staub, der dir in die Augen fliegt, denn auch du bist fremd hier, Luise, wie ich. Nur die Fremden bleiben stehen und reiben sich den Ruß aus den Augen. Die Einwohner von B. laufen mit zusammengekniffenen Lidern durch die Stadt; du könntest denken, sie lächeln.[4]
Die Braunkohle besiegelte Bitterfelds Schicksal, indem sie eine fatale Dynamik in Gang setzte. Das Elektrizitätswerk zog die Chemieproduktion an, die von ihm gleich doppelt profitierte, da sie ihren enormen Strombedarf decken und wie durch günstige Fügung zugleich ihre Abfälle in den ausgekohlten Fördergruben der im Tagebau gewonnenen Braunkohle entsorgen konnte. Inmitten der Gifte und des Mülls richten die Menschen ihr Leben ein:
Und diese Dünste, die als Wegweiser dienen könnten. Bitte gehen Sie geradeaus bis zum Ammoniak, dann links bis zur Salpetersäure. Wenn Sie einen stechenden Schmerz in Hals und Bronchien verspüren, kehren Sie um und rufen den Arzt, das war dann Schwefeldioxyd. […] Fünfmal häufiger Bronchitis als anderswo, Bäume, die über Nacht ihre Blüte verlieren, als wäre ein böser Zauber hinweggefegt oder eben eine Windladung voll Schwefeldioxyd.[5]
Die chemische Industrie schreibt sich der gesamten Existenz der Menschen ein:
Hinter der Mauer zischt und dröhnt es, steigen Dämpfe auf, klingt dumpfes rhythmisches Stampfen. Wie ein Golem, denke ich, ein unheimlicher Koloß, zwar gebändigt, aber in jedem Augenblick bereit, sich loszureißen, auszubrechen und mit heißem Atem alles niederzubrennen, was ihm vor die giftgrünen Augen kommt. […] Großbetriebe erinnerten Josefa an Reservationen. Gewiß, niemand trieb die Leute mit Gewalt hinein oder zwang sie, auf dem ihnen zugewiesenen Terrain zu bleiben, aber waren nicht auch der Zufall ihrer Herkunft, der Leistungsdurchschnitt in der siebenten Klasse, eine nicht erkannte Begabung gewalttätige Zwänge, die sie hinter diese Mauern trieben, zwischen die giftigen Gase und die stampfenden Monstren. Und wenn sie es nicht wären, müßten es andere sein. Pflanzenschutzmittel, Weichspüler, Kunstdünger. Könnte man nicht wenigstens auf den Weichspüler verzichten?[6]
Monika Marons literarische Schilderungen werden von einem als «Streng geheim!» klassifizierten Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit vollumfänglich bestätigt.[7] Die Experten stellen 1987 fest, dass von dem VEB Chemiekombinat Bitterfeld/Halle eine «erhebliche Gefährdung für das Leben und die Gesundheit der Werktätigen und Anwohner» ausgeht. Die Fabriken sind marode und werden «im gesetzlosen Zustand weiterbetrieben». Da eine zentrale Kläranlage fehlt, werden die chemisch belasteten Abwasser direkt in die Mulde eingeleitet – zu diesem Zeitpunkt schon seit fast einhundert Jahren. Die als Giftmülldeponien dienenden ausgekohlten Tagebaurestlöcher kommen an die Grenzen ihres Fassungsvermögens. Für die «Grube Antonie» erwartet man dies schon 1988. Die «Grube Johannes» in der Nachbargemeinde Wolfen hat sich durch Einleitungen der Filmfabrik in den berüchtigten «Silbersee» verwandelt. In der Filmproduktion wurden Chemikalien eingesetzt, um die für das Filmmaterial benötigte Zellulose aus dem Holz herauszutrennen. Die gesamten Abfälle wurden in die Grube eingeleitet, wo sich ein gewaltiger, hochgiftiger Tümpel bildete, dessen Schwefelwasserstoffausdünstungen weithin einen Geruch von faulen Eiern verbreiteten. «In B. scheint keine Sonne. Es kommt vor, daß mattes gelbes Licht sich durch den Nebel quält, wie durch Milchglas.»[8]
Paradoxe Effekte
Heute ist von diesen Zuständen auf den ersten Blick nichts mehr sichtbar. Vom «Bitterfelder Bogen», einer begehbaren, monumentalen Stahlskulptur, die im Jahr 2005 eröffnet wurde, hat man einen guten Blick über das Urstromtal der Mulde, in welchem auch die Stadt liegt. Für eine romantische Ideallandschaft fehlt es dem Relief des norddeutschen Tieflands an Energie, aber ihm eignet doch eine ansprechende Naturschönheit. Ausgedehnte Wälder, die sogar Wölfe beherbergen sollen, grenzen an einen großen See mit abwechslungsreichen, weitgeschwungenen Ufern. In der Ferne ahnt man im Dunst Hügel, auf denen Windräder stehen. Die nach dem Zusammenbruch der DDR neu angesiedelten Chemiewerke sind immerhin weiß und sauber, blanke Stahlrohre glänzen in der Sonne und die Schlote entlassen nur blütenweißen Wasserdampf in die Atmosphäre. Monika Maron hat diese Wende zum Guten 2009 in einem literarischen Bericht dokumentiert, der den Namen des Monuments trägt, von dem wir auf die Stadt blicken.[9]
Allein, der Eindruck täuscht. Nicht nur hat die Solarindustrie, auf die Maron ihre ganzen Hoffnungen setzte, ihre Produktionslinie in Bitterfeld längst wieder geschlossen und nach Asien verlegt.[10] Die Probleme reichen im wahrsten Sinne des Wortes tiefer. Neben mir auf dem Bitterfelder Bogen steht Fred Walkow, der vor 1989 als Chemiker in der Filmfabrik Wolfen arbeitete und im Anschluss bis 2015 das Amt des Umweltdezernenten des Landkreises Bitterfeld versah. Der uns umgebenden Landschaft ist er verbunden. Die Wälder um uns gehören dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, in dem Walkow heute aktiv ist. Angesichts der Gegend, die sich in der Märzsonne vor uns ausbreitet, spricht er indes von einer «zerstörten Landschaft». Aus dem Tonfall und seinen Schilderungen wird deutlich, dass Walkow mit diesen Worten keinen reißerischen Effekt sucht, sondern eine präzise Diagnose formulieren will. Eine fundamentale Wahrheit über die Welt, in der wir leben, zeichnet sich unter der Oberfläche der Worte ab und nimmt langsam Gestalt an. Welche?
Die Diagnose beginnt damit, dass die gesamte Landschaft, die sich vor uns ausbreitet, von Menschenhand umgestaltet ist. Wir stehen hier eigentlich am Rande der am dünnsten besiedelten Gegenden Deutschlands und werden uns auf unseren Reisen noch viel tiefer in die anthropogenen Landschaften begeben. Aber schon hier gilt diese These von den allgegenwärtigen Spuren des Menschen ohne Einschränkung. Bei dem Hügel am Horizont – der mit Windrädern geschmückten Barbarahöhe bei Zschornewitz, der höchsten Erhebung im Gesichtskreis – handelt es sich um eine Hochkippe, auf der ab 1986 der Abraum aus einer Braunkohlegrube aufgehaldet wurde. Auch die Anhöhe, von der aus wir das Land betrachten, der Bitterfelder Berg, ist eine solche Hochkippe. Das vor uns liegende Gewässer, der Goitzschesee, ist ebenfalls künstlichen Ursprungs. Wo heute sein Wasser in der Sonne glänzt, gähnte vor nicht langer Zeit das fünfzig Meter tiefe Loch des Tagebaus Goitzsche, in dem seit 1948 großflächig die Braunkohle abgebaut wurde. Die ursprünglich durch dieses Gebiet laufende Mulde musste 1975 auf einer Länge von mehreren Kilometern verlegt werden, um den Tagebau ausdehnen zu können. Es war dies vermutlich das letzte große Projekt einer Flussverlegung in der Industrialisierungsgeschichte Deutschlands. Mit ihrem Wasser begann man 1998 die Flutung des ausgekohlten Tagebaus. Was in aller Behutsamkeit geschehen und einige Jahre hätte dauern sollen, wurde von einem Hochwasser 2002 binnen 36 Stunden jäh vollendet: Plötzlich liegt ein See in der Landschaft. Für Ortsfremde und geographische Laien weist kein Indiz auf seinen künstlichen Ursprung hin. Auch die Wälder um uns herum sind von Menschenhand gestaltet. Die Schwefelemissionen aus dem Kraftwerk haben den Wäldern als saurer Regen stark zugesetzt. Über Jahrzehnte stellte sich allerdings ein neues Gleichgewicht ein. Von den lichteren Kronen der geschädigten Bäume profitierte eine bodennahe Vegetation und es bildeten sich neue Biotope heraus.
Die «Paradoxien von Bitterfeld» nennt Walkow dies, und diese Formel schließt einen fundamentalen Perspektivwechsel ein, den uns die vor uns liegende Landschaft abverlangt. «Paradoxe Effekte» bedeutet, dass wir der heutigen Welt – den zerstörten Landschaften, der Müll-Welt – mit solchen Begriffen wie denen der «Zerstörung» oder «Verschmutzung» einer vormals «unberührten» Natur eigentlich gar nicht gerecht werden. Solche Begriffe rufen im Grunde eine statische Vorstellung hervor, wonach es einen reinen Zustand gibt, der vom Menschen allmählich verunreinigt und zerstört wird. In einem Diagramm könnte man diesen Naturzustand als einen vollständig grünen Balken bis zur Marke von 100 % darstellen. Daneben würde man Balken für die verschiedenen Landschaften der Erde, geordnet nach ihrem Verschmutzungsgrad auftragen. Der grüne Anteil fällt allmählich auf 80, 60, 40 %, und der Rest des Balkens wird rot eingefärbt. Man könnte auch differenzieren zwischen «anthropogen überformten» Landschaften, z.B. in Gelb, und kontaminierten Landschaften, etwa in Violett. Für Bitterfeld hätten wir vielleicht noch einen kleinen Sockel von 5 % in Grün, einen großen Bereich von vielleicht 60 % in Gelb und zuoberst erschreckende 35 % des Balkens in Violett.
Aber ein solches Diagramm würde der Situation nicht gerecht, denn wir haben es in der Wirklichkeit – anders als im Diagramm – nicht mit Segmenten zu tun, die unverbunden nebeneinanderstehen. Wir sprechen vielmehr über komplexe Ökosysteme, die durch menschliche Aktivitäten einem bestimmten Druck ausgesetzt werden. Der Mensch greift in sie ein, indem er gewisse Parameter verändert, manche Elemente aus ihnen entfernt und andere, neue Entitäten in sie einbringt – Spezies, Gifte, Landschaftsmerkmale. Ökosysteme reagieren auf Veränderungen dynamisch und streben unter den veränderten Bedingungen einem neuen Gleichgewichtszustand zu. Eine Veränderung an einer Stelle zieht im Allgemeinen mithin Verschiebungen in der gesamten Systemarchitektur nach sich, bis wieder eine stabile Situation erreicht ist. Selbst zerstörerische Eingriffe können neue Biotope entstehen lassen, in denen sich passende Flora und Fauna ansiedelt. Es ist wohlbekannt und in der Literatur an vielen Fällen aus aller Welt ausführlich beschrieben, dass in den vergifteten Landschaften, aus denen sich die Menschen zurückziehen müssen, die Natur wieder zum Vorschein kommt und von den freigegebenen Flächen Besitz ergreift. Die schottische Journalistin Cal Flyn hat kürzlich einen Reisebericht über diese «verlassenen Inseln» verfasst. Umweltverschmutzung kann sich, wie sie anmerkt, als effektiver Umweltschutz erweisen, und zwar so gut, dass James Lovelock, der Urheber der Gaia-Theorie, vorgeschlagen haben soll, zur Abschreckung gieriger Industrien in den tropischen Regenwäldern kleine Mengen lebensgefährlichen Atommülls einzulagern.[11]
Dies sind die «paradoxen Effekte». Die Formel enthält den Perspektivwechsel vom statisch gedachten Bild der Umweltverschmutzung zu dem dynamischer Systeme. Saurer Regen schädigt nicht einfach das Ökosystem in einem seiner Elemente, sondern führt zu unvorhergesehenen und ganz andersartigen, bisweilen gegenläufigen Effekten an anderer Stelle. Nun, wo der Schwefeleintrag aus dem Kraftwerk ausbleibt, verschiebt sich das Gleichgewicht wieder zu einem anderen Punkt. Der BUND hat beschlossen, seine Wälder, die er im Zuge der Privatisierungswelle nach dem Zusammenbruch der DDR erstehen konnte, unberührt zu lassen, damit sie sich selbst zu diesem neuen Gleichgewichtspunkt vortasten. Sicher ist dabei nur, dass dieser Punkt wieder ein neuer sein wird und die Wälder nicht zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehren. Zu viele Parameter haben sich verändert, nicht zuletzt steigende Temperaturen und veränderte Niederschlagsmengen durch den Klimawandel. So sind nicht nur die Wölfe in die Wälder zurückgekehrt, sondern auch die wärmeliebende Gottesanbeterin hat das Gebiet, aus dem warmen Süden kommend, für sich erobert. Die hier lebenden Wildschweine haben schon längst herausgefunden, dass es Schlammlöcher gibt, in welchen zu suhlen sie sofort von allen Parasiten befreit, so sehr sind sie mit polychlorierten Biphenylen (PCB) verseucht. Ihr Fleisch muss allerdings als Sondermüll entsorgt werden.
Ingenieure geben auf
Allein, sogar dieser Blick auf die uns umgebende Aussicht liefert eine – im Wortsinn – nur oberflächliche Lesart der Rede von der zerstörten Landschaft. Die Probleme reichen tiefer, nämlich tief in den Untergrund. Am entgegengesetzten Ende der Stadt liegt die Grube Antonie, die als Deponie für die Abfälle der chemischen Industrie genutzt wurde. Heute ist dort nur mehr eine Rasenfläche sichtbar. Darunter liegen allerdings die Altlasten bis in eine Tiefe von 60 Metern. In den Chemiewerken sollen bis zu fünftausend verschiedene Substanzen hergestellt worden sein. Sie alle findet man hier im Erdreich wieder. Da wir uns in einem sehr niedrigen Urstromtal der norddeutschen Tiefebene befinden, in welchem einst vor den skandinavischen Gletschern, die auf dem leicht ansteigenden Terrain Norddeutschlands irgendwann zum Stehen gekommen waren, das Schmelzwasser abfloss, steht das Grundwasser sehr hoch und durchspült die Grube Antonie und alle anderen Deponien. Man schätzt, dass unter Bitterfeld auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern etwa 200 Millionen Kubikmeter hochgradig verseuchten Grundwassers durch das Gestein strömen. Krebserregende Stoffe, für die Grenzwerte im Bereich von Mikrogramm festgesetzt wurden, liegen hier in hunderttausendfach erhöhten Konzentrationen von Gramm pro Liter vor. Würde man eine Probe nehmen, wüsste man an manchen Stellen nicht, ob man es mit verschmutztem Wasser oder nicht vielmehr mit verdünntem Schmutz zu tun hat.
Die «zerstörte Landschaft» meint also auch dies: eine immense giftige Altlast im Untergrund. Manchmal spricht man von der «Bitterfelder Blase», aber dieses Bild trifft die Realität nicht. Eine Blase ist zwar fragil, und ihr «Platzen» evoziert die Vorstellung einer drohenden Katastrophe, die mitnichten bereits abgewendet wäre. Gleichwohl handelt es sich bei einer Blase um ein zumindest temporär stabiles, bekanntes und klar abgegrenztes Phänomen. Für den giftigen Untergrund von Bitterfeld ist all dies indes nicht der Fall. Zuallererst handelt es sich bei dem Grundwasserkörper nicht um ein stehendes Wasser, sondern eigentlich um einen Fluss. Das Oberflächenwasser versickert im Boden, bis es auf eine undurchlässige Schicht trifft, zum Beispiel aus Ton, um sodann dem natürlichen Gefälle durch lockerere Schichten zu folgen. In Bitterfeld sind die Ströme kompliziert, da die Mulde in ihrem breiten Urstromtal in den letzten zehntausend Jahren frei mäandern konnte, wobei im Laufe der Jahrtausende seit der letzten Eiszeit ein sehr heterogener Untergrund entstand. Dichtere Sedimente wechseln ständig mit alten Flussbetten, die mit lockerem Gestein gefüllt sind und das Grundwasser lokal in stark variierende Richtungen leiten können. Mit der Trockenlegung der Tagebaue schon seit dem späteren 19. Jahrhundert hat man auch in diese auf der Oberfläche unsichtbare Dynamik eingegriffen. Ein Tagebau ist ein künstliches Loch in der Hydrosphäre, welches die Grundwasserströme anzieht und zu sich hin umlenkt. Mit der Flutung der Goitzsche hat man diese Eingriffe erneut umgekehrt und damit eine neue Problemlage geschaffen. Der Grundwasserspiegel stieg an, weshalb die giftige Brühe nun allenthalben in Gebäude eindrang. Eine Grundschule musste geräumt und endgültig aufgegeben werden. Wir sehen uns das hübsche, nostalgisch anmutende Gebäude an. Man glaubt noch, die Kinderstimmen zu hören. Um eine tiefliegende Siedlung wurde für die enorme Summe von 10 Millionen Euro eine unterirdische Mauer gezogen. Aus dem derart künstlich geschaffenen Becken muss das Grundwasser rund um die Uhr abgepumpt und sodann in einer speziellen Kläranlage behandelt werden. Noch schlimmer allerdings ist, dass nun das Grundwasser die aus den Deponien ausgewaschenen Giftstoffe langsam in Richtung Mulde spült. Hier spielt sich im Untergrund eine Katastrophe in Zeitlupe ab, die man verzweifelt einzudämmen bemüht ist. Das einzige Hilfsmittel besteht darin, das Grundwasser auf dem Weg zur Mulde abzupumpen und zu reinigen – während die Deponien noch Nachschub für mehrere Jahrtausende bereithalten.
Die vermeintliche Blase ist also kein statisches Objekt, ja im eigentlichen Sinne nicht einmal ein Objekt, sondern eher eine Situation. Physikalisch haben wir es mit einem komplizierten Fließgeschehen zu tun. Umwelttechnisch hat die Blase ihren Status radikal geändert: Nahm der Grundwasserkörper ursprünglich die von der Chemieindustrie ausgehende Verschmutzung auf, so gibt er sie heute unter den neuen Bedingungen an die weitere Umwelt ab. Aus der «Senke» in der Dynamik der Giftströme wurde eine «Quelle». Anders, als es das Bild der Blase nahelegt, handelt es sich bei dem Untergrund von Bitterfeld aber auch nicht um ein «bekanntes» Objekt. Die fünftausend eingebrachten Chemikalien führen im Untergrund ein Eigenleben. Sie vermengen und vermischen sich, provozieren Reaktionen, die womöglich Stoffe hervorbringen, die noch in keinem Labor der Welt untersucht und in keinem Buch beschrieben worden sind. Niemand kann sagen, welche Stoffe sich im Untergrund bilden und wo diese unbekannten Substanzen einst wieder auftauchen werden.
Diese komplizierte Situation war es auch, die bisher alle Ansätze, der Lage Herr zu werden, scheitern ließ. Wir haben bereits gesehen, dass es mikrobielle Prozesse in früheren Epochen der Erdgeschichte waren, die die Grundlagen für die späteren industriellen Aktivitäten der Menschheit geschaffen haben. Der Planet Erde ist in seiner heutigen Gestalt mitnichten das Resultat bloß der geologischen Kräfte. Vielmehr hat, wie der sowjetische Wissenschaftler Vladimir Vernadsky schon vor einhundert Jahren feststellte, das Leben selbst tief in sie eingegriffen, und zwar für lange Zeit durchaus führend die kleinsten der Lebewesen, nämlich die Bakterien.[12] Es waren schon solche Wesen, genauer Cyanobakterien, die die Uratmosphäre erst mit Sauerstoff anreicherten und somit die Grundlagen für die ihnen folgenden Organismen schufen. Diese Erkenntnis, auf die wir noch zurückkommen werden, bezeichnet man heute in der Biologie als «Nischenkonstruktion» oder «Koevolution» von Spezies und Umwelt. Sie ersetzt die evolutionsbiologische Vorstellung, dass sich Arten immer besser an ihre Umwelt anpassen, durch die Einsicht, dass die Umwelt keinen festen, von den Organismen unabhängigen Parameter darstellt, sondern durch die Lebewesen durchaus einschneidend verändert werden kann. Die Relevanz dieses Konzepts für das Thema Müll liegt auf der Hand, denn Müllproduktion ist eine Form von Nischenkonstruktion. Der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss evozierte genau dieses Bild, als er die Menschheit mit Mehlwürmern in einem Sack Mehl verglich, die ihren Lebensraum «mit ihren eigenen toxischen Ausscheidungen zu vergiften beginnen, noch ehe die Nahrung oder der Platz aufgebraucht sind». Er diagnostizierte der Menschheit «eine Organisationsform der inneren Vergiftung».[13] – Vor diesem Hintergrund ist die Idee, Mikroorganismen zur Sanierung chemisch belasteter Gebiete einzusetzen, gar nicht abwegig. Dieser Ansatz nennt sich Bioremediation, und er reiht sich in eine ganze Serie von Versuchen ein, das Mikrobiom zu zähmen und für unsere Zwecke einzusetzen – von der Züchtung von «Hochleistungsstämmen» in der Produktion von fermentierten Lebensmitteln bis hin zu Versuchen der «Bioextraktion» oder des «Biomining» in der Gewinnung von Rohstoffen und insbesondere auch ihrer Rückgewinnung aus Abfällen (wovon wir später noch mehr hören werden).
In Bitterfeld musste diese Technologie allerdings versagen. Sie wurde an anderen Orten bereits erfolgreich eingesetzt, um bestimmte Chemikalien durch hochspezialisierte Bakterienstämme in vergifteten Böden abzubauen. Aber wie geht man mit einer Altlast von fünftausend verschiedenen Chemikalien und ihren unbekannten Reaktionsprodukten um? Das praktische Problem beinhaltet auch eine philosophische Schwierigkeit. Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger hat den Begriff des «epistemischen Objekts» geprägt.[14] Epistemische Objekte sind vage umrissene Gebiete des Unbekannten, die unter den Möglichkeiten des experimentellen Zugriffs allmählich Gestalt annehmen. Haben sie sich hinreichend stabilisiert, und haben wir ihr Verhalten und ihre Reaktionen auf wechselnde Umstände besser kennengelernt, lassen sich diese Objekte als Werkzeuge einsetzen, zu praktischen Zwecken in der angewandten Technologie, aber auch um in der Forschung als technische Apparate neue unbekannte Gebiete zu erschließen. Man denke etwa an radioaktive Erze. Ende des 19. Jahrhunderts stieß man auf seltsame Strahlungen, die unsichtbar sind, aber in verschiedensten Effekten verräterische Spuren hinterlassen. Nur wenige Jahrzehnte später hat sich das epistemische Objekt weitgehend stabilisiert und kann in der Kerntechnik zu friedlichen oder zerstörerischen Zwecken gezielt eingesetzt werden. Zugleich gelang es, die radioaktiven Strahlen im Labor einzusetzen, um einen Blick in die subatomare Struktur der Materie zu werfen, also neue Felder epistemischer Objekte zu eröffnen.
Epistemische und technische Objekte bilden derart keine getrennten Klassen, in die wir die Welt sortieren können. Die beiden Kategorien sind vielmehr aufeinander bezogen, bringen sich gegenseitig hervor: Epistemische Objekte tauchen in einem technischen Rahmen auf, der sich selbst aus ehemaligen epistemischen Objekten zusammensetzt, wie auch die aktuellen epistemischen Objekte allmählich zu technischen Objekten werden. Der Müll erweitert diese Dialektik offenbar um eine weitere Wendung. In den Altlasten der Chemieindustrie erleben wir, wie Technologie in ihren Nebenfolgen neue epistemische Objekte hervorbringt. Neue, unscharfe, unbekannte Dinge tauchen auf. Der Untergrund von Bitterfeld, der eigentliche Kern der zerstörten Landschaft, ist ein solches unbekanntes Objekt, von dessen Bewegungsgesetzen und chemischer Zusammensetzung wir nur eine vage Ahnung haben.
Und noch in einer dritten Hinsicht erweist sich das Bild einer «Blase» unter Bitterfeld als irreführend. Eine Blase hat eine scharf definierte Grenze. Ein wenig später am Tage stehe ich mit Fred Walkow in einer idyllischen Auenlandschaft am Ufer des Spittelwassers, ein kleiner Zufluss der Mulde. Die Gegend gehört zum UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe, übrigens auch schon vor 1989. Nur entsorgten damals die in Wolfen ansässigen Chemiefabriken über diesen Fluss einen Teil ihres Giftmülls. Die Filmfabrik Wolfen leitete ihre Abfälle vor allem in die stillgelegte Grube Johannes ein, die sich darüber in jenes gewaltige stinkende Schlammloch des Silbersees verwandelte. Auf der Fahrt machen wir hier kurz Halt. Die Schlämme sind vor allem mit Chlorkohlenwasserstoffen und Schwermetallen belastet. Diese Altlasten gehören nicht einmal zu den giftigsten in der Gegend, haben aber aufgrund von Schwefelwasserstoffausdunstungen, die einen Geruch von faulen Eiern verbreiten, besondere Bekanntheit erlangt. Auch hier steht die Deponiesohle im Grundwasser. Die 5 Millionen Kubikmeter auszubaggern, steht nicht zur Debatte. Stattdessen versucht man, die Situation notdürftig zu stabilisieren, indem man – nach dem bewährten Rezept zur Kontrolle von Waldbränden – Feuer mit Feuer, hier nämlich Müll mit Müll bekämpft. Es wurde begonnen, den See mit den Schlacken aus der örtlichen Müllverbrennungsanlage zu verfüllen, damit diese die Gifte binden und als trockene Masse zumindest am Ort fixieren. Allerdings wurden beim Einkippen der Schlacken die alten Sedimente wieder aufgewirbelt, wodurch die Bildung von Schwefelwasserstoff wieder in Gang kam und die Maßnahme aufgrund des neu auflebenden Gestanks unterbrochen werden musste. Das Spittelwasser war der zweite Abfuhrweg für die Abfälle. Wenn es gegen den Osten ging, entdeckte die Westpresse mit einem Mal ihr ökologisches Gewissen, und so zeichnete 1990 der Spiegel ein Bild der Situation in dramatischen Farben:
Mehr als 70 Millionen Kubikmeter Abwasser, genug für einen Tankwagenzug, der von Hamburg bis Melbourne reicht, leitet das CKB [VEB Chemiekombinat Bitterfeld] Jahr für Jahr aus seinen Reaktionsöfen und Rührmaschinen in Bitterfeld und Wolfen ab – der größte Teil läuft dem Spittelwasser zu, ein kleinerer fließt in die Mulde. Darin sind unter anderem 176.000 Tonnen Salze, 250 Tonnen Phenole und 1200 Tonnen direkt toxische Stoffe enthalten. Außerdem schwimmen 42 Tonnen reine Schwefelsäure, 8 Tonnen Quecksilber, mehrere tausend Tonnen der gefährlichen Chlorierten Kohlenwasserstoffe und Riesenmengen von aromatischen Kohlenstoffverbindungen, zum Beispiel Mercaptane, jedes Jahr in der Giftbrühe mit – das Kombinat mit seinen 80 Einzelbetrieben hat keine ordentliche Kläranlage.[15]
Das Spittelwasser war zu dieser Zeit biologisch tot. Die Giftbrühe ergoss sich über die Mulde in die Elbe und gelangte schließlich in die Nordsee. Noch heute sind in den Fischen des Wattenmeers Chemikalien aus Bitterfeld nachweisbar. In Aalen finden sich z.B. Nebenprodukte aus der Herstellung von Insektiziden.[16] «Wo hört Bitterfeld auf?», fragt Fred Walkow rhetorisch, als wir uns in der idyllischen, renaturierten Auenlandschaft des Spittelwassers umsehen. Nicht am Ortsschild, nicht an der Mündung des Spittelwassers in die Mulde noch an der der Mulde in die Elbe, und auch nicht in der Helgoländer Bucht, in die sich die Elbe ergießt. Nirgends. Die persistenten Gifte können nur ihren Ort verändern, aber sie verschwinden nicht. Allein, Bitterfeld hört nicht nur nirgends auf, sondern fängt auch nirgends an. Walkow erzählt, dass zu seiner Zeit in der Wolfener Filmproduktion ein merkwürdiges Problem auftrat. Das Filmmaterial wies Flecken auf, als sei es stellenweise zu einer Belichtung gekommen. Der Ursprung des Problems, so stellte sich heraus, lag im Wasser der Mulde, das bei der Produktion verwendet wurde. Die beiden Quellflüsse der Mulde – die Zwickauer und die Freiberger Mulde – entspringen im Erzgebirge, wo nach dem Krieg auch Uran für die sowjetischen Atommeiler abgebaut wurde. Zeitweise deckte die Sowjetunion ihren Brennstoffbedarf hauptsächlich über diese Mine. Konrad Wolfs Film Sonnensucher von 1958, ein Klassiker des DDR-Kinos, erzählt in beeindruckenden Bildern von dem Bergwerk und den komplizierten Konflikten, die um die «Wismut» der unmittelbaren Nachkriegszeit kondensieren.
Es entbehrt nicht einer merkwürdigen Ironie, dass die Mulde radioaktive Abfallstoffe des Uranbergbaus hinab nach Wolfen spülte, wo in der Filmfabrik die von kaum einem Kulturhistoriker zur Kenntnis genommenen materiellen Voraussetzungen für die siebte Kunst des Kinos geschaffen wurden. Denn nichts anderes als die Strahlung dieser Radionukleide war es, die die Flecken auf dem Filmmaterial verursachte. Jenseits aller Ironie hält der Fall aber auch eine allgemeine Lehre bereit. Bitterfeld verseuchte nicht nur die flussabwärts gelegenen Gebiete, sondern empfing seinerseits Gifte vom Oberlauf. «Bitterfeld» – wenn wir mit diesem Wort endlich keine Stadt in Mitteldeutschland mehr meinen, sondern einen Zustand und eine Gegenwartsdiagnose – dieses Bitterfeld hat keinen Anfang und kein Ende, sondern beschreibt eine Welt, in der der Müll überall ist.
Jupiter und Venus in Konjunktion
Hier berühren wir einen zentralen Punkt. Wir haben «B.» als Tor zur Welt des Mülls gewählt, aber diese Wahl war im Grunde beliebig, da sich hinter dem Tor eine Welt auftut, in welcher der Müll allgegenwärtig ist. Zwischen 1900 und 2015 soll die Menschheit geschätzte 1315 Gigatonnen (1315.000.000.000.000 kg) festen und flüssigen Müll und noch einmal 643 Gigatonnen gasförmige Emissionen produziert haben, insgesamt also 2000 Gigatonnen oder 2 Billionen Tonnen Abfall.[17] Das entspricht 100 Millionen mal dem Gewicht des Eiffelturms (10.000 t), mehr als zehn Bergen von der Größe des Mount Everest (wenn man diesen näherungsweise als einen Kegel aus Granit betrachtet und seine Höhe über dem Meeresspiegel misst) und somit auch mehr als dem Zehnfachen des Halley’schen Kometen, der bisweilen am Firmament erstrahlt. Unser Mond ist immerhin noch 40 Millionen Mal schwerer, womit aber der Müll auf einer logarithmischen Skala (welche zählt, wie oft wir mit 10 multiplizieren müssen) immerhin die stolze Mitte zwischen dem Eiffelturm und dem Erdtrabanten einnimmt. – Und der Müll wächst natürlich immer weiter. Fast fünf Tonnen fügt jeder EU-Bürger jährlich allein an festen und flüssigen Hinterlassenschaften hinzu, wobei die Haushaltsabfälle – also diejenigen Abfälle, die wirklich durch unsere eigenen Hände gehen – nur etwa 10 % der Gesamtmenge ausmachen.[18] Aber es gibt natürlich enorme Mengen an Müll, die wir zwar nie zu Gesicht bekommen, aber durchaus durch unseren Konsum verursachen. Die großen Anteile fallen auf Bergbau und den Bausektor. Erst danach folgen Abwasser und Industriemüll mit Anteilen, die dem Hausmüll vergleichbar sind, und weit hinten folgen Dienstleistungen, Landwirtschaft und der Energiesektor. Wenn wir der Zurechnung von Müllmengen das Prinzip der Verursachung durch Konsum zugrunde legen, dürften diese Zahlen sogar noch zu gering ausfallen, da die europäischen Länder viele material- und energie- und somit auch müllintensive Produktionen in Länder des Globalen Südens ausgelagert haben, denen die Müllmengen bei der territorialen Verrechnung – es zählt der Produktionsort, nicht das Zielland des fertigen Produkts – noch angelastet werden. Die CO2-Emissionen, die in China bei der Produktion von für den britischen Markt bestimmten Waren entstehen, entsprechen dem gesamten Ausstoß des Treibhausgases in Großbritannien selbst, dessen Emissionen man bei einer konsum-basierten Bilanz mithin getrost doppelt so hoch veranschlagen kann.[19]
Diese Zahlen, die einen Eindruck von der schieren Größe des Müllproblems verschaffen sollen, haben indes eine ziemlich beschränkte Aussagekraft, schon weil uns noch der richtige Maßstab fehlt, um sie einordnen zu können. Sind zwei Billionen Tonnen viel oder wenig? Wir können es zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Und dann unterschlagen diese nackten Mengenangaben weitere wichtige Informationen. Über welche Arten von Stoffen sprechen wir überhaupt, in welcher Form liegen sie vor und welche Wirkungen entfalten sie in der Umwelt? Einige beeindruckende Phänomene aus der Müllwelt, die uns eine erste Ahnung von der Qualität des Problems liefern können, wurden in den vergangenen Jahren tatsächlich von den Medien aufgegriffen. Ein Beispiel ist die Plastikverschmutzung der Weltmeere. Die Masse des von Menschen hergestellten Plastiks übertrifft die Masse aller Tiere zu Land und zu Wasser um das Doppelte. Große Mengen dieses Plastiks sind heute Müll. Wohl mehr als 100 Millionen Tonnen davon haben bereits ihren Weg in die Ozeane gefunden, und 20 Millionen Tonnen kommen inzwischen jährlich dazu.[20] 100 Billionen (1 Billion sind 1 Million Millionen) Plastikteile verschiedenster Größe mit einem geschätzten Gesamtgewicht von 80.000 Tonnen haben sich im Nordpazifik zwischen Hawai und der kalifornischen Küste zu einem gewaltigen Müllstrudel zusammengefunden, dem «Great Pacific Garbage Patch», der mit 1,6 Millionen Quadratkilometern das Dreifache der Fläche Frankreichs bedeckt.[21] Die Plastikteile zerreiben sich allmählich zu feinsten Partikeln, dem sogenannten Mikroplastik, die sich in den Ökosystemen umso besser verteilen, aber auch wieder in Organismen anreichern. Ein anderes Beispiel, welches in den Medien Furore machte, ist die Müllkippe für Fast-Fashion in der chilenischen Atacama-Wüste. 59 Tausend Tonnen schnelllebiger Modeartikel, die in den USA und Europa keine Abnehmer fanden, werden jährlich nach Südamerika verschifft, wo allerdings nur ein Drittel von den Märkten absorbiert wird. Die übrigen zwei Drittel werden in der Atacama-Wüste aufgehaldet, wo sie inzwischen eine neue Landschaft bilden, groß genug, um selbst aus dem Weltraum sichtbar zu sein: Hügel aus synthetischen Textilien, mit allen erdenklichen Giftstoffen belastet, die sich dort über viele Jahrhunderte allmählich zersetzen und dabei ihre giftigen Inhaltsstoffe umso weiter in der Welt verbreiten werden.[22]
Kein Ort der Welt ist vor diesen Hinterlassenschaften mehr sicher, und sei er noch so weit von aller Zivilisation entfernt. Die Gletscher des Himalayas schwitzen heute unter steigenden Temperaturen Pestizide und Quecksilber aus, die sich dort über die vergangenen Jahrzehnte angereichert haben.[23] Diese Kontamination mit Giften erstreckt sich nicht nur in die fernsten und unwirtlichsten Winkel der Natur, sondern auch in die uns nächste Natur, nämlich das Stück Natur, welches wir selbst sind. 2004 landete der WWF einen Coup, als er im Blut von EU-Abgeordneten 76 verschiedene Chemikalien industriellen Ursprungs nachweisen konnte. Im Blut einer jeden einzelnen Testperson fand sich ein giftiger Cocktail aus einem verstoffwechselten Rest des Insektizids DDT, dem Fungizid HCB (Hexachlorbenzol), dessen Einsatz in der Landwirtschaft in Europa schon seit 1981 verboten ist, und dem als Flammschutzmittel verwendeten BDE (bromierter Diphenylether).[24] Um eine Kontamination mit solchen Stoffen aufzuweisen, muss man nicht erst im Laufe seines Lebens mit diesen Chemikalien in Berührung kommen, ja man muss nicht einmal die Muttermilch abwarten, die nicht nur bei einzelnen Frauen, sondern in der gesamten Bevölkerung kontaminiert ist. In Wahrheit kommt schon das ungeborene Kind im Uterus mit Schwermetallen, organischen Verbindungen und Pestiziden in Kontakt.[25] Die Folgen für die Gesundheit sind weitgehend unbekannt und werden von staatlichen Einrichtungen auch nicht systematisch studiert. In der Literatur ist von einem erschreckenden Spektrum von Krankheiten die Rede: «Aufgrund ihrer Fähigkeit, biologische Systeme zu stören, häufig durch Störungen des Hormonhaushalts, werden sie mit einer immer stärkeren Belastung durch chronische Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter Stoffwechselstörungen, Störungen der Gehirnentwicklung und Krebs» – so schrieben gerade US-amerikanische Medizinerinnen in einem Weckruf «Akute Gefahr für Mutter und Kind: Dringende Maßnahmen gegen den Klimawandel und giftige Chemikalien erforderlich».[26] Der gemeinsame Nenner von Klimawandel und Giftmüll besteht nicht nur in der an dieser Stelle hervorgehobenen besonderen Vulnerabilität von Frauen und Kindern, sondern auch, wie ein anderer Artikel derselben Zeitschriftenausgabe hervorhebt, in der gemeinsamen Ursache: fossile Brennstoffe, die nicht nur bei ihrer Verbrennung Treibhausgase freisetzen, sondern auch den entscheidenden Rohstoff für die chemische Industrie liefern.[27] Und damit sind wir wieder in B.
«B.» war einmal die dreckigste Stadt Europas. Heute ist sie ein Ort in der dreckigsten Welt aller Zeiten – aber ein Ort, der uns einige wesentliche Eigenschaften des Phänomens exemplarisch zeigt. Wir haben nun schon gesehen, dass die vermeintliche «Blase» unter Bitterfeld die wichtigsten Eigenschaften eines solchen Objekts entbehrt: Sie ist nicht statisch, sondern ein kompliziertes Geschehen, sie ist nicht bekannt, sondern in Struktur, Zusammensetzung und Entwicklungstrajektorie bestenfalls zu erahnen, und sie hat keine definierten Grenzen. Die Grenzenlosigkeit resultiert dabei nicht einfach nur aus der Tatsache, dass hinter jedem Bitterfeld ein weiteres Bitterfeld liegt. Jeder dieser Orte überschreitet vielmehr aus sich selbst heraus seine Grenzen, indem der Müll sich immer weiter verteilt und in die Umwelt diffundiert.
Fred Walkow spricht in diesem Zusammenhang vom «Gesetz der Entropie», wobei er den Blick vom Bitterfelder Bogen über die Landschaft gleiten lässt, ganz so, als ob man dem Müll in seiner immer feineren Verteilung nachspüren könnte. Entropie meint in diesem Fall, dass sich die Materie unter der Einwirkung der natürlichen Kräfte in der Umwelt immer weiter verteilt. Jede Maßnahme, ihrer Herr zu werden, muss damit umgekehrt immer größere Mengen an Energie mobilisieren, was schnell an die Grenze des technisch Machbaren stößt. Sind Mikroplastik und chemische Moleküle erst einmal überall, so wird man sie mit normalen technischen Verfahren auch nicht mehr aufsammeln können.
Ziehen wir nun all diese Diagnosen zusammen, die es verbieten, sich das Problem von Bitterfeld als eine «Blase» vorzustellen, so zeigt sich, dass wir es mit einer neuartigen, unbekannten Situation und einer neuartigen Entität zu tun haben, für die wir mithin auch einen neuen Namen benötigen. Die Namensgebung ist kein unschuldiger Akt, wie uns die belgische Philosophin Isabelle Stengers in diesem Zusammenhang erinnert, sondern geht mit wichtigen Vorentscheidungen einher: «Einen Namen zu geben bedeutet nicht zu sagen, was wahr ist, sondern dem Benannten die Macht zu verleihen, uns in der Weise fühlen und denken zu lassen, wie es der Name verlangt. [… Einen Namen zu geben] bedeutet, eine Frage zu benennen, dabei aber auf keinen Fall schon die Begriffe vorzugeben, in denen die Antwort zu erfolgen hat, weil dies ja hieße, dass doch nur wir – wieder und wieder nur wir – das letzte Wort beanspruchen würden.»[28] Der Name soll anzeigen, dass die Entität nun in der Welt ist, dass wir an ihrer Existenz nicht unschuldig sind, dass sie uns angeht und sich vielleicht unser Schicksal an ihr entscheidet. Damit wollen wir zugleich aber auch nicht den alten Fehler wiederholen, mit der Benennung unseren Herrschaftsanspruch zu besiegeln, wie die Benennung aller Lebewesen durch Adam im ersten Buch Mose oft gedeutet wird: