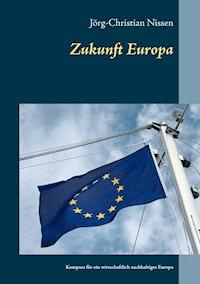
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch beschreibt die Sehnsucht nach einer demokratischen Umgestaltung Europas und einen politischen Kompass für eine Republik mit einfachen Strukturen. Dabei stehen immer die Menschen im Mittelpunkt der Überlegungen. Hier werden die Herausforderungen und sozialen Verwerfungen der Globalisierung nicht schöngeredet, sondern grundlegende Änderungen der Wirtschafts- und Währungsordnung sowie eine soziale Neuaufstellung Europas entworfen. Die alten Nationalstaaten sind zu klein und schwach, um sich in einer Welt der wirtschaftlichen Globalisierung gegen die Übermacht der international aufgestellten Wirtschaft zu behaupten. Nur in einem gemeinsamen Europa können die Bürger ihre politische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Mit einem Rückzug auf kleinere Einheiten ist das heute nicht mehr möglich. Geprägt durch seine beruflichen Erfahrungen versucht der Autor, einen Ausweg aus der derzeitigen Krise der europäischen Institutionen aufzuzeigen. Dabei spielen eine Rückbesinnung auf die Stärken der sozialen Marktwirtschaft, eine deutliche Vereinfachung der Steuer- und Sozialsysteme, die Konstruktion stabiler Regelkreise und die Trennung von Finanz- und Realwirtschaft eine entscheidende Rolle. Die Herleitung der erforderlichen Änderungen hat ihren Ursprung in der von vielen kritiklos akzeptierten Globalisierung mit ihren nicht mehr übersehbaren Fehlentwicklungen unserer Zeit. Die vorgeschlagenen Reformen orientieren sich immer ganz nah an den Bedürfnissen der Menschen. Die Einfachheit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Autor macht deutlich, dass die Menschen eine Neuaufstellung Europas nur lieben werden, wenn sie diese auch verstehen. Das gilt insbesondere für die Verfassung und die sie direkt betreffenden gesetzlichen Regelungen. Was die Menschen nicht verstehen, können sie auch nicht wertschätzen. Ausgehend von dieser Grundüberzeugung beschreibt der Autor einen Weg, wie unserer Gemeinwesen in Richtung einer sozialen Einfachheit weiterentwickelt werden kann. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass sich die vorgeschlagenen Reformen in kleinen Schritten umsetzen lassen. So können die Auswirkungen auf unser Wirtschaftsleben sukzessive beobachtet und der hier vorgestellte Kompass laufend neu geeicht werden. Das gibt Sicherheit, die die Menschen so dringend benötigen. Das alte Versprechen, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen selbst, wird so wieder für eine große Mehrheit der Menschen eingelöst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gedanken zur Zukunft Europas:
Ein starkes Europa in der Welt
Rechtliche Einheit und kulturelle Vielfalt
Gemeinden als liebenswerte Heimat der Menschen
Gleichheit vor dem europäischen Recht in der Republik
Effiziente digitalisierte Verwaltung in den Regionen
Wohlstand und Sicherheit in der Gemeinschaft
Solidarität und Chancengerechtigkeit
Soziale Einfachheit
Zukunft Europa
Kompass für ein wirtschaftlich nachhaltiges Europa Freiheit·Gleichheit·Brüderlichkeit in einer Republik Europa
(Quelle: Wikimedia Commons)
Jörg-Christian Nissen
Ausgabe 2017
Für Jana
Mein Dank gebührt
allen meinen Freunden, die sich geduldig meine Ideen angehört und das Manuskript gelesen haben. Sie haben mich in vielen Punkten inspiriert und korrigiert. Ausgangspunkt und Motivation zu diesem Buch war das Studium der Programme aller mir bekannten deutschen Parteien Anfang 2016. Viele Standpunkte, die ich für richtig gehalten habe, finden sich hier komprimiert wieder. In diesem Sinne waren an diesem Gemeinschaftswerk viele politisch aktive Menschen beteiligt. Mein besonderer Dank gilt meinen Freunden Udo Gruber und Christoph Freist, die mich immer wieder herausgefordert haben, und meiner Ehefrau Gabi, die alle meine Marotten ertragen und dann auch noch das Manuskript korrekturgelesen hat.
„Keine Idee ist eine gute, die nicht am Anfang als völlig illusorisch erschien“
Albert Einstein
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Utopie oder Kompass
Kompass für ein wirtschaftlich nachhaltiges Europa
Teil I
Die Krise der Demokratie und ihre Ursachen
Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute?
Politikverdrossenheit
Was macht immer mehr Bürger unzufrieden?
Vom Urvertrauen zur Angst
Die Menschen brauchen Sicherheit
Angst vor dem Unbekannten
Fremdenfeindlichkeit als Sensor für die Verunsicherung
Verstärkung der Angst durch die Medien
Wahrheit, Fakten und politische Korrektheit
Demokratie in Gefahr?
Materielle und emotionale Ursachen der Unzufriedenheit
Materielle Ursachen
Emotionale Ursachen
Was ist die Konsequenz?
Gewaltenteilung und der Einfluss der Juristen
Teil II
Gemeinwohl und Komplexität
Was muss sich ändern?
Wo kommen wir her - wo gehen wir hin?
Primat der Ökonomie und eine am Menschen orientierte Ordnung
Freiheit:
Gleichheit:
Brüderlichkeit:
Soziale Marktwirtschaft und Gemeinwohl
Grenzen der Marktwirtschaft, Monopole und Infrastruktur
Warum etwas ändern?
Fluch der Komplexität
Teil III
Die Sehnsucht nach Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit
Gerechtigkeit durch soziale Einfachheit als neues Ziel
Was ist das Ziel?
Der Charme der Einfachheit
Einfach ist gerecht
Komplexität nützt nur wenigen
Anforderungen an die neue Ordnung
Nur was ich verstehe, kann ich auch lieben
Einfachheit
Beständigkeit
Sicherheit
Gerechtigkeit
Freiheit des Einzelnen
Wohlstand
Republik Europa oder vereinigte Staaten?
Ein Europa der Bürger - soziale Gerechtigkeit
Kernthesen für ein besseres Europa
Der Charme einer sozialen und gerechten Einfachheit
Demokratie, gemeinsames Recht und kulturelle Vielfalt
Wohlstand für alle
Sicherheit hier und heute
Gerechtigkeit durch Einfachheit
Einfache und verlässliche Zukunftsvorsorge für das Alter
Eine Vision für künftige Generationen
Teil IV
Vereinigung freier Bürger in einer föderalen Republik
Ein Markt - eine Währung - eine Demokratie
Ein Europa der einfachen Strukturen
Ein föderales Europa der Bürger
Die Bürger und ihre Rechte
Subsidiarität
Heimat und kulturelle Vielfalt in den Gemeinden
Effiziente Verwaltung in den Regionen
Die föderale Republik Europa der Bürger
Verantwortungsbereiche auf der Ebene der Republik
Abgrenzung der Verantwortungsbereiche
Europa in der Welt
Europäische Interessen und partnerschaftliche Zusammenarbeit
Außenpolitik
Sicherheits- und Verteidigungspolitik - einfache Strukturen
Internationaler Handel
Asyl und Migration
Rechte der Regionen
Steuern und Finanzen
Selbstverantwortung und Umverteilung
Grundüberlegungen
Sozialer Ausgleich
Haushalt und Steuern in der Republik, den Regionen & Gemeinden
Verzicht auf die Gewinnermittlung und -besteuerung
Besteuerung der Stromgrößen und nicht der Bestände
Einkommensteuer und sozialer Ausgleich
In Ausnahmefällen Zusatzbeiträge der Regionen und Gemeinden
Die Staatssteuer zur Finanzierung der Republik
Mehrwertsteuer - 2. Säule der Umverteilung
Die Investitionssteuer - Abgrenzung zum Sparen
Auswirkungen auf die Leistungsträger der Gesellschaft
Weitere Verbrauchsteuern
Kohlenstoffsteuer
Finanztransaktionssteuer
Grundsteuer
Vermögensteuer
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Rechte der Finanzverwaltung
Einfache Zusammenfassung
Und darüber hinaus - Steuern mit Lenkungswirkung
Versuch einer Quantifizierung
Exkurs: Kritische Beurteilung - alles noch einfacher möglich?
Geld und Währung
Die Monetative als 4. Gewalt
Vier Hauptaufgaben der Monetative
Aufgabe 1: Geldversorgung für die Realwirtschaft
Aufgabe 2: Preisstabilität
Aufgabe 3: Absicherung der Einlagen auf den Konten der Bürger
Aufgabe 4: Sichere Altersvorsorge
Regelkreise der Geldversorgung und Alterssicherung
Sozial- und Bildungspolitik
Umverteilung und Chancengerechtigkeit
Presse und Meinungsfreiheit
Bedingungsloses Grundeinkommen
Familienförderung
Chancengerechtigkeit durch Bildung
Arbeitslosen- und Rentenversicherung
Gesundheit
Quantifizierung des bedingungslosen Grundeinkommens
Wirtschaft und Recht
Soziale Marktwirtschaft in Europa
Europaweites Leben
Rechtsstaat
Soziale Marktwirtschaft und Freiheit der Bürger
Schutz der Umwelt
Öffentliche Verwaltung - demographischer Wandel
Schutz geistigen Eigentums - europäische Standards
Infrastruktur
Trennung von Real- und Finanzwirtschaft
Schutz der Realwirtschaft vor den Risiken der Finanzmärkte
Geldkreisläufe der Real- und der Finanzwirtschaft
Abgrenzung zwischen Real- und Finanzwirtschaft
Die erste Firewall - Schutz der Privatpersonen
Die Finanzwirtschaft hinter der ersten Firewall
Die zweite Firewall - Reibungsverlust beim Finanztransfer
Kompatibilität mit einer einfachen Besteuerung
Teil V
Zusammenfassung und Ausblick
Packen wir es an - Mut zur Einfachheit
Zusammenfassung der Vorschläge
Wohin geht die Reise?
Attraktivität des neuen Europas
Was macht dieses Europa interessant?
Für die Menschen und Bürger Europas
Für die Gemeinden und ihre Bürger
Für die Regionen und die Mitarbeiter in den Verwaltungen
Für die Nutzer unserer Kulturlandschaft und die Landwirtschaft
Für die besten Köpfe der Welt
Für die innovativsten Unternehmen
Und wie weiter?
Der Weg in ein am Menschen orientiertes Europa
Postfaktische Zeiten
Stufenweise Umsetzung
Wieder nur ein Elitenprojekt?
Kritische Diskussion
Anmerkungen
1
Vorwort
Konrad Adenauer hat 1957 mit dem Slogan „Keine Experimente“ die Bundestagswahl in der alten Bundesrepublik Deutschland gewonnen. Menschen wollen Sicherheit. In den 1950er Jahren ging es fast allen von Jahr zu Jahr besser. Das wollte die Mehrheit der Wähler nicht aufs Spiel setzen.
Auch heute geht es vielen Bürgern immer besser. Wir sind immer besser geschützt und abgesichert. Dennoch fühlen viele Menschen eine zunehmende Unsicherheit. Es fällt in Deutschland immer schwerer, dem Wohlstands- und Sicherheitsversprechen des Staates zu vertrauen. Im Gegenteil, manches Vorgehen der Politiker verunsichert so einige Bürger:
Zunahme der - aus Sicht der Betroffenen - nicht ausreichend verfolgten Kleinkriminalität bei immer weniger Polizei im öffentlichen Raum,
verheimlichte Verletzung der Privatsphäre durch Geheimdienste,
Einschnitte in die Sozialsysteme aus finanziellen Gründen,
hektische Aktionen zur Rettung des Euros und der Banken,
eine ausufernde Staatsverschuldung,
eine als unkontrolliert empfundene Zuwanderung,
Änderungen der gesetzlichen Alterssicherung je nach Kassenlage
und ein Politikstil, der häufig auf die Komplexität des Gemeinwesens verweist und dadurch zu verschleiern sucht, dass der Bürger nicht mehr ernst genommen wird. Angeblich schränken diese komplexen Sachzwänge die Möglichkeiten einer am Menschen orientierten Politik immer weiter ein.
Bei der weitgehend friedlichen Umgestaltung der Sowjetunion hat Gorbatschow gesagt: Politik ist die Kunst des Möglichen - und hinzugefügt: Alles andere ist Abenteuer. Könnte es sein, dass heute in Europa eine Politik des Möglichen nicht mehr ausreicht? Für diesen Fall hoffe ich, dass uns ein Rückfall in die Abschottung der alten Nationalstaaten erspart bleibt. Eine Politik, die sich nur an dem orientiert, was wir allgemein für möglich halten, springt meines Erachtens zu kurz. Lieber würde ich mich auf einen Weg zur Weiterentwicklung Europas zum Wohle der Menschen einlassen.
In diesem Sinne möchte ich hier einige Gedanken niederschreiben, die entweder anderen den Anstoß geben könnten, einen alternativen Blick auf die Wirtschaft und unsere Gesellschaft zu werfen, oder die Leser motivieren, mich zu korrigieren. So können dann vielleicht einige Ideen weiterentwickelt werden. Ideen, die dann hoffentlich einmal einem Realpolitiker Anstoß geben, sich für machbare Schritte in Richtung einer am Menschen orientierten Politik für Europa einzusetzen. Vielleicht eröffnen diese Gedanken aber auch nur meiner Tochter und ihren Kindern die Möglichkeit, später einmal herauszufinden, was der Vater/Großvater vor langer Zeit einmal gedacht hat - dann, wenn man ihn nicht mehr selbst fragen kann.
An dieser Stelle noch ein Wort an alle Frauen, die sich mit diesem Buch kritisch auseinandersetzen: Ich verwende hier sprachlich immer noch die altmodische männliche Form (Bürger, Einwohner, …), auch wenn ich damit natürlich ebenfalls gleichberechtigt die weibliche Form meine. Es liest sich einfach flüssiger. Ich verspreche, das Buch komplett zu überarbeiten, wenn der Duden die Form BürgerInnen oder Bürger*innen oder etwas anderes als richtig vorschreibt. Natürlich sind alle Menschen gleichberechtigt - die Schreibweise ist mir persönlich da nicht so wichtig. Die Frage der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist für mich längst entschieden und insofern ein alter Hut. Viel wichtiger ist heute die Frage, ob alle Weltbürger gleichberechtigt sind oder ob die reichen Europäer das Recht haben, sich gegen den Rest der Welt abzuschotten. Mehr dazu später.
Ich frage mich: „Finden wir in Europa noch die richtigen Antworten auf die Globalisierung der Wirtschaft?“ In den meisten erfolgreichen Ländern mit starker Ökonomie basieren die wirtschaftlichen Aktivitäten größtenteils auf marktwirtschaftlichen Prinzipien. Diese haben sich als erfolgreichstes Konzept zur dezentralen Koordinierung der wirtschaftlichen Aktivitäten erwiesen. Die Wirtschaft hat sich mit der Globalisierung erfolgreich eine eigene Weltordnung geschaffen. Weltweit wurde mit einem Geflecht von Handelsabkommen ein Rechtsrahmen hauptsächlich für global agierende Unternehmen geschaffen. Wir profitieren davon - die Globalisierung hat uns in Summe zusätzlichen Wohlstand gebracht.
Weltweit in Summe ja, doch wie sieht es in den reicheren Ländern Europas aus? Der Mensch ist in dieser Ordnung ein Produktionsfaktor, der aus der betriebswirtschaftlichen Sicht der Unternehmen vorzugsweise möglichst preisgünstig sein sollte. Die Menschen stehen dabei mehr und mehr in einem weltweiten Wettbewerb um Arbeitsplätze.
Bleiben die Bedürfnisse vieler Menschen dabei auf der Strecke? Haben viele Politiker den Kontakt zu ihrer Basis außerhalb der Parteien verloren? Sind die Interessen der Wirtschaft und politische Machtspiele häufig wichtiger als die Nöte der Menschen?
Europäische Nationalstaaten haben heute kaum noch Möglichkeiten, die Spielregeln dieser Weltordnung der Wirtschaft ohne Wohlstandsverluste zu beeinflussen. Deshalb haben sich viele europäische Staaten zur Europäischen Union zusammengeschlossen. Anfangs sicher hauptsächlich, um den Frieden in Europa zu wahren, später aber auch mehr und mehr, um ihren Einfluss in der Welt zu sichern. So können sie den international aufgestellten Konzernen und global agierenden Wirtschaftsverbänden doch noch ein nennenswertes Gewicht entgegensetzen. Wie schon bei der Bildung der europäischen Nationalstaaten wurde der Zusammenschluss zu größeren Einheiten stark von Einflussgruppen in der Wirtschaft unterstützt, insbesondere solange sich diese Vorteile davon versprachen.
So auch innerhalb der EU. Die Mitgliedsstaaten haben sich auf Druck der Wirtschaft in erster Linie auf die Verbesserung der Rahmenbedingungen für unsere wirtschaftlichen Aktivitäten konzentriert. Erfolge wurden u. a. bei der Vollendung des Binnenmarktes und der Arbeitnehmerfreizügigkeit gefeiert. Auch das hat uns in der Summe geholfen, den Wohlstand zu mehren. Aber gibt es in unseren Ländern nicht auch Verlierer?
Haben wir die Menschen aufgegeben, die im globalen Wettbewerb um Arbeitsplätze keine Chance mehr haben? Die global wettbewerbsfähigen Löhne passen teilweise nicht mehr zu unseren Lebenshaltungskosten in Europa. Wir glauben, dass wir uns ausreichend um die Betroffenen kümmern, indem wir sie zu Bittstellern der Sozialbehörden machen. Ist das eine menschenwürdige Lösung für ein globales Problem? Ich glaube nicht.
Ein gefühlter politischer Stillstand in Europa macht mich traurig. Die Euphorie für ein gemeinsames Europa hat bei vielen Menschen an Kraft verloren. Eine Idee, die mich in meiner Jugend begeistert hat und die ich mir über viele Berufsjahre in Europa bewahren konnte. Was ist daraus geworden? Eine Rückbesinnung auf kleinere Einheiten kann nur ein Teil der Lösung sein.
Ich sehe, wie die Schrecken der europäischen Bürgerkriege der letzten Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Viele Menschen besinnen sich wieder auf die Nationalstaaten. Abschottung und Angst vor dem Fremden gewinnen an Boden. Und diejenigen, die die weitere europäische Integration vorantreiben, haben offensichtlich die Bedürfnisse der Bürger aus den Augen verloren oder trauen sich nicht aus der Deckung. Haben wir noch die richtigen Themen im Blick? Oder lassen wir uns von Lobbygruppen treiben und dem vermeintlich politisch Machbaren einengen? Kümmern wir uns daher mehr und mehr um Dinge, die den Bürgern nicht wirklich wichtig sind?
Auf der Suche nach neuen Ideen für ein geeintes Europa habe ich so einiges gelesen, um zu lernen. Eine gute Möglichkeit um Abgreifen unterschiedlicher Ansichten schien mir das Studium einiger - auch älterer - (meist deutscher) Wahlprogramme zu sein. Bei dieser Durcharbeitung habe ich viele gute Ideen aufgesogen, die bereits von vielen politisch interessierten Menschen gefiltert und für gut befunden wurden - sonst hätten sie es ja nicht in ein Wahlprogramm geschafft. Dennoch habe ich wenig neue Ansätze gefunden, die Antworten auf die Herausforderungen geben, die viele Menschen heute bewegen. Kein Konzept, das mich überzeugt oder gar begeistert hätte. So scheint es auch anderen Bürgern zu gehen; die Politikverdrossenheit nimmt zu - auch wenn nicht jeder Wahlprogramme liest.
Auch im öffentlichen Diskurs gibt es nur selten einmal konstruktive Ansätze, die das europäische Projekt im Sinne der Bürger voranbringen könnten. Dieses mag daran liegen, dass es nur wenige solcher Ansätze in Deutschland gibt, ich sie nicht erkenne oder sie so weit vom Mainstream abweichen, dass sie kaum jemand in die Öffentlichkeit tragen möchte.
Es ist modern geworden, zu behaupten, auf komplizierte Fragen müssen auch komplizierte Antworten gegeben werden. Und wer diese nicht versteht, ist dumm. Einfache Antworten sind schon wegen ihrer Einfachheit verdächtig und werden nicht ernst genommen. Sie müssen in dieser Logik ja zwangsläufig falsch sein. Damit scheint sich für viele eine inhaltliche Auseinandersetzung zu erübrigen.
Dieser Hang zur Komplexität unserer intellektuellen Eliten scheint mir jedoch nur eine Nebelkerze zu sein, die verbergen soll, dass sie selbst den Überblick verloren haben oder ihnen schlüssige Antworten fehlen. Oder ist die Komplexität auch eine elegante Möglichkeit, die Interessen der Bürger fast unbemerkt zu ignorieren? Die Bürger werden misstrauisch.
Wir benötigen neben der Weltordnung für die Wirtschaft eine gemeinsame politische Ordnung für die Menschen. Die Wirtschaft hat ihre wichtigsten Ziele in Europa weitgehend erreicht. Warum sollte sie sich jetzt noch für ein demokratischeres und sozialeres Europa einsetzen? Jetzt sind die Menschen am Zug.
Da wir und unsere Kinder die Umsetzung eines Ansatzes für die ganze Welt wahrscheinlich nicht mehr erleben würden, habe ich mich bei meinen Gedanken auf unseren Kontinent Europa konzentriert und mich damit hoffentlich noch am Rande des politisch Machbaren bewegt. Im Gegensatz zu den Nationalstaaten ist Europa zur Zeit noch wirtschaftlich stark genug, um eigene Akzente zu setzen und sich auf der globalen Bühne zu behaupten.
Bei der Weiterentwicklung des gemeinsamen Europas müssen wir uns neben der Wirtschaft noch mehr auf die Menschen konzentrieren. Nicht nur das bisher Erreichte bewahren, sondern ein Europa schaffen, das begeistert und das die Menschen wieder lieben können.
2
Utopie oder Kompass
Kompass für ein wirtschaftlich nachhaltiges Europa
Ulrike Guérot versteht ihr Buch „Warum Europa eine Republik werden muss!“ als eine politische Utopie, in der Frieden und soziale Gerechtigkeit herrschen. Sie ist überzeugt, dass Europa eine solche Utopie braucht, da die Europäische Union nicht mehr funktioniert. Sie schreibt: „Was sich gerade vor unseren Augen abspielt, ist die Auflösung des Europas der Gründerväter, das Ende des nationalstaatlichen Konzepts der »Vereinigten Staaten von Europa«.“2-1)
Wenn nicht die »Vereinigten Staaten von Europa«, was dann? Wie muss das neue Konzept aussehen? Wie ich später versuche herauszuarbeiten, ist der Rückfall in die alten Nationalstaaten keine wirtschaftlich nachhaltige Option und kann somit den Bürgern Europas nicht von Nutzen sein. Die global aufgestellte Wirtschaft erfordert andere Konzepte. Ulrike Guérot skizziert eine postnationale Demokratie in Europa als „ein Netzwerk aus europäischen Regionen und Städten, über die das schützende Dach einer Europäischen Republik gespannt wird, unter dem alle europäischen Bürger gleichgestellt sind.“2-2) Sie beschreibt ihre Utopie als unfertige Idee, an der viele Menschen mitarbeiten müssen. Das entspricht meiner Lebenserfahrung. Nur die Verbindung vieler Gehirne wird innovative, gute Lösungen hervorbringen.
Daher versuche ich, meine Ideen mit möglichst vielen Menschen zu diskutieren und von ihnen zu lernen. Manche sind begeistert und spornen mich zum Weitermachen an, andere halten die Ansätze für zu utopisch und politisch nicht umsetzbar. Meist liegt die Wahrheit ja in der Mitte. Da ich nicht an die Revolution des 21. Jahrhunderts glaube, versuche ich hier, nicht eine weitere Utopie zu entwerfen, sondern leiste meinen Beitrag zur Diskussion, indem ich ein Puzzle aus meist bewährten Bausteinen zusammensetze, die ich mit meinen Erkenntnissen und Ideen kombiniere. Dabei lasse ich mich von wenigen Vorgehensweisen und Grundüberzeugungen leiten:
Denke in dynamischen Systemen und Flüssen (Wertströme, Warenströme, …) und weniger in Bestandsgrößen.
Konstruiere nichts, was den Naturgesetzen oder dem menschlichen Eigennutz widerspricht. Es wird nicht funktionieren.
Schaffe stabile Regelkreise, die dynamisch immer wieder auf einen gewünschten Gleichgewichtszustand zustreben. Systeme, die eine übergeordnete steuernde Hand benötigen, werden auf Dauer nicht überleben.
Die Geschichte wird sich mit dem Bewusstsein der Menschen - teilweise auf Umwegen - kontinuierlich weiterentwickeln. Daher konzentriere ich mich in erster Linie auf Ideen, die sich zeitlich, räumlich und inhaltlich schrittweise und evolutionär umsetzen lassen.
Ich spüre, dass sich die politisch Handelnden unserer Generation in der Komplexität unseres Gemeinwesens verrannt haben. Sie finden auf die Herausforderungen der Globalisierung der Wirtschaft keine Antworten und können die zurückgelassenen Menschen nicht mehr mitnehmen. Wenn wir nicht wollen, dass wir Europäer wieder in Konflikte untereinander getrieben werden, müssen wir etwas ändern. Solche Konflikte könnten nur allzu leicht im wirtschaftlichen Untergang oder in einem neuen europäischen Bürgerkrieg enden.
Ich versuche, in diesem Buch einen Kompass zu entwerfen, der uns helfen soll, dem Ziel der Wohlstandsmehrung in einer freien und menschlichen Gesellschaft näherzukommen. Wohlstand ist dabei natürlich nicht nur auf ökonomisch messbare Faktoren beschränkt.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist das gesellschaftliche Leben in der jüngeren Geschichte Europas. Meist beschränkt auf die Zeit nach den vielen Versuchen, Europa durch eine Zwangsherrschaft zu einigen. Eine Zeit mit vielen Fortschritten auf dem Weg zu einem friedlichen oder sogar vereinten Europa, die ich persönlich über weite Strecken in verschiedenen europäischen Regionen miterleben durfte.
Bei der Beschreibung der aktuellen Lebenssituation der Menschen und deren Unzufriedenheit bin ich sehr stark von meinen Erfahrungen in der Industrie und der Diskussion in Deutschland geprägt. Dennoch glaube ich, dass die Folgen der Globalisierung für uns Europäer mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes haben. Die Leser mögen mich hier einbremsen, wenn ich diesbezüglich nicht aufmerksam genug war und meinen Blick zu sehr eingeengt habe.
Diese Ausgangslage mit seinen permanenten Reparaturversuchen zu Lasten unserer Sozialsysteme und die Unfähigkeit der etablierten Politik, den Menschen alternative Zukunftsentwürfe anzubieten, hat mich motiviert, den Änderungsbedarf einmal aus meiner Sicht herauszuarbeiten und daraus einen Kompass für ein wirtschaftlich nachhaltiges Europa zu entwerfen.
Zu dem Kompass gehört auch eine Beschreibung des Zielpunkts, auch wenn der Weg dorthin noch im Nebel liegt. Nur so kann man auch einmal den zweitbesten Weg akzeptieren, in der Gewissheit, dass man dem Ziel in Summe näherkommt. Einen Entwurf für dieses Ziel (den Nordpol) habe ich im Teil IV „Vereinigung freier Bürger in einer föderalen Republik“ beschrieben. Neue Erkenntnisse aus den Diskussionen über den Entwurf werden ihn weiter verbessern. Wir werden lernen, den Kompass immer wieder neu zu eichen.
Teil I
Die Krise der Demokratie und ihre Ursachen
Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute?
Ulrike Guérot beginnt ihre Streitschrift
„Der neue Bürgerkrieg
Das offene Europa und seine Feinde“
mit einer einfachen Zustandsbeschreibung und folgert:
„Die einen sprechen von Kulturkampf, die anderen von Bürgerkrieg. Auf jeden Fall ist Europa in Aufruhr, sind die europäischen Gesellschaften tief gespalten. Gegenüber stehen sich …
Globalisierungsverlierer und Globalisierungsgewinner, urbane Zentren und ländliche Regionen, Jung und Alt, Arm und Reich, Identitäre und Kosmopoliten. Es herrscht eine fast prä-revolutionäre Situation, die mit dem klassischen politischen Schema von rechts und links nichts mehr zu tun hat; wohl aber mit dem Paradigma des Bürgerkriegs, nämlich Beherrschte gegen Herrschende oder eben »Volk« gegen Elite. Anders formuliert: Die europäischen Nationalstaaten zerfallen als politische Körper.
… die europäischen Bürger … sollten einen emanzipatorischen Prozess in die Wege leiten, der ein vereintes Europa auf dem Grundsatz der allgemeinen politischen Gleichheit aller Bürger begründet und in dem Freiheit und Gleichheit in eine neue Beziehung zueinander gestellt werden. Motto dieser politischen Neugründung Europas muss sein:
ein Markt - eine Währung - eine Demokratie!“3-1)
3
Politikverdrossenheit
Was macht immer mehr Bürger unzufrieden?
Der Wohlstand in der EU ist Jahr für Jahr immer weiter gestiegen. Und das in vielen Jahren auch real nach Abzug der Inflationsrate. In der Summe geht es uns immer besser. Dies gilt auch für das wirtschaftlich starke Deutschland. Nur die Löhne für breite Bevölkerungsschichten halten teilweise mit dieser Entwicklung nicht Schritt.
In manchen Jahren liegen die Lohnsteigerungen für viele Arbeitnehmer unter der Inflationsrate. Real geht es diesen Arbeitnehmern in vielen Jahren also eher schlechter. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch die Steuerprogression und steigende Sozialabgaben. Die Leistungen der öffentlichen Hand werden teilweise zurückgefahren. Daher beginnen manche Bürger an dem Versprechen zu zweifeln, dass es uns immer besser gehen wird. Sie sind verunsichert und fühlen sich mehr und mehr wirtschaftlich abgehängt.
Auf der Suche nach günstigeren Produktionsmöglichkeiten wird ein immer größerer Teil unserer Industrieproduktion, insbesondere der mit hauptsächlich einfachen Tätigkeiten, in günstigere Regionen der Welt ausgelagert. Da mag sich mancher Bürger noch auf die Hilfe des Sozialstaates verlassen. Andere verweisen bei ihren Gehaltsverhandlungen auf das höhere Gehaltsniveau in den USA und versuchen so, auch in Europa persönlich von der Globalisierung zu profitieren.
Doch was machen all diejenigen dazwischen? Die, die nicht dem Sozialstaat zur Last fallen wollen und dennoch ihre Familien nur mühsam über die Runden bringen. Menschen, die sich teilweise mit mehreren Teilzeitjobs oder befristeten Arbeitsverträgen durchschlagen müssen? Das hat auch viele junge Menschen mit ordentlicher Ausbildung getroffen, insbesondere im Süden Europas. Wie soll so eine solide Familienplanung möglich sein?
Die Schere zwischen Arm und Reich geht so immer weiter auseinander. Natürlich läßt sich diese Entwicklung durch die Marktgesetze zusammen mit der Globalisierung einfach erklären. In einer vernetzten Wirtschaft mit freiem Kapitalverkehr und weitgehend offenen Grenzen für den Warenverkehr werden sich die Herstellkosten in Summe so weit vereinheitlichen, dass sie nur noch die unterschiedlichen Wechselkurse, Handelsstrukturen und Transportwege widerspiegeln. Damit können nur noch Produzenten überleben, die zu diesen global wettbewerbsfähigen Kosten produzieren. Da der Lohn bei vielen Produkten einen wesentlichen Kostenfaktor darstellt, werden langfristig Industrien so lange in günstigere Regionen der Welt abwandern, bis sich das Lohnniveau unter Berücksichtigung aller gegebenen Standortbedingungen weiter angeglichen hat.
Wenn man die Wohlstandsgewinne der Globalisierung und die der Marktwirtschaft will, muss man diese zweite Seite der Medaille akzeptieren. Es gibt ja auch viele Arbeitnehmer in den sich entwickelnden Ländern, die von dieser Entwicklung profitieren. Dieser Zusammenhang könnte auch als Form des sozialen Ausgleichs in der Welt gesehen werden. Er wird im öffentlichen Diskurs nur meist verschwiegen.
Im Gegenteil: Es wird auf Druck der Wirtschaft versucht, mit einer Begrenzung der Lohnnebenkosten den Anstieg der Kosten für den Produktionsfaktor Lohn zu dämpfen. Es wird ausführlich über die Alterung unserer Bevölkerung berichtet und damit die erforderlichen Einschnitte in unserem Sozialsystem begründet. Die Ursachen der für viele Bürger schmerzhaften Anpassungsprozesse aufgrund der Globalisierung werden in der veröffentlichten Politik deutlich seltener diskutiert.
Spätestens wenn die Wirtschaft zu Recht auf den bevorstehenden Fachkräftemangel hinweist und als Lösung eine verstärkte Zuwanderung anpreist, beginnt das Problem. Es wird so getan, als würde eine ungesteuerte Zuwanderung die Bevölkerungsstruktur verjüngen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Die von der Allgemeinheit zu tragenden Integrationslasten werden dabei in der Diskussion als Investition in die Zukunft dargestellt oder auch einmal vergessen. Die Politik widerspricht häufig nicht und ordnet die Behauptungen nicht differenziert ein.
Viele Menschen spüren aber, dass der Zuzug zusätzlicher Arbeitskräfte den Wettbewerb gerade um einfache Arbeitsplätze und günstigen Wohnraum verschärft und ihnen nicht nur Vorteile bringt. Wenn das Angebot an Arbeitskräften steigt, werden die Löhne eher weniger stark steigen und möglicherweise real sinken. Ob dieser Effekt durch zusätzliches Wirtschaftswachstum wieder ausgeglichen wird, ist vermutlich schwer vorherzusagen. Nur thematisiert werden diese Zusammenhänge eher selten. Viele Bürger fühlen sich in der Folge nicht mehr ernstgenommen und wenden sich von der etablierten Politik ab. Es entsteht eine allgemeine (gefühlte) Politikverdrossenheit. Oder besser gesagt, eine Verdrossenheit gegenüber den Politikern, den Eliten.
Sichtbar wird dieser Unmut in der politischen Landschaft, weil er nicht nur Menschen mit geringem Einkommen betrifft. Nicht nur Bürger, die sich enttäuscht von den politischen Eliten abwenden und sich bei Wahlen enthalten. Nein es sind auch solche Bürger betroffen, die bereit sind, sich zu engagieren. Auch Bürger mit ordentlichem Einkommen, die sogar noch für ihre Altersvorsorge sparen können, sind verunsichert bis verärgert. Die gesetzliche Altersvorsorge wird kontinuierlich beschnitten. Versprechen der Vergangenheit werden gebrochen. Die Politik sagt den Bürgern, sie müßten selbst für ihr Alter vorsorgen. Die Menschen werden in die private Altersvorsorge gedrängt - mit all den Risiken eines kapitalgedeckten Systems. Und mehr noch: Nach jahrelanger Einzahlung der Sparraten in diese privaten Systeme werden die Auszahlungen mit zusätzlichen Sozialabgaben belastet. Ausschüttungsregeln von Lebensversicherungen werden in der Krise zu Lasten der Sparer von der Politik geändert. Und das, obwohl es den Versicherungen so gut geht, dass sie regelmäßig Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten können.
Manche fürchten zusätzlich um ihr selbst erspartes Geldvermögen. Es scheint nicht mehr sicher zu sein. Banken werden mit Steuergeldern gerettet und Staaten verschulden sich über alle Maßen. Wie soll so Vertrauen in unsere Politiker entstehen? Es entsteht der Eindruck, dass die etablierte Politik die Kontrolle über unser Gemeinwesen verloren hat, sich von Lobbygruppen die Feder führen lässt und nicht mehr die Interessen der Bürger vertritt.
Ist es da ein Wunder, dass sich viele wieder abschotten wollen? Sie beginnen, sich europaweit wieder auf den guten alten Nationalstaat zu besinnen. Ein Irrweg, der uns alle ärmer und ohnmächtiger machen wird. Die Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen. Wir müssen andere Antworten finden. Die alten europäischen Nationalstaaten sind dafür zu schwach, auch die größeren wie Deutschland.
Was uns fehlt ist ein starkes und verantwortungsbewußtes Europa nach außen, ein einfaches Konzept zur Umverteilung sowie eine Geldverfassung, die eine verlässliche Altersvorsorge wieder möglich macht. Das Konzept zur unbürokratischen Umverteilung der Einkommen von oben nach unten muss transparent und unabhängig von Einflüssen der Tagespolitik sein.
Wir benötigen diese Umverteilung. Sie darf nur nicht der Wirtschaft schaden und den Leistungswillen der Menschen beschädigen. Wir benötigen sie sowohl für die Menschen als auch für die Wirtschaft:
Für die Menschen, damit sie unbürokratisch vor den größten Lebensrisiken geschützt werden und ein Mindestmaß an Sicherheit haben. Ein Grundeinkommen aus der Umverteilung, das unabhängig vom Arbeitslohn ausgezahlt wird, gibt Sicherheit und ermöglicht es den Menschen, auch eine niedrig entlohnte Beschäftigung zu akzeptieren. Damit wird ihre Arbeitskraft im weltweiten Wettbewerb wieder wettbewerbsfähig. So können wir die Abwanderung unserer Industrie stoppen und mit Ländern konkurrieren, deren Lohnkosten deutlich niedriger sind. Wir fördern damit Beschäftigung und alimentieren nicht Arbeitslosigkeit in Europa. Das Grundeinkommen macht wettbewerbsfähige Löhne in der globalen Wirtschaft erst sozialverträglich.
Aber wir benötigen die Umverteilung nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Unternehmen. Unternehmen können nur wachsen, wenn es ausreichend Nachfrage am Markt gibt. Wenn wir nicht hauptsächlich vom Export leben wollen, benötigen die Unternehmen inländische Nachfrage. Deren größerer Teil ist der private Konsum.
Die Nachfrage nach Konsumgütern wird heute zu einem großen Teil dadurch generiert, dass die Unternehmen ihren Beschäftigten gute Löhne zahlen. Doch hier stoßen wir an Grenzen. Wie wir gesehen haben, müssen die Löhne (global) wettbewerbsfähig bleiben. Da sich viele Marktpreise im internationalen Wettbewerb bilden, können Preise bei einer Erhöhung der Produktionskosten diesen Steigerungen nicht ausreichend folgen. In der Konsequenz können die Reallöhne dann auch nicht beliebig steigen. Sonst würden sich die im Inland produzierten Erzeugnisse ja nicht mehr mit Gewinn verkaufen lassen.
Um in einer globalen Wirtschaft wettbewerbsfähige Verkaufspreise bieten zu können, müssen die Unternehmen also auch weltweit wettbewerbsfähige Löhne zahlen. Wenn nun aber die Löhne nicht ausreichend steigen können, kommt die durch sie erzeugte inländische Konsumgüternachfrage zu kurz. Aber genau diese Nachfrage benötigen die Unternehmen, um zu wachsen. Das Dilemma ist nicht über den Lohn zu lösen. Wir benötigen ein anderes Instrument, um selbst bei niedrigen wettbewerbsfähigen Löhnen ausreichend Nachfrage zu generieren. Um es vorwegzunehmen: Eine kontinuierliche Staatsverschuldung und gut gemeinte Konjunkturprogramme sind keine nachhaltigen Lösungen. Wir benötigen einen Umbau unserer Steuer- und Sozialversicherungssysteme. Mit einer starken Umverteilungskomponente, die inländische Produzenten nicht über Gebühr belastet und den Produktionsfaktor Lohn verschont.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir uns nicht mehr allein auf den Lohn verlassen können, um die Umsatzerlöse der Unternehmen zu einem signifikanten Teil wieder in die Konsumgüternachfrage zurückzuschleusen. Wir leben in einer Zeit stetig steigender Arbeitsproduktivität. Die Produktionstechniken werden immer ausgefeilter. Die Konsumgüter werden mehr und mehr durch Maschinen hergestellt. Dadurch beobachten wir einen eher sinkenden Lohnanteil an den Produktionskosten. Wir sind also nicht nur mit moderaten Löhnen, sondern auch mit einem sinkenden Lohnanteil an den Produktionskosten konfrontiert.
Wenn wir nicht gegensteuern, saugt der Unternehmenssektor tendenziell immer mehr der umlaufenden finanziellen Mittel auf. Wegen der stagnierenden Nachfrage im Inland sinken die heimischen Investitionen in die Produktionsanlagen, was die Gesamtnachfrage weiter bremst. Viele sehen den einzigen Ausweg in Exportüberschüssen (Verschuldung des Auslands) oder einer kontinuierlichen Steigerung der Inlandsverschuldung. Für mich sind das beides keine nachhaltigen Lösungen. Es sind beides Möglichkeiten der ständig steigenden Verschuldung, die auf Dauer nicht gut gehen kann. Die Erträge der produzierenden Unternehmen müssen auf anderem Wege wieder zurück an die Konsumenten fließen können - ohne den Unternehmen ihren Anreiz zur inländischen Produktion zu nehmen (Gewinnmöglichkeiten und Nachfrage).
Dieser Einkommenstransfer von den Unternehmen zu den Konsumenten geschah früher in homogenen und geschlossenen Volkswirtschaften - wie dargestellt - hauptsächlich durch steigende Löhne. Wir haben gesehen, dass das heute in einer global aufgestellten Wirtschaft kein zielführendes Konzept mehr ist. Wir wollen ja nicht, dass unser produzierendes Gewerbe in Regionen abwandert, in denen sie ein deutlich niedrigeres Lohnniveau vorfinden. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass die Unternehmen nicht mehr genug inländische Nachfrage haben, wenn wir die Löhne nicht erhöhen. Sie sind dann zum Export verdammt oder können nicht weiter wachsen.
Da die Unternehmen für ihre Weiterentwicklung einen permanenten Anreiz benötigen, sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen der für sie relevanten Kaufkraft zurückzuholen, muss diese immer wieder neu erzeugt werden. Das geht aber nur, wenn wir es schaffen, den Menschen Kaufkraft zu geben, ohne ihre Löhne so weit zu erhöhen, dass sie weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Einige mögen nun auf die Idee kommen, das Heil in der Abschottung unserer Märkte zu suchen, um den Produktionsfaktor Lohn wieder aus dem weltweiten Wettbewerb herauszunehmen. Eine solche Abschottung würde zu hohen Wohlstandsverlusten führen. Die internationale Arbeitsteilung schafft Wohlstand, auf den wir nicht verzichten wollen. Wir müssen diesen Wohlstand nur intelligent genug verteilen.
Die deutsche Sozialdemokratie hat sich mit der Agenda 2010 den Verdienst erworben, wieder wettbewerbsfähige Löhne möglich zu machen. Das hat mit dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf die Hälfte gesunken ist und die Beschäftigung Rekordstände erreicht. Das ist für viele ein Sündenfall und für andere - auch außerhalb Deutschlands - ein Vorbild für Europa. Ich denke, es ist ökonomisch ein richtiger Schritt gewesen, nur hat er die Menschen dabei zu sehr vergessen.
Menschen mit keinem oder sehr geringem Einkommen werden auch heute sozial aufgefangen. Leider haben es die Konstrukteure der Reform versäumt, den Leistungswillen derjenigen zu stärken, die nur sehr geringe Einkommen erzielen können. Warum? Niedrige Einkommen werden subventioniert. Mit zunehmendem Arbeitseinkommen wird die Subvention immer geringer. Die Leistungsbereitschaft der Leistungsempfänger wird nur sehr wenig honoriert. Menschen mit keinem oder nur geringem Einkommen verlieren für jeden zusätzlich verdienten Euro, der 100 €/Monat übersteigt, 80 bis 90 % durch gekürzte Sozialleistungen oder im schlimmsten Fall sogar alles. Es widerspricht der Natur des Menschen, mehr zu arbeiten, wenn man dadurch fast das ganze Gehalt an den Staat verliert. Das empfinden gerade diese Menschen als ungerecht und weichen in die Schwarzarbeit aus oder verzichten gleich ganz auf eigene Anstrengungen.
Das System mag theoretisch sehr vernünftig und ökonomisch erfolgreich sein, nur hat es nicht ausreichend die Menschen im Blick. Es ist leistungsfeindlich, bürokratisch, kompliziert, bevormundend und arbeitet mit Sanktionen statt mit Motivation. Ein guter erster Schritt, aber nicht ausreichend. Das spüren auch diejenigen, die noch nicht selbst betroffen sind.
Wir benötigen ein Steuersystem und Sozialabgaben, die nicht hauptsächlich den Lohn, sondern auch andere Komponenten des Wirtschaftskreislaufs belasten. Die Einnahmen sollten dann auf möglichst unbürokratische Weise zu den Konsumenten zurückfließen. Unbürokratisch, um wenig Arbeitskräfte in der staatlichen Verwaltung zu binden und die Systeme für den Bürger durchschaubar zu machen. Mit geringerem Verwaltungsaufwand können wir das produktive Arbeitsvolumen bei gegebenem Volkseinkommen steigern und das Lohnniveau noch wettbewerbsfähiger machen. Weiter unten werde ich einen einfachen Ansatz darstellen, der von den Unternehmen einen kleinen Teil der Umsätze und einen größeren Teil der ausgeschütteten Gewinne wieder in die Konsumnachfrage zurückführt. Im Gegenzug werden die Unternehmen bei den Lohnnebenkosten und den re-investierten Gewinnen entlastet.
Doch wieder zurück zu den Menschen und ihrer Unzufriedenheit mit der Politik. In einer gut funktionierenden Marktwirtschaft sollten die politisch Verantwortlichen Rahmenbedingungen vorgeben, die die Schaffung von Wohlstand und Sicherheit begünstigen und die von einer großen Mehrheit der Bevölkerung als gerecht empfunden werden. Komplexe Lösungen können meines Erachtens diese Anforderungen nicht erfüllen, da viele Bürger sie nicht verstehen. Man kann nicht einverstanden sein mit Dingen, die man nicht durchschaut; man kann sie nur tolerieren wie die kleingedruckten Nutzungsbedingungen einer vertrauenswürdigen App, denen man beim Download zustimmen muss.
Wenn Politiker in einer parlamentarischen Demokratie ihre Ideen durchsetzen wollen, müssen sie andere davon überzeugen und nach außen zumindest negative Reaktionen in der Presse und der Zivilgesellschaft verhindern. Da muss dann auch schon einmal taktisch vorgegangen werden. Da die komplexen Zusammenhänge selbst einer interessierten Öffentlichkeit nicht mehr vermittelt werden können, muss oftmals auch noch stark vereinfacht argumentiert werden. Die eigene Motivation wird dann oft verschwiegen oder vernebelt. Interessierte Betrachter der Auseinandersetzungen mögen vieles nicht mehr verstehen, aber sie entwickeln ein ungutes Gefühl und unterstellen Unredlichkeit. Den Politikern wird in Summe nicht mehr geglaubt. Politik ist aus der Sicht so mancher ein schmutziges Geschäft.
Diese sogenannte Politikverdrossenheit vieler Bürger und die Anziehungskraft, die vielerorts Autokraten oder sogenannte Populisten auf die Wähler ausüben, sind möglicherweise einer Sehnsucht nach einer Politik geschuldet, die man wieder verstehen kann. Und manche, die das Verstehen längst aufgegeben haben und sich nicht für Politik interessieren, wollen wenigstens das Gefühl haben, ihren Volksvertretern vertrauen zu können.
Meinungsmacher greifen diese Stimmung auf und geben Antworten, die wir längst als überwunden geglaubt haben. Von links die Wiederentdeckung idealistischer sozialistischer Konzepte, die sich mehrfach als untauglich erwiesen haben, und von rechts die Rückbesinnung auf die Nationalstaaten, die die Menschen in den letzten Jahrhunderten immer wieder ins Elend gestürzt haben. Diejenigen, die das Unbehagen und die Stimmungen der Menschen aufnehmen, werden von der etablierten Politik als Populisten ausgegrenzt. Ulrike Guérot beschreibt das so:
„Anstatt die Ursachen des populistischen Votums ernst zu nehmen und anzuerkennen, dass es dafür reale Gründe eines Systemversagens gibt, welches soziale und kulturelle Exklusion produziert, reagiert die politische Klasse oft selbstgefällig moralisch: Das eigene Argument wird ethisch überhöht, Rechtspopulisten gelten als nicht integer, irrational, böswillig oder gefährlich, wobei die identitären Bedürfnisse der Globalisierungsverlierer als konkurrierende Werteordnung oder als einfach andere politische Meinung nicht anerkannt werden. … Mit der Ausgrenzung der Populisten beginnt also der Verfall der Demokratie.“3-2)
Der Populismus ist ein Hilferuf an die Politik, wie Laurent Baumel aus Sicht der französischen Linken ihn beschreibt:
„Die progressiven Kräfte müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass der Erfolg der Populisten der politische Ausdruck einer enormen Verunsicherung der europäischen Gesellschaften ist. Diese Verunsicherung ist das Ergebnis von weitreichenden Veränderungen der Existenzbedingungen der Menschen und der Unzulänglichkeit der Antworten, die von der Politik bislang darauf gegeben werden.3-3)
Das Verlangen nach einem Rückzug auf kleinere Einheiten - wie das eigene Königreich, die eigene Nation oder die noch kleinere Region - könnte aber auch seine Ursachen in dem Wunsch nach überschaubaren Strukturen und einer Reduzierung der Komplexität haben. Die Menschen wollen ihr Umfeld wieder verstehen und es zusammen mit anderen beeinflussen können. Die komplexen Strukturen der EU und die Art der Meinungsbildungsprozesse in den Parlamenten produzieren den europäischen Populismus.
Der Wunsch, die Rahmenbedingungen für unser Leben und das Wirtschaften gerecht zu gestalten, sowie die Beteiligung vieler Bürger und Organisationen am demokratischen Prozeß erzeugen eine Komplexität, die viele Menschen nicht mehr wertschätzen.
Auf der anderen Seite haben die demokratischen Strukturen in Europa weitgehend Unterdrückung, Willkür und Krieg - mit all dem Leid für die Menschen - verhindert. Wir sollten sie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.





























