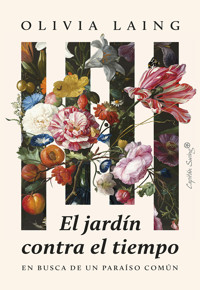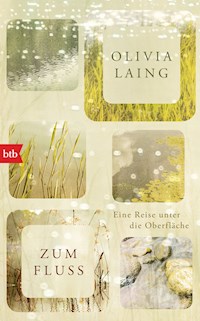
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Über sechzig Jahre nachdem Virginia Woolf in der Ouse ertrunken ist, macht Olivia Laing sich an einem hellen Mittsommermorgen auf den Weg durch Südengland, um dem Lauf des magischen Flusses von der Quelle bis zur Mündung zu folgen. In von Kreidefelsen milchig-grün gefärbten Windungen, an Ufern auf dem Weg Richtung Meer sucht sie nach den Geheimnissen, die Flüsse tragen, verbergen, preisgeben. Herauskommt eine große, kluge und poetische Erzählung davon, wie Geschichte sich in eine Landschaft einschreibt – und davon, wie Geister nie von den Orten verschwinden, die sie lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Über sechzig Jahre nachdem Virginia Woolf in der Ouse ertrunken ist, macht Olivia Laing sich an einem hellen Mittsommermorgen auf den Weg durch Südengland, um dem Lauf des magischen Flusses von der Quelle bis zur Mündung zu folgen. In von Kreidefelsen milchig grün gefärbten Windungen, an Ufern auf dem Weg Richtung Meer sucht sie nach den Geheimnissen, die Flüsse tragen, verbergen, preisgeben. Heraus kommt eine große, kluge und poetische Erzählung davon, wie Geschichte sich in eine Landschaft einschreibt – und davon, wie Geister nie von den Orten verschwinden, die sie lieben.
Zur Autorin
OLIVIA LAING, geboren 1977, ist eine der renommiertesten Kulturkritikerinnen Großbritanniens und Autorin. Sie studierte Englische Literatur an der Universität von Sussex, brach ihr Studium ab, um Umweltaktivistin zu werden, auf einem Baum in der Wildnis zu leben und ein Diplom in Pflanzenheilkunde zu erwerben, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte. Ihre Bücher sind in fünfzehn Sprachen übersetzt. Sie schreibt unter anderem für den Guardian und New Statesman und ist Kolumnistin für Frieze. Für Zum Fluss war sie für den Ondaatje-Preis und den Dolman Best Travel Book Award nominiert, 2018 erhielt sie für ihre Sachbücher den Windham Campbell-Preis.
Olivia Laing
Zum Fluss
Eine Reise unter die Oberfläche
Aus dem Englischen von Thomas Mohr
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »To The River. A Journey Beneath the Surface« bei Canongate Books Ltd, Edinburgh.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2011 Olivia Laing
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © plainpicture/Jan Håkan Dahlström; © Shutterstock/VA_Art; Elena Dijour; ronnybas frimages; Ismiza binti Ishak; tesoro-photo; Toma Stepunina
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24967-0V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Meinen Eltern und meiner Schwester und dem Andenken an meinen Großvater Arthur Laing
Illustration Flusslauf: Helen MacDonald
Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller; an den Ort, da sie her fließen, fließen sie wieder hin. Es sind alle Dinge so voll Mühe, dass es niemand ausreden kann. Das Auge siehet sich nimmer satt, und das Ohr höret sich nimmer satt. Was ist’s, das geschehen ist? Eben das hernach geschehen wird. Was ist’s, das man getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird; und geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Prediger 1, 7 – 9
INHALT
I NICHTS WIE WEG
II AN DER QUELLE
III AUF DEN GRUND
IV FAHRWASSER
V IN DEN FLUTEN
VI EINE DAME VERSCHWINDET
VII BEDAS SPERLING
VIII BERGUNG
Zitierte Literatur
Bibliografie
Danksagung
Foto: Olivia Laing
I NICHTS WIE WEG
Gewässer haben mich schon immer fasziniert. Vielleicht liegt es daran, dass ich in mir so trocken bin, so englisch, oder schlicht an meinem ausgeprägten Sinn für Schönheit, aber ohne einen Fluss in meiner Nähe fühle ich mich auf dieser Welt nicht wirklich wohl. »Wenn es schmerzt«, schrieb der polnische Dichter Czesław Miłosz, »kehren wir zu den Flüssen zurück«, und ich schöpfe Trost aus seinen Worten, denn es gibt einen Fluss, an den ich immer wieder zurückkehre, in Krankheit und Gesundheit, in Trauer, in Betrübnis und in Freude.
Erste Bekanntschaft mit der Ouse machte ich an einem Juniabend vor zehn Jahren. Ich war mit einem längst abgelegten Lover aus Brighton gekommen, und wir hatten den Wagen auf einer Wiese in Barcombe Mills abgestellt und marschierten nun nach Norden, der Strömung entgegen, während die letzten Angler in der Hoffnung auf Hechte oder Barsche ihre Köder auswarfen. Es wurde langsam dunkel, der Duft von Mädesüß lag in der Luft, und auf den zweiten Blick erkannte ich einen dünnen Film von Blütenblättern, die träge am Ufer entlangtrieben. Der prallvolle Fluss verlief am Rande eines offenen Feldes, und je tiefer die Sonne sank, desto stärker stieg er einem in die Nase: jener kalte, grüne Ruch, mit dem wildes Wasser sich ankündigt. Als ich mich bückte, um die Hand hineinzutauchen, fiel mir ein, dass Virginia Woolf sich in der Ouse ertränkt hatte, auch wenn ich nicht wusste, wann oder warum.
Eine Zeitlang ging ich mit Freunden in Southease schwimmen, unweit der Stelle, wo ihre Leiche gefunden wurde. Erfüllt von leiser Beklommenheit, in die sich schon bald ein Gefühl der Ekstase mischte, watete ich ins schnell fließende Wasser und spürte, wie die Strömung an mir zerrte, eine Strömung, die mich tief unter die Oberfläche zu ziehen und geradewegs ins Meer hinaus zu spülen drohte. Der Fluss durchquerte in dieser Gegend ein von den Hügeln der Downs gesäumtes Kalksteintal, und der Kalk sickerte ins Wasser und färbte es milchig grün, wie Meerglas, das viele kleine Feuer in sich gefangen hält. Man konnte nicht bis auf den Grund sehen; man konnte kaum die eigenen Gliedmaßen ausmachen, und vielleicht war es diese Opakheit, diese Trübung, die dem Fluss den Anschein gab, Geheimnisse in sich zu tragen: dass unter seiner Oberfläche etwas verborgen lag.
Doch nicht Morbidität führte mich zu dieser gefährlichen Stelle, sondern vielmehr die Lust, mich an etwas auszuliefern, über das ich keinerlei Kontrolle hatte. Die Ouse zog mich an, wie Metall einen Magneten anzieht, und mit den wechselnden Jahreszeiten, in Sommernächten wie an den kurzen Wintertagen, kehrte ich immer wieder dorthin zurück, um zu schwimmen und zu wandern, bis diese Bäder und Spaziergänge Ritualcharakter angenommen hatten. Ich war ohne bestimmtes Ziel in diese Ecke von Sussex gekommen und ohne die Absicht, länger als nötig dort zu bleiben, aber heute scheint es mir, als hätte der Fluss damals die Angel ausgeworfen, als hätte er mich in vollem Flug erwischt und an sein nasses Herz gedrückt. Und als mein Leben ins Wanken geriet, war es die Ouse, bei der ich Zuflucht suchte.
Im Frühjahr 2009 befiel mich eine dieser kleinen Krisen, die unser Leben in regelmäßigen Abständen heimsuchen, wenn das Gerüst, das uns aufrecht hält, zum Einsturz verurteilt scheint. Ich verlor durch Zufall erst meine Arbeit und dann, aus purer Gedankenlosigkeit, auch noch den Mann, den ich liebte. Er kam aus Yorkshire, und eines der Scharmützel in unserer langen Schlacht drehte sich um Territorium, genauer gesagt um die Frage, wo in England wir uns niederlassen sollten. Weder mochte ich Sussex ade sagen, noch konnte er sich von den Hügeln und der Heide trennen, zumal er gerade erst dorthin zurückgekehrt war.
Nachdem Matthew mich verlassen hatte, verlernte ich das Schlafen. Brighton schien unruhig und war bei Nacht sehr hell. Das Krankenhaus gleich gegenüber hatte man vor kurzem stillgelegt, und wenn ich von meiner Arbeit aufblickte, sah ich nicht selten eine Gruppe Jugendlicher, die Fensterscheiben einschmissen oder Feuer machten auf dem Hof, wo früher Rettungswagen gestanden hatten. Mehrmals täglich hatte ich das Gefühl zu ertrinken und war kurz davor, mich auf den Boden zu werfen und zu heulen wie ein kleines Kind. In lichteren Momenten wusste ich, dass diese Panikattacken nicht von Dauer sein und bald vorübergehen würden, doch die Schönheit des Aprils machte sie nur noch schlimmer. Die Bäume entflammten zu neuem Leben: erst die Kastanie mit ihren aufragenden Kerzen, dann Ulme und Buche. Inmitten dieser grünen Flut begann die Kirsche zu blühen, und binnen Tagen hatten sich die Straßen in ein Meer von Blüten verwandelt, welche die Gullys verstopften und die Windschutzscheiben geparkter Autos tapezierten.
Der berauschende Wechsel der Jahreszeit brachte mich auf die Idee, den Fluss abzugehen. Ich wollte in jedem Sinne des Wortes verschwinden, nichts wie weg, und mein Herz riet mir, an den Fluss zurückzukehren. Ich begann, wie besessen Landkarten zu kaufen, dabei hatte ich Karten eigentlich nie viel abgewinnen können. Ein paar pinnte ich mir an die Wand; eine geologische Karte war so schön, dass sie den Ehrenplatz über meinem Bett bekam. Was mir vorschwebte, war eine Erkundung oder auch Sondierung, eine möglichst genaue Vermessung und Beschreibung eines kleinen Fleckchens England in einer Mittsommerwoche zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Das jedenfalls war meine Antwort, wenn mich jemand danach fragte. Die Wahrheit ließ sich nicht ganz so leicht erklären. Ich wollte irgendwie unter die Oberfläche der Alltagswelt dringen, so wie ein Schlafender die schnöde Wirklichkeit abschüttelt und zu den Träumen emporklettert.
Auf seinem Weg durch eine Landschaft fängt ein Fluss die Welt ein und gibt sie gedoppelt zurück: eine glitzernde, veränderliche Welt, rätselhafter als die, in der wir gemeinhin leben. Flüsse ziehen sich durch unsere Kulturen wie eine Schnur durch Perlen, und mir fällt kaum eine Epoche ein, die nicht von einem großen Wasserlauf geprägt gewesen wäre. Heute ist es im Nahen Osten knochentrocken, doch einst war der Boden fruchtbar, gespeist vom reichen Nass des Euphrat und des Tigris, an deren Ufern Sumer und Babylonien florierten. Das alte Ägypten verdankte seine Reichtümer dem Nil, der, so glaubte man, die Grenze zwischen Leben und Tod markierte und sein himmlisches Pendant in jenem Sternenrinnsal fand, das wir die Milchstraße nennen. Das Industal, der Gelbe Fluss: Das sind die Orte, wo Zivilisationen ihren Anfang nahmen, genährt von süßen Wassern, die das Land überschwemmten und es urbar machten. Die Schriftkunst entstand unabhängig voneinander in jeder dieser vier Regionen, und es kann eigentlich kein Zufall sein, dass das geschriebene Wort aus Flusswasser geboren wurde.
Flüsse sind von einem Geheimnis umgeben, das uns anzieht, denn sie entspringen dem Verborgenen und nehmen morgen vielleicht schon einen ganz anderen Lauf als heute. Im Unterschied zu einem See oder dem Meer hat ein Fluss ein Ziel, und die Bestimmtheit, mit der er sich darauf zubewegt, gibt ihm etwas ungemein Beruhigendes, insbesondere in den Augen derer, die den Glauben an ihr eigenes Fortkommen verloren haben.
So gesehen schien mir die Ouse aus zwei Elementen zu bestehen. Einerseits war sie das Ding an sich: ein zweiundvierzig Meilen langer Fluss, der in einem Eichen- und Haselwald bei Haywards Heath entsprang, durch die Strudel und Schluchten der uralten Gehölze des Weald zu Tale stürzte, bei Lewes die Downs durchquerte und bei Newhaven in den ölschlierigen Ärmelkanal mündete, wo die Fähren nach Frankreich übersetzen. Solche Wasserläufe findet man in dieser Gegend zuhauf. Ich wette, auch in Ihrer Nähe gibt es einen malerischen, mittelgroßen Fluss, der sich durch Ortschaften und Felder schlängelt, weder von ursprünglicher Wildheit noch von verlässlicher Ruhe. Die Zeit der Salzwerke und Wassermühlen mag vorbei sein, doch die Ouse bleibt ein »arbeitender Fluss«, ganz nach der Mode unserer Zeit, der eine Handvoll Stauseen speist und die Abwässer von einem guten Dutzend Klärwerken aufnimmt. Wenn man in Isfield baden geht, stößt man mal auf große Klumpen verklebter Blasen, mal auf Wasserpestfelder, die dank des ausgewaschenen Weizendüngers blühen wie ein prächtiger Obstgarten.
Aber ein Fluss bewegt sich nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Flüsse haben unsere Welt geformt; sie tragen, wie es bei Joseph Conrad heißt, »die Träume der Menschen, die Saat neuer Staaten, den Keim großer Reiche« in sich. Sie haben schon immer Menschen angelockt, und so sind sie angefüllt mit den ausrangierten Überresten der Vergangenheit. Die Ouse ist nicht sonderlich bedeutend. Sie hat die breiteren Ströme der Geschichte nur ein- oder zweimal gekreuzt; als Virginia Woolf 1941 dort ertrank und als an ihren Ufern, Jahrhunderte zuvor, die Schlacht von Lewes ausgefochten wurde. Dennoch lässt sich ihre enge Beziehung zum Menschen mehrere tausend Jahre weit zurückverfolgen, bis in die Zeit vor Christi Geburt, als neolithische Siedler die Wälder rodeten und am Flussufer Feldfrüchte anzubauen begannen. Spätere Epochen haben sehr viel bleibendere Spuren hinterlassen: angelsächsische Dörfer, eine normannische Festung, Kanalsysteme aus der Tudorzeit, georgianische Deich- und Schleusenbauten zur Entlastung des mitunter stark anschwellenden Flusses, doch selbst diese aufwändigen Maßnahmen vermochten die Ouse nicht zu bezähmen, weshalb das Städtchen Lewes zu Beginn dieses Jahrtausends Opfer einer katastrophalen Überschwemmung wurde.
Bisweilen scheint die Vergangenheit recht nahe. An manchen Abenden, wenn die Sonne untergegangen ist und die Luft sich blau verfärbt, wenn Schleiereulen über den Rispengräsern schweben und ein abgespeckter Mond durch die Baumwipfel bricht, steigen vom Fluss hier und da Dunst- und Nebelschwaden auf. Dann zeigt sich das Besondere des Wassers. Die Erde hortet ihre Schätze, und was darin verborgen liegt, verbleibt an seinem Platz, bis es per Schaufel oder Pflug wieder zutage gefördert wird; ein Fluss hingegen ist ständig in Bewegung und gibt seinen kostbaren Besitz wahllos und aufs Geratewohl preis, ohne Rücksicht auf die Binnenchronologie, an die Historiker sich so sehr klammern. Eine anhand von Wasser kompilierte Geschichte ist ihrer Natur nach flink und flüssig, voll von submersem Leben und, wie ich am eigenen Leib erfahren sollte, durchaus in der Lage, sich unversehens in die Jetztzeit zu ergießen.
In jenem Frühjahr las ich wie besessen Woolf, weil sie meine Vorliebe für Wasser und seine Metaphorik teilte. Im Lauf der Jahre hat Virginia Woolf sich den Ruf einer tristen, trübseligen Autorin, einer blutleeren Neurasthenikerin erworben, wo nicht gleich den einer boshaften, exaltierten Schnepfe, einer Grande Dame biederen Bloomsbury-Geplauders. Wer diese Ansicht teilt, hat vermutlich ihre Tagebücher nicht gelesen, denn die sind voller Humor und zeugen von einer ansteckenden Liebe zur Natur.
Virginia kam erstmals 1912 an die Ouse und pachtete ein hoch über den Sümpfen gelegenes Haus. Hier verbrachte sie die erste Nacht ihrer Hochzeit mit Leonard Woolf und erholte sich, Jahre später, von ihrem dritten in einer ganzen Reihe schwerer Nervenzusammenbrüche. 1919, nach ihrer Genesung, wechselte sie ans andere Ufer des Flusses und kaufte ein zugiges, bläulich getünchtes Cottage im Schatten des Rodmell’schen Kirchturms. Bei ihrem Einzug war alles noch sehr primitiv; es gab kein heißes Wasser, und in der feuchten Außentoilette stand ein Rohrstuhl mit einem Eimer darunter. Doch Leonard und Virginia liebten Monk’s House, und die Ruhe und die Abgeschiedenheit erwiesen sich als der Arbeit förderlich. Große Teile von Mrs. Dalloway, Zum Leuchtturm, Die Wellen und Zwischen den Akten entstanden dort, neben hunderten von Rezensionen, Kurzgeschichten und Essays.
Sie war äußerst empfänglich für die Landschaft, und ihre Impressionen dieses kalk- und wasserreichen Tals durchziehen ihr gesamtes Werk. Ihre einsamen, oft täglichen Wanderungen und Exkursionen scheinen ein wesentlicher Bestandteil des Schreibprozesses gewesen zu sein. Während ihres Zusammenbruchs in Asham House, als ihr die »Überreizungen« des Schreibens und Spazierengehens verboten waren, notierte sie wehmütig in ihr Tagebuch:
Was gäbe ich darum, von Firle her durch den Wald zu radeln, erhitzt & voller Staub, die Nase heimwärts gerichtet, Müdigkeit in jedem Muskel & das Gehirn auf süßen Lavendel gebettet, gesund & kühl & reif für das kommende Tagwerk. Wie viel Beachtung ich allem schenken würde, der rechte Satz käme im nächsten Augenblick und würde wie angegossen passen; & auf der staubigen Straße würde meine Geschichte sich, noch während ich in die Pedale trete, von selbst erzählen; & dann ginge die Sonne unter & nach Hause & eine Runde Gedichte nach dem Abendessen, halb gelesen, halb gelebt, als ob das Fleisch zerflösse & Blumen es durchbrächen rot & weiß.
»Als ob das Fleisch zerflösse« ist eine typisch Woolf’sche Formulierung. Ihre Metaphern für den Vorgang des Schreibens, für das Betreten jener Traumwelt, in der sie buchstäblich aufblühte, sind Metaphern des Fließens und der Flüssigkeit: Sie schreibt vom hineinstürzen, versinken, hinabgesogen werden. Dieses Verlangen, die Tiefe zu ergründen, war es, was mich zu ihr hinzog, denn obgleich sie schließlich unterging, hatte es eine Zeitlang den Anschein, als besäße sie, wie manche Freediver, die Gabe, unter die Oberfläche der Welt hinabzutauchen. Als ich so in meinem überhitzten kleinen Zimmer saß, kam ich mir vor wie ein Möchtegern-Entfesselungskünstler, der Houdini studiert. Ich wollte den Kniff herausbekommen, und ich wollte wissen, wie diese eleganten Kopfsprünge sich in einen Verschwindetrick der sehr viel unheimlicheren Art hatten verwandeln können.
Der Frühling wich dem Sommer. Ich hatte beschlossen, die Stadt pünktlich zur Sonnenwende zu verlassen, am Scharnierpunkt des Jahres, wenn das Licht seinen Höchststand erreicht. Der mit diesem Tag verbundene Aberglaube gefiel mir: Es heißt, dass die Wand zwischen den Welten dann dünner wird, und es ist kein Zufall, dass Shakespeare seinen trunkenen Traum am Vorabend des Mittsommers spielen lässt, denn in der kürzesten Nacht des Jahres regieren seit je Magie und Narretei. Im Juni ist England am schönsten, und in den Tagen vor meiner Abreise wurde ich fast wahnsinnig vor Verlangen danach, in die blühenden Felder zu entfliehen und im kühlen, ruhigen Fluss zu baden.
In meiner Wohnung stapelten sich nervöse Listen. Ich kaufte mir einen Rucksack und eine leichte Hose mit hübsch geblümtem Bund. Meine Mutter schickte mir ein Paar Sandalen von beispielloser Hässlichkeit und schwor – fälschlicherweise, wie sich herausstellen sollte –, dieses Modell beuge der Blasenbildung vor. Ich verbrachte einen angenehmen Nachmittag damit, in Pubs entlang der Strecke Zimmer zu buchen, unter anderem im White Hart in Lewes, wo Virginia und Leonard Woolf Monk’s House ersteigert und sich dann, im Eifer der Erregung, einen ebenso kurzen wie handfesten Streit geliefert hatten. Außerdem kaufte ich Unmengen von Haferkeksen und einen großen Kanten Käse. Kein besonders abwechslungsreicher Speiseplan, aber verhungern würde ich jedenfalls nicht.
In all dieser Zeit hatte ich mit Matthew kaum ein Wort gesprochen, und am Abend vor meiner Abreise tat ich etwas Verbotenes. Ich rief ihn an, und irgendwann im Lauf unseres wirren, an Vorwürfen und Schuldzuweisungen nicht eben armen Gespräches fing ich an zu weinen und musste feststellen, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Es war, auch wenn ich das damals noch nicht wusste, der Nadir, der Tiefpunkt jenes finsteren Frühjahrs. Bis zur Sonnenwende waren es noch vierundzwanzig Stunden; und auch wenn die Tage danach wieder kürzer wurden, begann sich das Dunkel in mir langsam zu lichten.
Porträt Gideon Algernon Mantell von William Turner Davey: Granger/Bridgeman Images
II AN DER QUELLE
Die Mauersegler waren da, als ich erwachte, auftauchte wie aus tiefem Wasser, zum ersten Mal seit Monaten vom Schlaf erfrischt und reingewaschen. Die Mauersegler waren da und ein Fuchs auf dem Parkplatz des Krankenhauses, ein dürrer, orange-grau gefleckter Fuchs, der in der Sonne hockte und sich kratzte, bevor er wieder in den Schatten des alten Müllverbrennungsofens zurückschlich. Es war der 21. Juni, der längste Tag des Jahres, der Himmel bedeckt mit einem feinen Wolkenschleier, das Meer gehüllt in dichten Nebel. Mein Rucksack stand fix und fertig am Fußende des Bettes, prall gefüllt mit ordentlich gefalteten Kleidern und Landkarten, die Seitentaschen vollgestopft mit Feldflasche und Sonnenmilch, einem zerlesenen Exemplar von The Wild Flowers of Britain and Northern Europe und einem rostigen Opinel, das sich nicht mehr einklappen ließ.
Ich sang beim Kaffeekochen. Ich fühlte mich beinahe schwerelos nach den Tränen des vergangenen Abends, als hätten sie eine Last von mir genommen, die mich monatelang am Fortkommen gehindert hatte. An diesem Nachmittag wollte ich von Slaugham zur Quelle der Ouse wandern, die in einem schmalen Lehmgraben am Fuß einer Weißdornhecke entsprang. Von dort aus wollte ich einen weiten Bogen in Richtung Südsüdosten schlagen und dabei mehrmals die Flussseite wechseln, bis ich in Isfield ankam, wo Wander- und Wasserweg parallel verliefen und das flache Kalksteintal durchquerten, das zum Ärmelkanal führte. Das musste in einer Woche leicht zu schaffen sein, hatte ich mir ausgerechnet, etwaige Umwege eingeschlossen.
Am Abend zuvor hatte ich drei Ordnance-Survey-Karten auf dem Fußboden ausgebreitet und mit Kugelschreiber und zitternden Fingern die Strecke eingezeichnet, die ich zu nehmen gedachte, ein verworrenes Geflecht von Feld- und Fußwegen, immer dicht am Fluss entlang. Doch sosehr ich auch von der offiziellen Wanderroute abwich – dem Sussex Ouse Valley Way, der zu Beginn nachgerade von der Wasserscheu befallen schien –, in den ersten drei Tagen würde ich den Fluss nur aus der Ferne zu Gesicht bekommen. Es gibt kein automatisches Recht darauf, am Ufer eines Flusses entlangzuwandern, und so ist denn auch ein Großteil des Landes, durch das die Ouse sich windet, in Privatbesitz, und Stacheldraht und Betreten-verboten-Schilder markieren die alten Klassenschranken Englands.
Ich nahm den gleichen Zug nach Bedford, mit dem ich früher zur Arbeit gefahren war; er kroch im Schneckentempo durch die Londoner Vororte und machte an jedem noch so winzigen Provinzbahnhof Station. Haywards Heath schien mir die beste Wahl zu sein. Von dort aus wollte ich mit dem Taxi nach Slaugham weiterfahren, wo ich meinen Rucksack im Chequers Inn abgeben und mich im wahrsten Wortsinn unbeschwert auf die Suche nach dem Wasser machen konnte. Ich lehnte den Kopf an das dreckige Zugfenster und ließ mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Ein Streifen Brachland säumte die Gleise, überwuchert von den alltäglichen Pflanzen, die das Auge zu gern übersieht: zartrosa Baldrian, Weidenröschen, Holunder, Zaunwinde und Margeriten. Bei Hassocks erhaschte ich einen Blick auf flammend gelbe Nachtkerzen. Wenn es heiß ist, kann man hier bisweilen den einen oder anderen Fuchs entdecken, ein rostroter Fleck inmitten der metallisch schimmernden Mohnblumen. Heute rührte sich nichts, außer den Holztauben, die mit den Flügeln schlugen und immer wieder dieselben fünf Silben riefen.
Das Chequers war ein hübsches, weißgetünchtes Pub am Rand des Dorfangers. Drinnen war es menschenleer und drückend heiß. Eine junge Polin zeigte mir mein Zimmer und den Notausgang, durch den ich auch nach der Sperrstunde noch ins Haus gelangen konnte. Ich warf meinen Rucksack aufs Bett und ging mit leeren Händen und den Taschen voller Karten querfeldein. Die Luft war wie Wackelpudding und zitterte, wenn ich mich dagegenstemmte. Ich kletterte südwärts, vorbei an Pferdekoppeln und leeren, geheimnisvollen Gärten, in denen sich ausrangierte Dreiräder und Trampoline drängten. Unterdessen hatte die Sonne den höchsten Stand des Jahres erreicht, und große halbrunde Schweißflecke verunzierten mein T-Shirt. Als ich aus dem Schatten der Kiefern trat, traf die Hitze mich mit voller Wucht. Am Rand der Warninglid Lane stieß ich auf ein totes Kaninchen, dem die Gedärme aus dem Bauch quollen und über die Fahrbahn drapiert lagen; unter der gerunzelten Haut waren dunkle Köttel zu erkennen.
Ich hatte mir dieses Geviert des High Weald monatelang auf Karten angesehen und die blauen Linien, die sich durch die Hecken wanden und weiter östlich zu einem mäandernden Bach vereinten, mit der Fingerspitze nachgezeichnet. Ich glaubte genau zu wissen, wo der Fluss entsprang, hatte jedoch nicht mit der sommerlichen Vegetationsexplosion gerechnet. Am Rand des Feldes stand eine Weißdornhecke und daneben, wo ich den Bach vermutet hatte, eine hüfthohe Wand aus Brennnesseln und Safranrebendolden, die ihre giftigen weißen Blüten in den Himmel reckten. Es war unmöglich zu sagen, ob der Graben Wasser führte oder trocken lag, denn das durstige Grün hatte ihm auch den letzten Tropfen Feuchtigkeit ausgesaugt. Einen Augenblick lang stand ich unschlüssig da und haderte mit mir. Es war Sonntag, kaum ein Auto unterwegs. Sofern mich von Eastmans Farm aus nicht gerade jemand mit dem Feldstecher beobachtete, würde niemand es bemerken, wenn ich mich verbotenerweise über die Wiese schlich zu der Stelle, wo der Fluss angeblich seinen Ursprung hatte. Drauf geschissen, dachte ich, und duckte mich unter dem Zaun hindurch.
Der überwucherte Graben führte zu einer Ansammlung von Krüppeleichen und Haselsträuchern. Hier hatten die ausladenden Bäume die Brennnesseln vertrieben, und der Fluss war zu sehen, als braunes Bächlein zwischen Hufabdrücken, das am anderen Ende des Wäldchens versickerte. Es gab keine Quelle. Das Nass sprudelte nicht aus der Erde, rostrot, wie ich es in Balcombe gesehen hatte, zehn Meilen östlich von hier. Der Ursprung – eine reichlich hochtrabende Bezeichnung für dieses feuchte Rinnsal, das offensichtlich dazu diente, das überschüssige Wasser von den Feldern auf die angrenzenden Ebenen abzuleiten. Somit war es nicht mehr und nicht weniger als der am weitesten von der Mündung entfernt gelegene Zulauf der Ouse, ihr längster Arm, eine fast schon beliebige Methode, die ständige Bewegung des Wassers durch Luft, Erde und Meer auf eine Karte zu bannen.
Nicht immer lässt sich endgültig bestimmen, wo etwas seinen Anfang nimmt. Selbst wenn ich inmitten der gefallenen Blätter auf die Knie gesunken wäre, hätte ich sie nie gefunden, die exakte Stelle, an der die Ouse begann, wo ein dünner Regenfaden genügend Dynamik entwickelt hatte, um bis zur Küste zu gelangen. Diese ebenso schlammige wie schlampige Geburt erschien mir ausgesprochen passend, wenn man bedenkt, woher der Fluss seinen Namen hat. In England gibt es viele Ouses und entsprechend viele Deutungen des Wortes. Gewöhnlich wird es auf ūsa, das keltische Wort für Wasser, zurückgeführt, doch da die Angelsachsen in dieser Gegend siedelten, ziehe ich eine andere Lesart vor, nach der es vom sächsischen wāse herstammt, von dem auch das englische Wort ooze abgeleitet ist, das weichen Schlamm oder Schlick bezeichnet – Erde, die so nass ist, dass sie fast zerfließt. Horchen Sie: ooooze. Nahezu geräuschlos gleitet sie dahin und saugt an Ihren Schuhen. Ein ooze ist ein Sumpf oder Morast, und to ooze bedeutetsickern oder quellen. Es gefällt mir, wie dieses ungemein flexible, in einer Doppelrolle auftretende Wort auf ungreifbare, um nicht zu sagen schlüpfrige Art und Weise zweierlei zum Ausdruck bringt: nämlich einerseits die Befähigung der Erde, Wasser aufzunehmen, und andererseits die Fertigkeit des Wassers, den Boden zu durchdringen. Man konnte den Fluss darin förmlich hören, wie er durch den Weald – ooooze – an die Oberfläche quoll und sich durch die Täler wand, hin zu der Stelle, wo er einst einen todbringenden Sumpf gebildet hat.
Zum Valentinstag, bevor unsere Beziehung in die Brüche ging, schenkte Matthew mir eine selbstgemachte Karte der Ouse. Er hatte sämtliche in der Bibliothek von Huddersfield vorhandenen OS-Explorer-Karten fotokopiert, die Ausmaße des Stromgebietes berechnet und die Blätter dann, obsessiv wie er ist, entlang der schwankenden Linie der Wasserscheide zurechtgeschnitten. Sämtliche Nebenflüsse waren mit Leuchtmarker farblich hervorgehoben: orange für den Bevern, pink für den Iron River, grün für den Longford und den unterfähigen Glynde Reach. Ich klebte die Einzelteile mit Tesafilm zusammen und befestigte sie mit Reißzwecken an meiner Wand: ein 233 Quadratmeilen großes Stück Land in Form einer kollabierten Lunge. Binnen weniger Monate hatte die Sonne die Farben ausgebleicht, und Ende April hatte ich die Karte von der Wand genommen und sie in einem der vielen Papierstapel auf meinem Schreibtisch verschwinden lassen.
Daran musste ich denken, als ich dort im Wald stand. Auf der Karte war der Graben blau markiert gewesen. Was an sich nichts zu bedeuten hatte: eine Wasserstelle für Rehe, eine vor Jahrhunderten angelegte Rinne, um die Überschwemmung des benachbarten Feldes zu verhindern. Ein Blatt trudelte ins Wasser und trieb langsam Richtung Osten. Ich konnte mich nicht entsinnen, wann es zuletzt geregnet, wann dieses Wasser sich gesammelt hatte, bevor es im Gras versickert und als dieses schmale Rinnsal wieder ans Licht gekommen war. Die durchschnittliche Verweildauer eines Wassermoleküls in einem Fluss von dieser Größe beträgt einige Wochen, abhängig von Strömungsgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge und einem Dutzend anderer Faktoren. Wenn es stattdessen in den Boden eindringt und zu Grundwasser wird, kann es über hunderte oder, so es tief genug gesunken ist, hunderttausende von Jahren dort bestehen bleiben. Der Isotopenhydrologie zufolge ist das fossile Wasser in einigen der größten geschlossenen Aquifere dieser Welt über eine Million Jahre alt. Solche Aquifere befinden sich häufig unter Wüsten, und es ist eine seltsame Vorstellung, dass unter der Kalahari, der Sahara und großen Teilen der ausgedörrten Mitte Australiens gewaltige Vorkommen uralten Wassers lagern, gespeichert in Ton und Stein. Verglichen damit war dieses Grabenwasser am Ausgangspunkt des Flusses quasi taufrisch, eben erst vom Himmel gefallen. Das meiste davon verdunstete an der Sonne, noch ehe es den Slaugham Mill Pond erreichte, wo es fünfzig Jahre mit den Karpfen kreisen konnte, bevor es in Richtung Süden rauschte, um mit tausend Tonnen pro Minute ins Meer zurückzufließen.
Der kleine Bach stand jetzt fast still; kaum zu glauben, dass er seine Natur und Beschaffenheit so vollkommen verändern konnte. Am Waldrand lag ein stinkender Tümpel, und ein Traktor harrte seines Tagwerks. Der Hafer war noch nicht reif, nichts rührte sich. Ich hörte das Wasser leise über Wurzeln und winzige Steine plätschern, und wie ich so dort stand und wartete, kam mir eine Zeile aus einem Gedicht von Seamus Heaney in den Sinn, Teil der riesigen, ungeordneten Bibliothek von Flussliteratur. Es handelte vom Rutengehen und schien mir die Fremd- und Besonderheit des Wassers auf wunderbare Weise einzufangen: »Ein Brunnenquell, der zu uns spricht per grünem Draht geheimer Sender.« Vielleicht hatte der Gedanke an fossiles Wasser sie mir in den Kopf gesetzt, denn die Vorstellung, dass es auf diesem Planeten neben den sichtbaren auch unsichtbare Seen und Flüsse gibt, fand ich schon immer faszinierend. An diese Art verborgenen Reichtums muss Auden gedacht haben, als er »Ein Lob dem Kalkstein« schrieb, das mit den Worten schließt:
Teurer, ich weiß von beidem nichts, doch
Wenn ich mir eine makellose Liebe vorzustellen versuche
Oder das zukünftige Leben, dann höre ich das Murmeln
Unterirdischer Bäche, dann sehe ich eine Kalksteinlandschaft.
In Heaneys Gedicht kündigt das Wasser sein Vorhandensein mit einem Ruck an, der den gegabelten Haselstock »in Krämpfen hinabfahren« lässt. Es ist ein Akt purer Magie und deshalb wenig überraschend, dass das Rutengehen – das man in Amerika water witching, »Wasserhexerei«, nennt – der wissenschaftlichen Überprüfung schwerlich standhält und die Trefferquote der Wünschelgänger von Zufall so gut wie nicht zu unterscheiden ist. Und doch muss der Mensch, wie alle Tiere, einst eine empfindliche Antenne gehabt haben für die dunkle Frequenz, die das Wasser auf seinem Weg durch Erdreich und Gestein aussendet. Diese Sensibilität ist seither zweifellos verkümmert oder aber im Gehupe der Autos und dem permanenten Trillern unserer Handys verlorengegangen, trotzdem bin ich bei Waldspaziergängen schon viele Male, sei es per Zufall oder per Instinkt, auf einen Teich oder Bach gestoßen, von dessen Existenz ich nichts wusste.
Ich ging neben einer Krüppeleiche in die Hocke und zerrieb ein junges Stechpalmblatt auf meinem Knie. Mir war unbehaglich zumute und das Gefühl, mich auf verbotenem Terrain zu befinden, schier erdrückend. Flussquellen sind nicht selten mit Tabus belastet und, jedenfalls der Mythologie zufolge, bei all ihrer schaurigen Schönheit vielleicht nicht unbedingt der geeignetste Aufenthaltsort für einen Menschen. Der Legende nach schlug die Göttin Athene den Seher Teiresias mit Blindheit, kaum dass er sie nackt in einer Quelle auf dem Berg Helikon hatte baden sehen, und seine prophetische Gabe war der Ausgleich für den erlittenen Verlust des Augenlichts.
Wenn man dem Dichter Kallimachos glauben darf, fand diese Begegnung im Mittsommer – an einem Tag wie heute – statt, als Athene und die Nymphe Chariklo, Teiresias’ Mutter, gemeinsam in besagtem Bache lagen. Es geschah zur Mittagszeit, in jenem regungslosen Augenblick, da die Welt von der Hitze wie betäubt ist. Teiresias blieb allein auf dem Hügel zurück und ging mit seinen Hunden auf die Hirschjagd. Die Sonne hatte ihn durstig gemacht, und so stieg er den Hügel hinab, um sich zu erfrischen, ohne zu ahnen, dass der Bach besetzt war. Als Athene ihn zwischen den Bäumen hervorkommen sah, ließ sie ihn auf der Stelle erblinden, denn es ist verboten, eine Göttin unverhüllt zu sehen, auch wenn diese regelmäßig mit der eigenen Mutter badet. Helikon, ich werde dich nie wieder betreten, rief die Nymphe Chariklo. Dein Preis ist zu hoch: die Augen meines Sohnes für ein paar Hirsche. Und so säuberte Athene dem Knaben zur Wiedergutmachung die Ohren, sodass er die Vögel verstehen und den Böotiern und den mächtigen Labdakiden sagen konnte, worüber sie sprachen. Es war eine grausame Strafe, aber immer noch besser, wie Athene zu betonen nicht müde wurde, als das Los, welches den Jäger Aktaion befiel, der von seinen eigenen Hunden zerfleischt wurde, weil er Artemis im Bade erblickt hatte, sodass seine Mutter seine verstreuten Gebeine aus Dornicht und Dickicht zusammenklauben musste.
Die Quelle der Ouse hätte zwar allenfalls einer Miniaturgöttin ausreichend Platz zum Baden geboten, und doch hatte der Bach mit einem Mal etwas Unheilvolles. Ich wurde das Gefühl des Verbotenen nicht los, als ich im Zickzack nach Slaugham zurückkehrte, über einen Privatweg, der an einer Scheune vorbeiführte, in der unbeweglich ein Trapez hing. Der Pfad erklomm einen Hügel, vorbei an weidenden Pferden in mittelalterlichen Turniermasken, und mündete auf eine von Straußgras, Trespe und Honigmeddel bestandene Kleewiese, wo sich tausende von Bienen tummelten. Die rosaroten und gelbbraunen Halme schwankten und schaukelten im Wind, und die Bienen summten immer einzeln darüber hinweg und erfüllten die Luft mit ihrer Musik.
Hier gefiel es mir schon sehr viel besser. Ich legte mich in die Sonne und schlug die Beine übereinander. Das Gesirr wirkte einschläfernd, und während mir langsam die Augen zufielen, kam mir, lebhaft wie ein Traum, die Erinnerung an einen Nachmittag, an dem ich bäuchlings an einem Lehmhügel in Schottland gelegen und Bienen beobachtet hatte; sie hatten ein System winziger Höhlen in die Erde gegraben und flogen unablässig ein und aus. Es herrschte ein so munteres Kommen und Gehen, dass in der heißen, von Kiefernduft erfüllten Luft der ganze Hügel in Aufruhr zu geraten und regelrecht zu beben schien. Unter der Erde mussten sich noch weitaus mehr Bienen befinden, und jedem einzelnen der unzähligen Löcher entstieg das Geräusch ihrer Flügel: ein fernes, atonales Summen, als hätte die Erde sich zur Ruhe gebettet und würde sich ein Schlaflied singen.
Leonard Woolf war Hobbyimker. Er hatte einen Stock in Monk’s House, dem Cottage in Rodmell, das die Woolfs kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs gekauft hatten, und das Ausschwärmen der Bienen veranlasste Virginia zu einem ungewohnt erotischen Tagebucheintrag:
Als wir nach dem Mittagessen draußen saßen, hörten wir sie; & am Sonntag waren sie wieder da & hingen als zitternder glänzender schwarzbrauner Beutel an Mrs. Thompsetts Grabstein. Wir sprangen umher im hohen Gras der Gräber, Percy ausstaffiert in Regenmantel und Imkerhut. Die Bienen schwirren, wie Pfeile der Begierde: wild, lüstern; weben Fadenspiele in die Luft; jede saust an einem Fädchen; die ganze Luft erfüllt von einem Beben: von Schönheit, von dieser brennenden pfeilspitzen Begierde; & Tempo: ich empfinde den zitternden wimmelnden Bienenbeutel nach wie vor als ein ungemein sexuelles & sinnliches Symbol.
Ein paar Sätze weiter, von dem Bild noch immer wie berauscht, beschreibt sie eine hässliche Teilnehmerin der Teegesellschaft und setzt hinzu: »Warum die Bienen ausgerechnet sie umschwärmten, vermag ich nicht zu sagen.«
In dieser kleinen Episode steckt bereits die ganze Woolf: sinnlich, genau, selbst vielleicht eher Wespe als Biene, dennoch ebenso empfänglich für die Natur wie für das Künstliche, vor allem aber erfüllt von dem Bestreben, den Dingen auf den Grund zu gehen, das treffende Wort für ein Gefühl oder eine Wahrnehmung zu finden. Zugegeben, die Tagebücher sind nicht so ausgefeilt, nicht so ornamentiert wie die Romane, dafür vermitteln sie den umso stärkeren Eindruck einer Autorin, die mit ihren Möglichkeiten spielt und ihr Handwerk trainiert. Gleichwohl ist die polymorphe Sexualität dieser Episode ganz und gar charakteristisch und bietet ein reizvolles Gegengewicht zum öffentlichen Fantasiebild einer Virginia, die ebenso gut aus Glas sein könnte.
Einem hartnäckigen Mythos zufolge war Virginia Woolf, wie schon ihr Name andeutet, sexuell unerreichbar: ein Monument der Langmut und Geduld, eine Frau aus Alabaster mit sprudelndem Verstand. Zwar weiß man, dass sie Leonard Woolf vor ihrer Eheschließung 1912 eröffnete, dass sie sich körperlich nicht zu ihm hingezogen fühlte. Doch auch wenn es nicht immer in konventionellen romantischen Bahnen verlief, hatte ihr Liebeswerben seinen ganz eigenen Reiz, und Wasser spielte dabei eine erfreulich große Rolle. Sie besuchten zusammen die Titanic-Anhörungen, tauschten ihren ersten Kuss an der Kanalküste in Eastbourne, und an dem Nachmittag, als Virginia ihm ihre Liebe gestand, fuhren sie mit dem Boot die Themse hinauf bis nach Maidenhead. Auf einem damals aufgenommenem Foto wirkt sie nervös und unbeugsam zugleich; ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem ausgemergelten Porträt, auf dem sie neben dem Dichter Rupert Brooke zu sehen ist, der nicht nur eine täuschende Ähnlichkeit mit Leonardo DiCaprio besitzt, sondern verglichen mit der spindeldürren, spähenden jungen Frau an seiner Seite wie ein verfetteter Apollo aussieht.
Leonard und Virginia verbrachten ihr erstes gemeinsames Wochenende in Sussex, in den Hügeln mit Blick auf die Ouse, die in dieser Gegend durch ein breites, sumpfiges Tal am Fuß der Downs verläuft, bevor sie ein paar Meilen weiter in den Ärmelkanal mündet. Bei einer Wanderung durch die wogenden grünen Wiesen stießen sie auf Asham, das Haus, in dem sie schon bald ihre fast drei Jahrzehnte währende Ehe beginnen sollten. Zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit waren beide Mitte dreißig, standen beide kurz vor der Vollendung ihres ersten Romans. Leonard war Jude, sanftmütig, sensibel, und zu seinem Scharfsinn paarte sich ein kühler Pragmatismus, mit dem er schon damals abseits des plappernden Bloomsbury-Kreises stand. Er war kurz zuvor aus Ceylon zurückgekehrt, wo er es im Kolonialdienst zum stellvertretenden Statthalter der Regierung gebracht hatte. Sein Vater war tot, und trotz seiner bewundernswerten Geistesstärke befiel ihn in Stresssituationen ein nervöses Händezittern, das er nicht zu besänftigen vermochte.
Virginia war Vollwaise. Ihre Mutter war gestorben, als sie noch ein Kind gewesen war, und 1902 hatte man bei ihrem cholerischen Vater, dem Bergsteiger und Kritiker Sir Leslie Stephen, jene Darmkrebserkrankung diagnostiziert, die ihn zwei Jahre später das Leben kostete. Nach jedem dieser beiden schmerzlichen Verluste geriet Virginias geistige Gesundheit ins Wanken, und sie erlitt jene Zusammenbrüche, die das Bild ihrer Person in den Jahren nach ihrem Tod maßgeblich mitbestimmen sollten. Doch sie ging gestärkt aus ihrem Wahn hervor, in dem festen Entschluss zu arbeiten, zu schreiben, was ihr schließlich auch gelang.