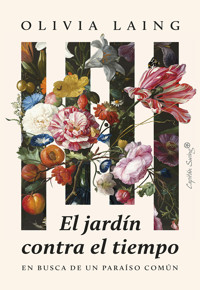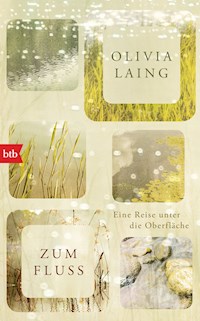17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum unser Körper politisch ist: Olivia Laing erzählt unter völlig neuen Vorzeichen von den Protestbewegungen des 20. Jahrhunderts.
Eine Tour de Force von »einer der bedeutendsten Stimmen unserer Zeit« (Financial Times). Brandaktuell geht Olivia Laing der Frage nach, was es bedeutet, einen Körper zu haben, der uns behindert, uns gefangen hält und zugleich befreit.
Der Körper ist eine Quelle des Vergnügens und des Schmerzes, gleichzeitig hoffnungslos verletzlich und doch voller Kraft. Mit einem radikal neuen Blick auf das letzte Jahrhundert analysiert Olivia Laing den langen Kampf um körperliche Freiheit. Laing erzählt von sexueller Befreiung und LGBTQ-Bewegungen, von Feminismus, globalen Gesundheitskrisen und dem Civil Rights Movement, stützt sich auf eigene Protesterfahrungen und unternimmt Reisen vom Berlin der Weimarer Zeit bis zu den Gefängnissen der McCarthy-Ära in Amerika. In den Recherchen begegnet Laing ausgehend von Wilhelm Reich und seinen Theorien einigen der spannendsten und kompliziertesten Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts, darunter Nina Simone, Sigmund Freud, Susan Sontag und Malcolm X.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Eine Tour de Force von »einer der bedeutendsten Stimmen unserer Zeit« (Financial Times). Brandaktuell geht Olivia Laing der Frage nach, was es bedeutet, einen Körper zu haben, der uns behindert, uns gefangen hält und zugleich befreit.
Der Körper ist eine Quelle des Vergnügens und des Schmerzes, gleichzeitig hoffnungslos verletzlich und doch voller Kraft. Mit einem radikal neuen Blick auf das letzte Jahrhundert analysiert Olivia Laing den langen Kampf um körperliche Freiheit. Laing erzählt von sexueller Befreiung und LGBTIQ+-Bewegungen, von Feminismus, globalen Gesundheitskrisen und dem Civil Rights Movement, stützt sich auf eigene Protesterfahrungen und unternimmt Reisen vom Berlin der Weimarer Zeit bis zu den Gefängnissen der McCarthy-Ära in Amerika. In den Recherchen begegnet Laing ausgehend von Wilhelm Reich und seinen Theorien einigen der spannendsten und kompliziertesten Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts, darunter Nina Simone, Sigmund Freud, Susan Sontag und Malcolm X.
Autorin
Olivia Laing, geboren 1977, »meisterhafte*r Biograf*in, Memoirschreiber*in und Essayist*in« (Helen MacDonald), studierte Englische Literatur an der Universität von Sussex. Laing brach ihr Studium ab, um auf einem Baum in der Wildnis zu leben und ein Diplom in Pflanzenheilkunde zu erwerben und sich anschließend dem Journalismus zuzuwenden. Laings Bücher sind in fünfzehn Sprachen übersetzt. 2018 erhielt Olivia Laing den renommierten Windham-Campbell-Preis.
Übersetzer
Thomas Mohr, geboren 1965, übersetzt seit 1988 englischsprachige Literatur, u. a. Truman Capote, Emma Donoghue, James Ellroy, Olivia Laing und Mark Twain. Für sein übersetzerisches Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet.
Olivia Laing
Everybody
Warum unser Körper politisch ist
Aus dem Englischen vonThomas Mohr
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Everybodybei Picador, London.
Die Arbeit des Übersetzers an vorliegendem Text wurde im Rahmen des Programms NEUSTARTKULTUR aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2021 Olivia Laing
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Susanne Wallbaum
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben | Köln
Umschlagabbildung: © Stefanie Naumann
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-25061-4V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Rebecca und PJ,in Liebe und Dankbarkeit
»Ich will keinen Körper mehr haben. Drauf geschissen.«
Ryan Trecartin, Sibling Topics
»Die Politik verschwindet nicht etwa aus meinem Leben, sondern findet im Innern meines Körpers statt.«
Kathy Acker, Bis aufs Blut: Zerfleischt in der Highschool
»Wir dürfen vielleicht sagen, dass im Menschen eine Art Umwandlung der Essenzen des Lebens beständig vor sich geht und allezeit vor sich gehen kann.«
Edward Carpenter, Wenn die Menschen reif zur Liebe werden
»Mein Leben unsicher in den sehenden /
Händen anderer gehalten«
Frank O’Hara, »Gedicht«
Dieses Buch handelt von Körpern in Gefahr und Körpern als treibende Kraft der Veränderung. Ich habe es während der Flüchtlingskrise 2015 begonnen und die Arbeit daran abgeschlossen, als die ersten Covid-19-Fälle gemeldet wurden. Die Pandemie hat das erschreckende Ausmaß unserer körperlichen Verwundbarkeit deutlich gemacht, die weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste im Jahr 2020 aber zeigen, dass der lange Kampf um die Freiheit noch keineswegs beendet ist.
1 Die Befreiungsmaschine
Im letzten Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts sah ich in einer Naturheilmittelapotheke in Brighton eine Werbung. Sie war rosa, umrahmt von einer Girlande aus handgemalten Herzchen, und behauptete frech, jegliche Art von Symptomen, von Kopfschmerz und Erkältung bis zu Wut und Depression, würde verursacht durch energetische Blockaden, die infolge früherer Traumata entstünden und sich mittels Körperpsychotherapie lösen ließen, sodass die Energie wieder in Fluss käme. Zwar wusste ich, dass diese Aussage – milde ausgedrückt – umstritten war, doch die Vorstellung vom Körper als Speicher für seelisches Leid faszinierte mich. Schon seit Kindertagen hatte ich das dunkle Gefühl, dass ich etwas tief und fest in mir verschlossen hielt, eine rätselhafte Traurigkeit, deren genaue Ursache ich nicht verstand. Ich war so steif und verkrampft, dass ich jedes Mal zusammenschrak, wenn mich jemand berührte, wie eine zuschnappende Mausefalle. Irgendetwas klemmte, und das wollte ich dringend ändern.
Anna, die Therapeutin, praktizierte in einem plüschigen Zimmer unter dem Dach ihres Hauses. In der Ecke stand eine professionell aussehende Massageliege, und doch herrschte eine Atmosphäre wohliger, wenn auch etwas schmuddeliger Häuslichkeit. Rüschenkissen noch und noch. Das Bücherregal an der Wand war mit Secondhandpuppen und Spielzeugen vollgestopft, die auf ihren Einsatz in einer Gestalt-Pantomime warteten. Manchmal nahm Anna einen grinsenden Affen, drückte ihn an ihre Brust und sprach mit hoher, lispelnder Stimme in der dritten Person von sich selbst. Ich wollte nicht mitspielen und so tun, als säße auf dem leeren Stuhl mir gegenüber ein Familienmitglied, oder mit einem Baseballschläger auf ein Kissen eindreschen. Dafür war ich zu gehemmt, mir meiner Lächerlichkeit schmerzlich bewusst, und obwohl ich Annas albernes Getue beschämend fand, spürte ich, dass sie eine Art von Freiheit besaß, zu der mir der Zugang fehlte.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit schlug ich statt eines Gesprächs eine Massage vor. Dazu musste ich mich zum Glück nicht ganz ausziehen. Anna schlang sich ein Stethoskop um den Hals und bearbeitete meinen Körper an den unmöglichsten Stellen. Sie knetete meine Muskeln nicht, sondern erteilte ihnen vielmehr den Befehl, sich zu entspannen. In regelmäßigen Abständen beugte sie sich über mich, presste mir den Kopf ihres Stethoskops auf den Bauch und horchte. Dabei hatte ich nicht selten das Gefühl, dass Energie meinen Körper durchströmte, vom Unterleib bis in die Beine, wo sie kitzelte wie die Tentakel einer Qualle. Es war eine angenehme Empfindung, nicht unbedingt sexuell, eher so als sei eine hartnäckige Blockade beseitigt worden. Weder sprach ich mit Anna darüber, noch fragte sie mich danach, und das war einer der Gründe, weshalb ich immer wiederkam: um diesen zu neuem Leben erwachten, bebenden Körper zu erfahren.
Ich war zweiundzwanzig, als ich Anna zum ersten Mal aufsuchte, und der Körper stand im Mittelpunkt meiner Interessen. Wenn über Körper gesprochen wird, besonders in der Populärkultur, ist das Themenspektrum in aller Regel eng begrenzt und es geht zumeist um das Erscheinungsbild oder die Gesunderhaltung des Körpers. Der Körper als eine Ansammlung von Oberflächen von mehr oder minder ansprechendem Aussehen. Der perfekte, unerreichbare Körper, so glatt und glänzend, praktisch nicht von dieser Welt. Womit man ihn füttert, wie man ihn pflegt und die ständige Angst, dass er womöglich abweichend oder ungenügend ist. Mich hingegen interessierte in erster Linie die Erfahrung, in ihm zu leben, etwas zu bewohnen, das so katastrophal verletzlich war, so hilf- und wehrlos Lust und Schmerz, Hass und Begehren ausgesetzt.
Ich war in den Achtzigern in einer lesbischen Familie aufgewachsen, unter der unbarmherzigen Knute der Section 28, eines homophoben Gesetzes, das es Schulen verbot, die »Akzeptanz von Homosexualität als vorgetäuschte Familienbeziehung« zu unterrichten. Dass der Staat so über meine Familie dachte, war eine bittere Lektion und schärfte mein Bewusstsein dafür, wie Körper in einer Wertehierarchie geordnet sind, wie ihre Freiheiten aufgrund von Attributen, auf die sie keinen Einfluss haben, von Hautfarbe bis Sexualität, gestärkt oder beschnitten werden. Immer wenn ich zur Therapie ging, spürte ich das Erbe dieser Zeit im eigenen Körper, als Knoten von Scham und Angst und Wut, die sich nur schwer benennen, geschweige denn entwirren ließen.
Doch meine Kindheit hat mich nicht nur gelehrt, dass der Körper ein Objekt ist, dessen Freiheit durch die Außenwelt beschränkt wird, sie hat mir auch gezeigt, dass der Körper selbst ein Mittel zur Freiheit sein kann. Meine erste Gay Pride Parade erlebte ich mit neun, und der Eindruck all dieser marschierenden Körper auf der Westminster Bridge blieb auch bei mir nicht ohne Wirkung; eine physische Empfindung, wie ich sie nie zuvor erfahren hatte. Mir wurde klar, dass man durch körperliche Präsenz auf der Straße die Welt verändern kann. Als Pubertierende, die vor der drohenden Klimaapokalypse schreckliche Angst hatte, nahm ich an ersten Demonstrationen teil und wurde in der Umweltschutzbewegung aktiv. Ich stürzte mich mit solcher Leidenschaft in die Protestarbeit, dass ich schließlich sogar mein Studium aufgab und in ein Baumhaus zog, in einem Wald in Dorset, der einer Umgehungsstraße weichen sollte.
Ich fand es toll, im Wald zu leben, aber meinen Körper als Instrument des Widerstands zu benutzen, war nicht nur berauschend, sondern auch zermürbend. Die Gesetze wurden in einem fort verschärft. Die Polizei ging mit zunehmender Härte vor, und einigen meiner Freunde und Bekannten drohten lange Haftstrafen wegen »schweren Landfriedensbruchs«, wie das neuerdings hieß. Die Freiheit hatte einen Preis, und dieser Preis hatte allem Anschein nach auch eine körperliche Seite: den ständig drohenden Verlust der physischen Freiheit. Wie so viele Aktivisten brannte ich aus. Im Sommer 1998 setzte ich mich auf einem Friedhof in Penzance auf eine Bank und füllte einen Antrag auf Ausbildung zur Heilpraktikerin aus. Als ich Anna aufsuchte, war ich bereits im dritten Semester.
Ich wusste es damals zwar noch nicht, aber die Form der Therapie, die Anna praktizierte, war in den Zwanzigerjahren von Wilhelm Reich erfunden worden, einem der sonderbarsten und weitsichtigsten Denker des zwanzigsten Jahrhunderts, einem Mann, der sein Leben der Erforschung der komplexen Beziehung zwischen Körper und Freiheit widmete. Reich war eine Zeit lang Freuds brillantester Protegé (»der beste Kopf« auf dem Gebiet der Psychoanalyse). Als jungem Analytiker im Wien der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg kam ihm der Verdacht, dass seine Patienten ihre Erfahrungen im Körper mit sich trugen und ihren emotionalen Schmerz als eine Art Anspannung speicherten, die er mit einem Panzer verglich. Über die nächsten zehn Jahre entwickelte er ein revolutionäres neues System der körperorientierten Psychotherapie und richtete sein Augenmerk auf die charakteristische Körperhaltung seiner Patienten. »Er hörte zu und beobachtete und folgte, während er fühlte, tastete und untersuchte«, erinnerte sich sein Sohn Peter später, »einem fast unheimlichen Instinkt für das Auffinden von erstarrten Erinnerungen und von Hass und Angst im menschlichen Körper.« Zu Reichs Erstaunen ging diese Gefühlsentladung häufig mit unwillkürlichen, lustvollen Kontraktionen des Körpers einher, die er »das Strömen« nannte; dieselbe unverwechselbare Empfindung, die ich auf Annas Liege verspürt hatte.
Viele von Reichs Wiener Patienten waren einfache Arbeiter. Die Geschichten, die sie ihm erzählten, brachten ihn zu der Erkenntnis, dass die Probleme, die er an ihnen beobachtete, die geistige Verwirrung, nicht allein auf kindliche Erfahrungen, sondern auch auf soziale Faktoren wie Armut, Wohnungsnot, häusliche Gewalt und Arbeitslosigkeit zurückzuführen waren. Jedes Individuum war fraglos größeren Kräften ausgesetzt, die ebenso gewaltige Probleme verursachen konnten wie Freuds Hauptinteressengebiet, die Feuerprobe Familie. Und so versuchte Reich, der kein noch so großes Wagnis scheute, in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen zwei bedeutende Systeme zur Diagnose und Behandlung menschlichen Unglücks zu fusionieren, indem er – sehr zum Unbehagen ihrer Anhänger – die Gedanken von Freud und Marx in einen produktiven Dialog zwang.
In Reichs Auffassung von Freiheit spielte Sex seit je eine zentrale Rolle, und im Jahre 1930 zog er nach Berlin, in eine Stadt am Rand des Abgrunds, gefangen zwischen zwei Katastrophen, wo aus den Trümmern des Krieges eine Fülle neuer Vorstellungen von Sexualität erwuchs. Reich war der Ansicht, dass sich die Welt verändern ließe, wenn man den Sex nur endlich aus seinem jahrhundertealten Gefängnis von Repression und Scham befreite, doch Hitlers Machteroberung im Frühjahr 1933 machte seiner Berliner Tätigkeit ein jähes Ende. Noch im selben Herbst schrieb er im dänischen Exil Die Massenpsychologie des Faschismus, eine packende Analyse der Strategie Hitlers, der unbewusste sexuelle Ängste wie die Furcht vor Infektion und Kontamination gezielt dazu benutzte, Stimmung gegen die Juden zu machen.
Als Erstes las ich People in Trouble (Menschen im Staat), worin Reich seine politischen Erfahrungen in Wien und Berlin schildert. Ich entdeckte ein Exemplar auf dem sonntäglichen Flohmarkt auf dem Parkplatz des Brightoner Bahnhofs und nahm es nur zur Hand, weil es denselben Titel trug wie ein Roman, den ich sehr mochte. Obwohl er es in den Fünfzigerjahren geschrieben hatte, musste ich bei der Lektüre an meine Zeit als Aktivistin denken, die Höhen und Tiefen des Kampfes für politische Veränderung. Reich war kein brillanter Stilist wie Freud, und auch seine Argumentation war nicht so klar und durchdacht. Er klang oft überheblich, ja paranoid, aber seine Leidenschaft steckte mich an. Es war, als berichte er direkt vom Schlachtfeld: über sein Notizbuch gebeugt, in dem er allerlei gewagte Möglichkeiten skizzierte, das gemeine Volk von seinen Fesseln zu entbinden.
Seine Ideen schienen auch für meine Zeit so relevant, dass ich mich fragte, warum ich noch nie von ihm gehört hatte, weder in Protestkreisen noch während meiner Ausbildung. Viel später erst wurde mir klar, dass ihm nur deshalb so wenig Achtung und Anerkennung zuteilwurde, weil die Exzesse seiner zweiten Lebenshälfte die erste überschatten. Die radikalen, scharfsinnigen Gedanken zu Sex und Politik, die er im Europa der Vorkriegszeit entwickelt hatte, werden überlagert von den weitaus problematischeren Ideen, in die er sich während seiner Zeit im amerikanischen Exil verrannte, von pseudowissenschaftlichen Krankheitstheorien bis hin zu einer Raumkanone, die das Wetter kontrolliert.
Als Reich 1939 in die USA auswanderte, ließ er sich dort nicht etwa als Psychoanalytiker oder Aktivist nieder, sondern als Wissenschaftler, auch wenn er vom Peer-Review-Verfahren, dem sich jede wissenschaftliche Publikation zu unterziehen hat, ausgesprochen wenig hielt. Kurz nach seiner Ankunft behauptete er, die universelle Energie entdeckt zu haben, die alles Lebendige beseelt. Er nannte sie Orgon, und in seinem hauseigenen Laboratorium in New York entwickelte er eine Maschine, mit der er ihre heilenden Kräfte gezielt nutzbar machen wollte. Gemessen an den Konsequenzen, die sie für ihren Erbauer haben sollte, mutet es nachgerade paradox an, dass es sich bei Reichs Allheilapparatur um eine einfache Holzzelle handelte, etwas kleiner als ein Telefonhäuschen, in der man sich trefflich in selbst gewählte Einzelhaft begeben konnte.
Reich glaubte, dass der Orgon-Akkumulator die Befreiungsarbeit automatisieren und die mühsame persönliche Therapie überflüssig machen würde. Und er hoffte, dass der Apparat Krankheiten würde heilen können, vor allem Krebs. Letzteres legte er in einem Aufsatz dar, der ihn ins Visier der Food and Drug Administration rückte, worauf diese eine Untersuchung der medizinischen Wirksamkeit des Orgon-Akkumulators einleitete, die fast ein Jahrzehnt in Anspruch nahm. Am 7. Mai 1956 wurde Reich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine Erfindung trotz Verbots auch weiterhin vertrieben hatte. Im Frühjahr 1957 landete er im Lewisburg Penitentiary in Pennsylvania.
Der Orgon-Heini: Das war Reich! Ich hatte zwischen den beiden keinen Zusammenhang herstellen können. Als Teenager war ich ein großer Fan von William Burroughs, und Burroughs war als junger Mann von Reich geradezu besessen. In seinen Briefen aus den Vierziger- und Fünfzigerjahren wimmelt es nur so von Anspielungen auf Reich und seine Orgon-Kisten. Der blaue Flackerschein der Orgon-Energie, »das vibrierende tonlose Summen der tiefen Wälder und Orgon-Akkumulatoren« bilden die alles durchdringende Atmosphäre seiner Bücher, tragen zu ihrem apokalyptischen Grusel bei: »Die Botschaft des Orgasmus erhalten und gesendet«. Wie so viele Protagonisten der Gegenkultur baute Burroughs seine eigenen Orgon-Akkumulatoren. Und tatsächlich war die erste Orgon-Kiste, die ich je gesehen habe, Burroughs’ verrosteter Gartenakkumulator, den Kurt Cobain 1993 in Kansas ausprobierte. Auf einem damals entstandenen Foto winkt er durch ein Guckloch in der Tür: ein melancholischer, an die Erde geketteter Astronaut, in der Zeit erstarrt, ein halbes Jahr vor seinem Suizid. Immer wenn ich dieses Foto sah, schien es Reich rückwirkend zu einem hoffnungslosen Scharlatan zu degradieren.
*
Erst im unseligen Jahr 2016 kehrte ich zu Reich zurück. In den Jahren zuvor war der Körper von Neuem zum Schlachtfeld geworden. Insbesondere zwei Phänomene hatten sich zugespitzt: die Flüchtlingskrise und die Black-Lives-Matter-Bewegung. In lecken Booten kamen Geflüchtete aus völlig zerbombten Regionen nach Europa, wo gewisse Kreise sie zu Schmarotzern und Kriminellen stempelten und ungeniert der Hoffnung Ausdruck gaben, sie mögen unterwegs ertrinken. Wer die Fahrt über das Mittelmeer lebend überstanden hatte, wurde in Lager gepfercht, aus denen es praktisch kein Entkommen gab. Die extreme Rechte benutzte die Anwesenheit dieser verzweifelten Körper, um ihre Macht in Europa zu vergrößern, während die Brexiteers in Großbritannien sie für die eigene xenophobe Angstkampagne missbrauchten.
2013 war in den USA als Reaktion auf die Ermordung Trayvon Martins, eines unbewaffneten schwarzen Teenagers, der von einem Weißen erschossen worden war, die Black-Lives-Matter-Bewegung entstanden. In den Folgejahren protestierte Black Lives Matter gegen die nicht abreißende Kette von Vorfällen, bei denen schwarze Männer, Frauen und Kinder durch Polizeikugeln ums Leben kamen: getötet, weil sie Zigaretten verkauft, mit einer Spielzeugpistole gespielt, ihren Führerschein aus dem Handschuhfach geholt oder zu Hause im Bett gelegen und geschlafen hatten. Es schien, als könnten die Demonstrationen in Ferguson, Los Angeles, New York, Oakland, Baltimore und vielen weiteren Städten im ganzen Land daran etwas ändern, doch am 8. November 2016 stimmte eine ausreichende Mehrheit der Amerikaner für Donald Trump, einen kaum verhohlenen Verfechter der White Supremacy – der weißen Vorherrschaft –, und kürte ihn zum 45. Präsidenten der USA.
Das traurige alte Lied von der körperlichen Differenz war wieder überall zu hören. In Ländern, die man bislang für sturmfeste Bastionen der Demokratie gehalten hatte, gebrauchten Presse und Politik plötzlich Wörter und Begriffe, die noch zehn Jahre zuvor undenkbar gewesen wären. In mehreren US-amerikanischen Staaten wurde das Recht auf Abtreibung ausgehöhlt oder gleich ganz abgeschafft, während Irland es endlich gesetzlich garantierte. In Tschetschenien wurden Schwule im Zuge eines euphemistisch so genannten »prophylaktischen Streichs« in Konzentrationslager gesperrt. Das Recht, zu lieben, zu migrieren, zu demonstrieren, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden, war ebenso heftig umkämpft wie zu Zeiten Wilhelm Reichs.
Die großen Befreiungsbewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts schienen im Scheitern begriffen, die Siege des Feminismus, der Homosexuellen- und der Bürgerrechtsbewegung einer nach dem anderen zunichtegemacht zu werden, gerade so als seien sie nie errungen worden. Obwohl ich mit einigen dieser Kämpfe groß geworden war, wäre ich nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass sich dieser langsam und schwer erkämpfte Fortschritt in so kurzer Zeit rückgängig machen ließ. All diesen Bewegungen gemein war das Bestreben, den Körper von einem Objekt von Scham und Stigma in einen Quell von Solidarität und Stärke zu verwandeln, der Veränderung nicht nur zu fordern, sondern auch herbeizuführen vermochte.
Das war von Anfang an Reichs Thema gewesen, und während die Zeiten zunehmend unruhig wurden, beschlich mich immer öfter das Gefühl, dass ein wesentliches Element seines Werkes bislang unerforscht geblieben war. Seine Ideen schienen wie Zeitkapseln, halb von der Geschichte verschüttet, und doch pulsierten sie vor Leben. Ich wollte sie ausgraben, im flackernden Licht des einundzwanzigsten Jahrhunderts ihrem Vermächtnis nachspüren. Was Reich begreifen wollte, war der Körper selbst: warum er so schwer zu bewohnen ist, warum wir ihm zu entfliehen, ihn zu zähmen, ja zu unterdrücken suchen, warum er eine nackte Energie- und Kraftquelle war und ist, bis heute. Diese Fragen nagten auch an mir, prägten viele verschiedene Phasen meines Lebens.
Obwohl ich Reichs pseudowissenschaftliche Orgon-Theorie haarsträubend fand, begann ich, mich zu fragen, ob sich aus seinem Niedergang nicht auch eine Lehre ziehen ließ. Seine gesamte Laufbahn hindurch hatte er für körperliche Emanzipation gekämpft, und doch war er am Ende in einer Gefängniszelle gelandet, gänzlich in Paranoia abgeglitten, ein unter Menschen, die in Befreiungsbewegungen aktiv sind, nicht eben seltenes Schicksal. Ich hatte das Gefühl, dass das Muster seines bewegten Lebens an und für sich erhellend war. Warum war seine Arbeit auf so katastrophale Abwege geraten, und was verriet uns das über die sehr viel größeren Kämpfe, in denen er eine so dynamische, ja glühende Rolle gespielt hatte? In dieser neuen Krisenzeit erschien es mir wichtig, seine Fehlschläge und Misserfolge ebenso zu begreifen wie seine deutlich gewinnbringenderen Ideen.
Wie sich herausstellte, reichte Reichs Einfluss sehr viel weiter, als mir in den Neunzigerjahren bewusst gewesen war. So hatte er die Begriffe »sexuelle Politik« und »sexuelle Revolution« geprägt, auch wenn er dabei wohl eher den Sturz des patriarchalen Kapitalismus im Sinn hatte als die von der Pille begünstigte freie Liebe der Sechzigerjahre. Für Andrea Dworkin, eine der vielen Feministinnen, die sich auf seine Arbeit stützten, war er »der optimistischste unter den sexuellen Befreiern, der einzige Mann unter ihnen, der Vergewaltigung wirklich verabscheute«. James Baldwin hatte Reich gelesen, ebenso Susan Sontag. Und selbst in der Popkultur lebte er fort. Mit ihrem Song »Cloudbusting« setzte Kate Bush dem langen Rechtsstreit um den Orgon-Akkumulator ein Denkmal; der nachdrückliche, hicksende Refrain – »I just know that something good is going to happen« (Ich weiß, es wird etwas Gutes geschehen) – vermittelt die bezwingende utopische Atmosphäre von Reichs Ideen.
Sein Leben, das Christopher Turner in seiner ebenso brillanten wie verstörenden Biografie Adventures in the Orgasmatron (Abenteuer im Orgasmatron) nachgezeichnet hat, faszinierte mich, aber ungleich interessanter fand ich Reich in seiner Rolle als Vermittler, der viele verschiedene Aspekte des Körpers bündelte, von Krankheit bis Sex, von Protest bis Gefängnis. Diese Resonanzräume wollte ich erforschen, und so ließ ich mich von ihm geleiten auf meinem verschlungenen Pfad durch das zwanzigste Jahrhundert, um die Kräfte zu begreifen, die der körperlichen Freiheit bis heute Form geben und Grenzen setzen. Auf meiner Reise bin ich vielen anderen Denkern, Aktivistinnen und Künstlerinnen begegnet, die sich teils direkt auf seine Arbeit beziehen, teils auf ganz anderen Wegen zu denselben Orten gelangt sind.
Als Erstes führte Reich mich zur Krankheit, derjenigen Erfahrung, die uns unsere Körperlichkeit am schmerzlichsten begreifen lässt: dass wir permeabel sind und sterblich, eine Offenbarung, welche die Coronapandemie der ganzen Welt bald schon mit Macht zum Bewusstsein bringen sollte. Laut einer von Reichs umstritteneren Theorien hat jede Krankheit ihren Sinn. Genau das kritisierte Susan Sontag in Krankheit als Metapher, doch je mehr ich über ihre eigene Erfahrung mit Brustkrebs las, desto stärker wurde mein Eindruck, dass die Realität der Krankheit in unser aller Leben weitaus persönlicher und komplizierter ist, als Sontag in gedruckter Form zugeben mochte. So notierte sie in ihr Krankenhaustagebuch: »Mein Körper spricht lauter, deutlicher, als ich es jemals könnte.«
Im Gegensatz zu Reich war ich zwar nicht der Ansicht, dass der Orgasmus den Sturz des Patriarchats oder das Ende des Faschismus herbeiführen könne (was Baldwin in einem Essay über Reich mit scharfer Zunge kommentierte: »Die Leute, unter denen ich aufgewachsen war, hatten ständig Orgasmen, trotzdem gingen sie jeden Samstagabend mit Rasiermessern aufeinander los«), aber seine Arbeit führte mich ins Berlin der Weimarer Republik, die Geburtsstätte der modernen sexuellen Befreiungsbewegung, deren zahlreiche Errungenschaften von Tag zu Tag stärker gefährdet schienen. Reich glaubte zwar fest an das befreiende Potenzial von Sex, doch sexuelle Freiheit ist längst kein so eindeutiger Begriff, wie man annehmen könnte, denn die Grenzen zu Gewalt und Vergewaltigung sind fließend. Meine Überlegungen zu diesen weniger angenehmen Aspekten von Sex führten mich zu der kubanisch-amerikanischen Künstlerin Ana Mendieta, zu der radikalen Feministin Andrea Dworkin und zum Marquis de Sade, die auf unterschiedliche Art und Weise eine der unwegsamsten Regionen der körperlichen Erfahrung kartiert haben, ein Gebiet, wo Lust und Schmerz sich nicht nur kreuzen, sondern Letzterer Erstere bisweilen sogar usurpiert.
Reichs Theorien mögen mit den Jahren immer bizarrer geworden sein, doch es besteht ohne jeden Zweifel ein Zusammenhang zwischen seinem Streit mit der Food and Drug Administration, der anschließenden Haftstrafe und den Fragen, mit denen er sich sein Leben lang beschäftigt hatte. Was bedeutet Freiheit? Für wen ist sie gedacht? Welche Rolle spielt der Staat bei der Gewährung oder Einschränkung von Freiheit? Ist Freiheit durch körperliche Selbstbestimmung zu erlangen oder, wie die Malerin Agnes Martin glaubte, durch die völlige Negation des Körpers? Reichs Befreiungsmaschine half vielleicht nicht gegen Krebs, ja nicht einmal gegen den gemeinen Schnupfen, aber sie entlarvte ein System von Kontrolle und Bestrafung, das unsichtbar bleibt, bis man auf die eine oder andere Art dagegen verstößt.
Seine Inhaftierung in Lewisburg war mir Anlass, mich mit der paradoxen Geschichte der Gefängnisreformbewegung und den radikalen Ideen von Malcolm X und Bayard Rustin zu befassen. Sie wiederum eröffneten mir das weite Feld von politischem Aktivismus und Protest, dem körperlichen Kampf für eine bessere Welt. Dort stieß ich auf den Maler Philip Guston und seine grotesken, comichaften Darstellungen derer, die die Freiheit einschränken wollen, und auf die Sängerin Nina Simone, die ihr Leben lang in Worte zu fassen versuchte, was für ein Gefühl es wäre, wirklich frei zu sein, Reichs großer Traum.
Wie all diese Leute stritt auch Reich für eine bessere Welt und hegte, mehr noch, die feste Überzeugung, dass sie tatsächlich machbar sei. Er glaubte, dass das Emotionale und das Politische pausenlos auf den physischen Körper einwirken, und er glaubte, dass man beides neu organisieren und verbessern kann, kurz: dass sich das Paradies auch zu diesem späten Zeitpunkt noch zurückgewinnen, wiederherstellen lässt. Der freie Körper: Was für ein herrlicher Gedanke. Trotz allem, was Reich widerfuhr, und trotz der unrühmlichen Geschichte der Bewegungen, an denen er mitwirkte, spürte ich auch Jahrzehnte später noch den schlagenden Puls seines unbändigen Optimismus: dass unser Körper vor lauter Kraft schier bersten will und dass er diese Kraft nicht etwa trotz, sondern wegen seiner manifesten Verwundbarkeit besitzt.
2 Krank
Mit siebzehn hatte ich einen unregelmäßigen Zyklus und Akne. Meine Mutter fand Ersteres so besorgniserregend, dass sie einen Termin bei einem Spezialisten machte. An einem drückend heißen Nachmittag fuhren wir nach London hinein, vorbei an den staubigen Platanen rechts und links der Cromwell Road. Im Krankenhaus bekam ich erst einmal einen Rüffel, weil ich keine volle Blase hatte, und musste zur Strafe gleich mehrere Gläser Johannisbeernektar in mich hineinschütten. Die Ultraschalltechnikerin schob ihren Zauberstab kreisend über meinen Bauch, und dann teilte mir ein Facharzt mit, ich habe Zysten an den Eierstöcken und könne nur durch künstliche Befruchtung schwanger werden. Erstens stimmte das nicht, und zweitens war es natürlich unverantwortlich, einem pubertierenden Mädchen so etwas zu sagen.
Die Erkrankung war rätselhaft und im Wesentlichen unbehandelbar, eine Hormonstörung, in deren Folge sich in den Eierstöcken Ansammlungen von flüssigkeitsgefüllten Bläschen bildeten. Zu den Symptomen gehörten Akne, Gewichtszunahme, Haarausfall und Hirsutismus, allesamt hervorgerufen durch einen erhöhten Testosteronspiegel. Kurioserweise war das einzige verfügbare Mittel dagegen: die Pille, die mir immerhin die Illusion einer regulären Menses bot und vielleicht auch gegen meine Pickel half, wenngleich im Kleingedruckten ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass ebenso gut das Gegenteil eintreten könne.
Wir schrieben die Mittneunziger, und ich war ein Punk-Hippie-Hybrid mit Undercut und einem Satz Tarotkarten in einem schwarzseidenen Säckchen. Ich wollte keine Pille schlucken gegen Symptome, deren Ursache ich nicht verstand. Ich fühlte mich in meinem Körper ohnehin nicht besonders wohl. Er kam mir vor wie ein Tier, mit dem ich nicht sprechen konnte, wie ein vernunftloses Pferd, das nur selten gehorchte. Immer wieder ging er mir durch, und dass er sich beharrlich weigerte, nach Plan zu funktionieren, steigerte meine Verwirrung noch. Mal lag ich nachts im Bett und versuchte, meinen Astralleib an die Decke zu projizieren, dann wieder wachte ich auf und stellte fest, dass ich von Kopf bis Fuß gelähmt war, unbeweglich wie ein Holzklotz, eine beängstigende Erfahrung, die – wie ich Jahre später las – Schlafstarre genannt wird. Ich lag da und konzentrierte meine ganze Kraft auf die schier übermenschliche Aufgabe, meinen Zeh zu krümmen, um den Bann zu brechen. Was, wenn ich für immer gelähmt blieb und niemand je erfuhr, dass ich noch in meinem Körper steckte?
Etwa um diese Zeit fiel mir ein Exemplar von David Hoffmans The Holistic Herbal (Das ganzheitliche Herbarium) in die Hände, einer Hippiebibel mit einer bezaubernden Spirale aus handgemalten Blumen auf dem Umschlag. Unter der gütigen Anleitung dieses Buches begann ich mit Kräutern zu experimentieren und notierte Eigenschaften und Kontraindikationen in mein Tagebuch. Im örtlichen Reformhaus besorgte ich mir getrocknete Himbeerblätter und Mönchspfeffer, um meine Regel in den Griff zu kriegen. Meine Kräutermischungen klangen wie Rezepte für einen Hexentrank, doch sie hatten eine echte, belegbare Wirkung, zumindest auf meine Eierstöcke.
Nachdem ich kurzzeitig mit einem Anglistikstudium geliebäugelt und ein Jahr in Protestcamps verbracht hatte, entschied ich mich für eine akademische Ausbildung in Naturheilkunde. Ich war erschöpft und ausgebrannt vom vielen Demonstrieren und wollte mit meinem Leben unbedingt etwas Positives anfangen, beitragen zu einer Zukunft, die keinen Raubbau mehr an Umwelt und Natur betrieb. Ich wollte mein Verständnis des Körpers wissenschaftlich unterfüttern und war zudem fasziniert von dem Gedanken, dass er womöglich über eine eigene Sprache verfügt, die ebenso eloquent und bedeutungsvoll ist wie die unsere, aber nicht mit Worten, sondern mit Symptomen und Sinneswahrnehmungen kommuniziert. Ein Puddingstudium, wie mein Vater zu sagen pflegte, aber ein verdammt hartes: volle acht Semester plus ein Vorbereitungsjahr, weil ich keine Hochschulreife vorzuweisen hatte. Die meisten Kurse waren die gleichen wie in einem regulären Medizinstudium, aber es gab auch hexigere Module, etwa in Materia medica und Pflanzenkunde.
Zwei Jahre lang zeichnete ich jeden Knochen, jeden Muskel und jedes Organ, paukte ihre Namen und Funktionen, bis hin zu den winzigen Knochen in der Hand: Lunate und Pisiform, so genannt wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Mond beziehungsweise einer Erbse. Auf großen Bogen Metzgerpapier kartierte ich die metabolischen Transformationen, die sich in der Miniaturfabrik jeder Zelle vollziehen. Anfangs hatte ich nur eine grobe Vorstellung vom Innenleben des menschlichen Körpers, doch ich blieb am Ball, fasziniert, aber auch leicht schockiert, weil ich nicht geahnt hatte, dass sich ein so großer Teil meines Lebens meiner bewussten Kontrolle entzog. Nach und nach gewannen die Dinge an Kontur. Der Körper war ein Instrument zur Verarbeitung der externen Welt; eine Konversionsmaschine, die hortete, transformierte, Unbrauchbares aussortierte, Brauchbares verwertete.
Wir studierten erst den idealen Körper, die theoretische Version, und dann alles, was damit schiefgehen konnte. Hunderte von Krankheiten arbeiteten wir durch, jede mit ihrer ganz eigenen, idiosynkratischen Pathologie. Die Abgrenzung verschiedener Erkrankungen mit ähnlicher oder übereinstimmender Symptomatik wurde Differenzialdiagnose genannt. Wir lernten, die sogenannten Trommelschlegelfinger zu erkennen, die Vorboten eines Herzanfalls sein können, lernten, ein atopisches Ekzem von einer Schuppenflechte zu unterscheiden, die hervortretenden Augen und den rasenden Puls der Schilddrüsenüberfunktion oder das klassische »Vollmondgesicht« des Cushing-Syndroms zu diagnostizieren.
In einer Lehrklinik im damals noch nicht gentrifizierten Bermondsey wurden wir in die hohe Kunst der körperlichen Untersuchung eingeführt und verbrachten ganze Nachmittage damit, uns kichernd und mit schamroten Gesichtern gegenseitig den Blutdruck zu messen und Lunge und Nieren abzutasten, die man wie ein Stück Seife mit beiden Händen fassen musste. Alles hatte etwas zu bedeuten. Zuckte der Patient zusammen, wenn man ihn unterhalb der Rippen befühlte, konnte dies auf eine Erkrankung der Gallenblase hindeuten. Fingernägel, die sich wie Löffel nach innen wölbten, wiesen auf eine Eisenmangelanämie oder Hämochromatose hin. Die schiere Menge an Informationen war überwältigend, aber auch herrlich wohlgeordnet, zumindest auf dem Papier.
Ab meinem zweiten Studienjahr durfte ich Sprechstunde halten. Da die Klinik mitten in London lag und kostenlose Termine anbot, war das Patientenspektrum sehr viel breiter als in den meisten Privatpraxen. Rasch stellte ich fest, dass die Diagnostik weitaus verwickelter und komplizierter war, als Davidsons Principles and Practices of Medicine (Medizin in Theorie und Praxis) mir vorgegaukelt hatte. Die meisten Leute hatten nämlich nicht nur eine Krankheit, sondern kamen mit einem ganzen Bündel von Beschwerden. So hatte ein älterer Mann zum Beispiel Diabetes und ein Herzleiden und geschwollene Knöchel; ein pubertierendes Mädchen Morbus Raynaud, Regelschmerzen und Depressionen. Man musste erst jedes Symptom exakt bestimmen und zu seinem Ursprung zurückverfolgen, bevor an einen Behandlungsplan auch nur zu denken war.
Die Naturheilkunde ist eine narrative Form der Medizin, hatte ein Dozent einmal gesagt, und dieser Satz war mir in Erinnerung geblieben. Da das Rezept erst am Ende jeder Beratungssitzung ausgestellt wurde, verbrachten wir den größten Teil der Stunde damit, dem Patienten zuzuhören und anhand seines Körpers seine ganze Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Es kam einer Psychotherapie – der sogenannten Sprechkur – so nahe, wie es eine physische Behandlung nur vermochte. Von Beginn an fand ich es faszinierend, wie die Patienten ihren eigenen Körper sahen, wie eng verflochten ihr körperliches und ihr emotionales Leben für sie waren. Ihrer Meinung nach führte eine Scheidung zu Blasenentzündung, bildete altes Leid den Nährboden für Tumore, entwickelten Trauernde entweder Magengeschwüre oder verloren, wie Freuds berühmte Patientin Dora, die Stimme.
Nach Abschluss meines Studiums eröffnete ich eine Praxis in einem großen, weiß getünchten Raum in Hove mit Blick auf einen langen Garten, den ich nicht betreten durfte. In einem Nebenraum hatte ich mir eine winzige Apotheke eingerichtet, wo ich auf einer alten Messingwaage Mädesüß und Lavendel für meine Kräutertees abwog, die Fünf- und Zehn-Gramm-Gewichte in die Waagschale legte und immerzu nieste, weil mir die würzigen Staubwolken in die Nase stiegen, wie es mir im Traum manchmal noch heute widerfährt. Ich hatte Patienten aller Altersklassen, vom Kleinkind bis zum Greis. Ich behandelte magersüchtige Mädchen und ganze Familien, die an Angststörungen litten. Ich sprach mit Leuten, die sich sehnlichst Kinder wünschten, mit Frauen, die so einsam waren, dass schon das als Krankheit gelten durfte, und Männern, die nur noch wenige Wochen zu leben hatten. Ich lauschte ihren Geschichten, und obwohl ich wusste, warum Duftraute und Schachtelhalm dem einen Patienten halfen und Veilchen und Schafgarbe einem anderen, hatte ich das Gefühl, dass meine Aufgabe in erster Linie darin bestand, ihren Geschichten eine Art Resonanzboden zu geben: als Zeugin, vor der sich das ganze verschlungene Knäuel physischer Beschwerden entwirren und unter die Lupe nehmen ließ. Dieser Vorgang schien an und für sich heilende Wirkung zu besitzen und steigerte meine Faszination für das Rätselhafte der Krankheit: Sie kommt und geht auf Pfaden, die für uns nicht immer sichtbar sind.
In der Esoterik- und Alternativszene herrschte seinerzeit die böswillige Ansicht, dass jede körperliche Krankheit durch negative psychische Zustände verursacht werde, der Körper mithin eine Art Arena sei, in der verdrängte oder uneingestandene Emotionen Chaos und Verwüstungen anrichten. Zu den Hauptvertretern dieser Denkart gehörte eine nicht mehr ganz junge US-Amerikanerin namens Louise Hay – ein ehemaliges Model mit platinblondem Haar und straffem, stets lächelndem Gesicht –, die mit ihrem 1984 erschienenen Selbsthilfe-Ratgeber Heile dein Leben eine reiche Frau wurde. Mit fünfzig Millionen verkauften Exemplaren ist er eines der meistverkauften Sachbücher aller Zeiten. Als Ende der Sechzigerjahre ihre Ehe in die Brüche ging, schloss Hay sich einer spiritualistischen Kirche an, wo sie das Konzept des positiven Denkens kennenlernte. Sie behauptete, sich damit vom Gebärmutterhalskrebs geheilt zu haben (als ein Journalist der New York Times sie 2008 bat, Beweise dafür vorzulegen, sagte sie, sie habe alle Ärzte, die diese Diagnose bestätigen könnten, um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte überlebt).
In Hays Universum war der Geist ungleich stärker als der Körper. Ihr zufolge konnten selbst so schwere Krankheiten wie Krebs spontan heilen, wenn man das zugrunde liegende seelische Leid bekämpfte, jedoch nicht etwa mit Medikamenten oder Behandlungen, sondern durch positive Affirmation, sprich die ständige Wiederholung von Slogans wie »Ich bin schön« oder »Ich strotze vor Gesundheit«. Es war so simpel wie das Abc, und in der Tat veröffentlichte Hay 2004 ein Alphabet körperlicher Krankheiten und ihrer geistigen Ursachen: Akne werde durch mangelnde Selbstliebe verursacht, Arthritis durch den Drang zu bestrafen, Asthma durch unterdrücktes Weinen. Krebs sei Missgunst und Hass, Polio lähmende Eifersucht (ein Gefühlszustand, der in England offenbar verschwindend selten geworden ist, seit Ende der Fünfzigerjahre die Polio-Impfung eingeführt wurde).
Es wunderte mich nicht, dass sie zu einer der meistverkauften Autorinnen aller Zeiten avanciert war, nur eine Leitersprosse unter den Titaninnen Danielle Steel und Agatha Christie. Sich einzureden, dass Krankheit stets die Folge von etwas sei, eine Reaktion auf verdrängte Emotionen oder unverarbeitete Traumata, scheint tröstlicher, als sich den existenziellen Schrecken der Willkür zu stellen, der sicheren Gewissheit, dass es jeden treffen kann, zu jeder Zeit, und sei er noch so edel, unschuldig und emotional gefestigt. Der Glaube, dass sein Leiden durch die eigenen Gedanken verursacht worden sei, verleiht dem Patienten zwar so etwas wie Macht über die Krankheit, bürdet ihm aber auch eine entsetzliche Schuld auf. Was mir bei Hay besonders übel aufstieß, war der Umstand, dass sie die Verantwortung für die Krankheit letztlich dem Kranken selbst zuschob. Das war nicht nur antiwissenschaftlich, sondern geradezu perfide, denn es suggerierte, dass es einen »korrekten« Körperzustand gebe und dass Krankheit oder Behinderung eine Folge von Versagen sei, physische Gesundheit hingegen der Lohn für psychisches Gleichgewicht.
Aus meiner persönlichen Erfahrung mit Patienten wusste ich, dass die Beziehung zwischen Soma und Psyche weitaus komplizierter ist, als Hays Modell oder die Schulmedizin es zuließen. Manchmal lag es quasi auf der Hand, dass körperliche Symptome in seelischem Leid ihren Ursprung hatten (so weist zum Beispiel vieles darauf hin, dass erlittene Traumata beträchtliche Auswirkungen auf die Funktion des Immunsystems haben können, wie der Psychiater Bessel van der Kolk in seinem faszinierenden Buch Verkörperter Schrecken:Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann darlegt). Aber diese Beziehung war nicht immer so einfach oder gar eindeutig. Meine Patienten waren zwar krank, nahmen ihre Krankheit jedoch auch zum Anlass, über andere Aspekte ihres Lebens nachzudenken. Für sie war ihre Erkrankung eine Möglichkeit, Schmerzen zu erkennen und auszudrücken, die sie anders nicht zulassen konnten; die körperlichen Symptome dienten ihnen als eine Art Sprache, mit der sie anderes vermitteln konnten.
Ganz am Ende seines fünfteiligen Patrick-Melrose-Zyklus fasst der Romancier Edward St. Aubyn dieses Phänomen so präzise in Worte, dass mich beinahe der Schlag traf, als ich die Passage las.
Sein Körper war ein Friedhof begrabener Gefühle; die Symptome scharten sich alle um denselben fundamentalen Schrecken, so wie sich die Friedhöfe, die sie soeben passiert hatten, wie ein Ausschlag an den Ufern der Themse ausbreiteten. Die nervöse Blase, der Reizdarm, die Kreuzschmerzen, der labile Blutdruck, der binnen weniger Sekunden vom Normalwert in gefährliche Höhen schnellen konnte, beim Knarren einer Diele oder beim Gedanken an einen Gedanken, und dann die Schlaflosigkeit, die über diese Symptome herrschte – all dies deutete auf eine Angst hin, die so tief saß, dass sie seine Instinkte zerrüttete und die Macht über das vegetative System seines Köpers übernahm. Verhaltensmuster konnte man ändern, Einstellungen modifizieren, Geisteshaltungen wandeln, aber es war schwer, mit den somatischen Gewohnheiten der frühen Kindheit in Dialog zu treten. Wie sollte sich ein Kind denn ausdrücken, bevor es ein Selbst besaß, das es ausdrücken konnte, oder die Worte, um auszudrücken, was ihm fehlte? Nur die stumme Sprache von Verletzung und Krankheit stand reichlich zur Verfügung.
Diese stumme Sprache war es, die ich unbedingt verstehen wollte: die Sprache des Körpers, der seine ganz eigene, ebenso störrische wie ungreifbare Zunge redete.
*
Auch wenn es ihnen vielleicht nicht bewusst war, zehrten doch sowohl St. Aubyn als auch Hay von Werk und Wirken Wilhelm Reichs, dessen Denken, im Guten wie im Schlechten, auf einem einzigen, in den Jahren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in Wien entwickelten Gedanken gründet: dass nämlich unser Körper unsere ganze verdrängte Geschichte in sich trägt, all die Dinge, die wir zu leugnen oder zu ignorieren versuchen. Aus diesem Gedanken erwachsen all seine späteren Überlegungen zum Thema Freiheit, er ist jedoch auch der Ursprung der beunruhigenden, um nicht zu sagen gefährlichen Gesundheitstheorien, die Reich in den Vereinigten Staaten propagieren sollte.
Als er im Sommer 1918 nach Wien kam, war er einundzwanzig, ein mittelloser jüdischer Soldat, der drei Jahre als Infanterieoffizier im Dreck der Schützengräben an der italienischen Front gelegen hatte. Das riesige Kaiserreich, in dem er aufgewachsen war, hatte eine vernichtende Niederlage erlitten, und es gab kein Zuhause mehr, in das er hätte zurückkehren können. Seine Eltern waren schon Jahre zuvor gestorben, und das blühende Familienanwesen in der Bukowina lag seit dem Einmarsch der Russen brach. Nach dem Zusammenbruch der K.-u.-k.-Monarchie im November 1918 wurde die Bukowina Rumänien zugeschlagen (heute gehört sie zur Ukraine). Reich fehlten die finanziellen Mittel, um auf Rückgabe zu klagen.
Die Stadt, in der er strandete, hatte ihrerseits zu kämpfen. Wien war nun nicht mehr die Kapitale eines vermögenden und kosmopolitischen Reiches, so opulent und luxuriös, dass man ihr den Beinamen »Traumstadt« gegeben hatte. Die neu geschaffene Republik Deutschösterreich hatte zwei Drittel ihres Vorkriegsgebietes eingebüßt und war damit von den meisten ihrer früheren Brennstoff- und Nahrungsmittelquellen abgeschnitten. Als Reich im Zuge eines Massenzustroms von obdachlosen und verzweifelten Kriegskameraden in Wien eintraf, hatte die Hyperinflation die österreichische Krone nahezu wertlos werden lassen. Holz war so knapp, dass die Toten in Pappsärgen beigesetzt wurden. Viele von ihnen waren Opfer der Spanischen Grippe, die in der zerstörten Stadt wütete.
Zwei Jahre lang ernährte Reich sich tagaus, tagein von nichts als Haferflocken mit Dörrobst; am Sonntag gab es zwei Stück Marmeladekuchen, und ein Achtel Brotlaib musste eine Woche reichen. Doch er verzehrte sich nicht nur nach Fleisch und Butter, er gierte auch nach intellektueller Stimulanz, einem Ventil für seine beträchtliche Energie und Intelligenz, und er sehnte sich nach Liebe, Gesellschaft und Sex. Seine zukünftige Schwägerin, die ihm etwa um diese Zeit zum ersten Mal begegnete, sollte nie vergessen, wie sehr der verwaiste junge Mann die Herzlichkeit ihrer Familie genoss. Sie schilderte ihn mit Worten, die auch auf einen streunenden Hund zutreffen könnten: »offen, verloren, hungrig nach Nahrung ebenso wie nach Zuwendung«. Andere Freunde beschrieben Willy, wie ihn alle nannten, als brillant, energiegeladen, weitaus lebhafter als andere Menschen, aber auch als linkisch, unsicher und arrogant, mit einer Neigung zu Depressionen und Eifersuchtsanfällen. Er war so schneidig und gut aussehend, dass man die schilfernden roten Quaddeln der Schuppenflechte, mit denen seine Haut schon seit Kindertagen übersät war, im Zweifelsfall gar nicht bemerkte.
Im Oktober begann Reich ein Jurastudium an der Rudolphina, und nach einem langweiligen ersten Semester wechselte er zur Medizin, einem Fach, das eher seinen Neigungen entsprach. In dem Zimmer, das er sich mit seinem jüngeren Bruder Robert und einem weiteren Studenten teilte, war es so kalt, dass er trotz Handschuhen und Pelzmantel Erfrierungen erlitt. Einmal brach er in einer Vorlesung vor Hunger sogar zusammen. Robert, der einem Broterwerb nachging, unterstützte seinen Bruder finanziell, bis dieser im zweiten Studienjahr anfing, Erstsemestern Nachhilfeunterricht zu geben, eine anstrengende Arbeit, die ihn täglich wertvolle Stunden kostete.
Obgleich sein Fachgebiet ihn brennend interessierte, hatte Reich mit dem herrschenden mechanistischen Modell der Medizin von Beginn an seine Schwierigkeiten. Er spürte instinktiv, dass etwas fehlte: eine Art von Lebensessenz oder -kraft, die bislang noch niemand hatte isolieren oder benennen können. Anatomie pauken war gut und schön, aber was war es, das ihn zu ihm machte, woher kam diese Gier, die einen durchs Leben trieb? Das Thema Sexualität war im Lehrplan nicht vorgesehen, und er war nicht der einzige Student, der das als schwerwiegenden Mangel empfand. Im Januar machte in einer Anatomievorlesung ein Zettel die Runde, der die Studenten zu einem informellen Seminar zum schamhaft verschwiegenen Thema Sex einlud. In diesem Seminar machte Reich zum ersten Mal Bekanntschaft mit den verblüffenden Ideen Sigmund Freuds.
Genau wie Reich war Freud ein nicht praktizierender galizischer Jude, der seine Karriere als Medizinstudent begonnen hatte, und wie Reich besaß er geradezu unersättliche Neugier, Mut und intellektuellen Ehrgeiz. Freud war ein Wissenschaftler, der sich »ein(en) Abenteurer« nannte, ein passionierter Mann, dessen Passion sich auf zweierlei beschränkte: seine Arbeit und das Rauchen, das aufzugeben er sich selbst dann noch beharrlich weigerte, als er wusste, dass es ihn das Leben kosten würde. In seinem ersten Forschungsprojekt untersuchte er die Geschlechtsorgane von Aalen. Nach und nach drang er in die nicht minder mysteriösen Tiefen des menschlichen Geistes vor, wie ein Taucher, der sich in eine dunkle See stürzt.
Das Fachgebiet der Psychoanalyse war gerade einmal ein Jahr älter als Reich selbst. Freud hatte es 1896 so genannt, ein Jahr nach Veröffentlichung seines bahnbrechenden, zusammen mit Josef Breuer verfassten Werkes Studien über Hysterie, in dem er darlegte, dass hysterische Symptome keineswegs auf Wahnsinn hindeuteten, sondern von unterdrückten traumatischen Erinnerungen herrührten; eine gewagte These, die durch seine Behauptung, dass fragliches Trauma stets sexuellen Ursprungs sei, an Brisanz noch gewann. Auch wenn er seinen Glauben an weitverbreiteten sexuellen Missbrauch später widerrief und stattdessen auf ein unbewusstes Reich der Fantasien und Triebe verwies, machte sein Beharren auf dem Primat der Sexualität, selbst bei Babys und Kindern, Freud in wissenschaftlichen Kreisen zur Persona non grata. Als Reich ihn kennenlernte, war er dreiundsechzig, weltweit anerkannt und doch ein Ausgestoßener in der eigenen Stadt, wo er als lächerlicher Exzentriker, wenn nicht als perverser Schmutzfink galt.
Besonders Freuds Theorie der Libido hatte es Reich angetan, weil sie eine Antwort auf die Frage nach der »vitalen Kraft« bereitzuhalten schien, über die er sich bei seinen eigenen Forschungen den Kopf zerbrochen hatte. Als Freud den Begriff Libido zum ersten Mal gebrauchte, meinte er damit schlicht die Energie der sexuellen Begierde, die durch den Geschlechtsakt befriedigt wurde. Mit der Zeit definierte er sie breiter, als eine positive Lebenskraft, eine instinktive, animalische Dynamik, die jedes Individuum vom Moment der Geburt an befeuert und in jeder Phase seiner Entwicklung beschädigt oder verzerrt werden kann. Freud hielt die Libido für die treibende Kraft hinter allen Formen von Liebe, Leidenschaft und Anziehung. Das überzeugte Reich, der im März aufgeregt in sein Tagebuch notierte: »Ich bin aus eigener Erfahrung, durch Beobachtungen an mir und anderen zur Überzeugung gekommen, dass die Sexualität der Mittelpunkt ist, um den herum das gesamte soziale Leben wie die innere Geisteswelt des Einzelnen […] sich abspielen.«
Tatkräftig wie eh und je besuchte er Freud in dessen Wohnung in der Berggasse 19 und bat ihn um eine Leseliste für sein Seminar. Ich versuche schon seit Jahren, mir vorzustellen, wie diese Begegnung wohl verlief. Reich kam in seinem Wintermantel die Treppe herauf und betrat Freuds Arbeitszimmer, das wie eine unterirdische Höhle anmutete, vollgestopft mit Gegenständen aus längst vergangener Zeit, als wären zahllose Kulturen hindurchmarschiert und hätten winzige Relikte und Reliquien hinterlassen. Es hatte etwas von einem Museum oder einem Schiffswrack, totenstill, und inmitten von alldem saß Freud, so alert und lebendig, dass Reich ihn später als »prächtiges Tier« bezeichnen sollte.
Damals war Freud von Jüngern umringt, doch die waren entweder nicht intelligent genug oder aber zu verstockt und, wie Jung, besessen von dem Drang, den Vater, um dessen Anerkennung sie einst gebuhlt hatten, zu töten. Als der gereifte Reich 1952 auf diese Begegnung zurückblickte, gelangte er zu dem Schluss, dass diese überhitzte und ungleiche Umgebung Freud furchtbar einsam gemacht, dass die Rezeption seiner Theorien ihn isoliert hatte und er sich nach jemandem sehnte, mit dem er sich unterhalten konnte, ein Bedürfnis, das seine jüngste Tochter Anna erst sehr viel später zu befriedigen vermochte. Reich bemerkte, dass Freud ihn interessant, ja aufregend fand – ein neuer Protegé, der hoffentlich nicht nur die nötige Intelligenz, sondern auch das entsprechende Maß an Loyalität mitbrachte. Freud ging vor seinen Regalen auf die Knie und zog Aufsätze daraus hervor, einen ganzen Stapel Lesestoff, der diesen ungeschliffenen jungen Mann mit der mysteriösen Wirkungsweise des Unbewussten vertraut machen würde, dem verblüffenden, verräterischen Reich der Träume, Versprecher und Witze.
Noch über dreißig Jahre später erinnerte Reich sich lebhaft an Freuds graziöse Gestik, seine leuchtenden Augen, den angenehm ironischen Unterton, der in jedem seiner Worte mitschwang. Im Unterschied zu den anderen Dozenten, die er um Material für seinen Kurs gebeten hatte, gebärdete Freud sich nicht als Prophet oder als großer Denker. »Er sah einen direkt an. Jede Pose war ihm fremd.« Rückblickend wird deutlich, dass die beiden Männer ein gerüttelt Maß an Wünschen und Verlangen auf den jeweils anderen projizierten, wie wir es alle tun, wenn wir jemanden kennenlernen, zu dem wir uns hingezogen fühlen, und dass die Unerfüllbarkeit dieser Erwartungen – geliebter Vater, getreuer Sohn – in ihrer späteren Beziehung eine gewichtige Rolle spielte.
Das »Klicken«, das er verspürt zu haben glaubte, fand Reich bestätigt, als Freud erst einen und kurz darauf noch einen Patienten an ihn verwies. 1920 wurde Reich offiziell in die Wiener Psychoanalytische Vereinigung aufgenommen. Er war erst dreiundzwanzig, zwanzig Jahre jünger als das bis dahin jüngste Mitglied, und hatte noch zwei Jahre Studium vor sich. Wie Christopher Turner in Adventures in the Orgasmatron darlegt, war das nicht ganz so ungewöhnlich, wie man meinen könnte (und tatsächlich sollten mehrere Teilnehmer des Seminars zum Thema Sexualität seinem Beispiel folgen). Anfang der Zwanzigerjahre steckte die Psychoanalyse »in einer noch nicht kodifizierten, experimentellen Phase und wurde nur von einem kleinen Club eifriger Apostel betrieben«. Einschlägige Vorbildung war nicht vonnöten, und auch wenn manch einer der Ansicht war, die angehenden Analytiker täten gut daran, erst einmal sich selbst einer Analyse zu unterziehen, wurde dies erst 1926 verpflichtend. Dennoch war Reich etwas Besonderes. Begabt und brennend vor intellektueller Neugier, brachte er neues Leben in den verschlafenen Kreis seiner Wiener Fachkollegen. Ein Hai im Karpfenteich, wie er es einmal nannte.
Die grundlegende Technik der Psychoanalyse war, damals wie heute, eigentlich recht simpel. Der Analytiker saß in einem Sessel, während der Patient vor ihm auf einer Couch lag (Freuds Diwan versteckte sich unter einem farbenprächtigen Perserteppich und zwei bestickten Chenille-Kissen). Die Patienten konnten den Analytiker nicht sehen, und so lagen sie einfach da und sprachen über das, was ihnen gerade in den Sinn kam, ein Prozess, den Freud freie Assoziation nannte. Fragen stellen oder Lösungen anbieten war nicht nötig. Alles, was den Patienten plagte, drang – wie durch einen Zauber – in den aufgeladenen Raum zwischen seinen Lippen und dem Ohr des Therapeuten. Dieser Strom scheinbar beliebiger Erinnerungen, Träume und Gedanken ließ sich durch ebenso subtile wie trickreiche Interpretation in sinnvolles Material übersetzen, bis der Grund für das Leid des Patienten glashell zum Vorschein kam.
Anfangs berührte Freud seine Patienten noch, doch als Reich hinzustieß, spielte sich die Therapie bereits auf rein verbaler Ebene ab. Die physischen Erfahrungen, die Freud in seine Deutung einbezog, waren hysterischer Natur, symbolische Symptome, die verdrängtes seelisches Leid repräsentierten. Doras Verlust der Stimme, die Verstopfung des Wolfsmanns, Anna Os Unfähigkeit zu schlucken: Sie alle waren das Ergebnis einer sogenannten Konversion, Hervorbringungen einer Psyche, die verzweifelt signalisierte, dass anderswo etwas im Argen lag. Es waren Hinweise, die entschlüsselt werden, sich einem versierten Leser preisgeben wollten, auf dass er darin Wünsche und Abwehrmanöver ausmachte, die weit unterhalb der Bewusstseinsschwelle siedeten und schäumten. Sobald der Patient die verschüttete Erinnerung freigelegt hatte, verschwanden die Symptome von selbst.
Doch diese Methode barg ein Problem. Half man den Patienten, sich der Ursache ihres Leids bewusst zu werden, bewirkte das nicht, wie Freud gehofft hatte, automatisch Besserung. Selbst wenn man den entscheidenden Vorfall, das verborgene Trauma mit Sorgfalt und Akribie ans Licht brachte, führte das nicht unbedingt zur Genesung. Therapeut und Patient steckten fest im noch unerforschten Gebiet zwischen Interpretation und Heilung. Wollt ihr etwa bis ans Ende eurer Tage Träume deuten?
Der ungeduldige Reich fand diesen Prozess grotesk und frustrierend, doch nur weil er ein Neuling war, konnte er noch lange nicht nach Lust und Laune experimentieren. Aber während er seinen Patienten zuhörte, schweifte seine Aufmerksamkeit von dem, was sie erzählten, immer wieder ab zu ihrem Körper, der starr und abwehrend dalag. War es möglich, dass sie ihm auf diese Weise etwas mitteilten, das sie nicht in Worte fassen konnten? Vielleicht lagen die Emotionen, zu denen sie nur schwer Zugang fanden, ja offen und klar zutage. Vielleicht war die Vergangenheit ja nicht nur im Gedächtnis, sondern auch im Körper gespeichert?
Was Reich sah, war kein hysterisches Symbol, das es zu entschlüsseln galt, sondern vielmehr ein Zucken und Krampfen, von dem das gesamte Wesen seiner Patienten beherrscht schien: eine permanente Anspannung, so massiv und undurchdringlich, dass er sich an einen Panzer erinnert fühlte. Sie fand in allem, was sie taten, ihren Ausdruck: in ihrem Händedruck, ihrem Lächeln, dem Klang ihrer Stimme. Er glaubte, dass dieser Charakterpanzer, wie er ihn nannte, zum Schutz gegen Gefühle diente, besonders gegen Angst, Wut und sexuelle Erregung. Wenn Gefühle zu schmerzhaft und quälend wurden, wenn emotionaler Ausdruck oder sexuelle Begierde verboten war, blieb einem nichts anderes übrig, als sich anzuspannen und alles in sich zu verschließen. Dadurch entstand rings um das verletzliche Ich ein körperlicher Schild, der einen zwar vor Schmerzen bewahrte, zugleich jedoch das Lustempfinden dämpfte.
Man versteht Reichs Theorie vielleicht am besten, wenn man sich einen Soldaten vorstellt – mit seiner strammen Haltung und seinem scheinbar unerschütterlichen Gleichmut –, dessen Körper der militärische Drill jegliches Gefühl ausgetrieben hat. Nicht jeder geht durch eine so harte Schule, doch nur sehr wenige Menschen durchlaufen Kindheit und Jugend, ohne eingetrichtert zu bekommen, dass dieser oder jener Aspekt ihrer emotionalen Erfahrung inakzeptabel sei, das eine oder andere Element ihres Verlangens ein Grund zur Scham. »Wie kindisch«, sagen die Eltern womöglich, oder: »Jungen weinen nicht«, und so spannt das Kind den Körper an, um seine Gefühle zu beherrschen und zu unterdrücken. Reich erkannte, dass dieser Vorgang sich permanent in den Körper einschreibt und ihn so in einen Speicher für traumatische Erinnerungen und verbotene Gefühle aller Art verwandelt.
Noch während ich dies schrieb, geschah etwas Seltsames. Einer meiner Ex-Freunde schickte mir einen Film, in dem er schildert, wie er mit sieben Jahren ins Internat kam. Es ist eine Stop-Motion-Animation, die das Ganze als Entführung erzählt: Der kleine, schmuddelige Junge mit den aufgeschlagenen Knien bekommt eine Decke über den Kopf gezogen und wird in den Kofferraum eines Autos gestoßen. »Mein Körper erstarrte«, sagt die Erzählerstimme, und rings um die traurige, gefesselte Gestalt erscheinen Wörter. Steifer Nacken. Kopfdruck. Trockene Kehle. Rückenschmerzen. Wehe Füße. »Aber Entführung ist vielleicht das falsche Wort«, fährt die Stimme fort. »Es war sehr viel englischer, gehemmter, zugeknöpfter, weggeschlossene Emotionen.« Seine Entführer waren die beiden Menschen, die er lieb hatte und denen er vertraute, und sie schickten ihn an einen Ort, wo Gefühle verboten und Übergriffe an der Tagesordnung waren. Inzwischen war er fast sechzig und hatte seit dem Tag seiner Verschickung nicht mehr weinen können. Und genau das meinte Reich: dass die Vergangenheit in unserem Körper begraben liegt, jedes Trauma gewissenhaft bewahrt, lebendig eingemauert.
Doch Reichs Erkenntnis reichte noch viel weiter. Im Laufe von zehn Jahren bezog er die Körper seiner Patienten nach und nach in seine Arbeit ein, zunächst verbal und dann, ab 1934, indem er sie berührte, was in der Psychoanalyse absolut tabu war. Zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass sich durch das Bearbeiten dieser »Spannungsgebiete« – die übertriebenen Schreckreaktionen, die geballten Fäuste und die angespannte Bauchmuskulatur – die dort sitzenden Gefühle an die Oberfläche holen und freisetzen ließen. Die Patienten erinnerten sich an weit zurückliegende Vorfälle, bei denen sie jemand bloßgestellt oder ihre Intimsphäre verletzt hatte, und durchlebten nun die Wut und die Verzweiflung, die sie damals nicht hatten empfinden können. Oft ging dies mit dem kuriosen Gefühl einher, dass den Körper eine besondere Energie durchfloss, das sogenannte Strömen, das auch ich bei meiner Therapie in Brighton erfahren hatte.
Ich kann das körperliche Empfinden, das ich im Laufe dieser Therapie erlebte, noch immer abrufen. Ich erinnere mich an die Verspannung in Nacken und Schultern und insbesondere in den Muskeln rings um mein Brustbein, einem mit solchem Unbehagen behafteten Bereich, dass ich es als kleines Mädchen nicht ertrug, dort berührt zu werden, ja noch nicht einmal mit dem eigenen Finger darauf zeigen konnte aus Angst vor der überwältigenden Ablehnung und Abscheu, die ich »das Gefühl« nannte, sodass ich mich bei dem Versuch, es zu vermeiden, immer noch mehr verkrampfte. Ich weiß auch noch genau, wie es sich anfühlte, als diese Verspannungen allmählich weicher wurden und sich lösten, erinnere mich an das Kräuseln und Kribbeln in Armen und Beinen, als schmölze und zerging dies allzu feste Fleisch und löst’ in einen Tau sich auf, wie es Hamlet einst erflehte. War es möglich, überlegte Reich, dass das Strömen, das der Patient verspürte, letztlich die Libido selbst war, Freuds – bislang gestaute – Lebensenergie, die nun endlich ungehindert fließen konnte?
*
Der Begriff Charakterpanzer war Reichs wichtigster und beständigster Beitrag zur Psychoanalyse. Es ist die einzige seiner Theorien, die noch heute zum konventionellen psychoanalytischen Kanon gehört; zudem bildet sie die Grundlage des späteren Fachgebiets der Körperpsychotherapie mit seinen zahlreichen körperlichen Ansätzen, die in den Sechzigerjahren so populär werden sollten, wie zum Beispiel Rolfing, Gestalt- und Urschreitherapie.
Das faszinierte viele, unter ihnen auch die junge Susan Sontag, die ihrem Tagebuch 1967 eine flammende Suada über das Problem des Bewohnens eines Körpers anvertraute. Die innere Welt, so dachte sie, sei weitaus fluider und wandlungsfähiger als der sie beherbergende Körper. Sie versuchte, sich etwas Besseres einfallen zu lassen: einen Körper aus Gas oder Dampf vielleicht, der sich ausdehnen, zusammenziehen, eventuell auch teilen und wieder vereinen könnte, schwellen, dicker oder dünner werden, je nach Stimmung seines Bewohners. Stattdessen war der Körper nichts weiter als ein Klotz, ein Klumpen Fleisch, ungefügig und massiv, praktisch unveränderlich. Er sei »fast gänzlich ungeeignet für all diese Prozesse, die folglich zu ›inneren‹ Prozessen werden (d. h. sich keineswegs vollständig manifestieren, der Entdeckung, der Herleitung bedürfen; sich verbergen lassen etc.). Unser Körper wird zum Gefäß – und zur Maske. Da wir uns (unseren Körper) nicht ausdehnen oder zusammenziehen können, versteifen wir ihn oft – schreiben ihm die Anspannung ein. Sie wird zur Gewohnheit – wird fest etabliert, um dann ihrerseits auf das ›Innenleben‹ zurückzuwirken.« Das sei Reichs Theorie vom Charakterpanzer, notierte sie und setzte betrübt hinzu: »Welch unvollkommene Konstruktion! Welch unvollkommenes Wesen!«
Als sie diese Zeilen schrieb, war Sontag vierunddreißig und hatte soeben ihr erstes nicht fiktionales Werk veröffentlicht, das viel gelobte Against Interpretation (Wider die Interpretation). Ein im selben Jahr in ihrer New Yorker Wohnung aufgenommenes Foto zeigt sie als spröde Schönheit im hautengen Paisleykleid, mit Ballerinas an den Füßen und einer Zigarette zwischen den Fingern, dabei hat sie nur Augen für ihren dreizehnjährigen Sohn David, der geradewegs in die Kamera grinst. An der Wand hinter ihr drängen sich Bücher und, im Schatten einer Vase voller Pfauenfedern, Bilder, hauptsächlich Fotografien. Eine leere Kaffeetasse rundet das Bild ab und zementiert zugleich das Image: die intellektuelle Ikone in medias res.
Fast zehn Jahre später kehrte Sontag in einem langen, ausführlichen Interview mit dem Rolling Stone