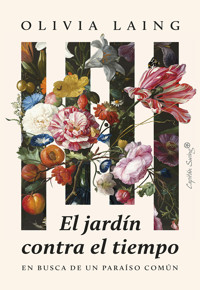22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein überwuchertes Eden voller ungewöhnlicher Pflanzen und Geheimnisse: Im Jahr 2020 beginnt Olivia Laing, eine der renommiertesten Literatinnen und Essayistinnen Englands, mit der Restaurierung eines verwunschenen Gartens in Suffolk. In ihrer Erkundung von Sehnsucht und Vergänglichkeit erzählt sie vom Werden ihres Paradieses, bewegt sich zwischen realen und imaginären Gärten der Kulturgeschichte, hinterfragt die manchmal schockierenden Kosten für die Schaffung eines Ideals genauso, wie sie den Garten als einen explosiven Ort der Rebellion und gemeinschaftlicher Träume ausmacht. Nicht nur unwahrscheinliche queere Utopien und konkrete Visionen eines idealen Zusammenlebens erzählen davon, dass inmitten von Blumenbeeten schon immer neue Lebensformen ausprobiert wurden. Eine berauschende, überbordende Hommage an die Vielfalt des Gartens und die tief verwurzelten Möglichkeiten, die in ihm verborgen liegen. »Dieses Buch ist reine Magie. Eine der ganz großen intellektuellen Stimmen unserer Zeit.« Daniel Schreiber
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Olivia Laing
Der Garten und die Zeit
Auf der Suche nach einem Paradies auf Erden
Über dieses Buch
»Dieses Buch ist reine Magie. Eine der ganz großen intellektuellen Stimmen unserer Zeit.« Daniel Schreiber
Ein überwuchertes Eden voller ungewöhnlicher Pflanzen und Geheimnisse: Im Jahr 2020 beginnt Olivia Laing, eine der renommiertesten Literatinnen und Essayistinnen Englands, mit der Restaurierung eines verwunschenen Gartens in Suffolk. In ihrer Erkundung von Sehnsucht und Vergänglichkeit erzählt sie vom Werden ihres Paradieses, bewegt sich zwischen realen und imaginären Gärten der Kulturgeschichte, hinterfragt die manchmal schockierenden Kosten für die Schaffung eines Ideals genauso, wie sie den Garten als einen explosiven Ort der Rebellion und gemeinschaftlicher Träume ausmacht. Nicht nur unwahrscheinliche queere Utopien und konkrete Visionen eines idealen Zusammenlebens erzählen davon, dass inmitten von Blumenbeeten schon immer neue Lebensformen ausprobiert wurden.
Eine berauschende, überbordende Hommage an die Vielfalt des Gartens und die tief verwurzelten Möglichkeiten, die in ihm verborgen liegen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Olivia Laing, geboren 1977, ist ein*e international renommierte Schriftsteller*in und Kritiker*in, Fellow der Royal Society of Literature und wurde 2018 mit dem Windham Campbell-Preis ausgezeichnet. Laings Bücher wurden in einundzwanzig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt »Zum Fluss«, »Die einsame Stadt« und »Everybody«. »Der Garten und die Zeit«, ihr erstes Buch bei S. FISCHER, wurde von der Kritik gefeiert, war Nr. 1 »Sunday Times«-Bestseller und stand auf der Shortlist für den Wainwright-Preis.
Impressum
Die Arbeit des Übersetzers an vorliegendem Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Der Übersetzer dankt Sabine Hübner und Michael Walter.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Garden against Time. In Search of a Common Paradise« bei Picador, einem Imprint von Pan Macmillan, London.
© Olivia Laing 2024
Illustrationen © John Craig 2024
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation, nach einer Idee von Kamil Rekosz and Stuart Wilson/Picador Art Department
Coverabbildung: Jan von Huysum, ›Bouquet of Flowers in an Urn‹, 1724
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
ISBN 978-3-10-492093-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Zitate]
I EINE TÜR IN DER MAUER
II PARADIES
III EINE LANDSCHAFT OHNE MENSCHEN
IV DER HÖCHSTE PFLANZER
V GARTENSTAAT
VI BENTON APOLLO
VII DIE WELT MEINE WILDNIS
VIII DER VERTREIBENDE ENGEL
HIN- UND NACHWEISE
BIBLIOGRAPHIE
I: Eine Tür in der Mauer
II: Paradies
III: Eine Landschaft ohne Menschen
IV: Der höchste Pflanzer
V: Gartenstaat
VI: Benton Apollo
VII: Die Welt meine Wildnis
VIII: Der Vertreibende Engel
DANKSAGUNG
ABBILDUNGEN
Linolschnitte von John Craig, 2022–23
Den Gärtnern
und dem Gedenken an
Pauline Craig
Wobei die Biene voller Fleiß
Wie wir die Zeit zu messen weiß.
Die süße Muße misst man nur
Mit solcher Blum- und Kräuteruhr![1]
Andrew Marvell, »Der Garten«
Dis buoch ist geheiszen eyn beheget, wol geschuezet garten,
eyn paradis vol oepfel aller art.[2]
Richard Rolle, English Psalter
IEINE TÜR IN DER MAUER
Manchmal habe ich einen Traum, nicht oft. In dem Traum bin ich in einem Haus, wo ich eine Tür entdecke, von deren Existenz ich nichts wusste. Dahinter liegt ein unverhoffter Garten, und einen schwerelosen Augenblick lang bewohne ich neues, unerschlossenes Territorium, reich an Potenzial. Mal gibt es Stufen, die zu einem Teich hinunterführen, mal eine Statue, umgeben von gefallenem Laub. Er ist nie ordentlich und aufgeräumt, sondern stets herrlich verwildert und weckt die Aussicht auf verborgene Schätze. Was hier wohl wächst, welch seltene Pfingstrosen, Schwertlilien und Rosen werde ich hier finden? Ich erwache mit dem Gefühl, dass ein steifes Gelenk sich gelockert hat und alles von neuem Leben durchdrungen ist.
Diesen Traum hatte ich, schon lange bevor ich einen eigenen Garten besaß. Ich bin erst spät zu einem Eigenheim gekommen und habe bis zu meinem vierzigsten Lebensjahr zur Miete gelebt, und das nur selten in Wohnungen mit Außenraum. Der erste dieser Gärten auf Zeit befand sich in Brighton. Er war so schmal, dass ich mit ausgestreckten Armen beide Zäune gleichzeitig berühren konnte, und fiel von einer Hügelkuppe in drei steilen Terrassen zu einer Laube hinab, die von Wildem Wein umwuchert war, in dem eine goldäugige Kröte hauste.
Dort pflanzte ich Acker- und Gartenringelblumen, die John Gerard, einem Botaniker des 16. Jahrhunderts, zufolge »das Hertz ueber die Maaßen staercken und erquicken«.[1] Ich absolvierte damals eine Ausbildung zur Kräuterärztin und hatte den Kopf voller Pflanzen, ein undurchdringliches Geschlinge von Naturgewächsen. Das Studium der Botanik war eine Schule des Sehens. Es machte die gewöhnliche Welt komplizierter, en gros wie en détail, und verdreifachte die Leistung des Auges. Jede Pflanze war so sehr mit der Menschheitsgeschichte verflochten, dass ihr Studium einem Sturz durch einen Zeittunnel glich. »Die Acker=Ringelblume gleichet der gemeinen Garten=Ringelblume, ist aber im Ganzen kleiner; beim ersten Eintritte des Winters verwelket sie und lebet erst wieder auf, wenn der Same faellt.«[2]
In Cambridge, zehn Jahre später, pflanzte ich Salbei und Ginster und sanierte den stinkenden Teich, wo sich im Frühjahr Molche tummelten, die bisweilen an die Oberfläche schwammen und eine silbrige Luftblase ausstießen. Ich wohnte befristet, mit schwarzem Schimmel an den Wänden, doch die Gärten gaben mir ein Gefühl der Beständigkeit, oder vielleicht lernte ich durch sie, Frieden mit der Vergänglichkeit zu schließen. Neben ihrem schöpferischen Aspekt genoss ich die Selbstvergessenheit der Arbeit, das Versinken in einer Trance der Konzentration, die mit gewöhnlichem Denken ebenso wenig gemein hatte wie die Traumlogik mit der des Alltags. Die Zeit stand still oder, besser, riss mich mit sich fort. Mit Anfang, Mitte zwanzig hatte ich irgendwo eine Liste von Lebensregeln gelesen, die ich so beeindruckend fand, dass ich sie in mein kleines schwarzes Notizbuch schrieb, das randvoll war mit Aphorismen und Anleitungen zum Menschsein. Meine Lieblingsregel lautete: »Es lohnt sich immer, einen Garten anzulegen, und sei dein Aufenthalt auch noch so kurz.« Diese Gärten mochten nicht von Dauer sein, aber war es nicht besser, der Welt auf dem eigenen Weg, wie Johnny Appleseed, blühende Haine zu hinterlassen?
Jeder dieser Gärten half mir dabei, mich häuslich einzurichten, trotzdem sehnte ich mich nach einer dauerhaften Bleibe, insbesondere wenn mir wieder einmal die Wohnung gekündigt wurde, deren Verkauf mir umso deutlicher vor Augen führte, dass sie nicht mir gehörte. Seit meiner Kindheit hatte ich mir einen Garten gewünscht, weit mehr noch als ein Haus. Von Liebe einmal abgesehen war es das Einzige, wonach ich mich regelrecht verzehrte, und wie es das Schicksal wollte, zog das eine das andere nach sich, ein seltenes Glück, das ich immer noch nicht fassen kann. Mit über vierzig verliebte ich mich in einen Cambridge-Professor, den ich bald darauf auch heiratete, einen außerordentlich intelligenten, schüchternen und warmherzigen Mann. Ian war erheblich älter als ich und wohnte in einem mit Büchern vollgestopften Reihenhaus. Seine Frau war kurz zuvor gestorben, und bald nach meinem Einzug musste er sich zwei schweren Operationen unterziehen. Wir hatten uns angefreundet, weil wir ein Faible für das Gärtnern teilten, und wir trugen uns mit dem Gedanken, uns nach seiner Pensionierung ein Haus auf dem Land zu kaufen, mit der Möglichkeit, einen Garten anzulegen oder auch zu restaurieren. Da nicht abzusehen war, wie viel Zeit uns noch bleiben würde, lag es nahe, zumindest einen Teil dieser Zeit mit der Gestaltung eines Gartens zu verbringen.
Während wir noch suchten, mailte mir meine Tante das Foto eines Hauses, das bis unter die Dachrinne mit Rosen berankt war, die in weiten Schwüngen an der Hauswand emporkletterten, so dass ein Strauß Blumen an jedes Fenster klopfte. Die Haustür wurde flankiert von zwei kunstvoll beschnittenen Buchsbaumbüschen, die an überdimensionale Cupcakes gemahnten. Es sah genauso aus wie die wuchtigen, viereckigen Häuser mit Kamin, die ich als kleines Mädchen gemalt hatte, ein Inbild der Verwurzelung, nach der ich mich in all den Jahres des Zweifelns und der Ungewissheit so fürchterlich gesehnt hatte. Ich überflog die Beschreibung der Innenräume, bis ich zu dem Absatz mit der Überschrift »Außenanlagen« kam. »Die von dem renommierten Gärtner Mark Rumary von Notcutts gestalteten RHS-Gärten sind eine Besonderheit des Hauses.« Das klang vielversprechend! Zwar hatte ich von Mark Rumary noch nie gehört, aber den Namen Notcutts kannte ich: ein berühmtes Gartenbauunternehmen aus Suffolk, das bei der Chelsea Flower Show für seine kunstvollen Arrangements vielfach ausgezeichnet worden war.
Wir sahen uns das Haus im Januar 2020 an und fuhren auf dem Weg dorthin durch kleine Suffolk-Dörfer, fast bis hinauf zur Küste. Mit jeder Meile wurde das Land flacher und der Himmel heller. Wir waren etwas zu früh dran, so dass mir noch genügend Zeit blieb, in dem Café gegenüber pochierte Eier und Toast zu essen, den Blick fest auf die Uhr gerichtet. Man konnte den Garten von der Straße aus nicht sehen. Er versteckte sich vermutlich hinterm Haus. Ich sah ihn gleich, als die Eingangstür aufging. Der lange, schummrige Flur führte zu einer zweiten Glastür. Eine Welle von sattgrünem Licht brandete herein.
Die Bäume draußen waren kahl. Der Garten war ummauert, der weiche rote Suffolk-Ziegel mit allerlei Kletter- und Schlingpflanzen bewachsen: Blauregen, Clematis, Winterjasmin und Geißblatt, neben Knäueln und Girlanden von wildem Efeu. Alles war verwahrlost und verwildert, doch schon auf den ersten Blick entdeckte ich ungewöhnliche Pflanzen wie die Zaubernuss, deren leuchtend gelbe, an Zitronenzesten erinnernden Blütenblätter einen beißenden, hypnotisierenden Geruch verströmten, und die unverwechselbaren schwarzen Knospen einer Strauch-Pfingstrose. Am Ende des Gartens führte eine Tür in der Mauer in einen viktorianischen Wagenschuppen, der jetzt als provisorische Garage diente. Hinter der Tür stand eine klapprige Kiste mit einem eisernen Futtertrog darin, genau wie der in The Children of Green Knowe, wo Tolly Würfelzucker für das Geisterpferd Feste hineinlegt. Im Geräteschuppen zeigte mir der Besitzer Mark Rumarys von Spinnweben überzogene Gartenschürze, die nach wie vor an ihrem Haken hing.
Das Grundstück umfasste nur knapp tausendvierhundert Quadratmeter Fläche, aber es wirkte sehr viel größer, weil es auf äußerst raffinierte Art und Weise durch zwei Hecken – einmal Buche, einmal Eibe – unterteilt war, so dass man es nie in seiner Gänze überblicken konnte, sondern durch Bögen und Durchgänge in immer neue, geheimnisvolle Räume gelangte. In dem einen gab es ein erhöhtes Wasserbecken in Vierpassform, ein anderer schien völlig aufgegeben, mit verrottenden Obstbäumen, darunter eine Mispel, die ich nur aus Shakespeares Romeo und Julia kannte, wo die Mägde die Frucht open-arses – offene Ärsche – nennen. Dort hatte eine Hochzeit stattgefunden, erzählte der Besitzer, und der Boden war immer noch mit einer Plane bedeckt, hier und da durchbohrt von Brennnessel und Fingerhut. Jenseits der Gartenmauer umschloss eine sanft abfallende Parklandschaft ein zartrosa getünchtes georgianisches Herrenhaus, das durch die kahlen Zweige des Ahorns jedoch kaum zu sehen war. Auch in dieser Mauer gab es eine mit einem Vorhängeschloss gesicherte gewölbte Tür, von der die enteneierblaue Farbe blätterte. Ihr Vorhandensein nährte das Gerücht, dies sei einst das Witwenhaus gewesen, für mich hingegen war sie lediglich ein Echo der rätselhaften Tür aus meinem Gartentraum.
Die meisten Mauern waren mit Rosen bewachsen. Sie sahen aus, als seien sie seit Jahren nicht beschnitten worden, und ich musste natürlich sofort an die böse Mary Lennox aus Der geheime Garten denken, mit ihrer gallengelben Haut, die einen Garten wie diesen betritt und als eine ganz andere wieder herauskommt. Hätte ich von diesen Rosen mit dem Taschenmesser ein Stück Rinde abgekratzt, wären sie darunter mit Sicherheit grün und gesund gewesen. Gärten verstehen es meisterhaft, sich tot zu stellen, obwohl sie quicklebendig sind, und so war der Boden auch hier mit Schneeglöckchen bestickt, die durch eine Schicht faulender Blätter zum Tageslicht hinstrebten. Da erspähte ich in einer Ecke einen Seidelbast, den größten, den ich je gesehen hatte, dessen muschelrosa Büschel unstete Ströme süßen Dufts aussandten. Daphne mezereum war die erste Pflanze, in die ich mich verliebt, der erste botanische Name, den ich als Kind gelernt hatte. Mehr als alles andere wollte ich, dass dieser Garten mir gehörte.
Das war im Januar. Dann kam der Februar, und in Großbritannien wurden die ersten Covid-Fälle gemeldet, gefolgt von Lockdowns in Italien, wo die Krankenhäuser schon jetzt völlig überlastet waren. Zu Hause fabulierte der Premierminister – den das Virus bald darauf beinahe das Leben kosten sollte – fröhlich, in spätestens zwölf Wochen sei »der Spuk vorbei«. Die Leute begannen Masken zu tragen, gingen kaum noch vor die Tür, hatten Angst, per Post oder beim Einkaufen infiziert zu werden. Kurz nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche wurde ein landesweiter Lockdown verhängt. Fast alle im Land waren zu Hause eingesperrt und durften sich nur eine Stunde täglich an der frischen Luft bewegen.
Und so kam die Welt, die sich in letzter Zeit so schnell gedreht hatte, von heute auf morgen zum Stillstand. In Das verlorene Paradies beschreibt Milton die Erde als an einer Kette hängend. So erscheint sie Satan auf seiner Reise durch die Wüsteneien des Chaos. Erst beschaut er den Himmel, mit seinen Türmen und Zinnen von Saphir und Opal, und dann, »nahebei in goldner Kette hängend,/Die Schwebewelt, von Ansehn wie ein Stern/Von kleinster Größe, dicht beim Monde stehend.«[3] Eine kleine Welt, baumelnd im Nichts: So etwa fühlte sich der erste Lockdown an.
Das Wetter war mild, zart, fast närrisch schön. Während sich alles gleichsam zusammenzog, brachte der Frühling eine Flut von Schönheit, beschäumt mit einem Teppich von Kirschblüten und Wiesenkerbel. Cambridge leerte sich, von Touristen und Studierenden keine Spur. Selbst die Spielplätze wurden geschlossen, die Schaukeln an ihren Gestellen festgekettet.
Ian war über siebzig und hatte zwei Aneurysmen überlebt, und die Angst um seine Gesundheit raubte mir fast den Verstand. Wir gingen durch leere Straßen und durch leere Parks, machten um jeden Fremden einen weiten Bogen und hielten den Atem an, wenn Jogger japsend und keuchend an uns vorüberliefen. Nicht, dass ich das Haus besonders oft verlassen hätte. Ein paar Wochen vor dem Lockdown hatte ich mir einen hartnäckigen Husten geholt, der sich zu einer Rippenfellentzündung auswuchs. Ich lag mit Fieber im Bett, kehrte in Gedanken immer wieder zu dem Garten zurück und vertrieb mir die endlosen Stunden damit, die Geschichte seiner Entstehung und Entwicklung zu rekonstruieren.
Die aktuellen Besitzer hatten mir zwei Artikel über ihn geborgt, der eine von Rumary selbst, aus einer Anthologie über die Gärten Suffolks, der andere aus einem Country-Life-Heft von 1974, illustriert mit aufwendigen Schwarz-Weiß-Fotografien. Autor des Textes war der Landschaftsarchitekt Lanning Roper, für den Rumary vor seinem Wechsel zu Notcutts gearbeitet hatte, wie ich später erfuhr. Ich stöberte ein wenig herum und fand einen dritten Aufsatz in dem von Rosemary Verey und Alvilde Lees-Milne herausgegebenen Band The Englishman’s Garden. Rumarys Stil ist so herzlich und lebendig, als stünde er im Zimmer und fuchtelte wild mit den Händen, ebenso enthusiastisch wie bescheiden in seiner kenntnisreichen Liebe zu den Pflanzen. »Ich werde nie vergessen, wie begeistert ich war«, schrieb er, »als ich den Garten das erste Mal sah«.[4] Er hatte das Haus 1961 bezogen, gemeinsam mit seinem Lebensgefährten, dem Komponisten Derek Melville, den er noch vierzig Jahre später als seinen Freund bezeichnete. Heimlich homosexuell – eine Sprache, die ich bestens kannte, aus meiner Kindheit in einer lesbischen Familie in den achtziger Jahren.
Bei ihrem ersten Besuch war der Garten ungepflegt, »mit einem kleinen Bestand von altersschwachen Apfel- und Pflaumenbäumen, die aus einem Meer von wild wucherndem Giersch aufragen, umgeben von ungewöhnlich hohen Mauern, die das klaustrophobische Gefühl eines Gefängnishofes vermitteln«.[5] Dazu ein Netz von schmalen, halb verfallenen Wegen, die ins Nichts zu führen schienen. Der Boden war leicht und sandig, und eine Phalanx von Ulmen hinter der rückwärtigen Mauer bildete einen dichten Schattenriegel. Rumary hatte Hunderte von Gärten entworfen, doch nur diesen einen für sich selbst. Selbst nach so langer Zeit war seine Begeisterung noch deutlich spürbar. Er beseitigte alles bis auf ein paar ausgewachsene Bäume, darunter drei Säuleneiben und eine prächtige Maulbeere aus der Zeit Jakobs I. Als er den Giersch gejätet und die kranken Apfelbäume gefällt hatte, erkannte er, dass die Unregelmäßigkeit des Grundstücks es ihm erlaubte, Räume anzulegen, die quasi als Erweiterungen des Hauses fungierten und deren Grenzen er mit Hecken markierte: der von Gertrude Jekyll begründete klassische Arts-and-Crafts-Stil, den Vita Sackville-West und Harold Nicolson in Sissinghurst Castle so raffiniert eingesetzt hatten. Und tatsächlich war die Feige, die ich bei meinem ersten Besuch bewundert hatte, der Ableger eines Baumes im Garten von Sissinghurst.
In seiner ursprünglichen Anlage des Gartens war der heutige Teichgarten mit altmodischen Rosen wie ›Ferdinand Pichard‹ und ›Fantin Latour‹ bepflanzt. Der Platz hinter der Eibenhecke, wo das Hochzeitszelt gestanden hatte, war ein schattiger weißer Garten, dessen Ecken verschiedene Obstbäume illuminierten, darunter eine Mahagoni- und eine Winterkirsche. Unter diesen sich türmenden Blütencumuli Garben von Funkien und Bambus, dazwischen büschelweise Skimmien, weißes Fingerkraut und weißer Polsterphlox neben Weißen Narzissen, Königslilien und lilienblütigen Tulpen. Laut Rumary der ideale Ort, um sich von einem Kater zu erholen, mit einer kreisförmigen Rasenfläche, die wie ein grünes Bassin aussah, und den weißen Blumen, die in dem narkotischen Licht erstrahlten, das durch das Blattwerk sickerte. Ich stellte es mir so ähnlich vor wie Carnation, Lily, Lily, Rose, John Singer Sargents samtige Darstellung eines Sommerabends.
Rumarys eleganter Sinn für Struktur lag in ständigem Widerstreit mit seinem Bestreben, immer neue Kultursorten und -arten auszuprobieren. »Im Lauf der Jahre kam es so zu einem Dauerkonflikt zwischen Gestalter und Gärtner«, schrieb er, »denn während ich von Berufs wegen in erstere Kategorie fiel, gehörte ich gefühlsmäßig zu letzterer. Sozusagen ein klassischer Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder, genauer, Miss Jekyll und Mr. Hyde! In der Anfangsphase hatte Jekyll die Oberhand … doch Hyde funkte immer wieder dazwischen, und das tut er bis heute.«[6] Da ich stärker in Richtung Hyde tendierte, konnte ich diesen Pflanzwahn sehr gut nachvollziehen. Damals war der Garten vollgestopft mit ebenso ungewöhnlichen wie heißbegehrten Pflanzen. Mit Hilfe dieser drei Artikel und den zwei Dutzend Fotos, die ich im Internet ausgegraben hatte, erstellte ich in mühevoller Kleinarbeit eine Liste von knapp zweihundert Arten, von denen Rumary nicht wenige allein ihres Duftes wegen ausgesucht hatte. Ich ging sie immer wieder durch, und sei es nur, um mich von der erschreckenden Unbestimmtheit der Zukunft abzulenken, indem ich von den unterschiedlichen Gerüchen tagträumte, die Fleischbeere, Winterblüte und Rosa rugosa ›Roseraie de l’Haÿ‹ verströmten. Einige waren im Laufe der Jahrzehnte ohne Zweifel eingegangen oder anderweitig verschwunden. Was wohl aus dem Silberginster geworden war, der zum Gedeihen eine warme Südwand braucht? Und gab es die Japanische Goldorange noch, gezüchtet aus einem Ableger vom Grab Chopins, oder die Nelken aus den Samen, die Rumary in George Sands Garten in Nohant gesammelt hatte?
Während die Schrecken des Pandemiejahres stetig wuchsen, wurde mir dieser halb imaginäre, halb reale Garten zu einem Trostort, einem Raum ganz für sich, den ich nach Belieben betreten konnte, obwohl ich ihn nur einmal gesehen hatte. Das klingt im wahrsten Wortsinn eigentümlich, doch war ich keineswegs die Einzige, die in jenem Frühling im Garten Trost und Stärkung suchte. Während ich im Bett lag, machte sich eine sonderbare Gartenobsession breit. Überall auf der Welt entbrannten die Leute in heißer Liebe zu den Pflanzen. Jeden Morgen wurde mein Instagram mit einer saftgrünen Flut von Zuckererbsensetzlingen und beim täglichen Spaziergang entdeckten Clematis überschwemmt. Im Lauf des Jahres 2020 fingen drei Millionen Menschen in Großbritannien an zu gärtnern, über die Hälfte davon unter fünfundvierzig. In den Gartencentern gab es keine Erde, kein Saatgut und irgendwann auch keine Pflanzen mehr, da die Leute ihre ganze Energie darauf verwandten, das kleine Stück Welt, auf das sie sich beschränken mussten, zu verändern. Das gleiche Muster wiederholte sich auf dem ganzen Globus, von Indien bis Italien. In den USA fingen während der Pandemie 18,3 Millionen Menschen an zu gärtnern, viele von ihnen Millennials. Das amerikanische Saatgutunternehmen W. Atlee Burpee meldete im ersten Lockdown-März den höchsten Umsatz seiner 144-jährigen Firmengeschichte, und auch der russische Onlinehändler Ozon verkaufte dreißig Prozent Pflanzensamen mehr als sonst. Es war, als seien Pflanzen, in dieser beruhigten und beängstigenden Zeit, sozusagen ins kollektive Blickfeld gerückt, als Quelle von Hilfe und Unterstützung.
Die Gründe lagen auf der Hand. Der Anbau von Nahrungsmitteln ist in unsicheren Zeiten ein Instinkt und hat im Pandemie- oder Kriegsfall regelmäßig Konjunktur. Das Gärtnern war heilsam, wohltuend, nützlich, verschönernd. Es füllte die leeren Tage und gab Menschen, die aus ihrer Büroroutine herausgerissen worden waren, neuen Sinn. Es war eine Möglichkeit, sich hinzugeben, dem Hier und Jetzt, in dem wir alle gefangen waren. In dieser unterbrochenen Zeit – kauernd auf der Schwelle einer unvorstellbaren Katastrophe, die Zahl der Todesopfer stieg rapide, und ein Heilmittel war nicht in Sicht – wirkte es beruhigend zu sehen, wie die Zeit verstrich, wie Samen sprossen, Knospen platzten, Narzissen ans helle Licht des Tages drängten; eine Erinnerung daran, wie die Welt einmal war und eines Tages vielleicht wieder werden würde. Das Gärtnern war auch eine Investition in eine bessere Zukunft.
Für manche Leute jedenfalls. Der Lockdown machte aber auch schmerzlich sichtbar, dass der Garten, diese vermeintliche Zuflucht vor der Welt, unzweifelhaft politisch war. In jenem süßen Frühling herrschte eine bittere Ungleichheit zwischen den Leuten, die mit der Pflanzschaufel in der Erde buddelten oder sich mit dem Laptop auf dem Schoß in ihren Liegestühlen rekelten, und denjenigen, die in trostlosen Wohnsilos oder verschimmelten Einzimmerwohnungen gefangen saßen. Diese Ungleichheit vergrößerte sich noch, als öffentliche Parks und Grünanlagen gesperrt oder zum Ziel verstärkter Überwachung wurden, was vor allem den Menschen den Zugang zu ihnen erschwerte, die dessen am dringendsten bedurften. Laut Erhebungen des Office of National Statistics vom Frühjahr 2020 hat die überwiegende Mehrheit – achtundachtzig Prozent – der britischen Bevölkerung Zugang zu einem Garten irgendeiner Art, und sei es ein Balkon, ein Hinterhof oder ein Gemeinschaftsgarten, doch diese Verteilung ist keineswegs zufällig. Schwarze haben fast viermal so häufig keinen Zugang zu einem Garten wie Weiße, während Ungelernte und Geringqualifizierte, Gelegenheitsarbeiter und Arbeitslose fast dreimal so häufig ohne Garten sind wie Leute in Fach- oder Führungspositionen. Einer Studie des National Institute of Health aus dem Jahr 2021 ist zu entnehmen, dass Gärten in den USA in der Gesamtbevölkerung zwar weniger weit verbreitet sind, Weiße aber fast doppelt so häufig wie Schwarze oder asiatische Menschen Zugang zu einem Garten haben.
Im Zuge der weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste gerieten auch Gärten, und insbesondere die aristokratischen, hochherrschaftlichen Gärten im Besitz des National Trust, in die Kritik. Ein Garten, eine Parklandschaft mag unschuldiger, um nicht zu sagen tugendhafter aussehen als die Statue eines Sklavenhändlers, aber auch sie steht in einem versteckten Zusammenhang mit Kolonialismus und Sklaverei. Nicht nur sind viele unserer handelsüblichen Gartenpflanzen, von Palmlilie und Magnolie bis zu Blauregen und Liebesblume, importierte »Exoten«, Erbe eines in Kolonialzeiten ungemein beliebten Sports: der Pflanzenjagd. Sondern die Sklaverei lieferte auch das Kapital für eine konzertierte Verschönerung der Landschaft, denn mit den grotesken Profiten aus Zuckerrohrplantagen wurde der Bau luxuriöser Häuser und Gärten in England finanziert.
Bestimmten Kreisen war diese Diskussion ein Dorn im Auge, politisierte sie doch, was ihrer Meinung nach neutral zu sein hatte, ein debattenfreier Raum. Sie wollten die Kosten für die Errichtung ihres Paradieses nicht erörtert wissen, auf dass der heimelige Charme der sogenannten Kulturlandschaft erhalten blieb. Für andere wurde der Garten dadurch zu einer befleckten, ja kontaminierten Zone, einer Quelle unhinterfragter Privilegien, der schimmernden Frucht schmutzigen Geldes. Ich selbst war der Ansicht, dass der Zauber des Gartens zwar durchaus in seinem Schwellendasein liegt, seiner vermeintlichen Abgeschiedenheit vom Rest der Welt, er deshalb aber noch lange nicht außerhalb von Geschichte oder Politik existiert. Ein Garten ist nicht nur eine Zeitkapsel, sondern auch ein Portal zu anderen Zeiten.
Die Erkenntnis, dass der Besitz eines Gartens ein Luxus ist, dass der Zugang zu Grund und Boden ein Luxus ist, ein Privileg und nicht das Recht, das es sein müsste, ist nicht neu. Die Geschichte des Gartens war seit seinen paradiesischen Anfängen immer auch eine Geschichte darüber, was oder wer aus seinem Gehege ausgeschlossen oder vertrieben wird, seien es Pflanzen oder Menschen. Toni Morrison bemerkte einmal: »Jedes Paradies, jedes Utopia ist definiert durch die, die darin fehlen, durch diejenigen, denen man den Zugang verwehrt.«[7] Während es einige von Englands ach so erhabenen Gärten ohne die von Sklaven auf den Zucker-, Baumwoll- und Tabakplantagen in Amerika und auf den Westindischen Inseln erwirtschafteten Gewinne wohl nicht gäbe, verdanken andere ihre Existenz einer vom Parlament beschlossenen Landreform, der legalen Überführung von ehemals offenen Feldern, Allmenden und Brachflächen des Mittelalters in Privatbesitz. Zwischen 1760 und 1845 wurden Tausende solcher »Einhegungen« beschlossen. Bis 1914 war mehr als ein Fünftel der Gesamtfläche Englands privatisiert worden, Vorspiel zu der bestürzenden Statistik unserer Tage, wonach sich die Hälfte des Landes im Besitz von kaum ein Prozent der Bevölkerung befindet. Die Privatisierung machte das neue Arkadien überhaupt erst möglich: das riesige Haus allein auf weiter Flur, inmitten einer scheinbar natürlichen Parklandschaft, die penibelst manikürt und von allen unliebsamen Spuren menschlicher Existenz bereinigt worden war, von Straßen, Kirchen und Gehöften bis hin zu ganzen Dörfern.
Ich hatte schon lange über diese eher beunruhigenden Aspekte des Gartens nachgedacht. Meinem Einkommen und meinen Neigungen entsprechend hatte ich die meiste Zeit meines Lebens mit Ad-hoc-Gärten zugebracht, angelegt für kleines Geld auf aufgegebenem oder ausgelaugtem Boden. Nach meiner Zeit als Umweltaktivistin hatte ich eine Ausbildung zur Naturheilkundlerin begonnen und hauste den ersten Winter meines Studiums in einem Astzelt auf einer stillgelegten Schweinefarm bei Brighton, als Mitglied eines Kollektivs, das dort einen Gemeinschaftsgarten anlegen wollte. Mein Entschluss, Heilpflanzenkunde zu studieren, ergab sich aus der verführerischen Mehrfachlektüre von Modern Nature, einem Buch des Filmemachers Derek Jarman, in dem er von seinem Versuch berichtet, am Kiesstrand von Dungeness einen Garten anzulegen, während er an Aids zugrunde ging. »Das Mittelalter hat das Paradies meiner Phantasie geprägt«,[8] schrieb er und streute zwischen seine Tagebucheinträge immer wieder Auszüge aus mittelalterlichen Herbarien, eine Pharmakopöe der Heil- und Zauberpflanzen; Rosmarin, Borretsch, Thymian, Echtes Herzgespann. Mit jeder Pflanze verbanden sich so viele Erinnerungen und Assoziationen, dass sein Garten sich in zwei scheinbar widersprüchliche Dinge verwandelte: einen Notausgang in die Ewigkeit und die Gelegenheit, sich selbst in die lebende Landschaft einzuschreiben (oder, wie er es nennt, sich an die Welt zu »ketten«).[9]
Als die ersten Covid-Fälle in den Nachrichten auftauchten, war ich an der Kampagne zur Rettung von Prospect Cottage, Derek Jarmans Haus, und dem berühmten Garten beteiligt, der es umgab. Zwei Wochen nach Beginn des Lockdowns erreichte die Kampagne das unfassbar ehrgeizige Crowdfunding-Ziel von dreieinhalb Millionen Pfund. Anscheinend war ich nicht die Einzige, die diesen unglaublichen Ort auch lange nach Jarmans Tod für erhaltenswert erachtete. Sein Garten hat weder Mauern noch Zäune und verwischt so und in voller Absicht die Grenze zwischen kultiviert und wild: Die Rosen und Raketenblumen weichen windgeformten Büscheln von Meerkohl und Ginster. Auf diese Weise macht er einen der interessantesten Aspekte von Gärten sichtbar: nämlich dass sie an der Schwelle zwischen Kunst und Natur, bewusster Entscheidung und blindem Zufall existieren. Selbst die gepflegtesten Parzellen sind einem fortwährenden Sperrfeuer durch äußere Gewalten ausgesetzt: von Witterung und Insektenaktivität über Bodenmikroorganismen bis hin zu Bestäubungsmustern. Ein Garten ist ein Balanceakt, der sowohl zur engen Zusammenarbeit als auch zum offenen Krieg führen kann. Diese Spannung zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie der Mensch sie sich wünscht, ist der Kern der Klimakrise, und so kann der Garten auch ein Ort des Experimentierens sein, an dem sich erproben lässt, wie man diese Beziehung auf neue und vielleicht weniger schädliche Art und Weise gestalten kann.
Wie ich aus eigener Erfahrung wusste, spiegelt die Geschichte des Gartens nicht immer und unbedingt größere Muster von Privileg und Exklusion. Er ist auch ein rebellischer Vorposten, ein Ort des Träumens von einem gemeinschaftlichen Paradies, wie es die Diggers taten, eine apostatische Sekte aus der Zeit des Englischen Bürgerkrieges, welche die bis heute radikale These vertrat, dass die Erde eine »gemeine Schatzkammer«[10] sei, an der, man höre und staune, alle Menschen teilhaben sollten. Sie errichteten ihr kurzlebiges vegetabiles Eden auf dem St George’s Hill in Surrey, wo sich heute eine vor allem bei russischen Oligarchen sehr beliebte gated community befindet. Diese Art von Garten ist ein Ort der Möglichkeiten, wo neue Lebensweisen und Machtmodelle erprobt werden können und auch wurden, ein Gefäß für Ideen und zugleich eine Metapher für die Umsetzung derselben. Wie der Künstler Ian Hamilton-Finlay, der den Skulpturengarten Little Sparta in Schottland angelegt hat, einmal bemerkte: »Manche Gärten sehen aus wie Rückzugsorte, sind in Wirklichkeit jedoch eine Attacke.«[11]
Falls ich den Zuschlag für Rumarys Garten erhielt, wollte ich ihn restaurieren, doch ich wollte auch nachzeichnen, wie und wo er den Pfad der Geschichte gekreuzt hatte, wie es unweigerlich auch der kleinste Garten tut, denn jede Pflanze ist eine Reisende durch Raum und Zeit. Ich wollte beide Arten von Gartengeschichten untersuchen: die Kosten für die Errichtung des Paradieses berechnen, aber auch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Vielleicht ließen sich ja Varianten des Gartens Eden finden, die nicht auf Ausgrenzung und Ausbeutung gründeten und auf Ideen gebaut waren, die in den kommenden schwierigen Jahren womöglich von existenzieller Bedeutung sind. Diese beiden Fragen erschienen mir sehr dringlich. Wir standen an einem Scharnierpunkt der Geschichte, wir lebten im Zeitalter des Massenaussterbens, des katastrophalen Endspiels der Beziehung zwischen Menschheit und Natur. Der Garten könnte eine Zuflucht sein, ein Ort des Wandels, aber er war und ist immer auch ein Abbild der Machtstrukturen und Denkweisen, die diese Verwüstung vorangetrieben haben.
Aber das war noch nicht alles. Ich war des ewigen, gequälten Jetzt der Nachrichten müde. Ich wollte nicht nur rückwärts durch die Jahrhunderte reisen. Ich wollte ein anderes Verständnis von Zeit: der Art von Zeit, die sich in Zyklen oder Spiralen bewegt, pulsierend zwischen Fruchtbarkeit und Fäulnis, Licht und Dunkel. Ich ahnte schon damals, dass der Gärtner eingeweiht ist in ein anderes Zeitverständnis, das womöglich einen Einfluss darauf hat, ob und wie die Apokalypse, auf die wir zuzusteuern scheinen, noch abzuwenden ist. Ich wollte tiefer graben und sehen, was ich finden konnte. Ein Garten birgt Geheimnisse, wie wir alle wissen, verschüttete Elemente, die einen merkwürdigen Wuchs entwickeln oder an den unmöglichsten Orten keimen. Der Garten meiner Wahl hatte zwar Mauern, aber wie jeder Garten war er in sich verbunden, sperrangelweit offen für die Welt.
IIPARADIES
Mitte August zogen wir endlich um. Hundstage, der Boden staubtrocken und rissig. Um zwölf Uhr mittags lag die Temperatur bei einunddreißig Grad, die Luft zitterte wie Wackelpudding. Kaum hatten wir die Schlüssel ausgehändigt bekommen, ging ich in den Garten hinaus. Er war nicht so, wie ich ihn in Erinnerung hatte, ganz und gar nicht. Er wirkte verwahrlost und marode, die Rasenflächen waren verbrannt, die Beete abgesackt. Der Buchs hatte Mehltau. Das Gewächshaus war voller halbtoter Tomatenpflanzen, und die Magnolia grandiflora vor der Tür hatte Hunderte von Blättern abgeworfen, die von der Farbe und Konsistenz her an Baseballhandschuhe erinnerten. Hatten wir einen Fehler gemacht? Hatte ich sie mir nur eingebildet, die Stimmung, die sich zwischen den Mauern förmlich zu ballen schien? Später erfuhr ich, dass sich der Garten im August, wenn er den ganzen Tag lang in der prallen Sonne dörrt, stets von seiner schlechtesten Seite zeigt.
Die Umzugsleute kamen, und nach und nach füllten die schönen leeren Zimmer sich mit Kisten und Kartons. Während die Arbeiter sich drinnen zu schaffen machten, entrümpelte ich das Gewächshaus und schleppte trotz der Hitze alte Töpfe und Säcke voller Blumenerde auf den Rasen. Ich schrubbte die Regale, verstaute mein Werkzeug und band Staudenhalter und Pflanzenstützen zu ordentlichen Bündeln. Doch das war weiter nichts als Flickwerk. Das Gebäude befand sich in weitaus schlechterem Zustand, als ich bei unserem ersten verführerischen Besuch bemerkt hatte. Dichter Efeu rankte sich bis unters Dach, und die Balken waren so morsch, dass man mit dem bloßen Daumen ein Loch hineindrücken konnte. In der Rückwand waren zahlreiche Ziegel geborsten oder mit giftigen algengrünen Flecken übersät. Da half kein schneller Anstrich, sondern nur ein kompletter Neuaufbau.
Wir hatten keine Pflanzen aus unserem alten Garten mitgenommen, nicht einmal die gestreifte Pfingstrose, die ich von klein auf gehegt und gepflegt hatte, aber eine Vielzahl von Topfpflanzen, darunter meine wachsende Sammlung von an die vierzig Pelargonien. Ihre Namen klangen wie Figuren aus einem Jane-Austen-Roman: ›Lady Plymouth‹, ›Lord Bute‹, ›Ashby‹, ›Brunswick‹, ›Mrs. Stapleton‹. Als sie abgeladen waren, trug ich sie eine nach der anderen in den Teichgarten und arrangierte sie zusammen mit einem Steinlöwen, dessen Kopf auf seinen Pfoten ruhte, und zwei Handvoll weißer Kieselsteine, die Ian einst aus Griechenland mitgebracht hatte, rings um das Bassin. Das Wasser war fast vollständig mit Grünalgen bedeckt. Garben von Frauenmantel ergossen sich auf die Gehwegplatten, und an der rückwärtigen Mauer stand eine einsame Kardone unter vollen Segeln, bekrönt mit kaiserlichem Purpur, den das unstete Licht in Flammen setzte. Eine malvenrote Geranie wütete zwischen dürren Rosen. ›Rozanne‹? Es war furchtbar heiß, und man hörte nur die Bienen und in der Ferne den Verkehr auf der A12.
Als die Umzugsleute weg waren, setzten wir uns ins Gras und aßen Kirschen. Lange Schatten krochen über den Rasen. Bei Tagesanbruch hatte mein Vater mir per E-Mail mitgeteilt, dass sich der Zustand seiner Frau über Nacht weiter verschlechtert hatte. Sie lag im National Hospital for Neurology and Neuroscience, der jüngste in einer langen Reihe von Klinikaufenthalten wegen eines Hirntumors. Zum ersten Mal seit zehn Jahren hatte er sie nicht besuchen können. Sonst war er jeden Tag mit dem Zug nach London gefahren, um an ihrem Bett sitzen und mit dem Personal über die komplexe Orchestrierung ihrer Pflege sprechen zu können, angesiedelt an der Schnittstelle zwischen Onkologie und Neurologie. Wenn sie zu Hause war, kümmerte er sich ganz allein um sie, eine Situation, die zunehmend unhaltbar wurde. Noch vor ein paar Tagen hatten wir darüber gesprochen, nach ihrer bevorstehenden Entlassung eine Pflegekraft zu engagieren. Nun jedoch würde sie die Woche wohl nicht überleben.
Wir zogen am Montag um. Am Mittwoch sah es aus, als würde sie sich wieder fangen und, wie schon so oft, eine wundersame Spontangenesung hinlegen. Ihr Blutdruck normalisierte sich, ebenso ihre Körpertemperatur. Doch am Freitagmorgen, nur wenige Stunden nach dieser letzten frohen Kunde, starb sie, und er rief weinend vom Queen Square aus an, wo er auf einer Bank vor der Klinik saß und einen Karton mit ihren Kleidern in den Armen hielt.
Es war mein Vater, der mir die Liebe zum Gärtnern eingeflößt hatte. Meine Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich vier war, und er hatte seine Besuchswochenenden damit verbracht, uns in sämtliche National-Trust-Gärten und Privatparks im Umkreis von hundert Meilen um die M25 zu schleppen, ein Gebiet, in dem wir uns ständig bewegten, da wir am unteren Ende der Autobahn lebten und er am oberen. Ich war ein ängstliches, nicht besonders glückliches Kind, und ich liebte die Selbstvergessenheit, die sich in einem Garten einstellte. Eines unserer liebsten Ausflugsziele war Parham, ein elisabethanisches Haus in Sussex, wo es in jeder Ecke des ummauerten Gartens winzige formale Teiche gab, die mit einer grün glänzenden Schicht von Entengrütze überzogen waren. Nach Sissinghurst fuhren wir immer im April, wenn ich Geburtstag hatte, die Wege festlich mit Apfelblüten geschmückt waren und man sich am reifen Duft des Goldlacks berauschen konnte, der am Fuß von Vitas Turm in der Sonne briet.
Mein Vater nahm immer ein kleines schwarzes Notizbuch mit auf diese Expeditionen. Darin listete er in seiner unleserlichen Handschrift Pflanzennamen auf und stürzte sich auf jede ungewöhnliche Kulturvarietät. Ich mochte vor allem die alten Sorten und sammelte Listen von alten Rosen oder Äpfeln, die in den Obstgärten des 16. Jahrhunderts sehr en vogue gewesen waren. ›Winter Queening‹, ›Catshead‹, ›Golden Harvey‹, ›Green Custard‹, ›Old Permain‹. Seine Frau begleitete uns nur selten. In dem Karton, den er von der Klinik ausgehändigt bekommen hatte, befand sich ein DIN-A4-Blatt, auf dem sie persönliche Angaben und Informationen notiert hatte, vermutlich mit Hilfe einer Krankenschwester, denn sie konnte nicht mehr lesen und schreiben. Der letzte Vermerk galt Dingen, die sie nicht mochte oder über die sie nur ungern sprach. Dort stand weiter nichts als: »Gartenarbeit – die erledigt normalerweise mein Mann.«
Seine jetzige Verzweiflung und der Schock und das Entsetzen, das ihr plötzlicher Tod auslöste, prägten mein Erleben des Gartens in diesen ersten Tagen und verstärkten die durch die Pandemie erzeugte Stimmung der Besorgnis. Im Winter hatte ich nur die Schönheit der Anlage, das Gefühl der Verheißung wahrgenommen, aber nicht, wie verwahrlost alles war. Jetzt sah ich mit anderen Augen. Die Bäume strotzen förmlich vor Pilzen oder waren völlig verwachsen, umrankt von üppigen Girlanden aus Ackerwinde. Mangels Nährstoffen schwächelten die meisten Pflanzen oder waren verkümmert, überrannt von Blutsaugern und Meuchelmördern, die weder Maß noch Ziel zu kennen schienen. Eines Nachmittags brach eine Johannisbeere vor meinen Augen zusammen, und auch der Baum darüber schien im Sterben zu liegen. Die Vorbesitzer hatten bei der Restaurierung des Hauses Unglaubliches geleistet, aber wie sie selbst sagten, waren sie keine Gärtner, und in den Monaten des Lockdowns hatte ihnen auch niemand zur Hand gehen können.
Nicht, dass ich ordentliche Gärten besonders mochte. In dieser Hinsicht hielt ich es mit Frances Hodgson Burnetts Maxime in Der geheime Garten, wonach ein Garten seinen ganzen Charme verliert, wenn er gar zu geschniegelt und gebügelt aussieht. Man muss sich darin verlieren können, sich, um es mit Burnett zu sagen, wie von der Welt abgeschnitten fühlen. Was mir an diesem Garten besonders gefiel, waren seine sonderbaren Proportionen: Die Mauern und die Buchenhecke mit ihren beiden Bögen waren so irre hoch, dass wir uns wie Liliputaner vorkamen, wenn wir mit unseren Rechen darunter hindurchgingen. Die Höhe, die einige der Pflanzen erreichten, schien die absorptive Qualität noch der trivialsten Gartentätigkeit zu unterstreichen.
Dieser Rückzug aus dem Alltagsleben hat etwas Magisches, eine vegetabile Veränderung, die eine geradezu ekstatische Wirkung entfalten kann. Zugleich kann ein allzu vernachlässigter Garten unheimlich und auf die gleiche Art und Weise beunruhigend sein wie ein verlassenes Haus, in dem Chaos und Verfall Einzug gehalten haben. Das Bild des ungepflegten Gartens kursiert in der Literatur als Metapher für Verwahrlosung in größerem Maßstab. Man denke an den Diener in Richard II., der sich weigert, die »schwanken Aprikosen« im Garten des Herzogs von York hochzubinden und fragt, warum er eine umhegte Parzelle jäten soll, wo doch der Garten Englands so heruntergekommen ist, »erstickt die schönsten Blumen,/Die Fruchtbäum’ unbeschnitten, dürr die Hecken,/Verwühlt die Beet’, und die gesunden Kräuter/Von Ungeziefer wimmelnd«.[1] Das Grauen spricht aus diesen Versen. Etwas Falsches, etwas Verfaultes oder Befallenes, das eigentlich heil und fruchtbar sein sollte.
Wenn der Garten hier ganz unverhohlen für den Gesamtstaat steht, so repräsentiert er in dem fünf Jahre später entstandenen Hamlet nicht nur eine emotionale, sondern auch eine politische Landschaft. Nach dem Tod seines Vaters vergleicht Hamlet die frisch beschädigte und verseuchte Welt mit einem »wüste[n] Garten,/Der auf in Samen schießt; verworfnes Unkraut/Erfüllt ihn gänzlich«.[2] Dieses ebenso hartnäckige wie beunruhigende Bild verdankt sich dem Umstand, dass ein Garten stets gepflanzt und gepflegt wird, weshalb seine Auflösung einen größeren Sündenfall darstellt, als es bei einem Stück Wildnis oder Brachland der Fall wäre.
Eine ähnliche Art von Beklemmung findet sich in dem unheimlichen, mit »Zeit vergeht« überschriebenen Teil von Virginia Woolfs Roman Zum Leuchtturm, in dem das Haus der Ramsays den Elementen überlassen wird, ebenfalls infolge eines unverhofften Todesfalls. Mohnblumen säen sich zwischen den Dahlien aus, und Artischocken ragen unter den Rosen auf, genau wie sie es hier in den Teichbeeten getan hatten. Dieses im wahrsten Wortsinn ersprießliche, wenn auch gartentechnisch eher unwahrscheinliche Durcheinander bekommt nachgerade etwas Lustvolles, wenn sich die Nelke mit dem Kohl paart. Und doch besteht kein Zweifel daran, dass sich diese Lust im Nu in etwas weitaus Trostloseres, ja Tödliches verwandeln kann. »Eine Feder, und das sinkende, fallende Haus wäre gekippt und kopfüber in die Tiefen der Finsternis gestürzt.«[3] Das Haus zerschellt, und seine Trümmer verschwinden unter einer Decke aus Schierling und Dornicht.
Diese Zeilen kamen mir in den ersten Wochen des Öfteren in den Sinn. Alles bedurfte der Pflege. Brennnesseln, notierte ich niedergeschlagen in mein Gartentagebuch, Quecke, Brombeeren, Ochsenzunge. Kein Schierling, dafür Bärenklau, größer als ich, Hunderte von weißen, schon ausgewachsenen Blütenköpfen. Der Boden war wie brauner Zucker, genau wie Mark Rumary ihn beschrieben hatte. Reiner Suffolk-Sand, der keine Nährstoffe aufnehmen kann und regelmäßig mit organischer Bodensubstanz angereichert werden muss. Ich sah kaum je einen Wurm, und immer wenn ich mich in die efeuüberwucherten Bereiche am Ende eines Beetes vorwagte, stolperte ich über eine Leiche: den traurigen Stumpf eines Baumes oder Strauches, der aus unbekannter Ursache sein Leben hatte lassen müssen und ein Totenkleid aus Unkraut trug.
Die ersten Wochen verbrachte ich damit, das Gelände zu erkunden und die Karte in meinem Kopf mit der Realität in Einklang zu bringen. Eigentlich waren es vier kleine Gärten sowie ein paar verstreute Beete am Rand des Weges, der an der Nordseite des Hauses entlang und am Geräteschuppen vorbei in den Garten führte, durch eine zweite Tür in der Mauer, die cremefarben gestrichen war und ziemlich schief in den Angeln hing. Das Haus befand sich zur Linken, ein rosiges L, das im Lauf der Jahrhunderte immer wieder durch Anbauten erweitert worden und so zu einem bunten Stilsammelsurium geraten war. Die eine Seite der Fassade verschwand fast völlig hinter einem riesigen Blauregen, dessen dicke, gewundene Sprossachsen es unmöglich machten, das Wohnzimmerfenster zu öffnen. Im Innern des L versteckte sich eine gepflasterte Terrasse, gerade groß genug für einen Tisch, flankiert von einem kleinen Buchsbaumparterre, in dem sich Pfingstrosen und Rosen drängten.
Diese Terrasse führte in einen weiteren verschwiegenen Garten auf der Südseite des Hauses, der, wenig einfallsreich, Gewächshausgarten genannt wurde, nach seiner ungemein verführerischen Hauptattraktion. Dort gab es auch einen verdorrten handtuchgroßen Rasen, in dessen Mitte ein Pflaumenbaum aufragte, umsäumt von gedrungenen, unglücklichen Sträuchern, darunter Mahonien, Erdbeerbäume und eine mir unbekannte Magnolie sowie zwei kurioserweise in den Tiefschatten gepflanzte Apfelbäume. Die Mauer war zur Straße hin durch einen Sichtschutz aus geflochtenen, an Pflöcken befestigten Hainbuchen erhöht worden. Es sah aus wie ein Klinikparkplatz. Ich stellte mir Waldmeister darunter vor, wogend und schäumend in Grün und in Weiß, eine veritable Frühlingsflut.
Mein Tagebuch war voll von Notizen wie diesen, besorgten Beobachtungen, die sich abwechselten mit Träumen von Fruchtbarkeit und Neubelebung. Ehrlich gesagt, fühlte ich mich etwas überfordert. Wo sollte ich anfangen? Nach welchem Prinzip sollte ich vorgehen? Ich hatte schon früher Gärten restauriert, aber noch nie einen mit einer so erhabenen Geschichte. Ich wollte nichts kaputt machen, aus Unwissenheit oder Versehen Perlen wegwerfen. Mein Freund Simon, Chefgärtner am Worcester College in Oxford, gab mir einen großartigen Rat. Er empfahl mir, ein ganzes Jahr lang keine Pflanze auszusondern, solange ich mir ihrer Identität und ihres Erscheinungsbildes in jeder Jahreszeit nicht restlos sicher sei. Zwar war ich von Natur aus eher ungeduldig, doch wenn ich wissen wollte, was überlebt hatte, gab es nur eine hundertprozentig zuverlässige Methode: wachen und warten.
Der Hauptgarten lag dem Haus direkt gegenüber. Er war um eine Rasenfläche herum angelegt und umrandet mit einer Reihe von tiefen, geschwungenen Beeten, die an der Eibenhecke endete, hinter der sich der Hochzeitsgarten verbarg. Die nördliche Grenze wurde von einer Magnolia x soulangeana beherrscht, einem Baum, der einst häufig in Vorstadtgärten anzutreffen war und so früh eine Überfülle von schnabelförmigen rosa Blüten sprießen lässt, dass sie nicht selten dem Frost zum Opfer fallen und die Gehwege mit einer braunen Schleimschicht überziehen. Als kleines Mädchen betrachtete ich den Baum vor dem Haus meiner Großmutter mit besitzergreifender Faszination, immer in der Hoffnung, dass unsere Besuche mit seiner kurzen Blütezeit zusammenfallen würden.
Hier beherbergte er eine Kolonie hagerer Hortensien von einer Art, die ich noch nie gesehen hatte, wie eine Revuetruppe von Giacometti-Figuren. Gegenüber stand eine von Wespen beharkte Maulbeere, die im Lauf der Jahrhunderte so weit hintüber gekippt war, dass sie fast lag und faul und träge auf zwei Stützen ruhte. Das Beet teilte sie sich mit einer Zaubernuss, und auf der anderen Seite des Weges stand eine Korkenzieherhasel, Corylus avellana ›Contorta‹, auch bekannt unter dem griffigeren Namen ›Harry Lauders Spazierstock‹. Sie bildete die Kulisse für eine imposante Palmlilie, die seit dem Tag unseres Einzugs eine elfenbeinfarbene Glockenblüte nach der anderen trieb. Wie ich von den Fotos in Country Life wusste, war die Palmlilie ein Überbleibsel eines prächtigen Beetes, bevölkert von einer Gesellschaft von Rittersporn und Türkenmohn, deren riesige seidige Köpfe mit bezaubernden schwarzen Sprenkeln übersät waren. Jetzt wirkte es verwuchert, ungesund. Der Rasen war bis ins Beet gedrungen und hatte seinen Samen darin verstreut, und nun nahmen spröde gelbe Matten den verkümmerten Pflanzen an der Vorderseite buchstäblich die Luft zum Atmen. Ich habe mir nie viel aus Rasen gemacht, doch der Anblick dieses Verhaus ließ mir die Haare zu Berge stehen. Eines heißen Vormittags schnappte ich mir eine Blumengabel, hockte mich vor das Beet und machte mich ans Werk. Die Graswurzeln bildeten Netze, die sich leicht herausziehen ließen, der einzige Vorteil von sandigem Boden.
Plötzlich stießen die Zinken der Gabel auf etwas Metallisches. Ich betastete es mit den Fingerspitzen. Es war die alte Einfassung, ein geschwungenes Metallband, das um die komplette Rasenfläche verlief. Es gab zu diesem Zeitpunkt wohl wenig Unzeitgemäßeres als eine saubere Rasenkante, doch für mich war sie wie ein Talisman, ein greifbares Symbol für das Gleichgewicht zwischen Chaos und Kontrolle, Fülle und Klarheit, das jeder Gärtner für sich definieren muss.
Natürlich verlief nicht jeder Tag gleich. Wir badeten an den Stränden von Dunwich und Sizewell. Als wir in der ersten Nacht zu Bett gingen, hörten wir die Wechselrufe zweier Waldkäuze, die ihr Gespräch von nun an Nacht für Nacht fortsetzten. Manchmal stand ich auf, stellte mich ans Fenster und sah auf den Rasen hinunter, einen negativen dunklen Raum unter dem sternbesäten Himmel. Das Wetter hielt, ungebrochen, und jeden Tag schlich ich mich kurz nach Sonnenaufgang hinaus, um einen Rundgang zu machen und meinen Tee zu trinken. Um diese Zeit war es im Garten am schönsten, in der Morgen- oder Abenddämmerung, wenn sanfte Farbtöne vorherrschten, Rosa, Lavendel und manchmal sogar Gold.
Ich ging über den Rasen und durch den ersten Bogen in der Buchenhecke, der in den Teichgarten führte, wo ich mich am liebsten aufhielt. Er war so intim, so abgeschieden. Selbst der Verkehrslärm war gedämpft. Die geschwungene Mauer war fast vollständig hinter einem dichten grünen Blättergobelin verschwunden: Feige und Jasmin, Akebia quinata und Wilder Wein, der sich bald schon kardinalrot färben würde. Eine Flut von Banks-Rosen wogte über die Mauerkrone, überschlug sich ein paarmal und bildete so eine Art Geheimgang. Ständig zwitscherten unsichtbare Vögel, was mir das angenehme Gefühl gab, nicht allein zu sein, mich in Gesellschaft verborgener kleiner Wesen zu befinden.
Dies war der formalste der Gärten. Am einen Ende lag der vierpassförmige Teich, und ihm gegenüber verlief ein Steinweg zwischen zwei langen Beeten, an deren Ende jeweils eine Zypresse stand, die eine hoch und ragend, die andere leicht verkümmert. Beide Beete waren begrenzt mit einer unordentlichen Reihe von fünf ungleichen Buchsbaumquadraten, und am anderen Ende stand eine Robinie, behangen mit zuckerwatteweißen Blüten. Daneben befand sich eine Holztür, die in die Ställe führte. Jenseits der Hecke sah man den alten Taubenschlag, bekrönt mit einer Wetterfahne, deren Form an ein stämmiges Pferd erinnerte.
Innerhalb dieser geordneten Struktur hatten die Pflanzen gewuchert wie wild. Auf den ersten Blick war es ein herrliches Tohuwabohu von Farben: blasslila Geranien, Nachtkerzen von leuchtendem Neapelgelb und die stacheligen mottenblauen Blütenbälle der Kugeldisteln. Staudenwicken kletterten an den Zypressen empor, und es gab ein Trio von am Spalier gezogenen Hibiskusbäumen, rosa, blau und weiß. Doch abgesehen von einem Büschel in diesen Breiten eher seltener Fackellilien, vermutlich der Sorte ›Bees’ Lemon‹, waren die meisten Pflanzen promiske Selbstsäer wie Wald-Scheinmohn und Weißes Leimkraut oder Wucherer wie Zitronenmelisse und Taubnessel, die fast alle Beete im Garten mit einer dichten, gestreiften Matte überzogen hatten, welche alles Wachstum schon im Keim erstickte. Auch am Stallende schien etwas Seltsames passiert zu sein. Der Boden dort war sehr viel niedriger, und zwischen den Pflanzen klafften große Lücken. Monate später fand ich heraus, dass auch hier ein Hochzeitszelt gestanden hatte.
Ursprünglich sollte dieser Raum etwas von der Atmosphäre und dem Charakter der südspanischen Hofgärten atmen. Die ungewöhnliche Vierpassform des Teiches, schreibt Mark Rumary in The Englishman’s Garden, war »dem Vorbild klassischer Mittelmeergärten [nachempfunden] und zweifellos maurischen Ursprungs«.[4] Der Fachbegriff für diese Art von Anlage lautet Paradiesgarten, und er ist viel älter, als Rumary annahm. Paradiesgärten entstanden sechshundert Jahre vor Christi Geburt in Persien (weshalb man sie auch Persische Gärten nennt) und sind nach strengen architektonischen Prinzipien angelegt. Sie müssen umschlossen sein und das Element des Wassers enthalten, zum Beispiel in Form von Becken, Kanälen oder Bächlein, sowie geometrisch angeordnete Bäume wie Granatapfel oder Zypresse.
Diese Gärten stehen in engem Zusammenhang mit Kyros dem Großen, dem Gründer des Persischen Reiches, über den Thomas Browne im Jahr 1658 sein ebenso seltsames wie melancholisches Traktat Der Garten des Cyrus verfasste. Im Lauf der Jahrhunderte verbreiteten sie sich überall in der islamischen Welt und wurden wegen ihrer besonderen Struktur, bestehend aus vier durch Wege oder Wasserläufe getrennten Quadranten, als Tschāhār Bāgh bekannt. Sie sind im Iran, in Ägypten und in Spanien zu finden (Rumary sah sie erstmals in den berühmten maurischen Gärten der Alhambra). Im 16. Jahrhundert wurden sie durch den ersten Mogulkaiser Babur in Nordindien eingeführt, und obwohl seither viele Gärten untergegangen sind oder zerstört wurden, bestehen sie in Form von Mogulminiaturen fort: prächtige Anlagen mit Terrassen und Pavillons, bepflanzt mit charakteristischen Blumen wie Schwertlilien und Lilien, bevölkert von Vögeln, Fischen und fleißigen Gärtnern.
Zuerst dachte ich, dass es die Gärten waren, die mit dem Paradies verglichen werden – einfach himmlisch! –, doch zu meinem Erstaunen verhielt es sich genau andersherum. Unser Wort »Paradies«, mit all seinen zauberhaften Assoziationen, hat seine Wurzeln im Awestischen, einer Sprache, die zweitausend Jahre vor Christus in Persien gesprochen wurde. Es leitet sich ab von dem awestischen Wort pairidaēz, das »ummauerter Garten« bedeutet, pairi für »um etwas herum« und daēz für »bauen«. Wie Thomas Browne in Der Garten des Cyrus erklärt, waren es diese botanikaffinen Menschen, denen »wir sogar das Wort ›Paradies‹ selbst [verdanken], auf das wir in der Heiligen Schrift vor der Zeit Salomons nicht stoßen und das wohl im Persischen seinen Ursprung findet«.[5]
Der griechische Historiker und Heerführer Xenophon begegnete dem Wort, als er im Jahr 401 vor Christus mit griechischen Söldnern in Persien kämpfte. Zum ersten Mal in der griechischen Sprache erschien es in seiner Beschreibung Kyros' des Großen, der auf seinen Reisen überall Lustgärten anlegte: παράδεισος, transliteriert als paradeisos