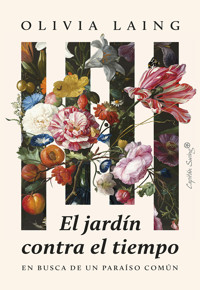12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Laing hat einen Klassiker geschrieben. Eine atemberaubende Hommage an die Kunst und daran, wie Einsamkeit uns empfänglicher macht für die Fremdartigkeit anderer.« Deborah Levy
Mit Mitte dreißig zieht Olivia Laing nach New York City, weil dort der Mann lebt, den sie liebt. Kaum ist sie angekommen, geht die Beziehung in die Brüche, und sie sitzt allein in ihrem kleinen Apartment – so einsam wie noch nie in ihrem Leben. Um sie herum feiern die Leute ausgelassen, hören Jazz und amüsieren sich. Doch bald entdeckt sie, dass sie mit ihrer Einsamkeit nicht allein ist. Vielen Kunstschaffenden vor ihr ist es in New York genauso ergangen. Hätte Edward Hopper sonst sein bekanntestes Bild malen können, die »Nachtschwärmer«? Jene drei Menschen, die allein am Tresen einer Bar hocken? Mitreißend erzählt Olivia Laing die Lebensgeschichten großer Künstler*innen in New York und zugleich von sich und einem Gefühl, das wir alle kennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Olivia Laing
Die einsame Stadt
Vom Abenteuer des Alleinseins
Aus dem Englischen von Thomas Mohr
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Lonely City« bei Canongate Books Ltd., Edinburgh.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 Olivia Laing
Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Susanne Wallbaum
Covergestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf von Peter Adlington unter Verwendung eines Motivs von © Victor Ho
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-24966-3V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
www.instagram.com/btb_verlag
Für alle,die einsam sind
aber untereinander ist einer des andern Glied
Römer 12,5
Inhalt
1 DIEEINSAMESTADT
2 MAUERNAUSGLAS
3 SIEH, MEINHERZERSCHLIESSETSICH
4 INDEMICHIHNLIEBTE
5 DASREICHDESIRREALEN
6 AMANFANGVOMENDEDERWELT
7 BEISPIELMENSCHEN
8 SELTSAMEFRÜCHTE
HIN- UNDNACHWEISE
BIBLIOGRAFIE
DANKSAGUNG
1 DIE EINSAME STADT
Stellen Sie sich vor, Sie stehen abends am Fenster, in der sechsten, siebzehnten oder dreiundvierzigsten Etage eines Hauses. Die Stadt entpuppt sich als eine Anhäufung von Zellen, hunderttausend Fenster, einige verdunkelt, andere geflutet von grünem, weißem oder goldenem Licht. Hinter dem Glas schwimmen Fremde hin und her, gehen Privatbeschäftigungen nach. Sie sind deutlich zu sehen und bleiben dennoch unerreichbar, und so verursacht dieses ganz alltägliche urbane Phänomen, das sich jeden Abend in jeder Stadt der Welt erleben lässt, selbst den geselligsten unter den Menschen einen Schauder der Einsamkeit, jener unguten Mischung aus Vereinzelung und Ausgesetztheit.
Einsam sein kann man überall, doch die Art von Einsamkeit, die dem Leben in der Stadt entspringt, inmitten von Millionen, ist eine Sache für sich. Man sollte meinen, dieser Zustand stehe in eklatantem Widerspruch zum urbanen Leben, zur massenhaften Präsenz anderer Menschen, und dennoch reicht bloße körperliche Nähe nicht aus, um diese Empfindung innerer Isoliertheit zu vertreiben. Es ist durchaus – und problemlos – möglich, sich elend und verlassen zu fühlen, während man mit anderen auf engstem Raum zusammenlebt. Die Großstadt kann einsam sein, und wer das erkannt hat, der weiß, dass Einsamkeit nicht unbedingt physisches Alleinsein erfordert, sondern vielmehr den steten Mangel von Nähe, Verbundenheit, Verwandtschaft: das Unvermögen, aus welchem Grund auch immer, das gewünschte Maß an Intimität zu finden. Bedrückung, wie uns ein Blick ins Wörterbuch verrät, auf Grundder fehlenden Gesellschaft anderer. Kein Wunder, dass sie ihren Gipfel oftmals in einer Menschenmenge erreicht.
Einsamkeit ist schwer einzugestehen, schwer zu kategorisieren. Wie die Depression – ein Zustand, mit dem sie sich in vielen Punkten überschneidet – kann sie tief ins innere Gefüge eines Menschen eindringen und zu einem integralen Bestandteil seiner Persönlichkeit werden, wie unbeschwertes Lachen oder rotes Haar. Ebenso gut jedoch kann sie flüchtiger, vorübergehender Natur sein, infolge äußerer Umstände anschwellen und wieder abebben, wie etwa die Einsamkeit nach einem Sterbefall, einer Trennung oder einer zerbrochenen Freundschaft.
Wie Depression, Melancholie oder Ruhelosigkeit ist auch die Einsamkeit der Pathologisierung unterworfen, wird sie als Krankheit eingestuft. Sie habe weder Sinn noch Zweck, so heißt es immer wieder, und sei, wie es Robert Weiss in seinem Standardwerk zum Thema formuliert, »eine chronische Krankheit ohne jede positive Eigenschaft«. Aussagen wie diese stehen in mehr als weitläufiger Verwandtschaft zu der Überzeugung, dass der Mensch zur Zweisamkeit geboren sei, oder der, dass Glück ein dauerhafter Besitz sein könne respektive müsse. Doch dieses Schicksal ist nicht jedem beschieden. Ich mag mich irren, aber eine Erfahrung, die so tief in unserem kollektiven Leben verankert ist, kann nicht völlig ohne Wert, Bedeutung oder Nutzen sein.
In ihrem Tagebuch des Jahres 1929 schildert Virginia Woolf eine Ahnung von innerer Einsamkeit, von deren Analyse sie sich Aufklärung verspricht, und setzt hinzu: »Wenn ich das Gefühl einfangen könnte, würde ich es tun: Das Gefühl vom Singen der wirklichen Welt, wenn man durch Einsamkeit & Schweigen aus der bewohnbaren Welt hinausgetrieben wird.« Ein interessanter Gedanke, dass die Einsamkeit einem womöglich zu einer Erfahrung von Wirklichkeit verhilft, die ansonsten unerreichbar bliebe.
Es ist noch nicht allzu lange her, da wohnte ich eine Zeit lang in New York, dieser wimmelnden Insel aus Gneis, Beton und Glas, und lebte Tag für Tag in Einsamkeit. Und obwohl diese Erfahrung alles andere als angenehm war, begann ich, mir Gedanken darüber zu machen, ob Woolf nicht vielleicht doch recht hatte und mehr dahintersteckte, als sich auf den ersten Blick erkennen ließ – und ob die Einsamkeit einen nicht tatsächlich dazu bringt, sich mit einigen der größeren Fragen nach dem Sinn des Lebens zu befassen.
Es gab Dinge, die mir keine Ruhe ließen, nicht nur mir als Privatperson, sondern auch mir als Bürgerin unseres Jahrhunderts, unserer pixeligen Zeit. Was bedeutet es, einsam zu sein? Wie leben wir ohne die intime Beziehung zu einem anderen Menschen? Wie nehmen wir mit anderen Kontakt auf, insbesondere wenn uns das Sprechen schwerfällt? Ist Sex ein Mittel gegen Einsamkeit, und wenn ja, was passiert, wenn unser Körper oder unsere Sexualität als abweichend oder beschädigt wahrgenommen wird, wenn wir krank oder nicht mit Schönheit gesegnet sind? Und kann die Technik uns helfen? Bringt sie uns näher zusammen, oder kettet sie uns an Monitore und Displays?
Ich war keineswegs die Erste, die sich über diese Fragen den Kopf zerbrach. Alle möglichen Schriftsteller, Künstler, Filmemacher und Songwriter hatten sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt, hatten versucht, sie in den Griff zu bekommen und die damit verbundenen Probleme anzugehen. Aber da ich gerade meine Liebe zu Bildern entdeckte, die mir Trost boten wie nichts und niemand sonst, konzentrierte ich meine Bemühungen in erster Linie auf das Gebiet der bildenden Kunst. Ich war von dem Verlangen besessen, Korrelate, Übereinstimmungen zu finden, handfeste Beweise dafür, dass andere das Gleiche erlebt hatten wie ich, und während meiner Zeit in Manhattan begann ich mit dem Sammeln von Kunstwerken, die von Einsamkeit gequält wirkten, von ihr zu sprechen schienen, speziell von jener Form der Einsamkeit, die sich in der modernen Großstadt manifestiert oder, genauer, im New York der vergangenen plus/minus siebzig Jahre.
Anfangs waren es die Bilder, die mich anzogen, doch je mehr ich mich in das Thema vertiefte, desto häufiger begegneten mir die Menschen hinter diesen Bildern: Menschen, die sich in ihrem Privatleben wie auch in ihrer Arbeit mit Einsamkeit und den dazugehörigen Fragen auseinandergesetzt hatten. Unter den vielen Dokumentaristen der einsamen Stadt, deren Arbeiten mich berührt oder etwas gelehrt haben und mit denen ich mich auf den folgenden Seiten befassen werde – unter ihnen Alfred Hitchcock, Valerie Solanas, Nan Goldin, Klaus Nomi, Peter Hujar, Billie Holiday, Zoe Leonard und Jean-Michel Basquiat –, weckten vier Künstler mein besonderes Interesse: Edward Hopper, Andy Warhol, Henry Darger und David Wojnarowicz. Sie haben zwar nicht dauerhaft in Einsamkeit gelebt, im Gegenteil, aber mit vielerlei Ansätzen und Herangehensweisen experimentiert. Und sie alle hatten ein extremes Gespür für die Grenzen und Gräben zwischen Menschen, sie alle wussten, wie es ist, sich in der Menge mutterseelenallein zu fühlen.
Am wenigsten scheint das auf Andy Warhol zuzutreffen, der bekanntlich ständig die Nähe anderer suchte. Obwohl er fast immer von einer schillernden Entourage umgeben war, geht es in seinem Werk erstaunlich oft um Vereinsamung und Bindungsangst, Probleme, mit denen er sein Leben lang zu kämpfen hatte. Warhols Kunst erkundet den Raum zwischen Personen, ist eine groß angelegte philosophische Studie über Nähe und Distanz, Intimität und Entfremdung. Wie so viele einsame Menschen war er ein obsessiver Sammler, umgab er sich mit – teils selbst gefertigten – Objekten, einem Schutzwall gegen die Zumutungen menschlicher Nähe. Aus Angst vor Körperkontakt ging er nur selten ohne ein Arsenal von Kameras und Kassettenrekordern aus dem Haus, die ihm im gesellschaftlichen Umgang als Prellbock und Puffer dienten: ein Verhalten, das einiges über den Einsatz von Technik in diesem unseren Zeitalter der sogenannten Konnektivität verrät.
Der Hausmeister und outsider artist Henry Darger lebte das andere Extrem. Er wohnte allein in einer Pension in Chicago, wo er in einem nahezu vollständigen Vakuum, ohne Gesellschaft oder Publikum, ein fiktionales, von ebenso schönen wie schrecklichen Wesen bevölkertes Universum erschuf. Als er sein Zimmer im Alter von achtzig Jahren räumen und in ein Heim der katholischen Mission umziehen musste, wo er wenig später starb, stellte sich heraus, dass es vollgestopft war mit hunderten verstörend bezaubernder Gemälde, Arbeiten, die er offenbar sein Lebtag niemandem gezeigt hatte. Dargers Biografie wirft ein Schlaglicht auf die sozialen Kräfte, welche die Isolation befördern – und darauf, wie die Fantasie sich dem zu widersetzen vermag.
Ebenso wie die Biografien dieser Künstler in Sachen Soziabilität stark variieren, kreiste oder drehte sich ihre Arbeit auf unterschiedlichste Art und Weise um das Thema Einsamkeit, das sie mal frontal angingen und mal über die Auseinandersetzung mit Themen – Sex, Krankheit, Missbrauch –, die ihrerseits zu Stigmatisierung und Isolation führen können. Edward Hopper, dieser hochgewachsene, wortkarge Mann, beschäftigte sich sein Leben lang, auch wenn er es bisweilen leugnete, mit dem visuellen Ausdruck von urbaner Einsamkeit, ihrer Übersetzung in Farbe. Seine Bilder von einsamen Männern und Frauen hinter Glas, in leeren Cafés, Büros und Hotellobbys, sind noch heute, fast hundert Jahre später, die klassischen Darstellungen großstädtischer Isolation.
Man kann zeigen, wie Einsamkeit aussieht, aber man kann ihr auch den Kampf ansagen, mit Arbeiten, die ausdrücklich kommunizieren wollen, sich gegen Zensur und Schweigen zur Wehr setzen. Das war die treibende Motivation von David Wojnarowicz, einem noch viel zu wenig bekannten amerikanischen Künstler, Fotografen, Autor und Aktivisten, dessen mutiges, außergewöhnliches Œuvre mir, mehr als alles andere, das bedrückende Gefühl abschütteln half, dass ich mit meiner Einsamkeit schmählich allein war.
Die Einsamkeit, so wurde mir klar, war ein dicht bevölkerter Ort: eine Stadt für sich. Und wenn man in einer Stadt wohnt, und sei es eine so streng und logisch strukturierte wie Manhattan, verläuft man sich zu Anfang erst einmal. Mit der Zeit entwickelt man so etwas wie einen inneren Stadtplan, eine Topografie bevorzugter Ziele und Strecken: ein Labyrinth, das kein anderer jemals ab- oder nachbilden könnte. Was ich in diesen Jahren entwarf und was nun folgt, war eine Landkarte der Einsamkeit, entstanden aus Not wie aus Interesse, zusammengesetzt aus fremden und persönlichen Erfahrungen. Ich wollte begreifen, was es bedeutet, einsam zu sein, und was es mit dem Leben anderer Menschen anstellt, wollte versuchen, die komplexe Beziehung zwischen Einsamkeit und Kunst zu kartografieren.
Es gibt einen Song von Dennis Wilson, den ich früher viel gehört habe. Er stammt von Pacific Ocean Blue, dem Soloalbum, das er nach der Auflösung der Beach Boys aufnahm. Eine Textzeile daraus mochte ich sehr: Loneliness is a very special place. Einsamkeit ist ein ganz besonderer Ort. Als Teenager saß ich abends oft auf meinem Bett und stellte mir diesen Ort als Stadt vor, bei Einbruch der Dunkelheit, wenn alle heimwärts eilen und das Neon flackernd zum Leben erwacht. Schon damals erkannte ich mich als einen ihrer Bewohner, und es gefiel mir, wie Wilson sie für sich eroberte, mit welch simplen Mitteln er es schaffte, sie fruchtbar und furchteinflößend zugleich klingen zu lassen.
Loneliness is a very special place. Es ist nicht immer leicht, die Wahrheit in Wilsons Worten zu erkennen, doch im Laufe meiner Reisen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass er recht hatte, dass Einsamkeit keineswegs eine gänzlich wertlose Erfahrung ist, sondern vielmehr mitten ins Herz dessen trifft, was uns lieb und teuer ist und was wir dringend brauchen. Die einsame Stadt hat viel Wunderbares hervorgebracht: Dinge, die in der Einsamkeit geschmiedet wurden, aber auch solche, die sie lindern können.
2 MAUERN AUS GLAS
Ich war in New York nicht ein einziges Mal schwimmen. Ich kam und ging, blieb aber nie über den Sommer, und so waren sämtliche Freibäder, die ich so verlockend fand, leer und für die Dauer der langen Nebensaison ohne Wasser. Ich wohnte zumeist auf der Ostseite der Insel, downtown, wo ich in einer Mietskaserne im East Village billig zur Untermiete lebte oder in einem der für Textilarbeiter errichteten Apartmentkomplexe unterkam, in denen man Tag und Nacht den Verkehrslärm von der Williamsburg Bridge hörte. Manchmal machte ich auf dem Heimweg von dem temporären Arbeitsplatz, den ich an jenem Tag ergattert hatte, einen Umweg durch den Hamilton Fish Park, wo es eine Bibliothek und ein in schilferigem Hellblau gestrichenes Zwölfbahnbecken gab. Ich war einsam damals, einsam und ohne rechtes Ziel, und der Anblick dieses spektralblauen Gevierts, in dessen Winkeln sich vom Wind verwehte braune Blätter sammelten, ging mir jedes Mal zu Herzen.
Was ist es für ein Gefühl, einsam zu sein? Es ist ein Gefühl wie Hunger: Man hat Hunger, während sich ringsum alle den Bauch vollschlagen. Es ist ein ebenso beschämender wie beunruhigender Zustand, und mit der Zeit beginnt der Einsame, dies auszustrahlen, wodurch sich seine Isolation, seine Entfremdung noch verstärkt. Das tut weh, wie Gefühle eben wehtun, und es hat auch körperliche Folgen, die sich, für das Auge unsichtbar, in den geschlossenen Abteilen des Körpers vollziehen. Will sagen, es wächst und wuchert, kalt wie Eis und klar wie Glas, bis es schließlich alles umfängt und verschlingt.
Die meiste Zeit wohnte ich zur Untermiete im Apartment einer Freundin in der East 2nd Street, in einem Viertel mit vielen Gemeinschaftsgärten. Es war eine unrenovierte Mietwohnung, arsengrün gestrichen, in der Küche stand hinter einem schimmelnden Vorhang eine Badewanne mit Klauenfüßen. Als ich an meinem ersten Abend in New York übernächtigt und mit schwerem Jetlag zur Tür hereinkam, bemerkte ich einen leichten Gasgeruch, der immer intensiver wurde, je länger ich schlaflos auf dem Hochbett lag. Schließlich wählte ich den Notruf, und ein paar Minuten später stürmten drei Feuerwehrleute die Wohnung, zündeten die Pilotflamme wieder an und bewunderten den Holzfußboden unter ihren klobigen Stiefeln. Über dem Herd hing das gerahmte Plakat einer Theaterproduktion von Martha Clarke aus den Achtzigerjahren, Miracolo d’Amore, auf dem zwei Schauspieler in den weißen Hüten und Kostümen der Commedia dell’Arte abgebildet waren. Einer bewegte sich auf eine erleuchtete Tür zu, und der andere rang entsetzt die Hände.
Miracolo d’amore. Ich war in der Stadt, weil ich mich in ein Liebesabenteuer gestürzt hatte, Hals über Kopf und ein bisschen zu plötzlich, und nun war ich ins Trudeln geraten und befand mich in freiem Fall. In diesem falschen Frühling der Leidenschaft hatten der Mann und ich den hirnrissigen Plan gefasst, dass ich England den Rücken kehren und zu ihm nach New York ziehen sollte. Nachdem er es sich von heute auf morgen anders überlegt und seine zunehmend gewichtigen Bedenken in eine Reihe von Hoteltelefonen ventiliert hatte, trieb ich ziellos dahin, vom Anker geschlagen durch das unverhoffte Auftauchen und das noch unverhofftere Verschwinden all dessen, wonach ich mich zu sehnen glaubte.
Jetzt, da die Liebe dahin war, klammerte ich mich mit aller Macht an die Stadt selbst: an die schier endlose Abfolge von Wahrsagerinnen und Bodegas, das ewige Stop-and-go des Verkehrs, die lebenden Hummer in der Ninth Ecke West 16th, den Dampf, der aus den Kanaldeckeln aufstieg. Ich wollte die Wohnung in England, in der ich seit über zehn Jahren lebte, nicht verlieren, andererseits gab es nichts – weder eine Beziehung noch Arbeit oder familiäre Verpflichtungen –, was mich dort hielt. Ich suchte einen Untermieter und sparte mir die Kosten für ein Flugticket, ohne zu ahnen, dass ich ein Labyrinth betreten hatte, eine ummauerte Stadt im Herzen Manhattans.
Aber schon das ist nicht ganz richtig. Meine erste Wohnung lag überhaupt nicht in Manhattan. Sie lag in Brooklyn Heights, nur ein paar Straßen entfernt von der Gegend, in der ich die alternative Realität erfüllter Liebe gelebt hätte, dieses geisterhafte andere Leben, das mir noch zwei volle Jahre im Kopf herumspukte. Ich kam im September an, und bei der Einreise fragte mich der Beamte ohne jede Spur von Freundlichkeit: Warum zittern Ihre Hände? Der Van Wyck Expressway sah aus wie immer, trostlos und wenig verheißungsvoll, und erst nach mehreren Anläufen gelang es mir, mit dem Schlüssel, den mir mein Freund ein paar Wochen zuvor per FedEx hatte zukommen lassen, die schwere Haustür zu öffnen.
Ich hatte die Wohnung erst ein Mal gesehen. Es war ein Einzimmerapartment mit Kochnische und einem eleganten, ganz in Schwarz gefliesten Männerbadezimmer. Auch hier hing ein ironisches, etwas befremdliches Poster an der Wand, ein altes Werbeplakat für irgendein Erfrischungsgetränk. Eine Frau im knallgelben Zitronenrock, die an einem mit Früchten reich behangenen Baum freudestrahlend ihre Limonadenflasche füllt. Offenbar ein Sinnbild für Sonne in Hülle und Fülle, dabei schaffte es das Licht kaum über die Wohntürme gegenüber, und mir wurde klar, dass ich die falsche Seite des Hauses erwischt hatte. Im Souterrain gab es eine Waschküche, aber ich war noch zu neu in New York, um diesen Luxus angemessen würdigen zu können, und so stieg ich die Treppe nur widerwillig hinab, immer in der Angst, dass die Kellertür zufallen und ich in der tropfenden, nach Waschmittel stinkenden Dunkelheit festsitzen könnte.
Die Tage verliefen alle nach demselben Muster. Ich nahm irgendwo eine Portion Rührei und eine Tasse Kaffee zu mir, wanderte kreuz und quer durch die hübschen, kopfsteingepflasterten Straßen oder hinunter zur Promenade, um mir den East River anzusehen, jeden Tag ein kleines Stück weiter, bis ich zu dem Park in Dumbo kam, wo sich sonntags die puerto-ricanischen Hochzeitspaare fotografieren ließen, die Mädchen in immensen skulpturalen Kleidern in Limettengrün und Fuchsienrot, gegen die alles andere langweilig und bieder wirkte. Jenseits des Wassers Manhattan, die glitzernden Türme. Ich hatte zwar Arbeit, aber längst nicht genug zu tun, und am schlimmsten war es abends, wenn ich in mein Zimmer zurückkehrte, mich auf die Couch setzte und das Leben hinter Glas an mir vorüberziehen sah.
Ich wollte überall sein, nur nicht da, wo ich war. Was nicht zuletzt daran lag, dass ich im Grunde nirgends war. Mein Leben schien leer und irreal, und ich schämte mich seiner Armseligkeit, so wie man sich schämt, wenn man ein fleckiges oder zerschlissenes Kleidungsstück trägt. Ich hatte das Gefühl, dass ich Gefahr lief zu verschwinden, und meine Emotionen waren so schmerzhaft und überwältigend, dass ich mir nicht selten wünschte, mich vollends verlieren zu können, nur für ein paar Monate, bis die Intensität endlich nachließ. Hätte ich das, was ich empfand, in Worte fassen können, es wäre auf das Jammern und Wehklagen eines Kindes hinausgelaufen: Ich will nicht mehr allein sein. Ich will, dass mich jemand will. Ich bin einsam. Ich habe Angst. Ich will geliebt, berührt, in den Arm genommen werden. Das Erschreckendste von allem war diese Gier, dieser Hunger nach Zuwendung: als hätte sich ein nimmersatter Abgrund aufgetan. Ich aß kaum noch etwas, und die Haare gingen mir aus und fielen auf den Dielenboden, was meine innere Unruhe noch verstärkte.
Ich war auch früher schon einsam gewesen, aber nie so wie jetzt. In der Kindheit hatte die Einsamkeit zu- und dann, in den freundbeglückteren Jahren, wieder abgenommen. Seit ich Mitte zwanzig war, hatte ich allein gelebt, zumeist in einer Beziehung, aber nicht immer. Eigentlich fand ich es ganz schön, allein zu sein, und wenn nicht, war ich relativ zuversichtlich, dass sich früher oder später eine neue Liaison, eine neue Liebe ergeben würde. Das Offenbarwerden der Einsamkeit, das allgegenwärtige, unwiderlegliche Gefühl, dass es mir an etwas mangelte, dass ich nicht bekam, was einem Menschen zustand, und dass dies von einem ebenso massiven wie für jeden sichtbaren persönlichen Defizit meinerseits herrührte: All das hatte sich in letzter Zeit beschleunigt, war die unliebsame Konsequenz des Umstands, dass ich so rüde abserviert worden war. Hinzu kam, dass ich auf die Mitte meines vierten Lebensjahrzehnts zusteuerte, ein Alter, in dem weibliches Alleinsein gesellschaftlich nicht länger sanktioniert ist und den penetranten Ruch von Verschrobenheit, Normabweichung und Versagen an sich hat.
Vor dem Fenster schmissen andere Leute Dinnerpartys. Der Mann über mir hörte mit voller Lautstärke Jazz und Musicals, und der Rauch seiner Joints wälzte sich durch die Gänge und erfüllte das Treppenhaus mit seinem Duft. Manchmal sprach ich mit dem Kellner in meinem Frühstückscafé, und einmal übereichte er mir ein Gedicht, fein säuberlich auf dickes weißes Papier getippt. Aber die meiste Zeit sprach ich kein Wort. Die meiste Zeit war ich in mir eingemauert, von meinen Mitmenschen wie abgeschottet. Ich weinte nicht oft, aber als es mir einmal nicht gelang, die Jalousien herunterzulassen, brach ich in Tränen aus. Die Vorstellung, dass womöglich jemand zu mir herübersah und mich dabei ertappte, wie ich im Stehen ein Schälchen Cornflakes aß oder im Widerschein des Laptopbildschirms meine E-Mails checkte, war einfach zu schrecklich.
Ich wusste, wie ich aussah. Ich sah aus wie eine Figur in einem Hopper-Bild. Wie die junge Frau in Automat, zum Beispiel, mit Glockenhut und grünem Kleid, die in eine Tasse Kaffee stiert, im Fenster hinter ihr das Spiegelbild zweier Reihen von Deckenleuchten, die in der Dunkelheit zu schweben scheinen. Oder die in Morning Sun, die auf ihrem Bett sitzt, das Haar zu einem unordentlichen Dutt geknotet, und durch das Fenster auf die Stadt hinausblickt. Ein schöner Morgen, Licht tüncht die Wände, und doch liegt etwas Verzweifeltes in ihrem Blick und in der Linie ihrer Wangen, ihrer schmalen Handgelenke, die sie unterhalb der Knie kreuzt. Auch ich saß oft so da, verloren in meinem zerwühlten Bett, und versuchte, nichts zu empfinden, einfach nur einen Atemzug nach dem anderen zu tun.
Am verstörendsten fand ich Hotel Window. Wenn ich es betrachtete, hatte ich das Gefühl, in den Spiegel einer Wahrsagerin zu blicken, in dem man die Zukunft sieht, ihre verzerrten Konturen, ihren Mangel an Verheißung. Diese Frau ist älter und sitzt, steif und unnahbar, auf einem marineblauen Sofa in einer leeren Suite oder Lobby. Sie trägt Abendgarderobe, einen eleganten rubinroten Hut mit passendem Cape, und dreht sich zur Seite, um auf die dunkle Straße hinabblicken zu können, obwohl dort draußen weiter nichts zu sehen ist als eine hell schimmernde Säule und das beharrlich schwarze Fenster des Gebäudes gegenüber.
Auf die Frage nach dem Ursprung des Gemäldes antwortete Hopper ausweichend: »Es ist überhaupt nichts Bestimmtes, nur eine Stegreifkomposition von Dingen, die ich irgendwo gesehen habe. Es ist keine bestimmte Hotellobby, aber ich bin oft durch die Thirties vom Broadway zur Fifth Avenue gelaufen, und es gibt da eine Menge schäbiger Hotels. Daher stammt wahrscheinlich die Idee. Einsam? Ja, ich denke, es ist einsamer, als ich es ursprünglich geplant hatte.«
Was macht Hopper so besonders? Von Zeit zu Zeit betritt ein Künstler die Bühne, der eine bestimmte Erfahrung wiedergibt, nicht unbedingt bewusst oder gar willentlich, aber mit solcher Einfühlung und Kraft, dass er auf ewig damit assoziiert wird. Hopper hielt wenig von dem Gedanken, dass seine Gemälde sich eindeutig interpretieren ließen oder dass Einsamkeit sozusagen sein Spezialgebiet, sein zentrales Thema sei. »Das mit der Einsamkeit ist übertrieben«, sagte er einmal zu seinem Freund Brian O’Doherty, in einem der wenigen Langinterviews, zu denen er sich je bereit erklärte. Und noch einmal in dem Dokumentarfilm Hopper’s Silence, als O’Doherty fragt: »Reflektieren deine Bilder die Isolation des modernen Lebens?« Hopper hält einen Augenblick inne und sagt dann nur: »Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.« Später antwortete er auf die Frage, was er an den von ihm favorisierten düsteren Szenen so anziehend finde, etwas undurchsichtig: »So bin ich nun mal.«
Warum versehen wir seine Werke dennoch hartnäckig mit dem Etikett »Einsamkeit«? Die Antwort liegt auf der Hand: Die Figuren in seinen Bildern sind zumeist allein oder in gehemmten, unkommunikativen Zweier- und Dreiergruppen dargestellt, in einer Haltung, aus der Kummer und Leid zu sprechen scheinen. Nicht minder interessant ist, wie er die Straßen seiner Stadt anordnet. Wie Carter Foster, der Kurator des Whitney Museum of American Art, in Hopper Drawing anmerkt, bildet Hopper in seinen Gemälden immer wieder »bestimmte Räume und räumliche Erfahrungen ab, die in New York recht häufig sind und daraus entstehen, dass Menschen einander körperlich sehr nahe- und doch nicht zusammenkommen, sondern durch eine Reihe von Faktoren wie Bewegung, Gebäude, Fenster, Mauern und Licht oder Dunkelheit getrennt bleiben«. Diese Perspektive wird oft als voyeuristisch bezeichnet, doch darüber hinaus veranschaulicht Hopper in seinen Straßenszenen eine der zentralen Erfahrungen von Einsamkeit: wie sich der Eindruck, nicht dazuzugehören, eingesperrt oder eingemauert zu sein, mit einem nahezu unerträglichen Gefühl der Ausgesetztheit paart.
Diese Spannung existiert selbst in den heitersten seiner New Yorker Bilder, die von einer angenehmeren, gleichmütigeren Form des Alleinseins zu erzählen scheinen. Morning in a City zeigt eine Frau, die nackt, mit nichts als einem Handtuch in den Händen, am Fenster steht, entspannt und gänzlich unbefangen, ihr Körper eine Landschaft aus wunderschönen lavendelfarbenen, rosa und hellgrünen Pinselflecken. Die Stimmung ist friedlich, und doch rührt sich am linken Rand des Bildes etwas Unheimliches: Man blickt durch das offene Fenster auf das Gebäude gegenüber, das vom flanellweichen Zartrosa des Morgenhimmels beschienen wird. In dem Haus drei weitere Fenster, die grünen Rouleaus halb geschlossen, das dahinterliegende Interieur grobe Rechtecke von tiefem Schwarz. Wenn wir Fenster – engl. windows – als eine Art Augen begreifen, wofür sowohl Wortherkunft – altisländisch vind-auga – als auch Funktion sprechen, dann erzeugt diese Barriere, diese mit Farbe versiegelte Öffnung eine gewisse Unsicherheit: Wird die Frau gesehen, beobachtet gar, oder vielmehr übersehen, sprich ignoriert, nicht wahrgenommen, nicht beachtet, nicht begehrt?
In dem düsteren Night Windows steigert sich diese Ungewissheit zu akutem Unbehagen. Das Gemälde rückt den oberen Teil eines Hauses in den Mittelpunkt; drei Öffnungen, drei Schlitze, geben den Blick in ein erleuchtetes Zimmer frei. Im ersten Fenster bauscht ein Vorhang sich nach außen, im zweiten beugt sich eine Frau im blassrosa Unterrock, der um ihre Hinterbacken spannt, über einen grünen Teppich. Im dritten fällt der Schein einer Lampe durch ein dünnes Stück Stoff, was aussieht wie eine Wand aus Flammen.
Auch die Blickrichtung ist ungewöhnlich. Sie verläuft eindeutig von oben nach unten – wir sehen zwar den Fußboden, nicht aber die Decke –, doch die Fenster befinden sich mindestens im ersten Stock, wodurch der Eindruck entsteht, als hinge der heimliche Beobachter in der Luft. Das spricht dafür, dass er durch die Fenster der »El« auf diese Szene blickt, der New Yorker Hochbahn, mit der Hopper nachts gern fuhr; bewaffnet mit seinen Skizzenblöcken und Conté-Stiften hielt er eifrig Ausschau nach Glanzlichtern, Momenten, die sich, unfertig, in die geistige Netzhaut brennen. So oder so wird der Betrachter – in diesem Falle ich beziehungsweise Sie – zum Komplizen bei einem entfremdenden Akt. Die Privatsphäre wird verletzt, und doch ist die entblößte Frau in ihrem lodernden Zimmer deshalb nicht weniger allein.
So ist das mit Städten: Selbst in seinen eigenen vier Wänden ist man fremden Blicken schutzlos ausgeliefert. Wohin ich auch ging – ob ich zwischen Bett und Couch hin- und herlief oder in die Küche trottete, um die vergessenen Eiscremedosen im Gefrierfach anzustarren –, überall konnte ich gesehen werden, von den Bewohnern des Arlington, eines riesigen Wohnkomplexes im Queen-Anne-Stil, dessen zehnstöckige, mit einem Gerüst versehene Klinkerfassade den Ausblick dominierte. Zugleich konnte ich – à la Das Fenster zum Hof – die Zuschauerin spielen und dutzenden von Menschen zusehen, mit denen ich nie auch nur eine Silbe wechseln würde, konnte beobachten, wie sie ihren kleinen, intimen Alltagsverrichtungen nachgingen, nackt den Geschirrspüler einräumten oder auf High Heels durch die Küche stöckelten und den Kindern das Abendessen machten.
Unter normalen Umständen hätte all das wohl kaum mehr als verhaltene Neugier provoziert, aber dieser Herbst war nicht normal. Schon kurz nach meiner Ankunft spürte ich, dass mich die ständige Sichtbarkeit zunehmend beunruhigte. Einerseits wollte ich gesehen, wahrgenommen und akzeptiert werden wie vom wohlwollenden Blick eines Geliebten. Zugleich jedoch hatte ich das grauenerregende Gefühl, auf dem Präsentierteller zu sitzen, begutachtet zu werden, vor allem in Situationen, in denen mir mein Alleinsein peinlich war oder schlichtweg falsch erschien, in denen ich von Pärchen oder Gruppen umgeben war. Diese Gefühle wurden dadurch, dass ich zum ersten Mal in New York lebte – dieser Stadt aus Glas, der umherstreichenden Blicke –, zwar ohne Frage noch verstärkt, doch entsprangen sie der Einsamkeit, die sich stets in zwei Richtungen bewegt: hin zur Intimität und fort von der Bedrohung.
In jenem Herbst kehrte ich immer wieder zu Hoppers Bildern zurück, fühlte ich mich zu ihnen hingezogen, als seien sie ein Bauplan und ich eine Gefangene; als enthielten sie den alles entscheidenden Hinweis zu meinem Zustand. Ich blickte in dutzende von Zimmern und fand doch immer wieder an denselben Ort zurück: das New Yorker Diner aus Nighthawks, ein Gemälde, das Joyce Carol Oates einmal »unser schmerzlichstes, endlos kopiertes romantisches Bild amerikanischer Einsamkeit« genannt hat.
Es gibt in der westlichen Welt wohl nicht allzu viele Menschen, die noch nie einen Blick auf das kühle Eisschrankgrün dieses Bildes geworfen haben, die noch nie eine schmuddelige Reproduktion im Wartezimmer eines Arztes oder in einem Büroflur haben hängen sehen. Es ist derart verschwenderisch verbreitet, dass es längst schon jene Patina angenommen hat, die allzu vertrauten Gegenständen anhaftet, wie Schmutz auf einem Kameraobjektiv, und doch hat es seine geheimnisvolle Kraft, seine Expressivität bewahrt.
Ich hatte es mir jahrelang auf Laptopdisplays angeschaut, bevor ich es an einem drückend heißen Oktobernachmittag im Whitney das erste Mal in natura sah. Es hing am Ende des Saals, versteckt hinter einer Menschentraube. Die Farben sind fantastisch, sagte ein Mädchen, und dann hatte ich mich auch schon nach vorne durchgedrängelt. Aus der Nähe betrachtet, ordnete sich das Gemälde sozusagen neu, zerfiel es in Schönheitsfehler und Anomalien, die mir zuvor nie aufgefallen waren. Durch das helle Dreieck, das die Decke des Diners bildete, ging ein Riss. Zwischen den beiden Kaffeemaschinen hing ein lang gezogener Tropfen Gelb. Die Farbe war sehr dünn aufgetragen, deckte den Leinengrund an manchen Stellen kaum, sodass die Oberfläche von einer Fülle weißer Nadelpunkte und winziger weißer Fäden durchbrochen war.
Ich trat einen Schritt zurück. Grüne Schatten fielen in spitzen Zacken und Rauten auf den Gehsteig. Es gibt keine Farbe, die das Gefühl großstädtischer Entfremdung, der Auflösung des Menschen hinter den von ihm selbst errichteten Mauern, auf so eindringliche Art und Weise vermittelt wie dieses ungesunde fahle Grün, das mit dem Aufkommen der Elektrizität überhaupt erst entstand und untrennbar verbunden ist mit der nächtlichen Stadt, der Stadt der Glastürme, der leeren, hell erleuchteten Büros und der Neonreklamen.
Eine Museumsführerin mit hochgestecktem dunklem Haar brachte eine Gruppe von Besuchern in den Saal. Sie deutete auf das Gemälde und fragte: Sehen Sie? Es hat gar keine Tür, und sie scharten sich mit leisen Ausrufen des Erstaunens um das Bild. Sie hatte recht. Das Diner war eindeutig ein Zufluchtsort, aber es hatte keinen sichtbaren Eingang, bot keine Möglichkeit, hinein- und wieder hinauszugelangen. Im Bildhintergrund gab es eine cartoonesk anmutende ockerfarbene Tür, die vermutlich in eine schmuddelige Küche führte. Aber von der Straße aus war der Raum versiegelt: ein urbanes Aquarium, eine gläserne Zelle.
Drinnen, in ihrem sattgelben Gefängnis, die vier berühmten Gestalten: ein zwielichtiges Pärchen, ein Tresenjunge in weißer Uniform, das Blondhaar unter eine Mütze geschoben, und ein Mann, der mit dem Rücken zum Fenster sitzt, der Halbmond seiner offenen Jackentasche der dunkelste Punkt auf der gesamten Leinwand. Keiner sprach ein Wort. Keiner sah die anderen an. War das Diner ein Refugium für die Einsamen und Isolierten, ein Ort des Beistands, oder sollte es die Vereinzelung illustrieren, die in der Großstadt förmlich wuchert? Die Genialität des Gemäldes lag in seiner Uneindeutigkeit, in seiner Weigerung, sich festzulegen.
Betrachten wir den Tresenjungen mit seiner vielleicht freundlichen, vielleicht aber auch kalten Miene. Er steht inmitten einer Reihe von Dreiecken und erteilt das nächtliche Sakrament des Kaffees. Aber ist er nicht auch ein Gefangener? Eine der Ecken wird vom Bildrand abgeschnitten, aber der Winkel ist zu spitz, er lässt keinen Platz für eine Klappe oder einen Durchgang. Das ist ein Beispiel für die Art von subtiler geometrischer Verwirrung, die Hopper so virtuos beherrschte und die er einsetzte, um beim Betrachter Empfindungen zu wecken, Beklemmung, das Gefühl des Eingeschlossenseins, tiefes Unbehagen.
Was noch? Schwitzend in meinen Sandalen, lehnte ich mich gegen die Wand und erstellte im Stillen eine Liste all dessen, was auf dem Bild zu sehen war. Drei weiße Kaffeetassen, zwei leere Gläser mit blauem Rand, zwei Serviettenspender, drei Salzstreuer, ein Pfefferstreuer, vielleicht Zucker, vielleicht Ketchup. An der Decke grelles gelbes Licht. Fahlgrüne Kacheln (leuchtender Streifen Jadegrün, wie Hoppers Frau Jo in das Notizbuch schrieb, in dem sie seine Bilder katalogisierte), überall sanft fallende dreieckige Schatten von der Farbe eines Dollarscheins. Auf dem Dach des Diners eine Reklametafel für Phillies American Cigars, Only 5cs, illustriert mit einer grob gezeichneten Zigarre. Im Fenster des Ladens gegenüber eine grüne Registrierkasse, obwohl dort keine Ware ausliegt. Grün auf Grün, Glas auf Glas, eine Stimmung, die immer weitere Kreise zog, je länger ich dort stand, und mich zunehmend unruhig werden ließ.
Am sonderbarsten war das Fenster: eine Glasblase, die das Diner von der Straße trennte und sich rundete wie ein Parabelbogen. Dieses Fenster ist einmalig in Hoppers Werk. Obgleich er im Laufe seines Lebens hunderte, wenn nicht tausende von Fenstern malte, sind alle anderen schlicht Öffnungen, Löcher, durch die das Auge blickt. Manche fangen Spiegelungen ein, doch nur hier malt er das Glas selbst in seiner ganzen ambivalenten Materialität. Massiv und transparent, stofflich und ephemer zugleich, fügt es zusammen, was Hopper anderswo nur teilweise gelingt: Es verschmilzt die Zwillingsmechanismen Eingeschlossensein und Ausgesetztheit in einem niederschmetternden Symbol. Es war unmöglich, einen Blick ins Innere des Diners zu werfen, ohne einen Anflug von Einsamkeit zu verspüren, eine Ahnung davon, wie es ist, ausgeschlossen zu sein, allein in der sich abkühlenden Nachtluft zu stehen.
*
Das Wörterbuch, dieser scharfe, kalte Richter, definiert das Wort einsam als ein durch Isolation hervorgerufenes negatives Gefühl, dessen emotionale Komponente es von einzeln, allein oder solo unterscheidet. Bedrückt mangels Gesellschaft oder Anwesenheit anderer Personen; traurig angesichts der Vorstellung, allein zu sein; unter dem Gefühl des Alleinseins leidend. Doch Einsamkeit geht nicht zwangsläufig mit einem externen oder objektiven Mangel an Gesellschaft einher, den Psychologen als soziale Isolation oder soziale Deprivation bezeichnen. Längst nicht alle Menschen, die ohne die Gesellschaft anderer leben, sind auch einsam, andererseits ist es durchaus möglich, in einer Beziehung oder unter Freunden akute Einsamkeit zu empfinden. Wie schon Epiktet vor fast zweitausend Jahren schrieb: »Mancher ist allein und doch nicht gleich einsam. Mancher hingegen ist selbst unter vielen einsam.«
Die Empfindung entsteht aus einem gefühlten Mangel oder Fehlen von Nähe und kennt vielerlei Ausprägungen, von leisem Unbehagen bis zu chronischen, unerträglichen Schmerzen. Im Jahre 1953 formulierte der Psychiater und Psychoanalytiker Harry Stack Sullivan eine bis heute gültige Arbeitsdefinition: »ein Gefühl, das eine eminent unangenehme Erfahrung darstellt und mit unangemessener Entladung des Intimitätsbedürfnisses einhergeht«.
Sullivan befasste sich in seiner Arbeit nur am Rande mit dem Thema Einsamkeit, weshalb als die eigentliche Pionierin auf dem Gebiet der Einsamkeitsforschung die deutsche Psychiaterin Frieda Fromm-Reichmann gelten muss. Fromm-Reichmann verbrachte den größten Teil ihres Berufslebens in den USA und ist als die Therapeutin Dr. Fried in Joanne Greenbergs halb autobiografischem Roman Ich hab dir nie einen Rosengarten versprochen über deren jugendlichen Kampf mit der Schizophrenie in die Populärkultur eingegangen. Als sie 1957 in Maryland starb, fand man auf ihrem Schreibtisch einen Stapel unfertiger Notizen, die später, redaktionell bearbeitet, unter dem Titel »Über die Einsamkeit« erschienen. Dieser Aufsatz ist einer der ersten Versuche eines Psychiaters beziehungsweise Psychologen, Einsamkeit als eigenständige Erfahrung zu betrachten, unterschieden von und womöglich weitaus schädlicher als Depression, Angst oder Verlust.
Für Fromm-Reichmann war Einsamkeit ein im wahrsten Wortsinn unfassbares Phänomen, schwer zu beschreiben, schwer einzuordnen, schwer zu thematisieren, und so bemerkt sie trocken:
Wenn man über das Problem der Einsamkeit schreiben möchte, begegnet man zuerst einem ernsten terminologischen Hindernis. Einsamkeit scheint eine so schmerzliche, erschreckende Erfahrung zu sein, dass der Mensch praktisch alles tut, um sie zu vermeiden. Dies scheint einen merkwürdigen Unwillen vonseiten der Psychiater einzuschließen, eine wissenschaftliche Klärung dieses Themas zu versuchen.
Sie sichtet das wenige Material, das sie finden kann, zitiert Passagen von Sigmund Freud und Anna Freud und Rollo May. In ihren Augen werden darin verschiedene Typen von Einsamkeit durcheinandergeworfen, werden temporäre oder umstandsbedingte – etwa nach einem Trauerfall oder mangels Zärtlichkeit im Kindesalter – mit den tiefer gehenden und therapieresistenteren Formen emotionaler Isolation vermischt.
Zu letzteren, tief unglücklich machenden Zuständen notiert sie: »In ihrer Quintessenz ist diese Einsamkeit ihrer Natur nach anderen nicht mitteilbar. Auch kann sie wie andere nicht-mitteilbare emotionale Erfahrungen nicht auf dem Wege der Empathie geteilt werden. Es ist durchaus möglich, dass die Emanation der angsterregenden Eigenschaft der Einsamkeit an sich schon die empathischen Fähigkeiten des anderen lähmt.«
Bei der Lektüre dieser Zeilen musste ich daran denken, wie ich als Teenager vor einem Bahnhof im Süden Englands gesessen und auf meinen Vater gewartet hatte. Es war ein sonniger Tag, und ich las ein spannendes Buch. Nach einer Weile setzte sich ein älterer Mann zu mir und versuchte mehrmals, ein Gespräch zu beginnen. Ich hatte keine Lust, mich mit ihm zu unterhalten, und nach einem kurzen Austausch von Höflichkeiten wurden meine Antworten immer knapper, bis er schließlich, nach wie vor lächelnd, aufstand und davonging. Ich schäme mich meiner Herzlosigkeit noch heute und habe nicht vergessen, was ich spürte, als mich das Kraftfeld seiner Einsamkeit bedrängte: ein überwältigendes Bedürfnis nach Zuwendung, das unstillbare Verlangen, gehört, berührt, gesehen zu werden.
Es ist schwer, mit Leuten in diesem Zustand umzugehen. Noch schwerer ist es für sie, sich ihrer Umwelt zu öffnen. Einsamkeit ist eine ungemein beschämende Erfahrung. Sie steht dem Leben, das wir zu führen haben, so diametral entgegen, dass sie zunehmend als unstatthaft erachtet wird, um nicht zu sagen als Tabu. In ihrem Aufsatz kommt Fromm-Reichmann wiederholt auf dieses Problem der Unmitteilbarkeit zu sprechen und merkt an, dass selbst ihre einsamsten Patienten »große Schwierigkeit« haben, dies »dem Therapeuten in Worten einzugestehen«. In einer ihrer Fallstudien geht es um eine schizophrene Frau, die um einen Termin bei ihrem Therapeuten bat, um ihm »von ihrem tiefen, hoffnungslosen Zustand zu erzählen«. Nach mehreren erfolglosen Versuchen bricht es schließlich aus ihr heraus: »Ich weiß nicht, warum die Leute sich die Hölle als einen Ort vorstellen, wo es heiß ist und wo Feuer lodern. Das ist nicht die Hölle. Die Hölle bedeutet, dass man in seiner Isolation zu einem Eisblock gefroren ist. Und genau so habe ich sie erlebt.«
Als ich den Aufsatz das erste Mal las, saß ich bei halb geschlossenen Jalousien auf meinem Bett. Ich unterkringelte die Worte zu einem Eisblock mit Kuli. Ich hatte nicht selten das Gefühl, in Eis oder Glas gegossen zu sein, klare Sicht nach draußen zu haben, ohne mich jedoch befreien oder den Kontakt herstellen zu können, nach dem ich mich verzehrte. Von oben wieder Musicals, auf Facebook surfen, eingeschlossen zwischen weißen Wänden. Kein Wunder, dass ich so sehr auf Nighthawks fixiert war, diese Blase aus grünlichem Glas von der Farbe eines Eisbergs.
Nach Fromm-Reichmanns Tod widmeten sich allmählich auch andere Psychologen diesem Thema. 1975 publizierte der Sozialwissenschaftler Robert Weiss die grundlegende Studie Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation (»Einsamkeit: Die Erfahrung emotionaler und sozialer Isolation«). Auch er schreibt gleich zu Anfang, dass das Thema bislang sträflich vernachlässigt worden sei, und setzt süffisant hinzu, die Zahl der Popmusiker, die sich mit der Einsamkeit beschäftigt hätten, übersteige die der Gesellschaftswissenschaftler offenbar bei Weitem. Er vertrat die Ansicht, Einsamkeit sei nicht nur an und für sich zermürbend – er beschreibt sie als etwas, das von einer Person »Besitz ergreift« und »äußerst hartnäckig« ist; »eine geradezu unheimliche Gemütserkrankung« –, sondern hemme obendrein die Empathie, weil sie eine Art selbstschützender Amnesie hervorrufe und die Betroffenen auch nach Überwindung ihrer Einsamkeit ständig versuchten, sich an diesen Zustand zu erinnern.
Menschen, die einmal einsam waren, haben danach keinen Zugang mehr zu dem Ich, das diese Einsamkeit erfahren hat, und sind in aller Regel daran interessiert, dass dies auch so bleibt. Infolgedessen reagieren sie mit Unverständnis, wo nicht Verärgerung, wenn sie auf jemanden treffen, der einsam ist.
Selbst Psychiater und Psychologen, so glaubte Weiss, seien gegen diese fast schon phobische Abneigung keineswegs immun; auch sie liefen Gefahr, sich »durch die Einsamkeit, die in jedermanns Alltagsleben lauert«, verunsichern zu lassen. Damit schreiben sie dem Opfer alle Schuld zu: Sie halten die Zurückweisung einsamer Menschen für gerechtfertigt oder unterstellen ihnen, den Zustand selbst herbeigeführt zu haben, weil sie zu schüchtern oder zu unattraktiv sind, sich in Selbstmitleid suhlen oder zu viel Nabelschau betreiben. »Warum können sich einsame Menschen nicht einfach ändern?«, lautet seiner Meinung nach die Frage, die sich sowohl Fachleute als auch Laien stellen. »Sie scheinen in der Einsamkeit eine perverse Befriedigung zu finden; vielleicht ermöglicht die Einsamkeit es ihnen, trotz der damit verbundenen Schmerzen, ihre selbstschützende Isolation aufrechtzuerhalten, oder sie verschafft ihnen ein emotionales Handicap, das den Menschen, mit denen sie interagieren, Almosen des Mitleids abpresst.«
Dabei zeichnet sich Einsamkeit, wie Weiss im Folgenden anschaulich darlegt, vor allem durch das heftige Verlangen aus, diese Erfahrung zu beenden, was sich nicht etwa durch bloße Willenskraft oder häufigeres Ausgehen, sondern nur durch den Aufbau von Vertrauensverhältnissen erreichen lässt. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan, insbesondere für Menschen, deren Einsamkeit die Folge von Verlust, Verbannung oder Vorurteilen ist und die allen Grund haben, der Gesellschaft anderer mit Angst oder Argwohn zu begegnen, obwohl sie sich zugleich nach ihr sehnen.
Weiss und Fromm-Reichmann wussten zwar, dass Einsamkeit schmerzhaft und entfremdend ist, aber sie wussten nicht, wie ihre Begleiterscheinungen entstehen. Die moderne Forschung beschäftigt sich genau mit dieser Frage: Sie versucht zu begreifen, was Einsamkeit mit dem menschlichen Körper anstellt, und konnte im Zuge dessen klären, warum sie so schwer abzuschütteln ist. Aus den Untersuchungen, die John Cacioppo und seine Mitarbeiter in den vergangenen zehn Jahren an der University of Chicago durchgeführt haben, geht hervor, dass Einsamkeit tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit eines Menschen hat, soziale Interaktionen zu deuten und zu verstehen, was wiederum eine fatale Kettenreaktion in Gang setzt, in deren Folge der Betroffene sich von seinen Mitmenschen noch weiter entfremdet.
Wenn Menschen vereinsamen, entwickeln sie eine »erhöhte Wachsamkeit gegenüber sozialer Bedrohung«, wie Psychologen das nennen, ein Phänomen, das Weiss in den Siebzigerjahren erstmals postulierte. In diesem unbewusst erlangten Zustand neigt der Betroffene dazu, die Welt in zunehmendem Maße negativ wahrzunehmen, Unhöflichkeit, Ablehnung und Aggression nachgerade zu erwarten und solchen Erfahrungen, auch und vor allem in der Erinnerung, mehr Gewicht und Bedeutung beizumessen als anderen, freundlicheren oder wohlwollenderen Interaktionen. Das führt zwangsläufig in einen Teufelskreis, in dem der Einsame sich immer weiter abkapselt, sein Misstrauen immer stärker kultiviert. Und da diese erhöhte Wachsamkeit nicht bewusst wahrgenommen wird, ist es alles andere als einfach, die Schieflage zu erkennen, geschweige denn zu korrigieren.
Mit anderen Worten, je mehr ein Mensch vereinsamt, desto schwerer fällt es ihm, die sozialen Stromschnellen zu durchschiffen. Die Einsamkeit umwuchert ihn, wie Schimmel oder Pelz, bildet eine Art Schutzschicht, die jeden Kontakt unmöglich macht, auch wenn er sich noch so sehr nach Kontakt sehnt. Einsamkeit wächst aus sich selbst, erhält und erneuert sich in einem fort. Und hat sie sich erst einmal festgesetzt, wird man sie nur sehr schwer wieder los. Deshalb reagierte ich plötzlich so hellhörig auf Kritik, fühlte ich mich schutzlos und ausgeliefert, zog ich den Kopf ein, wenn ich in meinen Flip-Flops anonym durch die Straßen schlappte.
Gleichzeitig bewirkt dieser ständige Alarmzustand des Körpers eine Reihe physischer Veränderungen, ausgelöst durch die steigenden Pegel von Adrenalin und Cortisol. Das sind die Kampf-oder-Flucht-Hormone, die dem Organismus helfen, auf äußere Stressfaktoren zu reagieren. Doch wenn der Stress chronisch ist und nicht akut, wenn er über Jahre andauert und man vor seiner Ursache nicht einfach weglaufen kann, dann wirken sich diese biochemischen Anpassungen auf den Körper geradezu verheerend aus. Einsame Menschen schlafen unruhig, wodurch die regenerative Wirkung des Schlafes abnimmt. Einsamkeit führt zu Bluthochdruck, beschleunigt den Alterungsprozess, schwächt das Immunsystem und fördert den Abbau kognitiver Fähigkeiten. Laut einer Studie aus dem Jahr 2010 erhöht Einsamkeit auch das Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko, was nichts anderes ist als eine elegante Umschreibung des Umstands, dass Einsamkeit tödlich enden kann.
Anfangs dachte ich, dieses erhöhte Sterblichkeitsrisiko rühre von den praktischen Folgen der Isoliertheit her: der mangelnden Pflege, dem potenziell verminderten Vermögen, regelmäßig zu essen und sich angemessen zu ernähren. Inzwischen jedoch gilt es als erwiesen, dass es die subjektive Erfahrung der Einsamkeit ist, die diese physischen Konsequenzen zeitigt und nicht die schlichte Tatsache des Alleinseins. Es ist das Gefühl selbst, das den Stress verursacht; das Gefühl, das die ganze grausame Lawine in Bewegung setzt.
*
Hopper kann von alldem nichts gewusst haben, außer natürlich aus eigener Erfahrung, und doch zeigt er uns mit jedem neuen Bild nicht nur, wie Einsamkeit aussieht, sondern auch, welches Gefühl mit ihr verbunden ist; mit seinen kahlen Wänden und offenen Fenstern vermittelt er ein Simulacrum ihrer paranoiden Architektur, in der man sich eingeschlossen und ausgesetzt zugleich fühlt.
Es wäre naiv anzunehmen, dass ein Künstler mit seinem Thema persönlich vertraut ist, dass Kunstschaffende mehr sind als bloße Zeugen ihrer Zeit, der vorherrschenden Themen und Stimmungen ihrer Epoche. Trotzdem, je länger ich Nighthawks betrachtete, desto größer wurde meine Neugier auf den Menschen Hopper, nicht zuletzt weil er einmal gesagt hatte: »Der Mensch ist das Werk. Etwas entsteht nicht aus dem Nichts.« Die Perspektive, die das Bild dem Betrachter auferlegt, ist so spezifisch, so entfremdend. Woher kam sie? Wie waren Hoppers persönliche Erfahrungen mit Städten, mit Intimität, mit Sehnsucht beschaffen? War er einsam? Wer muss man sein, um die Welt so zu sehen?
Zwar hat er Interviews verabscheut und deshalb in Wort und Schrift nur wenig über sein Leben hinterlassen, doch wurde Hopper oft fotografiert, und so lässt sich seine Entwicklung über die Dekaden verfolgen: vom schlaksigen jungen Mann mit Strohhut in den Zwanzigerjahren bis zum prominenten Künstler in den Fünfzigern. Was uns in diesen meist in Schwarz-Weiß aufgenommenen Bildern begegnet, ist ein ungeheuer verschlossener, tief in sich selbst zurückgezogener Mensch, wenig kontaktfreudig, entschieden reserviert. Immer steht oder sitzt er ein wenig ungelenk, leicht gebeugt, wie viele hochgewachsene Männer, die langen Glieder unbequem geordnet, im dunklen Anzug mit Krawatte oder Dreiteiler aus Tweed, auf dem länglichen Gesicht ein mal mürrischer, mal zurückhaltender Ausdruck und hier und da sogar ein leises Funkeln der Belustigung, der entwaffnenden Selbstironie, die bisweilen jäh aufflackert. Ein zugeknöpfter Zeitgenosse, könnte man meinen, der mit der Welt notorisch über Kreuz lag.
Alle Fotografien sind stumm, aber manche sind noch stummer als andere, und diese Porträts belegen Hoppers nach übereinstimmenden Berichten hervorstechendste Charaktereigenschaft: seine enorme Abneigung gegen das Sprechen. Das ist etwas anderes als Schweigen oder Einsilbigkeit; es ist energischer, aggressiver. In den Interviews fungiert sie als Barriere, macht es dem Interviewer unmöglich, ihn zum Reden zu bringen oder ihm Worte in den Mund zu legen. Wenn er doch einmal spricht, dann oft nur, um der Frage auszuweichen. »Das weiß ich nicht mehr«, sagt er häufig, oder: »Keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe.« Er greift regelmäßig zu dem Wort unbewusst und weist damit jegliche Bedeutung, die der Interviewer in seinen Bildern zu erkennen glaubt, brüsk zurück.
Kurz vor seinem Tod im Jahre 1967 gab er dem Brooklyn Museum ein ungewöhnlich langes Interview. Er war damals vierundachtzig: der bedeutendste noch lebende realistische Maler der USA. Wie immer war auch seine Frau zugegen. Jo war eine begnadete Dazwischenrednerin, die jede Lücke füllte und in jede Bresche sprang. Das Gespräch (das zwar aufgezeichnet und transkribiert, aber nie vollständig veröffentlicht wurde) ist erhellend, nicht nur seines Inhalts wegen, sondern auch weil es die komplexe Dynamik der an intimen Konflikten nicht eben armen Ehe der Hoppers beleuchtet.
Die Interviewerin fragt Edward, nach welchen Kriterien er seine Sujets auswähle. Wie üblich scheint ihm die Frage unangenehm zu sein. Er sagt, das sei ein komplizierter Vorgang, schwierig zu erklären, aber er müsse sich schon sehr stark für sein Sujet interessieren, weshalb er nur ein oder zwei Arbeiten jährlich fertigstelle. Da meldet Jo sich zu Wort. »Das ist jetzt sehr biografisch«, sagt sie, »aber als er zwölf war, ist er stark gewachsen, da war er eins achtzig groß.« – »Nicht mit zwölf. Nicht mit zwölf«, sagt Hopper. »Aber das hat deine Mutter immer gesagt. Du selbst hast es auch gesagt. Und jetzt behauptest du was anderes. Nur damit du mir widersprechen kannst … Man könnte meinen, wir wären erbitterte Feinde.« Die Interviewerin macht ein verneinendes Geräusch, Jo hingegen plappert unverdrossen weiter und schildert ihren Mann als Schüler, dürr wie ein Grashalm, ein kraftloser Knabe, der mit den bösen Kindern, den Schulhofrowdys, keinen Ärger will.
Und dadurch wurde er ziemlich, na, wer würde da nicht menschenscheu … In der Schule musste er immer der Erste in der Reihe sein, als der Größte, und das hasste er wie die Pest, diese gemeinen kleinen Jungs, die hinter ihm liefen und ständig versuchten, ihn in die falsche Richtung zu stoßen.
»Menschenscheu ist erblich«, sagt Hopper, und sie erwidert: »Also, ich glaube, die Umwelt ist genauso wichtig … Aber ein großer Redner war er ja noch …« Da fällt er ihr ins Wort und sagt: »Ich spreche durch meine Bilder.« Und noch einmal, etwas später: »Meines Erachtens habe ich noch nie versucht, die amerikanische Szenerie zu malen. Ich versuche, mich selbst zu malen.«
Er hatte immer schon gut zeichnen können, seit seiner Kindheit in Nyack, New York, im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert, als einziger Sohn kultivierter, aber nicht besonders gut harmonierender Eltern. Eine wunderschöne, natürliche Linienführung, gepaart mit einer gewissen Bissigkeit, die vor allem in den hässlichen Karikaturen zum Ausdruck kam, die er sein Leben lang zeichnete. In diesen oft erstaunlich unschönen Zeichnungen, die nie ausgestellt wurden, aber in Gail Levins Biografie abgebildet sind, präsentiert Hopper sich als skelettartige Figur, nichts als lange Knochen und ein schiefes Grinsen, oft unter der Fuchtel von Frauen oder sich stumm nach etwas sehnend, das sie ihm partout nicht geben wollen.
Mit achtzehn ging er auf die Kunstakademie in New York, wo er von Robert Henri unterrichtet wurde, einem der führenden Vertreter des harten urbanen Realismus, der sogenannten Ashcan School. Hopper war ein hervorragender und vielgelobter Student, und so ist es kaum verwunderlich, dass er sich noch jahrelang an der Akademie herumtrieb und wenig Lust verspürte, ein eigenständiges Erwachsenenleben zu beginnen. 1906 finanzierten die Eltern ihm eine Reise nach Paris, wo er völlig zurückgezogen lebte und nicht einen einzigen der Künstler kennenlernte, die sich damals in der Stadt aufhielten, eine Gleichgültigkeit gegenüber herrschenden Strömungen oder Moden, die ihm ein Leben lang erhalten blieb. »Von Gertrude Stein hatte ich gehört«, erinnerte er sich später, »aber ich kann mich nicht entsinnen, auch von Picasso gehört zu haben.« Stattdessen wanderte er den ganzen Tag durch die Straßen oder setzte sich ans Ufer des Flusses, wo er malte, Prostituierte und Passanten skizzierte und eine Taxonomie von Frisuren, Frauenbeinen und adretten Federhüten anlegte.
In Paris lernte er – nach den düsteren Braun- und Schwarztönen, die er in seinem Studium in New York favorisiert hatte –, seine Gemälde zu öffnen, getreu dem Vorbild der Impressionisten Licht hereinzulassen. Auch lernte er, mit der Perspektive zu spielen und in seinen Szenen kleine Unmöglichkeiten unterzubringen: eine Brücke, die ragte, wohin sie gar nicht ragen konnte, eine Sonne, die aus zwei Richtungen gleichzeitig schien. Gestreckte Körper, geschrumpfte Gebäude, unendlich kleine Brüche im Gefüge der Realität. So verstört man den Betrachter, indem man etwas in Un-Ordnung bringt, es in kleine weiße, graue oder schmutzig gelbe Pinselstöße übersetzt.
Nachdem er ein paar Jahre lang zwischen Europa und den USA gependelt war, ließ er sich 1910 endgültig in Manhattan nieder. »Es kam mir alles schrecklich roh und ungehobelt vor, als ich zurückkam«, erinnerte er sich Jahrzehnte später. »Es dauerte zehn Jahre, bis ich Europa hinter mir gelassen hatte.« New York traf ihn wie ein Schock, das rasende Tempo, die gnadenlose Jagd nach dem almighty dollar. Und Geld wurde in der Tat recht schnell zum Problem. Lange Zeit interessierte sich buchstäblich niemand für seine Bilder, und er musste sich als Illustrator durchschlagen; er hasste die geistlosen Brotaufträge, den entwürdigenden Zwang, ein Portfolio durch die ganze Stadt zu schleppen, als unwilliger Verkäufer von Arbeiten, denen er selbst keinerlei Wert beimaß.
Auch an Beziehungen waren sie nicht eben reich, diese ersten Jahre in Amerika. Keine Freundin, allenfalls ein paar kurzlebige Affären hier und da. Keine intimen Freundschaften und nur sporadischer Kontakt zu seiner Familie. Kollegen und Bekannte, ja, aber ein Leben, in dem es auffallend wenig Liebe gab, dafür ein umso größeres Maß an Unabhängigkeit und jener vergessenen Errungenschaft, die man Privatheit nennt.