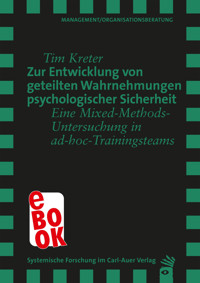
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Warum kommt es immer wieder vor, dass Teammitglieder schweigen, wenn sie Fehler sehen oder mit ihrer Meinung Entscheidungen verbessern könnten? Höchstwahrscheinlich, weil im Team die psychologische Sicherheit niedrig ist oder keine geteilte Wahrnehmung über die psychologische Sicherheit vorherrscht. Es ist keine Seltenheit, dass Softwareentwickelnde eine kritische Sicherheitslücke zwar erkennen, aber nichts sagen, weil der Softwareentwicklungsprozess schon weit fortgeschritten und der Ergebnisdruck hoch ist. Oder Projektmitarbeitende vermuten, dass die gemachten Pläne nicht funktionieren werden, aber schweigen, um die Stimmung im Team nicht negativ zu beeinflussen. Oder eine pflegende Person bemerkt einen Behandlungsfehler, traut sich aber nicht, diesen im Team anzusprechen, aus Angst vor persönlichen (z. B. Abwertung oder Ablehnung) oder professionellen (z. B. Abmahnung oder ausbleibende Beförderung) Konsequenzen. Solche Situationen kennen wir alle – und sie können dramatische Folgen haben. Doch während Führungskräfte und Beratende längst wissen, wie wichtig psychologische Sicherheit ist, stehen viele noch vor dem Rätsel: Wie schafft man es, dass alle Teammitglieder ihre Wahrnehmungen, Unsicherheiten, Bedenken, Fehler etc. miteinander teilen und besprechen? Zwar erklärt die bisherige Ratgeber- und Forschungsliteratur, warum psychologische Sicherheit wichtig ist und welche Auswirkungen sie hat, aber es gibt kaum empirisch fundierte Antworten darauf, wie sie sich entwickelt. Dieses Buch adressiert diese Lücke und liefert empirisch fundierte Antworten darauf, welche Faktoren dafür sorgen, dass Teams eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit entwickeln. Der Autor: Tim Kreter, Dr., arbeitet als Spezialist für Organisationsentwicklung beim Bundeskriminalamt. Er promovierte an der Universität Witten/Herdecke und hat darüber hinaus zu den Themen ad-hoc-Teams, online Teamdynamik und Change-Management geforscht sowie veröffentlicht. Seit 2019 bietet er als Trainer für Gruppendynamik freiberuflich Seminare und Trainings an und ist als Gutachter bei wissenschaftlichen Fachzeitschriften tätig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Verlag für Systemische Forschung im Carl-Auer Verlag
Tim Kreter
Zur Entwicklung vongeteilten Wahrnehmungenpsychologischer Sicherheit
Eine Mixed-Methods-Untersuchung in ad-hoc-Trainingsteams
2025
Carl-Auer im Internet: www.carl-auer.de
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Carl-Auer Verlag
Vangerowstr. 14
69115 Heidelberg
Über alle Rechte der deutschen Ausgabe verfügt der Verlag für Systemische Forschung im Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg
Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlages
Reihengestaltung nach Entwürfen von Uwe Göbel
Printed in Germany 2025
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-9094-3 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-9095-0 (ePub)
DOI 10.55301/9783849790943
© 2025 Carl-Auer-Systeme, Heidelberg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Diese Publikation beruht auf der gleichnamigen Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Staats- und Wirtschaftswissenschaften (Dr. rer. pol.) an der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft der Universität Witten/Herdecke, 2025.
Die Verantwortung für Inhalt und Orthografie liegt beim Autor.
Inhalt
Geleitwort
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Psychologische Sicherheit
2.1.1 Psychologische Sicherheit als geteilte Wahrnehmung: Eine kurze Begriffsgeschichte
2.1.2 Psychologische Sicherheit als emergentes Phänomen
2.1.3 Psychologische Sicherheit als Klima
2.1.4 Einflussfaktoren auf psychologische Sicherheit
2.2 Zur Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams: Ein systematischer Literaturüberblick
2.2.1 Methode
2.2.2 Ergebnisse
2.2.3 Limitationen
2.3 Zwischenfazit: Geteilte Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams
3 Empirische Untersuchung
3.1 Methode
3.1.1 Methodologische Grundlagen und Forschungsansatz
3.1.2 Gruppendynamische Trainingsgruppen als ad-hoc-Teams
3.1.3 Stichprobe
3.1.4 Forschungsdesign und Datenquellen
3.1.5 Datenanalyse
3.2 Ergebnisse
3.2.1 Qualitative Ergebnisse
3.2.2 Quantitative Ergebnisse
3.2.3 Zusammenführung der Ergebnisse in ein Prozessmodell: Zur Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit in ad-hoc-Teams
4 Diskussion
4.1 Theoretische Implikationen
4.1.1 Beschreibung und Erklärung der Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit
4.1.2 Psychologische Sicherheit als empirische Erklärung für Lernerfolg in gruppendynamischen Trainingsgruppen
4.2 Praktische Implikationen: Über den Umgang mit Ärger in ad-hoc-Teams
4.3 Limitationen
4.4 Zukünftige Forschung
5 Fazit
6 Anhang
6.1 Fragebögen: Psychologische Sicherheit
6.2 Explorative und konfirmatorische Faktorenanalyse
Literaturverzeichnis
Geleitwort
Offene Kommunikation mit Kolleg:innen und Vorgesetzten, insbesondere im Umgang mit Problemen und Fehlschlägen, ist der Wunsch vieler Mitarbeiter:innen. Und doch kennen wir alle Geschichten, in denen offenkundige Schwierigkeiten im Team oder gegenüber Vorgesetzten unausgesprochen bleiben. In vielen Arbeitsumfeldern hat sich ein Klima etabliert, in dem solches Schweigen gängige Praxis ist – aus Sorge der Mitarbeiter:innen vor negativen persönlichen Konsequenzen. Neue Mitarbeiter:innen erfahren oft während der Einarbeitung, ob das Ansprechen von Problemen oder Fehlschlägen willkommen ist – oder ob solche Courage ins Abseits führt.
Mit der vorliegenden Dissertation adressiert Dr. Kreter ein wichtiges Defizit in der verhaltenswissenschaftlichen Organisationsforschung: die Fragen, wie und warum sich in Teams ein Klima psychologischer Sicherheit entwickelt. Psychologische Sicherheit – definiert als „the shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking“ (Edmondson, 1999, S. 354) – ist eine Voraussetzung für eine offene Kommunikation, in der Probleme und Fehlschläge ohne Angst vor negativen persönlichen Konsequenzen angesprochen werden können.
Zwar belegen mittlerweile zahlreiche Studien die positiven Effekte eines solchen Klimas auf das Lernen und die Leistung von Teams und Organisationen, jedoch fehlen bislang systematische Erklärungsansätze für die Entstehung dieser geteilten Wahrnehmung. Dr. Kreter geht ebendieser Frage nach. Theoretisch baut seine Arbeit auf aktuellen Ansätzen zur Mikrofundierung von Gruppenklimata auf und erweitert klassische Modelle der Kollektivwahrnehmung um affektive und prozessuale Perspektiven. Methodisch setzt Dr. Kreter auf einen abduktiven Mixed-Methods-Ansatz: Qualitative Videodaten aus zwei gruppendynamischen Trainingsgruppen werden mit quantitativen Umfragedaten zum Niveau und dem Grad der geteilten psychologischen Sicherheit verknüpft. So gelingt es, sowohl Verlaufsmuster als auch Einflussfaktoren der Klimaentstehung herauszuarbeiten.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit liefern nicht nur neue, interessante Befunde und theoretische Erkenntnisse zur Entstehung psychologischer Sicherheit in Teams, sondern zeigen auch praktische Ansatzpunkte für Führungskräfte und Organisationsentwickler:innen auf, die ein leistungs- und lernförderliches Umfeld schaffen möchten. Insbesondere die Identifikation zentraler Prozesse und affektiver Interventionspunkte bietet wertvolle Hinweise, um in neu formierten Teams eine offene und unverstellte Kommunikation zu ermöglichen.
Die Dissertation von Dr. Kreter ist ein empirisch fundierter und praxisorientierter Beitrag. Sie verbindet theoretische Innovation mit methodischer Sorgfalt und schafft somit eine inspirierende Grundlage für weitere Forschungen sowie konkrete Anwendungsmöglichkeiten zur Gestaltung leistungsförderlicher Arbeitsumfelder. Ich wünsche Dr. Kreter, dass seine Arbeit in Wissenschaft und Praxis Beachtung findet.
Witten, im Juli 2025
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Wilhelm
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Psychologische Sicherheit – d. h. die von Teammitgliedern geteilte Wahrnehmung, wie sicher ein bestimmter Kontext (bspw. eine Trainingsumgebung) ist, um interpersonelle Risiken (bspw. das Sprechen über eigene Fehler) einzugehen (Edmondson, 1999) – beeinflusst die Leistung von Teams (Edmondson & Lei, 2014; Edmondson & Bransby, 2023; Frazier et al., 2017; Newman et al., 2017). Dies liegt vor allem daran, dass Teammitglieder die Folgen ihres Verhaltens antizipieren. Haben sie Anlass, negative persönliche (z. B. Abwertung oder Ablehnung) oder professionelle (z. B. Abmahnungen oder Entlassung) Konsequenzen (Kish-Gephart et al., 2009) zu fürchten, vermeiden sie Verhalten, welches interpersonelle Risiken birgt (Edmondson & Lei, 2014; Itzchakov & DeMarree, 2022; Lu et al., 2018). Je (lebens-)bedrohlicher, komplexer und zeitkritischer die zu bewältigenden Aufgaben für Teams sind, wie bspw. die Rettung der Reisenden der Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglo 2012 (Bartolucci et al., 2021) oder das Lösen von Softwareproblemen im Juli 2024 bei Microsoft (Spiegel, 2024), desto wichtiger ist es für die erfolgreiche Zusammenarbeit, dass alle Teammitglieder ihre Wahrnehmungen, Unsicherheiten, Bedenken, Fehler etc. miteinander teilen, da die Folgen von Missverständnissen oder misslungener Koordination gravierend sein können (Edmondson, 1996; Okhuysen & Bechky, 2009; Vogus et al., 2010). So liegt es an den Teammitgliedern, im Laufe der Zeit eine geteilte Wahrnehmung darüber zu entwickeln, dass „timely and candid sharing is possible and expected“ (Bransby et al., 2024, S. 58) – es also psychologisch sicher genug ist, um Fragen, Bedenken, Fehler, neue Ideen oder Unsicherheiten etc. zu teilen (Edmondson, 1999; Edmondson & Lei, 2014; Edmondson & Bransby, 2023).
Obwohl die Auswirkungen und Wirkweisen einer hohen oder niedrigen psychologischen Sicherheit seit den 2000er Jahren konstanter Gegenstand der Teamforschung sind, verblieb die Frage, wie sich eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit entwickelt, weitestgehend unbeantwortet (Edmondson & Lei, 2014; Edmondson & Bransby, 2023; Frazier et al., 2017; Newman et al., 2017). So wurde auf der einen Seite empirisch nachgewiesen, dass eine geteilte Wahrnehmung hoher psychologischer Sicherheit nicht nur die Leistung von Teams positiv beeinflusst, sondern bspw. auch deren Innovations- (Gu et al., 2013; Hora et al., 2021; Iqbal et al., 2020) und Lernfähigkeit steigert (Edmondson, 1996; Harvey et al., 2019; Ortega et al., 2014). Auf der anderen Seite zeigen Studien, dass eine geteilte Wahrnehmung hoher psychologischer Sicherheit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Teammitglieder Fragen stellen (Carmeli & Gittell, 2009), neue und z. T. unausgearbeitete Ideen vorschlagen (Collins & Smith, 2006; Liang et al., 2012), um Hilfe bitten (Edmondson & Lei, 2014; Friedman et al., 2018), sich trauen, bei Bedenken den Status Quo zu kritisieren (Detert & Burris, 2007; Detert & Edmondson, 2011), oder Fehler bzw. Schwächen von sich selbst oder anderen ansprechen (Deng et al., 2019; Mura et al., 2016).
Trotz des nachhaltigen Interesses der Forschung an psychologischer Sicherheit liegen bislang kaum Studien vor, die die Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit beschreiben oder erklären (Edmondson & Lei, 2014; Edmondson & Bransby, 2023; Frazier et al., 2017; Newman et al., 2017). Unter geteilter Wahrnehmung wird die Übereinstimmung im Erleben und der Interpretation von Situationen sowie Reizen in einem sozialen Kontext, bspw. einem Team, verstanden (Perrigino et al., 2021, S. 152). Herrscht in einem Team ein hoher Grad an geteilter Wahrnehmung, dann stimmen das Erleben und die Interpretation der Teammitglieder in einer Situation oder bei einem Reiz weitestgehend überein. Bei einem niedrigen Grad an geteilter Wahrnehmungen weichen Erleben und Interpretation der Individuen voneinander ab. Bezogen auf psychologische Sicherheit kann ein hoher Geteiltheitsgrad sowohl bei hoher als auch bei niedriger psychologischer Sicherheit vorherrschen. Teammitglieder können in beiden Fällen die Folgen ihres Verhaltens antizipieren. Die wenigen Studien, die auch den Grad der Geteiltheit psychologischer Sicherheit in Teams berücksichtigen, weisen darauf hin, dass vorangegangene Interaktionen (Bransby et al., 2024; Koopmann et al., 2016; Singh et al., 2018) und Führungspersonen1 (Edmondson, 2004; Edmondson & Bransby, 2023; Frazier et al., 2017) zwar durchaus Einfluss auf den Geteiltheitsgrad der Wahrnehmung psychologischer Sicherheit nehmen, diese aber vor allem das Niveau der psychologischen Sicherheit beeinflussen. Entsprechend gibt es in der Literatur zu psychologischer Sicherheit kaum Theorie zur Erklärung der Entwicklung solcher geteilten Wahrnehmungen. Außerhalb der Literatur zu psychologischer Sicherheit gibt es zwar bereits Erklärungsansätze zur Entwicklung geteilter Wahrnehmungen verwandter Teamkonstrukte (wie etwa team justice climate), auf die sich erste Versuche einer allgemeinen Theorie zur Entwicklung geteilter Wahrnehmungen beziehen (vgl. Beus et al., 2023; Perrigino et al., 2021). Allerdings gibt es Gründe für Bedenken bezüglich der Anwendbarkeit dieser auf psychologische Sicherheit. So zeigt die allgemeine Theorie bspw., dass gemeinsam erlebte Reize und ein darauffolgender Prozess des collective sensemaking (Weick, 1993) – d. h. ein Prozess der „involves attending to and bracketing cues in the environment, creating intersubjective meaning through cycles of interpretation and action, and thereby enacting a more ordered environment from which further cues can be drawn“ (Maitlis & Christianson, 2014, S. 67) – den Geteiltheitsgrad von Wahrnehmungen beeinflussen. Diese Arbeiten lassen allerdings offen, welche Reize warum welche geteilten Wahrnehmungen beeinflussen – sie können damit nur bedingt Erklärungen für die Entwicklung geteilter Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit bieten. Entsprechend betonen Edmondson und Bransby (2023, S. 72) in einem aktuellen Literaturüberblick, dass „learning about how psychological safety forms, erodes, gets destroyed, or rebuilt remains an area of critical consideration“. Zusammenfassend sind Auswirkungen und Wirkweisen von einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit gut erforscht, wohingegen die Frage, wie Teams eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit entwickeln, kaum beforscht sind.
Aus dem Fehlen von Forschung zu geteilter Wahrnehmung im Kontext psychologischer Sicherheit ergeben sich zum einen Probleme für die Theorie von psychologischer Sicherheit und zum anderen Probleme für die Praxis von Teamarbeit. So wird psychologische Sicherheit als dynamisches Konstrukt theoretisiert, welches sich erst über die Zeit entwickelt (Edmondson, 1999, S. 397; Edmondson & Lei, 2014, S. 38 f.). Daher bedeutet das Fehlen von Beschreibungen und Theorien, wie sich vor allem eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit über den Zeitverlauf entwickelt, dass die Theorie psychologischer Sicherheit unvollständig ist. Allgemein sollte eine Theorie nicht nur Phänomene und ihre Folgen erklären, sondern auch deren Ursachen und Entwicklung erklären und beschreiben (Aguinis & Cronin, 2022; Fisher & Aguinis, 2017). Allgemeine Theorien zur Entwicklung geteilter Wahrnehmungen können dieses Defizit, wie oben dargestellt, nur bedingt adressieren. Zwar beschreiben sie Erklärungsmechanismen – wie collective sensemaking –, die auch für die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologische Sicherheit gelten könnten (vgl. Beus et al., 2023; Perrigino et al., 2021), sie identifizieren aber keine Reize und Situationen, die spezifisch für die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit sind. Das ist ein Problem, denn die Übertragbarkeit von bereits bekannten Reizen aus der Forschung auf andere geteilte Wahrnehmungen ist aufgrund der Spezifizität der geteilten Wahrnehmungen nicht möglich. So konnten bspw. Colley und Neal (2012, S. 1575) und Hajro et al. (2017) zeigen, dass die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung darüber, wie hoch die Arbeitssicherheit im Unternehmen wahgenommen wird („safety climate“), durch öffentlich ausgehängte Tafeln mit Sicherheitshinweisen positiv beeinflusst wird. Dabei ist davon auszugehen, dass Sicherheitstafeln nicht die geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit beeinflussen, da letztere sich vor allem auf die interpersonelle Sicherheit und nicht auf die Arbeitssicherheit („safety climate“) bezieht. Ohne empirische Forschung bleibt zudem offen, ob die Erklärungsmechanismen dieser Ansätze – wie bspw. collective sensemaking – auch bei der Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit Erklärungen bieten. Das theoretische Defizit besteht also darin, dass die vorliegende Theorie zu psychologischer Sicherheit unvollständig ist und relevante verwandte Literatur nur eingeschränkt auf geteilte Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit übertragbar ist.
Für die Praxis ist fehlendes Wissen darüber, welche Reize die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit befördern oder verhindern, vor allem für neu zusammengesetzte Teams relevant. Da diese Teams zumeist aus einander unbekannten Personen bestehen, verfügen sie bei Beginn der Zusammenarbeit nicht über eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit. Teams mit besonders relevanten Aufgaben stehen hier vor besonderen Herausforderungen: Bei neu zusammengesetzten Trainings-2 und Notfallteams kommt erschwerend hinzu, dass diese entweder nur eine sehr begrenzte Zeit haben, um neues Wissen oder Fertigkeiten zu erlernen (Bell et al., 2017; Delise et al., 2010; Hughes et al., 2016) oder bei der Versorgung von Personen mit multiplen Verletzungen oder der Behebung eines Datenleaks schnell Lösungen auf komplexe und z. T. unvorhersehbare Probleme finden müssen (Bolton et al., 2021; Edmondson & Harvey, 2017; Faraj & Xiao, 2006). Möglichst schnell eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in Teams zu entwickeln, kann entscheidend dazu beitragen, die Kommunikation, Koordination und Leistung dieser zu verbessern. Somit stellt fehlendes Wissen um die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit ein folgenreiches Problem für die Zusammenarbeit in neu zusammengesetzten Teams dar, insofern diesen keine Empfehlungen gegeben werden können, wie die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit befördert werden kann. Um auf der einen Seite neu zusammengesetzten Teams Empfehlungen geben zu können, wie sie die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit fördern können, und auf der anderen Seite die Theorie zu psychologischer Sicherheit weiter zu vervollständigen, ist eine nähere Untersuchung der Frage erforderlich, wie sich eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit entwickelt.
1.2 Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Modell zu entwickeln, das Reize, Interaktionen und Prozesse für die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in Teams beschreibt und in ihrem Zusammenwirken erklärt. Ad-hoc-Teams – d. h. einander unbekannte Personen, die ausschließlich zur Bewältigung einer Aufgabe und ohne Aussicht auf weitere Zusammenarbeit zusammenkommen (Hollenbeck et al., 2012, S. 86; Salas, Cooke, & Rosen, 2008, S. 910; White et al., 2018) – eignen sich aus zwei Gründen als Untersuchungsgegenstand, um die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit zu beforschen. Einerseits sind sie ein in der Teamforschung etablierter Forschungskontext, um einander unbekannte Personen bei der Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben zu untersuchen (Bell et al., 2017; Salas, DiazGranados, et al., 2008; White et al., 2018). Andererseits stellen ad-hoc-Teams aufgrund ihrer Ausgangsbedingungen einen Kontext dar, in dem die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit unwahrscheinlicher ist als in stabilen Teams, die auf eine gemeinsame Vergangenheit der Zusammenarbeit sowie die Erwartung, auch in Zukunft zusammenzuarbeiten, zurückgreifen können (Hollenbeck et al., 2012, S. 84). Ad-hoc-Teams haben vor der Zusammenarbeit keine Gelegenheit, Selbstregulation zu lernen, die Zusammenarbeit zu koordinieren oder eigene Pläne zu machen und diese auf ihre Zielerreichung hin zu überprüfen (Hackman, 2012; Lyubovnikova et al., 2015; Wheelan, 2004). Stattdessen sind sie gefordert, sowohl die gelingende Zusammenarbeit als auch die erfolgreiche Aufgabenbewältigung simultan zu koordinieren (Burtscher et al., 2010; Kolbe et al., 2014; Vashdi et al., 2013). Wenn unter diesen unwahrscheinlichen Bedingungen dennoch Reize, Interaktionen und Prozesse gefunden werden können, die die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit erklären können, können diese als robust betrachtet werden. Zusammenfassend wird mit den Ergebnissen dieser Arbeit die Theorie zu psychologischer Sicherheit erweitert. Außerdem können erste praktische Implikationen für die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in neu zusammengesetzten Teams und ad-hoc-Teams abgeleitet werden. Dazu wurde folgender Aufbau der Arbeit gewählt.
Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen geschaffen, um die empirische Untersuchung zur Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit in ad-hoc-Teams zu ermöglichen. Entsprechend wird in einem ersten Schritt psychologische Sicherheit in den Unterkapiteln 2.1.1 bis 2.1.3 als Zielgröße konzeptionell verortet. Da Einflussfaktoren auf das Niveau der psychologischen Sicherheit mitunter mit der Beantwortung der Frage verknüpft sind, wie sich eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in Teams entwickelt, wird bestehende Forschung zu Einflussfaktoren auf das Niveau der psychologischen Sicherheit in Teams in Unterkapitel 2.1.4 dargestellt. In einem zweiten Schritt wird die Frage beantwortet, ob ad-hoc-Teams überhaupt geteilte Wahrnehmungen entwickeln können. Antworten auf diese Frage liefert ein systematischer Literaturüberblick zu geteilten Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams (Unterkapitel 2.2). Um möglichst viele verschiedene leistungsrelevante geteilte Wahrnehmungen (wie psychologische Sicherheit, siehe Unterkapitel 1.1) in ad-hoc-Teams zu identifizieren, wurde Leistung als Zielgröße gesetzt. Dabei werden in aufeinanderfolgenden Unterkapiteln Methode (2.2.1), Ergebnisse (2.2.2) und Limitationen (2.2.3) des Literaturüberblicks dargestellt. Abgeschlossen wird Kapitel 2 mit einem Zwischenfazit (Unterkapitel 2.2.3), in dem mithilfe der Ergebnisse des Literaturüberblicks die Fragen beantwortet werden, ob adhoc-Teams geteilte Wahrnehmungen (wie die von psychologischer Sicherheit) entwickeln und davon profitieren. Damit fungiert das Zwischenfazit als Überleitung zur empirischen Untersuchung der Arbeit.
Kapitel 3 beantwortet auf Basis der vorab geschaffenen theoretischen Grundlagen empirisch die Frage, wie sich eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in ad-hoc-Teams entwickelt. Da die Forschungsfrage darauf abzielt, Erklärungen für beobachtbare Phänomene auf Grundlage bereits bestehender Theorie zu entwickeln, wurde für ihre Beantwortung eine abduktive Methodologie gewählt. Um ein möglichst umfassendes Bild zu generieren, wurde die abduktive Methodologie mit Mixed Methods als Forschungsansatz umgesetzt. Mixed Methods verbinden quantitative und qualitative Datenquellen im Erkenntnisprozess und ermöglichen es, das zu entwickelnde Prozessmodell auf einer möglichst breiten Datengrundlage aufzubauen. Um den gesamten Forschungsprozess nachzuvollziehen, wird die Methode in Unterkapitel 3.1 dargestellt. Diese gliedert sich auf in die methodologischen Grundlagen sowie einen daraus abgeleiteten Forschungsansatz (Unterkapitel 3.1.1), sowie die Darstellung des ausgewählten Forschungsumfelds – ad-hoc-Teamtrainings – (Unterkapitel 3.1.2), der Stichprobe (Unterkapitel 3.1.3) und des Forschungsdesigns (Unterkapitel 3.1.5). Abschließend werden die Strategien der qualitativen (Unterkapitel 3.1.5.1) und quantitativen (Unterkapitel 3.1.5.2) Datenanalyse sowie der Entwicklung eines Prozessmodells zur Erklärung der Entwicklung von geteilten Wahrnehmungen psychologischer Sicherheit (Unterkapitel 3.1.5.3) beschrieben. Unterkapitel 3.2 stellt die aus den qualitativen (Unterkapitel 3.2.1) und quantitativen (Unterkapitel 3.2.2) Daten gewonnenen Erkenntnisse dar, um daran anschließend das daraus abgeleitete Prozessmodell zu beschreiben (Unterkapitel 3.2.3).
Kapitel 4 nimmt Rückbezug auf die herausgearbeitete theoretische und praktische Problemstellung der Arbeit, um die Ergebnisse in Unterkapitel 4.1 im Hinblick auf ihre Implikationen für die Theorie zu diskutieren. Zentral ist die Herausarbeitung der Bedeutung der Ergebnisse für die Theorie psychologischer Sicherheit sowie für die Theorie des gewählten Forschungsumfeldes (gruppendynamische Trainingsgruppen). Darüber hinaus werden in Unterkapitel 4.2 aus den Ergebnissen praktische Implikationen für die Zusammenarbeit in neu zusammengesetzten Teams und ad-hoc-Teams abgeleitet. Unterkapitel 4.3 stellt Limitationen dar, die sich aufgrund der gewählten Methode und des Forschungsumfeldes ergeben haben und die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse einschränken. Daran anknüpfend werden in Unterkapitel 4.4 Potenziale für zukünftige Forschung eröffnet.
Kapitel 5 fasst die entwickelten Antworten und Zusammenhänge zusammen und schließt die Arbeit ab.
1 Vorliegende Studien zeigen, dass bspw. Teams, in denen Führungspersonen prosoziale, beziehungsfördernde Verhaltensweisen und Führungsstile zeigen, über einen höheren Grad an geteilter Wahrnehmung psychologischer Sicherheit verfügen (Coutifaris & Grant, 2022; Detert & Burris, 2007; Frazier & Tupper, 2018).
2 Natürlich finden nicht alle Teamtrainings unter der Bedingung statt, dass einander unbekannte Personen zusammenkommen. Allerdings können heutzutage (unter anderem aufgrund von Personalmangel) immer weniger Arbeitgebende vollständige Teams entbehren, bzw. der Arbeitsalltag (wie bspw. in der Notaufnahme) findet ohnehin in Teams aus einander unbekannten Personen statt.
2 Theoretischer Hintergrund
Der theoretische Hintergrund dieser Arbeit setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten Teil wird der Hauptgegenstand der Arbeit, psychologische Sicherheit, konzeptionell verortet und im zweiten Teil die bisherige Forschung zu geteilten Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams systematisiert. Damit werden die theoretischen Grundlagen für eine empirische Forschung der Entwicklung psychologischer Sicherheit in ad-hoc-Teams geschaffen.
Um der Frage, wie sich eine geteilte Wahrnehmung psychologischer Sicherheit entwickelt, nachzugehen, ist es zunächst notwendig, eine konzeptionelle Fassung psychologischer Sicherheit vorzulegen (Unterkapitel 2.1). Dieser Schritt ist wichtig, um die spätere Passung zwischen der Zielgröße (psychologische Sicherheit) und den Ergebnissen der empirischen Untersuchung zu gewährleisten. Darüber hinaus liefert die theoretische Darstellung erste Anhaltspunkte für Interaktionssequenzen, die potenziell auch bei der Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit relevant sind. In diesem Unterkapitel wird auch bereits bestehende Forschung zu Einflussfaktoren auf das Niveau der psychologischen Sicherheit in Teams dargestellt. Damit wird einerseits das Forschungsvorhaben in den bisherigen Forschungsstand zu psychologischer Sicherheit integriert und andererseits verdeutlicht, dass zum jetzigen Zeitpunkt kaum etwas über die Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit bekannt ist.
Nachdem psychologische Sicherheit konzeptionell verortet wurde, wird in einem zweiten Schritt der Frage nachgegangen, ob sich geteilte Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams entwickeln können. Dieser Schritt dient dazu, adhoc-Teams als Untersuchungsgegenstand zu legitimieren. Die Einschränkung auf Leistungstreiber erfolgt, da es sich bei psychologischer Sicherheit um eine leistungsrelevante geteilte Wahrnehmung handelt. Denn es scheinen vor allem Studien zu geteilten Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams relevant, die ebenfalls einen Leistungsbezug aufweisen. Unterkapitel 2.3 schließt mit in einem Zwischenfazit, das die Ergebnisse der Forschung zu geteilten Wahrnehmungen in ad-hoc-Teams einordnet. Es zeigt sich, dass auch adhoc-Teams geteilte Wahrnehmungen entwickeln können. Auch zeigen erste Ergebnisse, dass sie von psychologischer Sicherheit profitieren können. Damit rechtfertigt das Zwischenfazit die Forschung zur Entwicklung einer geteilten Wahrnehmung psychologischer Sicherheit in ad-hoc-Teams.
2.1 Psychologische Sicherheit
Im Folgenden wird eine konzeptionelle Einordnung psychologischer Sicherheit vorgenommen. Hierzu werden die Begriffsgeschichte (Unterkapitel 2.1.1), die Einordnung von psychologischer Sicherheit in die Theorie emergenter Phänomene (Unterkapitel 2.1.2) sowie Klimata (Unterkapitel 2.1.3) und Einflussfaktoren auf psychologische Sicherheit (Unterkapitel 2.1.4) dargestellt.
2.1.1 Psychologische Sicherheit als geteilte Wahrnehmung: Eine kurze Begriffsgeschichte
Der Begriff psychologische Sicherheit hat eine ca. 60-jährige Geschichte, die als Einführung in dessen Konzeptionalisierung kurz umrissen wird. Erstmalig wurde psychologische Sicherheit von Schein und Bennis (1965) im Kontext von Lewins Modell organisationaler Veränderungen verwendet. Lewin (1947) ging davon aus, dass es drei Phasen zur Veränderung der sozialen Verhältnisse in Gruppen und Organisationen bedarf: (1) „Unfreezing“, in der die aktuellen Strukturen von Führungspersonen aufgetaut bzw. hinterfragt werden und eine Veränderungsnotwendigkeit etabliert wird; (2) „Moving“, in der neue Standards bzw. Veränderungen durch Führungspersonen eingeführt werden und (3) „Freezing“, in dem die eingeführten Veränderungen unter Aufsicht von Führungspersonen etabliert und verfestigt werden (Lewin, 1947). Nach Schein und Bennis (1965) ist psychologische Sicherheit vor allem beim „Unfreezing“ entscheidend, da Individuen sich nur auf ein „Unfreezing“ einlassen, wenn sie von ihrer Führungsperson ein ausreichendes Maß an Sicherheit und Kompetenz für potenzielle organisationale Veränderungen erleben.
Darauf aufbauend etablierte Schein (1993) psychologische Sicherheit außerdem als essenziellen Bestandteil von individuellem Lernen. Nach Schein (1993) geht jedem Lern- und Veränderungsprozess ein Moment der Frustration oder Unzufriedenheit voraus. Ein individuelles Erleben von psychologischer Sicherheit – das entweder von Lehrenden geschaffen wird oder beim Individuum ohnehin schon vorherrscht – bestimmt, ob daran anknüpfende negative Emotionen wie Angst und Abwehr überwunden werden und Lernprozesse stattfinden (Schein, 1993). Sowohl Schein und Bennis (1965) als auch Schein (1993) nutzten psychologische Sicherheit vor allem als individuellen Faktor, der von Führungspersonen oder Lehrenden beeinflusst wird, um die Wahrscheinlichkeit von gelingenden Lern- und Veränderungsprozessen zu beschreiben.
Im Unterschied dazu nutzte Kahn (1990) den Begriff psychologische Sicherheit, um zu erklären, warum Individuen sich wahrscheinlicher physisch, kognitiv und emotional ausdrücken, ohne sich zurückzuziehen oder zu verteidigen bzw. Angst vor negativen professionellen oder persönlichen Konsequenzen zu haben (Kahn, 1990). Kahn (1990) betonte erstmalig, dass das individuelle Erleben psychologischer Sicherheit abhängig vom sozialen Kontext und nicht ausschließlich von Führungs- oder Lehrpersonen ist.
Edmondson (1996; 1999, S. 355) vollzog den aktuell letzten Schritt in der konzeptionellen Entwicklung psychologischer Sicherheit. Wie bereits in der Einleitung angerissen, fasst sie das Konstrukt als geteilte Wahrnehmung, dass ein bestimmter Kontext sicher genug ist, um interpersonelle Risiken einzugehen. Damit konzeptualisierte Edmondson (1999) psychologische Sicherheit, im Gegensatz zu Schein und Bennis (1965), Kahn (1990) und Schein (1993), als Teamqualität. Aus dieser Konzeptualisierung als shared team property folgt unmittelbar (Klein & Kozlowski, 2000), dass neben dem Niveau der erlebten psychologischen Sicherheit auch der Grad der Geteiltheit im Team theoretische Berücksichtigung findet. Die folgende Abbildung (Abb. 1) visualisiert die mit Edmondson (1999) hinzugekommene Dimension.
Abb. 1: Unterscheidung Niveau und Geteiltheitsgrad psychologischer Sicherheit





























