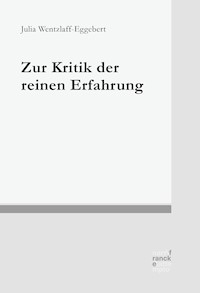
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Basler Studien zur Philosophie
- Sprache: Deutsch
Kritik ist mehr als der Gegenstand dieses Buches. Sie ist auch der ursprüngliche Impuls des Denkens, der es methodisch und inhaltlich strukturiert: In 19 aufeinander aufbauenden Abschnitten drängt Kritik das Denken zur produktiven Auseinandersetzung mit dessen Negativität. Angelpunkt dieser Selbstbewegung des Denkens ist die "reine Erfahrung". In ihr stehen klassisch kantische Problemkomplexe im konstellativen Zusammenhang mit existenzialphilosophischen und phänomenologischen Paradigmen; Urteilslogik verschwistert sich mit Verzweiflung, Unsicherheit, Kreativität, und schliesslich: mit der Kunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Wentzlaff-Eggebert
Zur Kritik der reinen Erfahrung
DOI: https://doi.org/10.24053/9783772057823
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-9918
ISBN 978-3-7720-8782-0 (Print)
ISBN 978-3-7720-0218-2 (ePub)
Inhalt
Für Nicolai
«Der philosophische Begriff lässt nicht ab von der Sehnsucht, welche die Kunst als begriffslose beseelt und deren Erfüllung ihrer Unmittelbarkeit als einem Schein entflieht. Organon des Denkens und gleichwohl die Mauer zwischen diesem und dem zu Denkenden, negiert der Begriff jene Sehnsucht. Solche Negation kann Philosophie weder umgehen noch ihr sich beugen. An ihr ist die Anstrengung, über den Begriff durch den Begriff hinauszugelangen.»
Theodor W. Adorno
Danksagung
Das vorliegende Buch ist die erneut durchgesehene Fassung einer Arbeit, die im Sommer 2021 von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel als Dissertation angenommen wurde. Betreut wurde sie von Gunnar Hindrichs und Markus Klammer, denen beiden ich aufrichtig danken möchte. Ausserdem bin ich der Trägerschaft und meinen Kolleginnen und Kollegen der eikones Graduate School am Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes zu Dank verpflichtet, von deren lebhafter und konstruktiver Diskussionskultur ich von 2019-2021 als Stipendiatin profitieren durfte. Schliesslich danke ich der Nachwuchsförderung der Universität Basel und dem Max Geldner-Fonds für die finanzielle Unterstützung zur Drucklegung, sowie Stefan Selbmann vom Narr Francke Attempto Verlag für die verlegerische Betreuung dieses Buches.
Einleitung
Der Titel: Zur Kritik der reinen Erfahrung stellt eine Verknüpfung in Aussicht von dem, was Kritik, und dem, was Erfahrung ist. Und er behauptet, dass diese Verbindung eine «reine» Verbindung sei. Was folgt, ist der Versuch, diese Verbindung zu artikulieren. Kern der Argumentation ist, dass Kritik in sich ihr Anderes oder dasjenige sucht, was sie nicht schon hat. Darin liegt beschlossen, dass «das Andere» keine inhaltliche Konkretheit erlangen kann, weil es nur darin bestimmbar ist, was Kritik nicht ist. Was Kritik sucht, ihr Anderes, ist also durch Negation zu charakterisieren. Ist Kritik nur negativ fassbar, so muss sie mit der Bereitschaft einhergehen, sich aufzugeben. Gleichzeitig kann diese Aufgabe kritisch nicht erfüllt werden, weil das kritische Überlegen so strukturiert ist, dass jeder kritische Denkakt als Reflexion des Vorhergehenden, und so fort ad infinitum, erscheinen kann. Aus diesem Grund versteht Kritik ihr Negatives nicht einfach als etwas, was ihr schleierhaft oder im Dunklen bleibt. Sondern es ist Kritik inhärent, sich selbst als ihr Negatives zu wissen – zur Kritik gehört das Selbstbewusstsein von jener Negativität, die sie ist: sich nicht in sich beruhigen zu können. Aber das Selbstbewusstsein um diese Negativität kann kein begriffliches sein, weil der Begriff fixieren würde, was anders ist und nicht stillgelegt werden kann. So kann Kritik sich nur in der Erfahrung wissen. Das heisst, eine Kritik der reinen Erfahrung sucht einen Begriff der Kritik imNegativenin sich. Für die Artikulation dieser Verbindung von Kritik und Erfahrung sind die folgenden argumentativen Grundpfeiler relevant.
Kritik ist die Pflicht, welche uns schon allein dadurch auferlegt ist, dass wir denken. Diese Pflicht ist deshalb unumgänglich, weil das Faktum, dass wir denken1, vom Denken nicht abstrahiert werden kann. Damit steht Kritik, so meine erste (§§1-2) und eine der letzten Thesen (§18), auf dem Grund philosophischen Ursprungsdenkens. Hier ist sie, erstens – kantisch –, als Grundbewegung bewussten Denkens auszuweisen. Resultat: Kritisch heisst das Denken, weil es die Welt nicht bloss hinnimmt, wie sie ist. In Anbetrachtder Welt beinhaltet die Konstitution des Denkens eine Aktivität des Subjekts, welche selbst nicht begrifflich fixiert werden kann. Dem systematischen Anspruch des kritischen Impulses folgend verlangt diese in der Grundkonstitution des Denkens liegende Aktivität nach einer logischen Artikulation. Das heisst: Das kritische Denken ist ein Denken, das sich selber auslegen will. (§§3-4) Die eigentlich kritische Frage lautet daher nicht, was Kritik ist, sondern: Wie ist Kritik möglich?
In dem Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu finden, werde ich zwei bedeutende, aber einander widersprechende Paradigmen diskutieren: Kants aus der Tradition übernommene Formulierung des Denkens: «S ist P» und Freges Funktionsausdruck: «F(x)». (§5-7) Die Gegenüberstellung von Kant und Frege wird ergeben, dass die traditionelle Formulierung nach Kant nicht (wie vielleicht zu erwarten wäre) die konventionelle, sondern die eigentlich kritische ist: Mit der Kopula «ist» in der Formulierung «S ist P» wird eine Trennungsbeziehung explizit (§3), welche das mit dem ursprünglichen Impuls bedingte Bewusstwerden des Denkens erklärt – also jenes Bewusstwerden, welches Kritik als die Pflicht erkennt, im Denken auch gegen das Denken vorzugehen. (§8) Dagegen bleibt ein Denken ohne Kopula nicht nur bewusst-, sondern vor allem bedeutungslos: Ohne Kopula schwindet der Weltbezug. Das Denken verfängt sich im eigenen Garn wie eine Spinne im Netz. Kritik, also sein Negatives, kann ein solches Denken nicht einfangen. (§7) Als Ergebnis dieser Gegenüberstellung muss zu Ungunsten der funktionalen an der kritischen Formulierung des Denkens «S ist P» festgehalten werden, was folgenreich ist. Dieses Buch nimmt sich vor, jene Folgen auszubuchstabieren. (§§9-14)
Im Zuge dessen drängt sich, zweitens, – nun gegen Kant –, eine Überschreitung des prädikativen Rahmens «S ist P» auf. In Antwort auf Kant argumentiere ich mit Fichte, dass das kritische Denken letztlich die «Vernichtung» des Denkens fordert (§15), ein Postulat, das – gerade aufgrund der kritischen Grundkonstitution – nicht eingelöst werden kann (§16). So führt die zum kritischen Denken gehörende Forderung, das Denken zu vernichten, weil sie nicht erfüllbar ist, zu einer Überschreitungsbewegung; einem Puls, wenn man so will, welcher sich vom prädikativen Denken ebenso wenig befreien, wie sich in ihm beruhigen kann. Diesen Puls nenne ich die reine Erfahrung. (§§15-16) Dass die Erfahrung rein ist, besagt, dass sie ihren Ursprung nicht in der Welt, sondern im denkenden Subjekt hat. Das heisst, sie gründet im Faktum des Denkens, welches dessen kritische Impulsivität ist (§1). Hier wird der anti-kantische Zug dieses Gedankengangs deutlich: Gegen Kant soll der Begriff einer reinen Erfahrung nicht Gegebenheiten bespiegeln, sondern den reflektierten Widerstand gegen alles Gegebene präsent machen. Erfahren wird also weniger die Welt, wie sie ist, als vielmehr die bildende Aktivität des Subjekts in Anbetracht der Welt.2 Entgegen der noch kantischen Auffassung von Erfahrung als Empirie meint dieser Erfahrungsbegriff eine Art «doppelt[e] Negationserfahrung» des Subjekts gegenüber dem sinnlichen Widerfahrnis: Das Subjekt der reinen Erfahrung «ist den Dingen gegenüber fremd, aber auch sich selbst gegenüber als demjenigen, was noch sich selbst zu reflektieren in der Lage ist.»3 Dieser anti-kantische Zug in der ursprünglich kantischen Radikalisierung des Kritikbegriffs führt zum Dialog mit einer Kritischen Theorie nach Adorno, Horkheimer, Marcuse. Allerdings soll mit dem Begriff der reinen Erfahrung – nun wiederum kantisch und gegen eine Kritische Theorie – die theoretische Reflexion nicht in eine historisch-materialistische umgekehrt werden. Denn reine Erfahrung sucht nicht primär den Widerstand des Materials, sondern vielmehr den Widerstand des Subjekts gegen sich selbst. Die Erfahrung bleibt rein, weil sie inhaltlich nicht konkret ist und sich weder in der Welt noch im Denken festmachen lässt. Reine Erfahrung macht das kritische Denken als eine nicht zugerichtete, eine abstrakte Unruhe, eine logische Tatkraft im Anblick der Welt greifbar.
Obwohl sie rein ist und ihren Ursprung im Subjekt hat, kann Erfahrung, drittens, nicht schöpferisch werden. Sie muss sich am Widerständigen vollziehen; also daran, was nicht schon in der reinen Erfahrung ist. Und so bedarf sie letztlich eines Gegenstandsbereichs, der sich mit der geschichtlichen Wirklichkeit nicht deckt, da dieser konkret ist. Der Gegenstand der reinen Erfahrung muss ein Gegenstand sein, der das Paradox nicht konkreter Gegenständlichkeit erfüllt, weil der gegenständliche Weltbezug durch Kritik gleichsam in der Schwebe gehalten wird. (§17) – Meine abschliessende These lautet: Ein solcher Gegenstandsbereich ist die Kunst. (§19)
Diese letzte These bleibt am Ende ein Ausblick auf ein neues Projekt, das nicht wie dieses Buch im reinen Denken, sondern in der Kunst anhebt. Für das vorliegende Buch ist dieser Ausblick dennoch relevant, weil er die abstrakte, reine Erfahrung konkretisiert: Im letzten Kapitel wird an einem Beispiel aus der Kunst demonstriert, dass die ursprünglich negative Bewegung oder der kritische Wesenszug des Denkens nicht nur eine zufällige, philosophiehistorische Entwicklung in Anschluss an Kant ist. In der Kunst erfahren wir die kritische Kraft des Denkens wirklich: Das in §19 beispielhaft betrachtete Kunstwerk soll uns am Ende vor Augen führen, was das reine (kritische) Denken in den vorangehenden Kapiteln mit den Begriffen Urteil, Kopula, Selbstbewusstsein artikuliert hat. Dabei geht es um die Forderung eines Urteils, das – weil wir das Kunstwerk nicht entziffern, nicht verstehen können – nicht gefällt werden kann. In dem Moment, in dem wir etwas nicht verstehen, beginnt unsere Suche nach einem Sinn. Diese Suche in der Betrachtung eines Kunstwerks ist im Grunde ein wirklicher Vollzug der urteilslogischen Kritik. Sie macht den Ursprung des Denkens erlebbar. Hier liegt der lebendige Puls einer Kritik der reinen Erfahrung: In der Kunst erfährt das kritische Denken das negative Bewusstsein dessen, was es ist, oder das Bewusstsein dessen, was es nicht ist – das Denken stösst an seine Grenze.
Mit der Kunst als Fluchtpunkt gibt uns eine Kritik der reinen Erfahrung keine Antwort auf die ursprüngliche Frage nach ihrer Möglichkeit, sondern sie wirft uns auf sie zurück. Im Anschluss an die Selbstartikulation des Denkens erscheint sie am Ende des vorgelegten Gedankengangs aber in neuem Licht. Ihr Gegenstandsbereich ist dann ein anderer: Durch Kritik öffnet sich der theoretische Blick für einen Gegenstandsbereich, welcher das Unbegriffliche und den Zweifel, und damit Kunst umfasst. – Wenn aber Kunst als Ausdruck des Paradoxes kritischen Denkens betrachtet werden kann, weil sie eine nichtgegenständliche Gegenständlichkeit fordert, muss letzten Endes auch sie in Frage bleiben. Und so ist die Antwort auf die Ausgangsfrage nach der Möglichkeit der Kritik wieder nur als Frage verständlich zu machen. (§19) Sie lautet: Wie ist Kunst möglich?
Kern der vorgezeichneten Argumentation ist der Umschlag des Logischen ins Phänomenologische, der Umschlag von Kritik in Erfahrung. Dadurch werden sehr unterschiedliche philosophische Traditionen miteinander in Verbindung gesetzt: Von der Seite des Logischen aus betrachtet liegt die Emphase auf der Offenheit des Denkens fürs Neue und auf der Möglichkeit denkender Transformation des Bestehenden. Hier liegen transzendentale Überlegungen zum kritischen Subjekt zugrunde. Andererseits wird das kritische Subjekt, weil es den Rahmen prädikativer Bestimmtheit phänomenologisch überschreiten soll, auch unter empirischen Gesichtspunkten betrachtet: etwa, wenn die Folgen der negativen Selbstbezüglichkeit für das Subjekt ausbuchstabiert werden (mit der Unschuld des Blicks, §12, oder mit der Phantasie, §13) und schliesslich, wenn die Kunst ins Spiel kommt (§19). Hier berührt der im Grunde theoretische Gedankengang Aspekte einer ästhetischen Kritik. Die Klammer um das Logische und Phänomenologische bildet aber eine Normativität (§§1, 18), welche wiederum moralphilosophische Dimensionen eröffnet: Kritik ist keine mögliche Denkhaltung neben anderen, sondern mit einem Sollen verbunden, das uns dadurch auferlegt ist, dass wir denken. – Somit wird der Rahmen der rein theoretischen Kritik zweifach überschritten: einmal in empirischer (und ästhetischer), einmal in normativer Hinsicht. Gleichzeitig bleibt die verbindende Idee zentral, dass die Auseinandersetzung mit dem Empirischen und dem Normativen nichts Eigenes neben dem Theoretischen darstellt. Es tritt nicht das Wirkliche oder das Normative anstelle des theoretischen Denkens. Vielmehr sind beide Hinsichten Aufgaben innerhalb der Auseinandersetzung mit dem Denken. Das Denken des Denkens ist intrinsisch normativ motiviert und wendet sich in sich zum Empirischen hin. Das heisst, obwohl das Motiv dieses Buches theoretisch bleibt, so ist es nicht das reine Denken, ebensowenig wie ein unreflektiertes Sein oder Sollen, sondern es ist die ursprüngliche Negativität und Reflexion, welche das theoretische Ich mit der Welt des Empirischen und der Welt des Sollens verknüpft. Nicht vom reinen Denken, aber von jener Reflexion handelt dieses Buch.
Wie schon der Titel nahelegt, stützt sich dieser Gedankengang auf die kritische Wende nach Kant. Und dennoch bemüht er keine Kant-Exegese. Es werden sehr unterschiedliche Philosophinnen und Philosophen um das umrissene Problem geordnet, und die Versenkung in deren Denken soll helfen, es zur Sprache zu bringen. Letzteres ist auch methodisch massgebend: Die Besprechung einer Position dient nicht zur historischen oder hermeneutischen Orientierung über unterschiedliche Interpretationsansätze. Vielmehr ist jede Position primär Sprachrohr der Sache und vermag wieder neue Aspekte an ihr sichtbar und verständlich zu machen. – Dieses Vorgehen lässt den Argumentationsgang an mancher Stelle vielleicht alternativlos erscheinen, rechtfertigt sich aber in der Zielsetzung dieses Buches: Hier wird ein kantisches Thema verfolgt, aber nicht nach historischen, sondern nach systematischen, man könnte eigentlich sagen: nach kantischen Gesichtspunkten. Kant spricht die Radikalisierung der Kritik aus, der zufolge Kritik nicht mehr von äusseren Irrtümern handelt, sondern von Scheingestalten, welche in die kritische Tätigkeit fallen. Das führt zu methodischen Konsequenzen. Denn im Zuge der Radikalisierung von Kritik ist jeder philosophische Standpunkt zum Scheitern verurteilt: Radikale Kritik lässt keinen Standpunkt zu, auch den eigenen nicht. Und damit besteht ihre Aufgabe nicht zuletzt darin zu zeigen, inwiefern eine vorgebrachte Position keine ist. Um dies aber belegen zu können, muss ein neuer Standpunkt eingenommen werden, und so weiter. Das bedeutet einerseits, dass eine kritische Tätigkeit von sich aus eine Vielfalt an philosophischen Positionen impliziert. Andererseits liegt darin die genannte methodische Prämisse beschlossen, dass Kritik nicht nur eine hermeneutische Auslegung verlangt. Sie lebt, bleibt sie selber kritisch, von der prismatischen Brechung des einzelnen Standpunkts. Ich betrachte also die Positionen, welche im Folgenden zu Hilfe gezogen werden, um Kritik und ihre reine Erfahrung darzulegen, wie Farbspektren, welche jeweils unterschiedliche Aspekte hervortreten lassen, und gerade mit der Brechung durch einen Fokus einen gemeinsamen Bezugspunkt erhalten: die Frage nach der Möglichkeit von Kritik, das Denken selbst. Hier verbinden sich gegensätzliche Ansichten zu einem Gesamtbild der reinen Erfahrung.
Dieses Gesamtbild sieht so aus, dass neben den klassisch kritischen Positionen in Anschluss an Kant (Fichte, Schelling, Hegel und Horkheimer, Adorno, Marcuse) auch Verbindungen in Gebiete hergestellt werden, welche auf den ersten Blick von der kantischen Frage weit entfernt zu sein scheinen: die analytische Philosophie (Frege), die Phänomenologie des 20. Jahrhunderts (Husserl, Imdahl, Boehm), aber auch die Existenzial- (Kierkegaard) und Kunstphilosophie des 20. und 21. Jahrhunderts (Bubner, Menke). Dieser Zusammenhang ist nicht linear, sondern um ein zentrales Problem konstelliert4, sodass, was historisch wie ein grosser Schritt aussieht – etwa der von Hegel zu Kierkegaard, oder von Kierkegaard zu Horkheimer –, im Folgenden eine perspektivische Brechung im selben Punkt darstellt. Weil dieser Punkt (die reine Erfahrung) aber selber nicht konkret und nicht begrifflich ist, tritt er gar nicht anders als negativ und anhand dieser gedanklichen Reflexionen hervor. Die Auswahl der Perspektiven, die vorgebracht und teilweise widerrufen werden, bleibt deshalb fragmentarisch, da für die Darstellung der Sache immer auch andere und noch weitere Perspektiven eingenommen werden könnten. – Dennoch ist die Auswahl nicht zufällig. Im Hintergrund stehen die Überzeugung, dass die vorgebrachten Positionen durch ein gemeinsames Projekt miteinander verwandt sind, und die Hoffnung, dass umgekehrt die Verknüpfung zu anderen die einzelne Perspektive bereichern kann. Mit dem Projekt selbst einen Standpunkt auszubilden, von dem aus wir uns die anderer aneigneten, lässt der konsequent antiautoritäre Zug radikaler Kritik allerdings nicht zu. Will Kritik das Scheitern, so muss sie letztlich auch zum eigenen Scheitern entschlossen sein und ihre Autorität ablegen.
Hier treffen sich Methode und Inhalt dieses Buches: Kritik kann sich nicht nur argumentativ vollziehen, weil eine lineare Argumentation dem Scheitern äusserlich bliebe. Deshalb soll Kritik nicht nur «gesagt», sondern in ihrer radikalen Formulierung auch vollzogen werden. Diesen Übergang sucht die vorgeschlagene Verbindung zur reinen Erfahrung: eine Brücke von der philosophischen Darlegung zu ihrem ehrlichen Vollzug. Die konstellativ verfahrende und Erfahrung suchende Kritik will Kritik nicht nur denken, sondern sie tun: Es geht um das Bewusstsein dessen, dass wir selbst wie auch die Welt durch unser Nachdenken zu bilden – und umzubilden sind.
§1Der kritische Impuls
Am Anfang jeder Untersuchung stellt sich die Frage, womit sie anfangen soll. Diese Frage stellt sich mit besonderer Dringlichkeit, wenn die Untersuchung, wie die vorliegende, keinen vorab bestimmten Gegenstand hat, an dem sie ansetzen könnte. Denn der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist das Denken selbst. Über das Denken können wir aber nicht als anfängliches nachdenken. Über das Denken können wir nur nachdenken, indem wir denken – das heisst, indem wir bereits angefangen haben. Das Denken kann nicht auf sich wie auf einen Gegenstand blicken. Will es sich selbst erfassen, so findet es immer nur das schon Gedachte, die geronnene Denktätigkeit vor. Aus diesem Grund kann die vorliegende Untersuchung nur mit einem Gedanken anfangen, der eigentlich keiner sein kann. Es muss ein Gedanke sein, der nur äusserlich, nämlich im Kontrast zum Denken, also negativ bestimmt werden kann.1 Diese negative Bestimmung des Denkens, oder dass sich das Denken nicht anfänglich denken kann, ist in besonderer Weise anfänglich: Sie ist, wie das Folgende zeigt, dem Denken ursprünglich.
Ursprünglich ist für das Denken, was vom Denken nicht getrennt werden kann. Die Nichtanfänglichkeit des Denkens ist dem Denken ursprünglich, weil wir sonst vom Denken das Denken abziehen müssten. Wir müssten, um den Anfang des Denkens zu denken, einen Gedanken fassen können, ohne ihn zu denken. Zum Denken gehört aber unbestreitbar, dass gedacht wird. Schelling hat diesen Zusammenhang das factum brutum des reinen Dass genannt. Was gedacht wird, das ist Sache des Denkens. Zu denken aber, dass diese Sache gedacht wird, übersteigt es. Es übersteigt das Denken um die Voraussetzung, dass wir denken.2 Schelling erläutert diese Unterscheidung zum Beispiel in Bezug auf das Denken und das Erkennen von Seiendem:
«Hier ist nämlich zu bemerken, dass an allem Wirklichen zweierlei zu erkennen ist, es sind zwei ganz verschiedene Sachen, zu wissen, was ein Seyendes ist, quid sit, und dass es ist, quod sit. Jenes – die Antwort auf die Frage: was es ist – gewährt mir die Einsicht in das Wesen des Dings, oder es macht, dass ich das Ding verstehe, dass ich einen Verstand oder einen Begriff von ihm, oder es selbst im Begriff habe. Das andere aber, die Einsicht, dass es ist, gewährt mir nicht den blossen Begriff, sondern etwas über den blossen Begriff Hinausgehendes, welches die Existenz ist. Dieses ist ein Erkennen, wobei freilich einleuchtet, dass wohl ein Begriff ohne ein wirkliches Erkennen, ein Erkennen aber ohne den Begriff nicht möglich ist.»3
Demzufolge vermag das Denken nur dasjenige an den Dingen zu ermitteln, was sie sind oder was an ihnen begrifflich ist. Davon grundverschieden ist das Erkennen, dass sie sind. In Bezug auf die anfängliche Fragestellung bedeutet dies einerseits, dass das Denken des Denkens oder die Einsicht, dass wir denken, vom Denken ausgeschlossen wird. Daraus folgt aber keineswegs, dass sie für das Denken bedeutungslos wird. Denn andererseits bedingt dieses «Dass» gleichsam jeden Gedanken: Es ist in all unseren Gedanken allein dadurch, dass wir sie denken, da es unmöglich ist einen Gedanken zu fassen, ohne dass wir ihn denken. Ebenso redundant wäre es, aus dem Gedanken zusätzlich noch herleiten zu wollen, dass er gedacht wird. Dies zu beweisen kann also nicht Sache des Denkens sein. Das gilt auch für Gedanken, welche nicht auf sich selbst gerichtet sind, sondern die zum Beispiel empirisch Erforschbares, Einsichten in «das Wesen» eines «Dings» (s. o.) im Sinn haben. Denn alles Erforschbare kann ja anders nicht erforscht werden als durch Gedanken. Es trägt eben deshalb schon das Dass in sich, weil es erforscht, das heisst, gedacht wird.
Obwohl es also nicht gedacht werden kann, ist das Dass vom Denken nicht wegzudenken. Somit betrifft es auch nicht irgendeinen Gedanken, diesen oder jenen, sondern jeden möglichen, den Gedanken, Denken überhaupt. Dass gedacht wird, ist dem Denken ursprünglich. Sicherlich gilt nun für das Denken, dass wir nur soweit denken können, als wir denken können – aber, dass wir dies können, so Schelling, ist nicht wieder eine Eigenschaft unseres Könnens. Dass wir denken, das ist ein factum brutum, weil es dem Denken ebenso wesentlich ist, wie es dieses übersteigt. – Wenn dieses factum aber nicht gedacht werden kann, wie kann es dem Denken dann innewohnen? Wenn das Denken des Denkens doch kein Gedanke ist, (wie) können wir dann dessen gewahr werden, dass wir denken?
Eine berühmte Antwort auf dieses Problem findet sich in Jacobis Briefen an Moses Mendelssohn von 1785. Jacobi hält die Frage nicht nur, wie Schelling, für unbeantwortbar, sondern er erklärt sie sogar für «ungemessene Erklärungssucht»4 hyperbolischen Denkens: «mehr verblendet als erleuchtet.»5 Die Verblendung betreffe den Versuch etwas denken zu wollen, von dem schon im Vornherein klar ist, dass es nicht denkbar ist. Jacobi schreibt:
«Eine Frage, die ich nicht begreife, kann ich auch nicht beantworten, ist für mich so gut als keine Frage. Es ist mir niemals eingefallen, auf meine eigenen Schultern steigen zu wollen, um freiere Aussichten zu haben.»6
Damit schliesst Jacobi aus der Einsicht in die Unbeantwortbarkeit auf die Sinnlosigkeit der Frage. Anschliessend vollführt er ein besonderes Kunststück: Anstatt weiter auf der Denkbarkeit des Undenkbaren zu pochen, gleich als wollten wir auf die «eigenen Schultern steigen» (s. o.), rettet sich Jacobi aus der vertrackten Situation durch einen Salto mortale: «ein[en] Sprung ins Leere […], dahin uns die Vernunft nicht folgen kann.»7 Dieser Luftsprung der Art Kopfunten solle uns von der Sphäre des Denkens in eine Sphäre des Vernehmens, einer besonderen Art des Wahrnehmens, katapultieren.8 Was dann vernommen wird, das bleibt freilich gedankenlos – man könnte es vielleicht als pulsierende Sehnsucht beschreiben, oder als begriffslose Fiebrigkeit.9
Von ähnlicher Fiebrigkeit wie Jacobi zeugen auch Ansätze des zwanzigjährigen Schelling. In der 1795 erschienenen Schrift Vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen argumentiert er, dass das Denken des Denkens nicht im gegenstandsbezogenen, vermittelten Denken vonstatten gehen kann, sondern dass dies in unmittelbarer Weise geschehen müsse.10 Das unmittelbare Erfassen heisse Anschauen. Nun könne das Denken aber nicht sinnlich angeschaut werden, da es sonst zum Gegenstand bedingt wäre.11 Deshalb, so der junge Schelling, habe die Anschauung nicht sinnlich, sondern intellektuell zu sein, damit die anschauende Person über alle denkbaren Inhalte hinaussehen könne. Die Frage ist freilich: Wie kommen wir überhaupt dazu, irgendetwas intellektuell zu schauen, das keine inhaltliche Bestimmung hat? Schellings frühe Antwort (er wird sie später revidieren) erinnert an Jacobi: theoretisch sei das Problem des Übergangs «unauflöslich».12 Oder in einem Slogan zusammengefasst: «Vom Unendlichen zum Endlichen – kein Uebergang!»13 Aber der so konzeptualisierte, übergangslose Sprung ins Reich der Gedankenlosigkeit hat einen Haken.
Das Problem ist: Setzen wir das Dass als allem Denken vorausgehend, dann ist es immer schon verloren. So ist mit ihm in Gedanken gar nichts anzufangen.14 Denn jedes Anfangen müsste den Punkt des Anfangs finden, aber gerade dies geht nicht, wie wir gesehen haben: weil der Anfang dann bereits Fortsetzung, also nicht mehr anfänglich wäre. Walter Schulz hat eine ähnliche Grundproblematik klarsichtig als Antinomie formuliert: Die These besagt, dass das Dass alles Denken bestimmt, durchwaltet, und ihm daher ursprünglich ist, weil es von keinem Gedanken abstrahiert werden kann. Die Antithese behauptet, dass dieses alles durchwaltende, ursprüngliche Dass selber jenseits des Denkens liegen muss bzw. «in sich selbst nicht festgestellt werden [kann].»15 Das Paradox besteht demnach in der Ursprünglichkeit dieses Zusammenhangs, dass wir uns des Denkens gewahr werden müssen, aber nicht (im Denken) gewahr werden können. Also gehören die Einsicht, dass das Denken nicht zum Gedanken werden kann, und die Einsicht, dass kein Gedanke jemals wahrhaft anfänglich ist, ursprünglich zusammen.16 Oder wie eingangs formuliert: Die Nichtanfänglichkeit des Denkens ist dem Denken ursprünglich. Aus demselben Grund ist es nicht möglich, wie der junge Schelling glaubte, das Denken in irgendeiner unmittelbaren Weise zu schauen oder zu vernehmen. Denn zum unmittelbaren Einssein mit sich, also zum Denken seines Anfangs, müsste das Denken Jacobis Kunststück vollführen und aufhören zu denken. Mit demselben Akt aber, dem Salto mortale aus dem Denken hinaus, entgleite auch das factum, dass wir denken. Ohne einen gehaltvollen Gedanken zu haben kann von keinem Denken die Rede sein. Hegel hat Jacobis «Leere, […] dahin die Vernunft nicht folgen kann» (s. o.) bekanntlich eine Nacht genannt, in der alle Kühe schwarz sind: blinde Naivität, Gedanke ohne Inhalt.17 Denn was sich ohne Unterschied zum Dass vollzieht, das kann nicht ins Bewusstsein eindringen. Ein Denken, welches das Faktum seines Vollzugs ins Undenkbare versetzt, bleibt in unterschiedsloser Dunkelheit gefangen.18 Jacobi und der junge Schelling haben also die Frage gestellt, aber ohne sie zu beantworten: Wie können wir eines Faktums gewahr werden, das nicht gedacht werden kann?
Die Antinomie hebt sich auf, wenn wir die Frage umkehren. Die Frage zielt dann nicht auf ein im Dunkel liegendes Faktum des Denkens. Vielmehr müssen wir sie so verstehen, dass sie vom Denken herkommt – also so, dass Fragen Ausdruck der Nichtanfänglichkeit des Denkens ist. Und das ist einsichtig: Fragen ist dasjenige Denken, das nicht bei sich ankommen kann, sondern von sich wegführt. Auf diesem Weg gilt weiterhin, dass das Dass nicht ins Denken eintritt. Aber dessen gewahr zu werden verlangt keinen Salto mortale. Verstehen wir nämlich die Frage nach dem Faktum des Denkens als Ausdruck des Denkens, so ist die Einsicht in die Ohnmacht, sich selbst ganz zu fassen, zugleich dessen adäquates Selbstverständnis.19 Das Selbstverständnis des Denkens besteht dann in der Selbstbegrenzung, also gerade in der Einsicht, die gestellte Frage nicht beantworten zu können. Das war auch der spätere Vorschlag Schellings. Er stellt damit Jacobi sozusagen im Salto nach der Art Kopfunten wieder auf seine Füsse: Schelling beantwortet die Frage, indem er ihre Beantwortung zwar nicht für sinnlos, aber für unmöglich erklärt.
Demzufolge kennt das Denken des Denkens durchaus eine adäquate Bestimmung. Es muss freilich eine Bestimmung sein, die etwas als undenkbar bestimmt. Das ist eine negative Bestimmung. Negativ, weil sie kein Vermögen, sondern die Einsicht in das Unvermögen des Denkens ist, sich selbst ganz zu begreifen. Sobald diese Negativität aber ausdrücklich wird, erhält sie Bestimmtsein. Die Bestimmung lautet auf ebendiese Negativität, dass der Anfang nicht in das Denken eintreten, und auch die letzte Affirmation das Denken nicht zum Gegenstand machen kann. Sofern aber das Denken selbst es ist, das sich denken will, ist dieses negative Ergebnis ebenso ein Gewinn: Der Gewinn lautet auf die Ausdrücklichkeit der Tendenz des Denkens, sich im Frageprozess weiter auf das hin zu entwerfen, was es nicht schon weiss. Denn ein Denken, das sich negativ bestimmt, ist ein Denken, das nie abgeschlossen ist. Es drängt zu weiterer Entfaltung. So gewinnen wir mit Schellings Negativitätsthese ein positives Selbstverständnis des Denkens als Entwurfsprozess: ein Denken, das von sich wegführende Fragebewegung ist, welche sodann im Unverstandenen auch ein Selbstverständnis ist. Das Selbstverständnis aber kann die Grenze des Denkens nicht «überspringen», weil dieser Sprung das Denken liquidieren würde – es wäre also nichts mehr da, was zu sich kommen könnte. Vielmehr kann das Denken nur in der Einsicht zu sich kommen, bei sich nicht stehenbleiben zu können. Und damit können wir endlich den Anfang einer Untersuchung des Denkens charakterisieren: die anfängliche Bestimmung ist unstimmig, denn das Denken überhaupt ist Dissonanz. Es ist ein Auseinanderklingen, das nach Auflösung strebt. Aber Einklang ist im Denken nicht möglich. – Dies färbt alle weiteren Denkbestimmungen ein.
Das Denken ist dissonant. Das heisst: Es ist Einspruch gegen das Denken. So fällt das Denken des Denkens zwar aus dem Denken heraus, aber ohne damit zusammen zu fallen. Das Denken selbst fällt aus dem Denken, weil es dasjenige im Denken ist, was nicht gedacht werden kann. Aber es fällt nicht damit zusammen, kannnicht damit zusammenfallen, weil es nicht unabhängig vom Denken vorstellbar ist. Es ist kein Akt, auf den das Denken am Ende «herabsehen» könnte. Das Denken als Dissonanz zu begreifen heisst vielmehr, es immer nur im Denken präsent machen zu können, und das heisst, als Weiterdenken. Alles Weiterdenken artikuliert sich in Fragen. Denn eine Frage beginnt dort, wo wir etwas nicht verstehen. Das Denken des Denkens, das wir nie verstehen können, ist deshalb die Frage schlechthin. Diese Frage, die negative Einsicht des sich nicht denken könnenden Denkens, treibt das Denken in Fragebewegungen voran. Die Frage ist das Denken, an dem das Denken sich allein dadurch, dass wir denken, stösst.
Daraus folgt zweierlei. Erstens ist die Negativität des Denkens, um mit einem Wort Adornos zu sprechen: «unbeirrt.»20 Unbeirrt ist Negativität, wenn sie sich nicht darin erschöpft, im Negativen zu verharren. Der Einspruch des Denkens gegen die Denkbarkeit seiner selbst ist ebenso ein Einspruch dagegen, dass diese Undenkbarkeit eine positive Einsicht sei, also eine gleichgültige Feststellung, dass das Faktum des Denkvollzugs ausserhalb des Denkens liege. Vielmehr ist der dissonante Anfang auch Widerstand dagegen, «das Negative selbst zu einem Letzten zu machen.»21 Denn das Negative zum Letzten zu machen würde einen Sprung Kopfunter ins Undenkbare verlangen. Dieser Sprung ins Undenkbare streiche aber ebenso das Undenkbare durch, weil dieses den obigen Begriffen zufolge gerade darin besteht, einen Gedanken zu haben. Würde das Denken aufgegeben, verlöre der Terminus des Undenkbaren den Sinn. Damit hängt, zweitens, zusammen, dass die Negativität des Denkens nicht nur einen Gedanken betrifft, sondern alles Denken, das überhaupt möglich ist. Denn kein Gedanke könnte gedacht werden, ohne dass er gedacht wird.
Hieraus ergibt sich eine Korrektur der anfänglichen Fragestellung: Die Negativität unbeirrten Fragens ist dem Denken nicht nur ursprünglich, sondern macht ebenso den Fortgang des Denkens aus.22 Wir können die Negativität somit das Prinzip des Denkens nennen.23 Das Prinzip lautet: Das Denken ist bei sich selbst, wenn es ausser sich ist. Es ist in sich gegen sich, «Übergang-in-sich-in-Anderes oder -in-Anderes-in-sich.»24 Die lateinische Übersetzung des griechischen Wortes für «Anfang» konserviert diesen sachlichen Zusammenhang: Der Anfang einer Untersuchung über das Denken ist kein zeitlicher Anfang, sondern ἀρχή, also ein ursprünglicher Widerstreit.25 Deshalb, weil er nicht nur ein zeitlich Erstes, sondern ein Ursprüngliches26 ist, macht er auch das principium des Fortgangs aus: Er kennt kein gleichgültiges Abseits, sondern ist gegenwärtig nur im Motiv des fragenden Weiterdenkens; er
«bedarf der Entfaltung. Auch Musik, und wohl jegliche Kunst, findet den Impuls, der jeweils den ersten Takt beseelt, nicht sogleich erfüllt, sondern erst im artikulierten Verlauf.»27
Die zu Beginn festgestellte Nichteinholbarkeit des Denkens ist also kein Defizit. Sie ist dem Denken ursprünglich und somit Strukturmoment, das, wie ein Takt im Musikstück, alles Denken durchwaltet. Und fast wie Musik, welche gespielt werden will, verlangt auch das Denken nach seiner denkenden Artikulation oder «Entfaltung». Ich werde auf diese Struktur als auf die Impulsivitätdes Denkens referieren.
§2Denken in der Krise
Der Impuls des Denkens besteht darin, dass sich das Denken nie ganz, sondern immer als sein anderes hat. Das impulsive Denken ist demnach ein Denken, das wesentlich im Konflikt mit sich selber steht. Das ist im eigentlichen Wortsinn ein Denken in der Krise (κρίσις) – ein Denken in der Scheidung von sich in Anderes.1 Aber das Denken muss erst zu dieser Krise hingeführt werden. Es hat die Krise – und gerade darin besteht die Krisenhaftigkeit – nie ganz. Und so ist die Krise nicht Eigenschaft oder Zustand des Denkens, sondern jenes Tun, welches die Krise herbeiführt. Sie ist also Bewegung, und diese ist selbstbezüglich. Die Krise ist diejenige Bewegung, deren Tun (welches ein Denken ist) sich selber herstellt, weil das Tun Konfligieren mit sich ist. Damit erhält die Krise die weitere Bestimmung einer κριτική τέχνη, also der Kunst und Tätigkeit des Unterscheidens, kurz: der Kritik. Kritik heisst somit der Ursprung des Denkens. Und dieser Ursprung ist, wie wir gesehen haben, eine Fragebewegung. Folgen wir dieser Bewegung, so gilt es nun einen kohärenten Kritikbegriff auszuarbeiten. Was also ist Kritik?
Gehen wir alltagssprachlich vor, so scheint Kritik zunächst eine Tätigkeit zu sein, welche nicht auf das Denken oder dessen Ursprung gerichtet ist, sondern auf Sachverhalte und Tatbestände, die in der Welt stattfinden. (Später werden wir sehen, dass dieser alltägliche Kritikbegriff unzureichend ist.) In der Alltagssprache ist Kritik also eine Haltung, die auf eine Mannigfaltigkeit verschiedener Sachverhalte gerichtet sein kann: Wir kritisieren zum Beispiel Kunstwerke, politische Zusammenhänge, wissenschaftliche Arbeiten etc. Etwas kritisch zu betrachten heisst hier, die Angemessenheit eines Sachverhalts in Frage zu stellen oder zu bewerten. Dazu wird ein bestimmter Massstab an den Sachverhalt herangetragen und überprüft, ob dieser jenem adäquat ist.2 Im ursprünglichen Wortsinn κριτική handelt es sich also um die Prüfung eines Sachverhalts (zum Beispiel im Bereich der Politik oder Kunst) in Hinblick auf einen bestimmten Anspruch oder Massstab (zum Beispiel der Mündigkeit, Emanzipation, Schönheit etc.). Man könnte auch sagen, Kritik bewertet eine Sache hinsichtlich eines Interessens. Dies besagt zunächst nichts anderes, als dass sie einen Anspruch an die Rechtmässigkeit eines Sachverhalts stellt. Durch diesen Anspruch unterscheidet sich eine kritische Untersuchung von anspruchsloseren Verfahren: Neben der neutralen Beschreibung des Gegenstandes artikuliert sie auch eine Wertung hinsichtlich dessen, was der Gegenstand zu sein habe.
Im Alltäglichen bedeutet Kritik zu üben: etwas anhand bestimmter Kriterien auf seine Rechtmässigkeit hin zu überprüfen. Dadurch wird die Geltungsmacht der kritischen Untersuchung konstatiert. Denn im Gegensatz zu neutralen Beschreibungen involviert Kritik, wie gesagt, eine Wertung anhand von Untersuchungskriterien. Das heisst, alltägliche Kritik nimmt eine bestimmte Perspektive auf etwas ein und verlangt so einen Standpunkt, ein kritisches Subjekt, welches den Massstab der Kritik bestimmt. Folglich ergibt sich ein Auseinanderfallen von kritisierender Instanz (Subjekt) und kritisiertem Gegenstand (Objekt).3 Das führt zu einer Reihe von Problemen.
Damit Kritik ihrem Anspruch der Überprüfung gerecht werden kann, muss das Subjekt den Massstab begründen können. Könnte das Subjekt die eingenommene Perspektive auf einen Gegenstand nicht begründen, so wäre Kritik überhaupt nicht kritisch, sondern nur wieder die anspruchslose Beschreibung individuellen Gutdünkens. Setzt aber das kritische Subjekt zur Legitimation des Massstabs wiederum einen anderen Massstab, so kann dieser von einem weiteren Standpunkt aus kritisiert werden und so fort ad infinitum. Aus systematischer Perspektive kann kein Anspruch sinnvoll erhoben werden, wenn er vom Werterelativismus erstickt wird. Hält hingegen das kritische Subjekt autoritär an der Rechtmässigkeit der gesetzten Kriterien fest, ohne diese zu begründen, so schrumpft Kritik zum Dogma. Dies aber mündet in einem Zirkel: Kritik kann nicht als Dogma gedacht werden, wenn der kritische Impuls darin besteht, das Gegebene oder Gemeinte auf dessen Rechtmässigkeit hin zu befragen. Vermöge des kritischen Impulses erscheint jedes Dogma immer schon als Moment von Kritik. So bleibt, wie es scheint, nur der Abbruch des Verfahrens. Aber an welchem Punkt der kritischen Untersuchung wäre ein solcher Abbruch legitim? – Offenbar an keinem: Denn jeder Abbruch unterliegt der Möglichkeit von Kritik. Oder er hebelt (ähnlich wie im genannten Zirkel) das kritische Prinzip als solches, d. i. den Rechtsanspruch der Untersuchung aus.4
Doch wie liesse sich der kritische Anspruch dann erfüllen? Alle drei Optionen: infiniter Regress, logischer Zirkel, Abbruch des Verfahrens, legen ja die Unmöglichkeit einer kompromisslosen Durchführung von Kritik nahe. So scheint es, dass Kritik die Möglichkeit ihrer Durchführung selber bezweifelt. Sie stellt die Frage: Wie ist Kritik möglich? Diese Frage ist nicht einfach abzuwenden, denn: Lassen wir den kritischen Anspruch fallen, leugnen wir nicht nur die überall praktizierte Kritik, sondern wir drohen wieder mit Jacobi Kopfunter zu fallen und den Boden des Denkens zu verlieren. (§1) Die Frage nach der Möglichkeit von Kritik drängt sich auf, weil wir denken können, dass wir denken, und das heisst soviel wie dies: dass wir überhaupt denken. Das blosse, denkend nicht einzuholende Faktum des Denkvollzugs reicht aus, das Denken zu entzweien, in die Krise zu führen und einen kritischen Anspruch an das denkende Subjekt zu stellen. – Hier wird bereits sichtbar, dass im Begriff «Kritik» ein normatives Motiv wirksam ist, welches Kritik weit über die individuelle Haltung einer Person hinaus auch als die allgemeine Pflicht ausspricht, die uns allein durch das Faktum aufgegeben ist, dass wir denken.5 – Wenn aber dieser mit dem Denken überhaupt erhobene kritische Anspruch nicht schon im Vornherein für aussichtslos gehalten werden soll, das heisst, wenn Kritik möglich ist, dann verlangt das Kriteriumproblem nach einer Lösung.
Das Problem zu lösen ist von dessen Auflösung zu unterscheiden: In einer Auflösung verflüchtigt sich eine Struktur. Wie ein Stück Zucker in heissem Kaffee würde sich das vorliegende Problem auflösen, wenn der Kritikbegriff als widersprüchlich anerkannt würde: Wir müssten dann schliessen, dass Kritik nicht möglich ist und den kritischen Anspruch fallenlassen. Wenn aber Kritik möglich ist – und diese Möglichkeit kann sich erst am Ende der Untersuchung erweisen –, so liegt es vielmehr nahe, den kritischen Impuls anders zu begreifen.
§3Die Möglichkeit von Kritik und das Kategorienproblem
Denken ist ein Auseinander-Klingen; Dissonanz, die das Denken daran hindert, bei sich stehen zu bleiben, weil es zu seiner Auflösung drängt. Dieses Streben, welches Resultat und Vollzug des ursprünglichen Denkens ist, habe ich kritische Impulsivität genannt. Das Problem des kritischen Impulses besteht aber darin, dass die Möglichkeit solcher Impulsivität nicht gesichert scheint: Sie hebt sich entweder als Standpunktkritik im Dogmatismus auf, oder ihr Geltungsanspruch geht im Legitimationsregress bzw. willkürlichen Abbruch verloren. (§2) Wenn daher kritisches Denken nicht überhaupt für unmöglich gehalten wird, so kann es offenbar nicht in dem alltäglichen Verständnis bestehen, irgendwelche Missstände herauszustellen, die ihm äusserlich sind. Um den kritischen Impuls legitimieren zu können, muss der kritisierte Gegenstand vielmehr in die Sphäre der kritisierenden Instanz hineingeholt werden. Die Legitimation des Denkens muss vom Standpunkt der kritisierenden Instanz, dem Subjekt selbst erfolgen, sodass Kritik – so die These dieses Kapitels – selbstlegitimierend wird: Soll ihre Geltung gesichert werden, ohne autoritär oder dogmatisch aufzutreten, ist Kritik, wie im Folgenden erklärt, Selbstkritik.1
Kritik ist möglich, sofern Selbstkritik möglich ist. Denn Kritik in der Form von Selbstkritik untersucht nicht nur einen Sachverhalt, sondern setzt die Untersuchung ins Verhältnis zu den Bedingungen, unter denen sie erfolgt. Mit anderen Worten: Das Subjekt der Selbstkritik untersucht nicht etwas Äusseres, sondern die eigene Möglichkeit, die Möglichkeit der kritischen Untersuchung. Dieses Verständnis von Kritik geht auf Kants Kritik der reinen Vernunft zurück.2 Kants Kritik ist radikal – eben nicht nur in dem etymologischen Sinne, dass sie beliebige Sachverhalte ihrer Geltung entwurzelt und sie als Irrtümer entblösst –, sondern weil sie ein Verfahren ist, das die eigene Geltungsmacht voraussetzungslos ins Offene zu stellen sucht. Selbstkritik handelt dann von den Irrtümern, welche in die Tätigkeit der Kritik fallen. Jeder Gegenstand von Selbstkritik wird hiernach als Reflex des kritisierenden Subjekts kenntlich und so in die subjektive Sphäre eingeholt. Das hat Folgen.
Geht das selbstkritische Denken zum Gegenstand aus, so ist es darin auch Rückkehr in sich. Denn gefragt ist nicht nur die Rechtmässigkeit des Gegenstands anhand irgendwelcher Kriterien, sondern die Möglichkeit, solche Kriterien anzusetzen, ohne im Regress oder Dogmatismus zu enden. Ein solches selbstkritisches Denken, das die Möglichkeit der Selbstlegitimation sucht, heisst transzendental. Kant unterscheidet transzendentale Kritik von der allgemeinen oder nur formalen: Während es in einer formalen Überlegung um die Stimmigkeit eines Gedankens unter Abstraktion seines Inhalts geht, ist die transzendentale Kritik auf einen Gegenstand gerichtet. Aber sie fragt nicht nach der Besonderheit des Gegenstands, sondern nach den allgemeinen Bedingungen, unter denen er als diese Besonderheit erscheint.3 Das bedeutet, transzendentale Überlegungen begründen nicht einzelne Objektivitätsbezüge. Schliesslich entsteht durch Überlegen allein noch nicht notwendigerweise etwas Objektives – transzendentale Kritik kreiert keine Objekte. Und doch hat sie ihrem Anspruch nach das Objektive «im Blick».4 Wie ist das zu verstehen?
In der Einleitung zur Logik schreibt Hegel dazu Folgendes:
«Dieses objective Denken ist denn der Inhalt der reinen Wissenschaft. Sie ist daher so wenig formell, sie entbehrt so wenig der Materie zu einer wirklichen und wahren Erkenntnis, dass ihr Inhalt vielmehr […] die wahrhafte Materie ist, […] der die Form nicht ein äusserliches ist, da diese Materie vielmehr der reine Gedanke […] ist.»5
Das «objective Denken» ist ein Denken, das Objektives im Sinn hat. Objekte im Sinn zu haben bedeutet nicht Objekte zu bestimmen. Objekte zu bestimmen ist Aufgabe der Standpunktkritik. (§2) Sie untersucht zum Beispiel einen politischen Zusammenhang auf die Frage der Emanzipation hin. Dagegen setzt Selbstkritik nicht primär konkrete Kriterien an, deren Rechtmässigkeit wieder anhand eines anderen Kriteriums demonstriert werden müsste usf. Inhalt von Selbstkritik ist in erster Linie die Rechtmässigkeit der angesetzten Kriterien: Legitimität dessen, Sachverhalte anhand bestimmter Kriterien kritisieren zu können. – Wenn aber Selbstkritik nicht vor allem konkrete Kriterien, sondern sich selbst bzw. die eigene Möglichkeit untersucht, so läuft sie Gefahr, im Kreisen in und um sich selbst allen Gehalt auszuhöhlen. Sie droht leer und bedeutungslos zu werden.
Der Zirkeleinwand beruht auf einem Missverständnis: Kritik «entbehrt so wenig der Materie», wie Hegel oben schreibt, «dass ihr Inhalt vielmehr […] die wahrhafte Materie ist.» Zwar bestimmt Selbstkritik nicht nur konkret vorliegende Gegenstände. Aber sie ist der Materie gegenüber nicht gleichgültig, sondern beansprucht deren Objektivität. Der Anspruch beinhaltet – darin liegt die Crux–, die Struktur einer Sache in subjektiver Hinsicht darzulegen.6 Subjektiv freilich nicht im persönlichen Massstab, sondern als die Möglichkeit, legitime Objektivitätsansprüche zu erheben. Im Unterschied zur formallogischen Überlegung handelt Selbstkritik also nicht von abstrakten Beziehungen variabler Inhalte, sondern vom Inhalt. Sie «hebt die Weltbezogenheit des Denkens nicht auf, sie hebt nur die Unmittelbarkeit dieser Weltbezogenheit auf»7





























