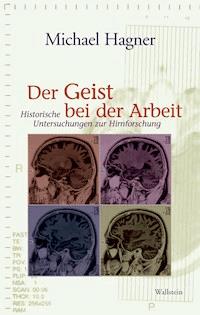Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das gedruckte Buch galt lange Zeit unangefochten als das wichtigste Organ geisteswissenschaftlicher Forschung. Doch in den letzten Jahren ist ein ganzes Gefüge von Medien, Werten und Praktiken in Bewegung geraten. Mit den Möglichkeiten digitaler Forschung und Kommunikation sowie Forderungen nach einer Standardisierung von Publikationen wirkt das Schreiben und Drucken von Büchern bisweilen fast wie ein Anachronismus mit begrenzter Lebensdauer. Die Kritik am gedruckten Buch offenbart ein Stück Kulturkritik, die ihr Unbehagen an der Gegenwart mit einer übertriebenen Erwartung an die technischen Möglichkeiten des Digitalen verbindet. Anstatt die unterschiedlichen Stärken von Papier und Digitalisat hervorzuheben und zu fragen, wo mögliche Synergien liegen könnten, wird ein rivalisierender Gegensatz zwischen beiden postuliert, der eine Entscheidung verlangt. In seinem neuen Buch verbindet Michael Hagner seine Analyse der digitalen Kulturkritik am Buch mit einer gründlichen Betrachtung von Open Access. Dabei durchleuchtet er auch jenes Phänomen, das für die gegenwärtige Krise des Buches mit verantwortlich ist: das unübersehbare Angebot an wissenschaftlicher Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Hagner
Zur Sache des Buches
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2015www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus der AldusUmschlaggestaltung: Günter Karl BoseDruck und Verarbeitung: Pustet, Regensburg
ISBN (Print) 978-3-8353-1547-1ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2785-6ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2786-3
Im Andenken an meine Mutter
Annemarie Hagner (1927-2013),
der ich alles zu verdanken habe.
Inhalt
Einleitung
Kulturkritik und mediale Heilserwartung
Der Untergang des Buches nach dem Ersten Weltkrieg
Das Buch am Ende der Gutenberg-Galaxis
Buchkritik digital
Bibliophobie in den Geisteswissenschaften
Alles umsonst? Open Access
Aufklärung, Utopie und Technologie: Der Budapester Appell
Science Sells oder: Die Geschichte der Wissenschaftsverlage
Der Gewinn an Bequemlichkeit ist ein Verlust an Freiheit
Open Access als Geschäftsmodell
Lost between common and commodity
Vom Buch zum Buch
Das Goldene Zeitalter des geisteswissenschaftlichen Buches
Überforschung
Das offene Buch
Lesen ist eine Kulturtechnik
Epilog: Warum Bücher?
Nachbemerkung
Anmerkungen
Einleitung
Es ist nicht so, daß allgemeine Lesefähigkeit und Bildung stets das Wohlgefallen frühzeitig pensionierter Philologieprofessoren gefunden hätten. »Noch ein Jahrhundert Leser – und der Geist selber wird stinken. Dass jedermann lesen lernen darf, verdirbt auf die Dauer nicht allein das Schreiben, sondern auch das Denken.«1 Mit diesen oft zitierten Sätzen aus Also sprach Zarathustra hat Nietzsche seine vielfach variierten Attacken gegen die Verwässerung der Bildung und gegen eine massenhafte Verbreitung des Wissens zum Problem der geistigen Produktivität selbst gemacht. Schlechte Leser in Legion, so die Befürchtung, haben einen Rückkopplungseffekt auf diejenigen, die das geistige Leben gestalten, und das führt zum Erlahmen von eigenständigem Denken, Kreativität und Urteilskraft.
Nietzsches grimmige Prognose aus dem 1883 veröffentlichten ersten Teil des Zarathustra ist nicht seine erste Wortmeldung zur Misere des gelehrten Schreibens und Denkens. Zehn Jahre zuvor, noch im Basler Professorenamt, nimmt er sich in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung jenen Mißbrauch von Geschichte »als kostbaren Erkenntniss-Ueberfluss und Luxus« vor, der eine ganze Kultur mit der »historischen Krankheit« infiziert.2 Die Gegenwart krankt aber nicht bloß an einer Übersättigung mit Geschichte. Orientiert an seinem Vorbild Schopenhauer, der die zunehmend spezialisierten Wissenschaften direkt in den Hafen des Fachidiotentums einfahren sah,3 lenkt Nietzsche den Blick auch auf die allgemeinere Frage, welchen Nutzen oder Nachteil Wissenschaft und Gelehrsamkeit für das Leben haben, und zwar in einer historischen Situation, da sie sich besonderer Pflege und Förderung erfreuen. Die Diagnose fällt ebenso frostig wie die Prognose aus: »Gut, die Wissenschaft ist in den letzten Jahrzehnten erstaunlich schnell gefördert worden; aber seht euch nun auch die Gelehrten, die erschöpften Hennen an. […] Gackern können sie mehr als je, weil sie öfter Eier legen: freilich sind auch die Eier immer kleiner (obgleich die Bücher immer dicker) geworden.«4
Bevor der Geist anfängt zu stinken, werden die Erkenntnisse bei gleichzeitigem Anschwellen der Bücher immer dürftiger. Damit ist das Buch selbst zum Indikator für den Gesundheitszustand des wissenschaftlichen Lebens geworden, das ausgerechnet in einer Phase üppiger staatlicher Zuwendungen in geistiger Adipositas zu erstarren droht, weil eben auch mit großzügiger Förderung die guten Ideen nicht beliebig vermehrt werden. Verantwortlich sind aber nicht nur die allzu verwöhnten Gelehrten, sondern auch die Popularisierung der Wissenschaft, »das berüchtigte Zuschneiden des Rockes der Wissenschaft auf den Leib des ›gemischten Publicums‹«. Aus diesem Publikum rekrutieren sich Leser, die das Buch mehr oder weniger ruinieren. In den nachgelassenen Entwürfen für die Unzeitgemässen Betrachtungen heißt es flankierend: »Jetzt weiß kein Mensch, wie ein gutes Buch aussieht, man muß es vormachen: sie verstehen die Composition nicht. Die Presse ruiniert dazu immer mehr das Gefühl.«5
Man braucht keine weiteren Zitate aus Nietzsches zahlreichen kritischen Einwürfen in die Bildungsdebatte seiner Zeit heranzuziehen, um zu verstehen, daß er die verlorene Qualität wissenschaftlicher Bücher als Indikator für die Verdorbenheit des intellektuellen juste milieu ansieht. Anders als Schopenhauer, für den unabhängig von der jeweiligen historischen Situation nur ein Bruchteil der geistigen Produktion Anspruch auf Originalität erheben kann – in diesem Sinne spricht er von einer »Unzahl schlechter Bücher«6 –, blickt Nietzsche mit Argusaugen auf die geistigen, materiellen und institutionellen Entwicklungen, an denen er selbst teilnimmt. Seine historische Standortbestimmung des Buches fügt ganz unterschiedliche Aspekte zusammen: den durch die Universität vermittelten Hang zu lebensferner Gelehrsamkeit; übertriebene staatliche Wissenschaftsförderung; durch äußere Anforderungen über die Maßen in Anspruch genommene Gelehrte; ungeübte und verbildete Leser; grassierende Populärwissenschaft und das Regime einer von Journalisten geprägten »Pseudokultur der Gegenwart«.7 Wer seiner Zeit ein so schlechtes Zeugnis ausstellt, kann auch der Buchkultur keine gute Note erteilen, denn wenn die Leser immer schlechter werden, werden die Bücher es auch. Und umgekehrt.
Nietzsches diagnostischer Scharfsinn und sein Gespür für Fehlentwicklungen sind nicht zu trennen von einem pathosanfälligen kulturkritischen Gestus, mit dem er seine Gefechte führt. Und doch ist es verführerisch, seine These, wonach guten Büchern zwischen unlesbaren Traktaten und allzu lesbaren Textmischungen die Luft abgedrückt wird, als Ausgangspunkt für eine Analyse zu nehmen, die sich mit dem so häufig beschworenen Untergang einer bedrohten Spezies namens gedrucktes Buch befaßt. Zwar wird man nicht im Ernst argumentieren wollen, daß es nach Nietzsches Tod kaum noch gute Bücher gegeben habe, doch immerhin benennt er drei miteinander verwobene, allerdings unabhängig voneinander zu identifizierende Aspekte, die den Blick auf unsere Gegenwart strukturieren könnten: Medienrivalität zwischen gedrucktem Buch und Tagespresse, Änderung der Lesekompetenzen und immanente Probleme in den Wissenschaften selbst.
Medienhistorisch gesprochen, ließe sich ein Teil von Nietzsches Befund darauf reduzieren, daß er das Medium Buch durch das Medium Zeitung bedroht sieht. Es ist ein in der Medien- und Technikgeschichte bekannter Gestus, daß es bei Einführung eines neuen Mediums mit größerer Reichweite zu Irrelevanz- oder gar Verlustängsten der Anhänger des alten Mediums kommt: Die Fotografie bedroht die Malerei, der Film die Fotografie, das Fernsehen wiederum den Film und das Internet schließlich das Fernsehen. Davon ist das gedruckte Buch nicht ausgenommen. 1994 finanzierte das Rank Xerox Research Center eine Konferenz mit exquisiten Teilnehmern wie Umberto Eco, Régis Debray oder Michael Joyce, bei der die Frage nach der Zukunft des Buches sich darauf zuspitzte, ob es überhaupt noch eine habe.8 Seit diesen neunziger Jahren, seit World Wide Web und all seinen Konsequenzen wird Marshall McLuhans Kerze mit der Inschrift vom Ende des Gutenberg-Zeitalters unermüdlich durch die Lande getragen. »Print is dead« lautet der Titel eines 2007 erschienenen schlichten Pamphlets,9 dessen zentrale Aussage auch von seriöseren und einflußreicheren Zeitgenossen wie dem langjährigen Direktor des MIT Media Lab Nicholas Negroponte oder dem Journalist Jeff Jarvis wiederholt wird.10 Inzwischen ertönt das Totenglöcklein so häufig, daß sich manche Kommentatoren bereits darüber lustig machen, wenn das Buch gerade wieder mal für tot erklärt worden ist.11
Sucht man nach Begründungen für das Ende des Buches, so geht es um die neuen, digitalen Lesegeräte, die in Eleganz und Bequemlichkeit dem Papier überlegen sind; um die mangelnde Flexibilität des gedruckten Buches; um das Einsparen von Papier und andere, effektivere Speicherformen; um neue kulturelle Distinktionsmerkmale, die eine umfangreiche Bibliothek eher als verstaubte Skurrilität denn als Zeichen von Bildung erscheinen lassen; um neue Textformen, die Texte nicht mehr nur um Fußnoten, sondern um sogleich abrufbare Metadaten bereichern – Daten, die neben Texten auch Bilder, Filme oder Musikstücke enthalten können; oder auch um neue Schreibformen, bei denen Texte in direkter Interaktion mit Lesern entstehen.12
Diese Aufzählung muß unvollständig bleiben, zumal alle paar Wochen irgendwelche neuen Aspekte hinzutreten, aber man sieht, es ist nicht schwer, sich zu der Annahme verleiten zu lassen, das gedruckte Buch werde in ein paar Jahrzehnten vielleicht nicht ganz verschwunden sein wie Schellackplatte, Schreibmaschine und floppy disc, aber doch nicht mehr als eine exklusive Nischenexistenz führen wie heutzutage vielleicht Produkte aus dem Manufactum-Katalog, der einer ausgewählten, auf Distinktion bedachten Käuferschaft die guten Dinge näherbringt. Es kann soweit kommen, aber darauf wetten möchte ich nicht. Nach wie vor gilt, was Michael Giesecke bereits vor Jahren notierte: »Der Aufstieg der elektronischen Medien wird als das Ende der Buchkultur erlebt – obwohl niemals mehr Bücher gedruckt und vielleicht auch gelesen wurden als gerade heute.«13 Das legt nahe, daß das Ende der Buchkultur eher ein gefühltes als ein reales ist, ein rheumatischer Schub gewissermaßen, der auch wieder vergeht.
Ein Blick in die entsprechenden Publikationsorgane der Verlagsbranche oder auch ein einziger Besuch bei der Frankfurter Buchmesse genügen, um festzustellen: Jeder, der sich in der Buchbranche auskennt, räumt bereitwillig ein, nicht zu wissen, was in den nächsten Jahren passieren wird. Diese Unsicherheit macht die Akteure der Branche nervös, weil Planungen und Investitionen erschwert werden. Beispielsweise weiß kein geisteswissenschaftlicher Verlag, ob es sich auf Dauer rentiert, allzuviel Geld in die Pflege des E-Book-Geschäfts zu stecken, und wenn, dann nur in bestimmte Segmente. Das Vertrauen in die Kaffeesatzleserei der Lobbyisten der Internetbranche könnte schneller zur Insolvenz führen als eine besonnen agierende Verlagspolitik. Auch ist die Anzahl an produzierten Büchern – darunter etliche herausragende – so groß, daß es mit dem gedruckten Buch kaum so schnell vorbei sein dürfte. Daß die Schwelle von 100.000 deutschsprachigen Neuerscheinungen pro Jahr möglicherweise nicht erreicht wird – die Zahlen 2012 rückläufig waren, 2013 wieder etwas nach oben gingen –, dürften zumindest diejenigen mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen, die ein stetiges Wachstum des Buchmarkts für verhängnisvoll halten, weil sie Qualität vor Quantität setzen.14
Technologische Innovationen allein führen nicht notwendigerweise zum Untergang von Dingen und Kulturtechniken. Gewiß haben Eisenbahn und Auto die Postkutsche, Heizungen den Kamin und Kohleofen weitgehend ersetzt. In der Geschichte der Medien ist es nicht so einfach. Der Aufstieg der Tageszeitungen, der erst nach Nietzsches Tod so richtig einsetzte, hat ebensowenig wie das Aufkommen von Massenmedien wie Radio und Fernsehen das Buch sonderlich unter Druck gesetzt. Auch die Einführung des für breite Leserschichten konzipierten preiswerten Taschenbuchs hat zwar vieles verändert, aber nicht zum Aussterben schöner, aufwendig gestalteter Bücher und der Buchkultur überhaupt geführt. Das hat bislang auch die globale Durchsetzung des Digitalen inklusive einer im dunkeln liegenden Anzahl von legalen oder illegalen Downloads nicht vermocht. Wie verhält es sich dann mit dem »stinkenden Geist«, mit den unliebsamen Auswirkungen der Popularisierung und des Medienwechsels, die die Buchkultur angeblich nachhaltig beschädigen? Ist das eine Übertreibung, die sich an ihrer eigenen Kritik berauscht? Nietzsche war für solche Temperaturerhöhungen mehr als anfällig, aber man wird seine Intuitionen nicht so schnell beiseite schieben, wenn man sich vergegenwärtigt, daß er nicht bloß das Publikum und die Medien im Visier hat, sondern auch Lesegewohnheiten und immanente Probleme der Wissenschaften selbst, und die haben erhebliche Auswirkungen auf die Foren, Formen und Formate des Publizierens.
In diesem Buch geht es vor allem um eine Aktualisierung von Nietzsches Frage: Wie steht es um Gegenwart und Zukunft des geisteswissenschaftlichen Buches? Darunter verstehe ich keineswegs bloß jene gelehrten Werke, denen man – um noch einmal Nietzsche zu beanspruchen – den Buckel, die »krummgezogene Seele« des Gelehrten ansieht.15 Solche Bücher, die im Elfenbeinturm der Gelehrsamkeit zu Hause sind, außerhalb dessen jedoch sofort die Orientierung verlieren, haben im 19. Jahrhundert das Ansehen der Geisteswissenschaften mitbegründet. Auch heute noch wird vielfach erwartet, daß man wenigstens ein solches Buch geschrieben hat, um in der Gelehrtenrepublik Fuß zu fassen. Vor einigen Jahrzehnten fand jedoch eine Verschiebung der Werte statt. Seitdem gilt ein Buch in einem herausragenden Verlag wie University of Chicago Press, Beck oder Gallimard in den Geisteswissenschaften ebenso viel wie zwei oder drei Publikationen in Nature oder Science. Doch bei diesen Verlagen landet nur, wer in der Lage ist, ein Buch für ein Publikum jenseits des engen Spezialistenkreises zu schreiben. Wenn man so will, ist der Anspruch an Stil und Lesbarkeit auch Bestandteil einer Demokratisierung des Wissens, die Fachleute und neugierige Laien enger zusammenrücken läßt.
Inzwischen haben sich die Bedingungen wiederum verändert, indem wissenschaftliche Forschung und öffentliche Wirkung einem anderen Zeitindex unterstellt sind. Ein elegant geschriebenes Buch, das neue Forschung enthält, benötigt in aller Regel mehrere Jahre, bis es fertig ist. Und es benötigt Zeit, um gründlich gelesen zu werden. Wie Hans Blumenberg einst nach Abschluß seines umfangreichen Buches Arbeit am Mythos an Jacob Taubes schrieb: »Aber das Unglück von Büchern ist, dass sie mit großen Verspätungen fertig werden, noch später zur Kenntnis genommen und nochmals mit Abstand sogar ernsthaft diskutiert werden.«16 Noch größer dürfte freilich das Unglück sein, daß solche Zeitspannen den beschleunigten Kommunikationskaskaden der Gegenwart so gar nicht entsprechen.
Die immer knapper werdende Zeit gehört zu den zentralen Topoi aller Formen von Moderne, und das hat auch die geisteswissenschaftliche Buchproduktion verändert. Mehrbändige Werke, wie sie die Gelehrten einstmals mit bewunderungswürdiger Disziplin ablieferten, sind so gut wie ausgestorben. Für Buchkontinente wie Theodor Mommsens Römische Geschichte oder Georg Mischs Geschichte der Autobiographie hätten heutige Universitätslehrer kaum mehr die Kapazitäten und schon gar nicht die Leser. Historiker schreiben bisweilen immer noch gern umfangreiche Bücher, womit sie ihren Ruf als die Epiker unter den Geisteswissenschaftlern bewahren, aber ansonsten dominiert die (mittel-)schlanke Monographie von ca. 80.000 Wörtern. Dabei entspricht die Vorstellung, daß längere Bücher ohnehin nicht mehr gelesen werden, der ökonomischen Logik, daß solche Bücher auch nicht mehr gekauft werden.17
Der Trend zu solchen Standardisierungen ist in den USA wesentlich ausgeprägter als in Deutschland, was mit den unterschiedlichen sozialen, ökonomischen und wissenschaftlichen Bedingungen akademischen Publizierens zu tun hat. Nach amerikanischen Vorstellungen hat eine geisteswissenschaftliche Monographie eine bestimmte Form und ein bestimmtes Format, ist zumeist von Universitätsangehörigen verfaßt worden und hat einen aufwendigen Peer-Review-Prozeß durchlaufen. Die Idee vom geisteswissenschaftlichen Buch, wie sie hier vertreten wird, ist wesentlich breiter. Sie umfaßt die in wenigen 100 Exemplaren für eine spezialisierte Leserschaft gedruckte Monographie ebenso wie das an ein breiteres intellektuelles Publikum gerichtete wissenschaftliche Sachbuch, einen schlanken Essay von weniger als 100 Seiten ebenso wie eine Sammlung von Notaten, Aphorismen oder Reflexionen, Gesprächs- und Sammelbände ebenso wie Theorietraktate und jene rhizomatischen Textmaschinen, von denen Gilles Deleuze und Félix Guattari träumten.18
Steht es um diese geisteswissenschaftlichen Bücher, die auf dem deutschen Buchmarkt keine 5 % Marktanteil erreichen, so betrüblich, wie Nietzsche glaubte? An ernstzunehmenden kritischen Diagnosen aus unterschiedlichen Perspektiven fehlt es nicht. Jürgen Kaube listet eine ganze Reihe von bedeutenden wissenschaftlichen Büchern der sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts auf, um die bange Frage anzuschließen, ob man aus der Produktion der letzten Jahre auch nur auf 20 Bücher wetten könne, daß sie in 50 Jahren noch bekannt seien. Und er benennt auch Gründe für diese Entwicklung: »Bedenklich ist weniger, dass 2012 nicht annähernd so viele Werke von Rang und Folgenreichtum vorgelegt werden wie 1962, als dass der Betrieb keine Begriffe und Maßstäbe dafür hat. Er misst in verausgabten Forschungsmitteln, in amtlich bestätigter Exzellenz und in Titelzahlen.«19 Kathrin Passig hat gegen die übliche Länge von Büchern, die sie als »Geldbäumchen« bezeichnet, Einwände, die Nietzsche-Lesern nicht ganz fremd vorkommen: Sachbuchautoren füllen »viele Seiten mit Zusammenfassungen anderer Texte, auf denen ihre eigene Argumentation aufbaut«, während die »Ideenmenge in einem handelsüblichen Sachbuch« ungefähr »drei bis zehn Blogbeiträgen« entspreche.20
Wohl wahr: Bücher, die ihre Zeit überdauern – egal, ob ihr Umfang 70 oder 700 Seiten beträgt; egal, ob es sich um Notizen, Essays oder geräumige Abhandlungen handelt –, sind noch nie am Fließband produziert worden. Manche Zeiten bieten für solche Bücher günstigere Bedingungen als andere, aber man hört auch nicht mit dem Weinanbau auf, wenn ein Jahrgang mal nicht so gelungen ist. Auch die markt- und markenzentrierte Aufrüstung des Buches zum »Geldbäumchen« hat nicht wenig zum Stinken des Geistes und seines Leitmediums beigetragen. Nicht wenige Bücher bringen in jeder Hinsicht rein gar nichts, nicht einmal Gewinne für die Verlage, die sie veröffentlichen. Das Schicksal der Irrelevanz teilen sie mit Filmen, Ausstellungen, Musikstücken, Zeitschriften, Blogs oder naturwissenschaftlichen Forschungsartikeln. Deswegen muß man sie noch nicht gleich verabschieden, denn der interessanteste und kostbarste Teil der Buchkultur in Vergangenheit und Gegenwart hat weder mit Zierpflanzen noch mit kostenloser Massenware zu tun. Man würde gern mit Kaube in eine Diskussion darüber eintreten, ob es 1962 wirklich Begriffe und Maßstäbe gab, die den aktuellen und künftigen Rang eines Werkes wie Das wilde Denken von Claude Lévi-Strauss bestimmen konnten; und würde gern an Kathrin Passig die Frage richten, ob sie immer die richtigen Bücher gelesen hat. Die Erörterung solcher Fragen setzt jedoch voraus, daß zunächst die wichtigsten Faktoren identifiziert werden, die zur gegenwärtigen Lage des geisteswissenschaftlichen Buches beigetragen haben.
Ich bin, trotz der gegenwärtig oft als unversöhnlich erscheinenden Gegenüberstellung von Papier und Bildschirm und trotz unübersehbarer Anzeichen für einschneidende Veränderungen in der Geschichte des gedruckten Buches, nicht der Ansicht, daß sich diese Lage mit dem ausschließlichen Verweis auf einen Medienwechsel oder auf technologische Entwicklungen hinreichend beschreiben läßt. Jeder weiß inzwischen, daß das Internet beunruhigende Konsequenzen mit sich gebracht hat, doch umgekehrt stellt es fabelhafte, bislang ungekannte Möglichkeiten zur Verfügung. Die geisteswissenschaftliche Alltagspraxis beispielsweise ist längst von digitalen Recherche- und Kommunikationsformen durchsetzt, und wer wollte schon – Google Books hin oder her – auf die Bequemlichkeit verzichten, Bücher aus dem 18. oder 19. Jahrhundert online zu durchmustern, um dann zu entscheiden, ob man sie gründlich durcharbeiten will?
Die Möglichkeiten der digitalen Technologien wenden sich erst in dem Moment gegen ihre Anwender, wenn diese irrtümlich glauben, mit den Vereinfachungen auch Verkürzungen des Forschungsprozesses vornehmen zu können. Dabei kommen im schlimmsten Fall Plagiate und im besten Fall schlechte Bücher heraus. Dem ist aber weniger mit Technikkritik als mit einem Blick auf soziale Mechanismen zu begegnen. Plagiate hat es lange vor dem Internet gegeben; sie können also einem neuen Medium ebensowenig angelastet werden wie den Verlagen, die solche Publikationen herausbringen. Wer seinen Autoren von vornherein betrügerische Absichten unterstellt, braucht eigentlich keine Bücher mehr zu verlegen. Entsprechendes gilt für die Universitäten: Ohne Vertrauen in die Ehrlichkeit von Forschern gäbe es keine Wissenschaft mehr, und doch suggeriert die projektgetriebene Wissenschaftskultur, Forschung wäre mit immer geringerem Zeitaufwand, also immer schneller zu haben.
Hartmut Rosa hat im Kontext seiner Überlegungen zur sozialen Beschleunigung argumentiert, daß diese keineswegs das zwangsläufige Ergebnis technologischer Beschleunigung darstellt.21 Niemand zwingt uns, so viel E-Mail-Verkehr zu unterhalten, so ausgiebig im Netz zu surfen oder sich immer wieder in die Social Media einzuklinken. Offensichtlich ist die von der digitalen Unterhaltungsindustrie aufbereitete Technologie das Futter, das unseren Appetit befriedigt und – selbstverständlich – durch Geschmacksverstärker noch steigert. Doch die Ursachen für die Beschleunigung sind eher im Horizont von sozialem Status und Reputation, der Verschiebung von Werten und neuen kommunikativen Präferenzen zu suchen.
Auf unseren Zusammenhang übertragen, heißt das: Das gedruckte wissenschaftliche Buch mag unter Druck gekommen sein, andere Forschungsmethoden und Artikulationsformen mögen sich in den Vordergrund drängen, doch das Netz ist eher Katalysator als Ursache dieser Veränderungen. Das bedeutet, daß es um spezifische Entwicklungen und Realitäten in den Geisteswissenschaften selbst geht, die auf die Frage hinauslaufen, welche Art von Wissen sie favorisieren und in welchen Formen und Formaten sie dieses Wissen kommunizieren wollen. In einer Welt der Beschleunigung, wie Rosa sie beschreibt, scheint ein an Büchern orientiertes geisteswissenschaftliches Zeitregime immer anachronistischer zu werden. »Wieso schreibt man eine Oper, wenn die Leute nur Dreieinhalb-Minuten-Songs hören wollen?«, fragt der ehemalige Cyberpunk Douglas Rushkoff.22 Wieso ein Buch schreiben, wenn sein Stern im akademischen Bewertungssystem sinkt, wenn Leser nur noch Zeit haben für Einleitungen, Abstracts, Rezensionen oder Interviews, in denen die Kernaussage des Buches zusammengefaßt wird? Natürlich kann man einwenden, daß es ohne Buch keine Zusammenfassungen oder Rezensionen gäbe, aber vielleicht führt das unangefochtene Beschleunigungsregime dazu, daß man sich ganz auf Kurzfassungen beschränkt.
Verschränkt mit der Problematik der Beschleunigung ist diejenige des Wachstums. Immer wieder wird behauptet, daß wir, im Gegensatz zu anderen Zeiten und Gesellschaften, in einer Wissensgesellschaft leben. Das soll hier gar nicht in Abrede gestellt werden, doch es wäre ein Irrtum, davon auszugehen, daß die Wissensgesellschaft in ihrem Selbstverständnis ein Eldorado für Bücher, anlaßfreie Bildung und profundes Wissen darstellt, die sui generis schwer marktgängig sind. Unsere Lage ist dadurch charakterisiert, daß inzwischen auch das öffentlich geförderte Wissen vorrangig als ökonomische Ressource betrachtet wird, die das Wirtschaftsleben ankurbeln und den Wohlstand der Gesellschaft befördern soll. Wachstum, so hat es zumindest den Anschein, ist auf Geschwindigkeit noch mehr angewiesen als auf Wissen. Oder anders: so viel Wissen wie nötig und so viel Wachstumsgeschwindigkeit wie möglich. Wiederum fragt sich, welche Funktion in einem solchen von kommerziellen Interessen dominierten Wissensregime ein in der Entstehung aufwendiges, komplexes, mit gewissen Mühen zu rezipierendes Buch haben soll. Bereits vor den Zeiten des Internet war es nicht gerade verlockend, wenn Autoren keinen oder allenfalls einen verschwindend geringen Stundenlohn für ihre Arbeit erhielten und Verlage keinen nennenswerten Gewinn mit geisteswissenschaftlichen Büchern erzielen konnten. An dieser Situation hat sich nur insofern etwas geändert, als die ökonomischen Rahmenbedingungen noch ungünstiger geworden sind, weil akademische Bibliotheken immer weniger Bücher kaufen.
Unter dem Eindruck der Wucht von realitätsstiftenden Werten wie Beschleunigung und Wachstum kann man leicht zu einer ungünstigen Prognose für das Buch gelangen. Selbst wenn man – wie ich – zu der Ansicht tendiert, daß gedruckte Bücher auch in Zukunft so selbstverständlich bleiben wie Zahnbürsten, Tische und Lampen, stellt sich die Frage: Wird es noch geisteswissenschaftliche Bücher geben, oder werden die Geisteswissenschaften auf den Pfaden der Naturwissenschaften wandeln, wo der Zeitschriftenaufsatz alles und das Buch als in sich geschlossenes Werk nichts ist? Werden diejenigen Formen des Lesens und Schreibens, die sich moderne Gesellschaften in den letzten 200 Jahren zugelegt haben, um ihr wertvollstes Wissen in angemessener Form zu artikulieren, zu adaptieren und über Generationen hinweg weiterzutragen, in 30 Jahren überhaupt noch gefragt sein?
Norbert Elias hat im Rahmen seiner Zivilisationstheorie einmal angemerkt: »Das stärkere Verlangen nach Büchern innerhalb einer Gesellschaft ist an sich bereits ein sicheres Zeichen für einen starken Zivilisationsschub; denn die Triebverwandlung und -regulierung, die es sowohl erfordert, Bücher zu schreiben, wie sie zu lesen, ist in jedem Fall beträchtlich.«23 Im Hintergrund schwingt Freuds Theorie der Kultur als Triebsublimierung mit, aber Elias geht es auch um die kommunikative Bedeutung des Buches. Lesen und Schreiben sind zugleich Voraussetzung für und Fortsetzung von Gesprächen, aber nicht, so könnte man seinen Gedanken fortsetzen, im Sinne einer unmittelbaren, affektgeladenen Intervention, sondern als Einübung in Geduld und Nachdenklichkeit, als Aufschub der Suche nach Bestätigung und als Erwägung solcher Gedanken und Ansichten, die einem erst einmal fremd erscheinen. Eine solche Entschleunigung und Distanznahme würde zu einem zivilisierteren Umgang miteinander beitragen. Ist es damit nun vorbei, und wenn ja, tritt etwas Adäquates an dessen Stelle?
In den westlichen Gesellschaften hat das gedruckte Buch in den letzten 550 Jahren nicht nur als Zivilisationsverstärker gedient. Es stellte auch eine Art Leitgestirn des Wissens dar, das auf der Prämisse beruhte: Die Welt oder, besser, das Buch der Welt ist verstehbar, und das gedruckte Buch enthält das Versprechen, diese Intelligibilität darstellen zu können.24 Vielleicht kommt diese Vormachtstellung, wie sie Medientheoretiker von Marshall McLuhan bis Michael Giesecke beschrieben haben, allmählich an ihr Ende, auch wenn es weiterhin gedruckte Bücher gibt. Dafür lassen sich eine Reihe von auf den ersten Blick trivialen Gründen anführen. In den Naturwissenschaften beispielsweise sind ökonomisches Wachstum und soziale Beschleunigung gerade dabei, das Publikationswesen vollständig umzukrempeln. Open Access, wie wir es heute kennen, dürfte nur der erste Schritt hin zu neuen Publikationsformen sein, bei denen die Erzeugung, Darstellung, Verfügbarmachung, Bearbeitung und Veränderung von Texten nichts mehr mit der linear angeordneten Texterstellung durch einzelne oder einige wenige Autoren zu tun hat. Vielleicht werden in absehbarer Zukunft Blogs, liquide und hybride, nach dem Wiki-Prinzip gefertigte Textkonglomerate einen strukturierten, linear gearbeiteten Text substituieren.
Diese neue Sorte von Texten hat noch eine weitere gravierende Eigenschaft: Computer als Autoren und Leser sind mindestens ebenso relevant wie Menschen; und das hängt mit der Vorstellung zusammen, daß die Welt, wenn sie denn einmal in die Logik des Computers eingegeben worden ist, für den Menschen nicht mehr ohne weiteres intelligibel ist, und deswegen muß der Computer das Buch als Leitmedium ersetzen. Davon kann die geisteswissenschaftliche Buchkultur gar nicht unberührt bleiben. Die Frage ist nur, wie sich diese beiden, Buchkultur und Informationsverarbeitung, zueinander verhalten. Es gibt nicht wenige Akteure, die sich wie digitale Sozialdarwinisten verhalten und von einem Verdrängungswettkampf ausgehen, bei dem der Schwächere zum Aussterben verurteilt ist. Kein Zweifel, daß damit das Buch gemeint ist. Neben den bereits angeführten Argumenten kann man so einiges hören und lesen: Ein Buch zu schreiben, herauszubringen und auch noch auf Leser bzw. auf Rezeption zu hoffen entspreche einer realitätsfernen Haltung, weil kritisches Lesen maßlos überschätzt werde und – wie Vilém Flusser das schon vor über 25 Jahren befürchtet hatte – eine aussterbende Kulturtechnik sei.25 Oder auch: Bücher seien überflüssig, weil sie sich kaum in jene akademischen Evaluationsverfahren eingemeinden lassen, die sich seit einigen Jahren durchgesetzt haben. Schließlich: Digitale Texte werden angeblich mehr rezipiert als gedruckte Bücher, also werden letztere immer weniger benötigt.
Die Gruppen, die solche Positionen vertreten, kommen aus sehr unterschiedlichen Ecken. Die eine setzt sich eher aus Utopisten und Enthusiasten zusammen, die die Zukunft gar nicht schnell genug erwarten können; die andere besteht aus Bürokraten, Funktionären, Pragmatikern und Technokraten, die ein einheitliches Management der Wissenschaften für wichtiger halten als die Wissenschaft selbst. So unterschiedliche Interessen diese Gruppen auch sonst vertreten mögen, in einem Punkt sind sie sich einig: Sie offenbaren einen kulturkritischen Affekt, der sich gegen diejenigen richtet, die die Buchkultur verteidigen.
Diesen Affekt möchte ich als Bibliophobie bezeichnen und gleich die Gelegenheit nutzen, um ein fundamentales, anscheinend weitverbreitetes Mißverständnis auszuräumen. Immer wieder wird ein Gegensatz zwischen Bibliophobie und Bibliophilie behauptet. Das ist abwegig. Bibliophile haben stets nur einen verschwindend geringen Teil unter denjenigen ausgemacht, die gedruckte Bücher benutzen und auch weiter benutzen wollen. Die meisten Bibliothekare beispielsweise sind überhaupt nicht bibliophil orientiert und entwerten Bücher, indem sie Schutzumschläge wegschmeißen, Paperbacks zum Buchbinder geben, um sie in einem zumeist häßlichen Festeinband widerstandsfähiger zu machen, und die Bücher auch sonst mit Stempeln, nicht entfernbaren Aufklebern, Barcodes usw. versehen. Das ist gar nicht zu kritisieren, hat aber eben nichts mit Bibliophilie zu tun, ebensowenig wie die überschaubaren Büchersammlungen vieler Leserinnen und Leser, die auf die Inhalte ihrer Bücher, nicht aber auf seltene Erstausgaben oder kostbare Bucheinbände Wert legen.
Kurz gesagt: Die meisten Anhänger der gedruckten Bücher sind nicht bibliophil. Man kann Bücher aus wissenschaftlichen, urheberrechtlichen oder ökonomischen Gründen für unverzichtbar halten; man kann das Verhältnis von Autor und Leser für vorrangig halten; man kann Bücher als ideale Medien zur Unterbrechung der üblichen Kommunikationskaskaden auffassen; oder man kann, allgemeiner verstanden, Bücher als perfekte Organe einer Kulturtechnik auffassen, welche die Möglichkeit bieten, Aussagen zu bestimmten Aspekten der Welt zu machen und diese Aussagen auf Dauer zu stellen, indem sie für lange Zeit in Bibliotheken, zu einem kleinen Teil in Buchhandlungen und neuerdings zu einem immer größer werdenden Teil im Netz befragbar sind. In den Augen der bibliophoben Kulturkritiker sind all diese – unterschiedlich guten – Argumente Hekuba. Mit großem Gestus behaupten, fordern und beschwören sie das Ende des gedruckten Buches, als würde damit eine gewaltige Last von der Zivilisation abfallen. Somit wäre Buchkritik nur die Abbreviatur für die Kritik einer dominanten, wenn auch heterogenen Kultur, in der wissenschaftliches Denken, Entfalten und Kommunizieren nach wie vor im und mit dem Buch stattfindet.
Ob das gedruckte Buch irgendwann einmal von einer großen Mehrheit derjenigen, die sich in der Welt des Wissens bewegen, als ungeeignetes Erkenntnisinstrument, als umständlicher Wissensspeicher und vor allem als haptisch und visuell unattraktiver Gegenstand angesehen wird? Wenn es dahin kommen sollte, dann ist es nur konsequent, darauf zu verzichten. An diesem Punkt befinden wir uns jedoch nicht, und das ist der Ausgangspunkt für die vorliegende Schrift. Meine Überlegungen zur Situation des Buches fasse ich in drei Kapiteln zusammen, nämlich erstens Kulturkritik und mediale Heilserwartung, womit gemeint ist, daß in jeder Phase von kultureller Unübersichtlichkeit grundsätzliche Zweifel gesät werden, die sich entweder in einer pessimistischen Geschichtsphilosophie oder in einer medialen Heilserwartung entladen. Ich möchte zeigen, daß die Kritik am gedruckten Buch, die sich nach wie vor einiger Beliebtheit erfreut, in einer älteren Tradition der Kulturkritik steht, die weit hinter die Anfänge des Internet zurückreicht und eine anti-intellektuelle Tendenz zum Vorschein kommen läßt, der sich die heutigen Anhänger der Bibliophobie wohl eher unbewußt bedienen. Diese Tendenz hat neben anderen Faktoren dazu beigetragen, daß sich das wissenschaftliche Publikationswesen zumindest im Hinblick auf Zeitschriftenartikel in wenigen Jahren grundlegend verändert hat. Deswegen geht es, zweitens, in dem Kapitel Alles umsonst. Open Access um eine genauere Beleuchtung der verschiedenen Bedingungen, Praktiken und Konsequenzen, die mit Open Access verbunden sind, und zwar in wissenschaftlicher, politischer, kultureller und ökonomischer Hinsicht. Dabei ist fast ausschließlich von den Naturwissenschaften die Rede, was in einem Buch, das sich ausdrücklich mit der Situation des gedruckten Buches befaßt, überraschen mag. Ich bin allerdings der Auffassung, daß Open Access die neue Umwelt darstellt, in der sich Bücher zurechtzufinden haben. Davon handelt, drittens, das Kapitel Vom Buch zum Buch, in dem nach einem historischen Rückblick in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die nicht selten als Goldenes Zeitalter des geisteswissenschaftlichen Buches bezeichnet wurde, dessen gegenwärtig noch dominierende Kultur vis-à-vis der digitalen Perspektiven zwischen E-Book und Open Access diskutiert wird. Abschließend wird in einem kurzen Epilog der unbescheidene Versuch unternommen, Argumente für die genuine Unverzichtbarkeit des gedruckten Buches zu versammeln.
Kulturkritik und mediale Heilserwartung
Kulturkritik – dieser Begriff ist in der Einleitung mehrfach gefallen. Das Spektrum der Kulturkritik reicht von reaktionärer Spielverderberei bis hin zum pointierten, legitimen Kommentar historischen Geschehens.1 Insbesondere, wenn es um gesellschaftliche, technologische und mediale Umbrüche geht, hat Kulturkritik stets auf der Tagesordnung gestanden. Die einen geben sich als Kulturkritiker und beklagen Trends und Tendenzen ihrer Zeit, andere halten Kulturkritik für ein Schimpfwort, mit dem sie reaktionäre Positionen abwehren. Im digitalen Raum dient der Begriff häufig als Allzweckwaffe, um Einwände gegen digitales Schreiben und Publizieren oder Argumente für das gedruckte Buch zurückzuweisen und denjenigen, die solche Positionen vertreten, destruktive Absichten zu unterstellen. Der Vorwurf, der dahintersteckt, läßt sich einfach auf den Punkt bringen: technophobe Attitüden der Ewiggestrigen, die sich nicht von der alten Zeit, in der alles besser war, lossagen können. Wir haben es hier mit einer Standardsituation der Zukunftseuphorie zu tun. Wer nach vorne schaut und mit dem Wind des technologischen Fortschritts segelt, hat es nicht schwer, den anderen Kulturkritik vorzuwerfen. Die Frage ist aber, ob Kulturkritik als Haltung und ihr vermeintliches Gegenteil so einfach auseinanderdividiert werden können. Gegen diese Trennung wäre einzuwenden, daß die emphatische Rede von der Abdankung des Buches selbst als Ausdruck einer Haltung zu verstehen ist, die im Kern kulturkritische Züge trägt. Das ist die These, die ich im Folgenden vertreten möchte. Dazu noch einige eingrenzende Bemerkungen.
Kulturkritik, wie ich sie hier verstehe, funktioniert nach einem recht simplen Schema. Sie hält sich erstens nicht mit diesem oder jenem Aspekt ihres Gegenstands auf, sondern zielt auf das Große und Ganze. Dabei behandelt sie die Phänomene, auf die sie es abgesehen hat, als Kollektivsingular. Wenn beispielsweise Das Buch oder Das Internet ins Visier gerät, dann ist damit eine ganze soziokulturelle bzw. technische Einrichtung gemeint, für die Buch oder Netz nur als Stellvertreter fungieren. Es ist immer mehr gemeint als nur ein Gegenstand oder eine technologische Errungenschaft. Zweitens: Kulturkritik ist apodiktisch. Sie kennt keine Selbstzweifel, ist sich ihrer Sache gewiß, teilt alle Diskursteilnehmer in ein Freund-Feind-Schema ein und deutet gegenteilige Ansichten und Argumente gerne im Gewimmel eines Verschwörungsszenarios. Dementsprechend lassen Anhänger solcher Szenarien nicht mit sich reden, denn sie meinen immer schon zu wissen, wie diejenigen Ansichten beschaffen sind, die von ihren eigenen abweichen. Zudem wirkt die Annahme einer Verschwörung als Aggressionsgenerator, der es ermöglicht, sich selbst als aufrechten Kämpfer zu stilisieren, der gegen einen vermeintlich übermächtigen Feind antritt. Drittens muß Kulturkritik keineswegs rückwärtsgewandt sein und sich nach einer guten alten Zeit sehnen. Es wäre ein großes Mißverständnis, Kulturkritik nur unter den Ewiggestrigen auszumachen. Die Verachtung für das Bestehende kann sich ebensogut mit einem erwartungsvollen Blick in die Zukunft zusammentun.
Diese drei Kriterien, die keineswegs immer im Gleichschritt zur Geltung kommen müssen, bedeuten im Hinblick auf die Diskussionen um das Buch, daß der Gestus der Kulturkritik Netzkritikern und Buchkritikern gleichermaßen eigen sein kann. Insofern wäre es reizvoll, die entsprechenden Kombattanten einer vergleichenden Analyse zu unterziehen, insbesondere die Art und Weise, wie sie die Rivalität zwischen Buch und Netz etablieren, die doch keine natürliche, sondern eine von verschiedenen, vor allem mit ökonomischen Absichten vorgehenden Akteuren konstruierte ist. Tatsächlich wird von beiden die Rede sein, und doch lege ich den Schwerpunkt auf die Kritik des Buches, weil ein Hauptanliegen dieses Kapitels darin besteht, eine Kontinuität der Buchkritik aufzuzeigen, die ihre Anfänge lange vor der Zeit des Internet hat.
Darüber hinaus scheint mir die gegen das gedruckte Buch gerichtete Kulturkritik ein bislang zwar beachtetes, aber zu wenig analysiertes Phänomen zu sein. Und sosehr das Netz nach den Enthüllungen durch Edward Snowden einer grundlegenden Kritik ausgesetzt ist, so wenig ist davon zu spüren, wenn es um die Erzeugung und Verbreitung wissenschaftlichen Wissens geht. Das ist eine erstaunliche Verdrängungsleistung. Als ob Attribute wie Offenheit, Zirkulation, Transparenz, Vernetzung, Schwarm oder Datenakkumulation, die einst den unwiderstehlichen Charme des Internet ausmachten und inzwischen ihre dunkle Seite hervorkehren, nicht auch für die Wissenschaften zu hinterfragen wären. Zu häufig wird suggeriert, Mißbrauch, Machtakkumulation oder Monopolisierung könnten mit ein paar neuen Regeln beherrscht werden.
Von Datenmanipulation und Plagiaten ist häufig die Rede – zu Recht, denn solche Fälle unterminieren den moralischen Kredit der Wissenschaften. Doch darüber wird vergessen, was entsprechende Machtmonopole mit sauberen Daten und ehrlichen Texten im Netz alles anfangen können. Es ist ein bißchen langweilig, immer wieder Amazon oder Google als Beispiele für zivilisationsgefährdende Entwicklungen im Netz heranziehen zu müssen, aber das liegt daran, daß diese beiden Konzerne zur Zeit eine Monopolstellung haben, an der sich solche Tendenzen exemplarisch festmachen lassen. Mittelfristig werden es vermutlich andere Akteure sein, die sich mit geistes- und naturwissenschaftlichen Daten in nicht-wissenschaftlicher Absicht befassen. Daß Wissenschaftler, Bibliothekare und Wissenschaftsbürokraten zu diesem Themenkomplex in der Regel nur wenig zu sagen haben, nährt die Vermutung, sie hätten auch im digitalen Betrieb den Elfenbeinturm nicht verlassen.
Der Untergang des Buchesnach dem Ersten Weltkrieg
Die Sottise vom stinkenden Geist ist nicht nur häufig, sie ist auch falsch zitiert worden. Rund 50 Jahre nach dem Zarathustra, 1932, führt Theodor Lessing seinen Säulenheiligen Nietzsche an: »Noch ein Jahrhundert Buchdruck und der Geist selber wird stinken.« Das ist ein kleiner, kaum zufälliger Lesefehler, der Nietzsches Satz eine ziemlich andere Wendung gibt. Nicht mehr der Leser wird dem Geist gefährlich, sondern eine ganze Kulturtechnik steht unter Generalverdacht. »Untergang des Buches«, so lautet die Überschrift im Feuilleton des Prager Tagblatts, und damit ist kein Bedrohungsszenario gemeint. Vielmehr wird das ersehnte Ende des Gutenberg-Zeitalters in Aussicht gestellt.
Zunächst konstatiert Lessing einen fundamentalen Wandel der Bedeutung des Buches seit dem 19. Jahrhundert: Während noch bis hin zu Schopenhauer Bücher unter dem Eindruck einer Unsterblichkeitsnorm geschrieben wurden, die darauf baute, daß erst die Nachwelt das eigentliche Anliegen eines Buches verstehen würde, verlagerte sich seitdem die Produktion immer mehr auf das Hier und Jetzt. Bücher dienen pragmatischen Bedürfnissen wie Unterhaltung und Belehrung, Entspannung und Spaß, allesamt Symptome einer westlichen Demokratisierung und Sozialisierung, die das Besondere und Einmalige zurückdrängen, um das Austauschbare und Reproduzierbare aufs Podest zu heben. Kein Wunder, daß Lessing Stefan George und seinen Kreis als Widerstandsnest aufruft, in dem das Esoterische der handschriftlichen Artikulation gegen die Gefahr der inflationären, kompromittierenden Publizität schützen soll. Auch da, wo Bücher die »anspruchsvolle Geistigkeit« erhöhen, erdrücken sie Unmittelbarkeit, Lebendigkeit und das Gefühl für den Augenblick. Dieses Gefühl ist gerade nicht mit einem aktuellen Faszinationserlebnis zu verwechseln, sondern gilt als authentische und schöpferische Beschäftigung der Seele. Entsprechend sind »schöpferische Menschen schlechte Leser«, sie »fürchten das Buch«.2
Hier kommen zwei Punkte zusammen, die im Prinzip unvereinbar sind. Zunächst einmal variiert Lessing Nietzsches Kulturkritik: Das Buch als Medium für Trivialitäten, Unterhaltung und Popularisierung ist an die Stelle von Belehrung, Originalität und Form getreten. Letztlich geht es ihm aber nicht darum, eine Fortsetzung des Kulturverfalls seit dem späten 19. Jahrhundert zu konstatieren. Sein Vorwurf richtet sich vielmehr gegen das Buch als Repräsentanten der neuzeitlichen Kultur schlechthin. Deswegen sollen die seit dem Buchdruck etablierten Methoden, Praktiken und Resultate der Gelehrsamkeit grundsätzlich in Zweifel gezogen werden. Bei Lessing taucht ein neues Element der Kulturkritik auf, das nichts mehr mit der Klage zu tun hat, der Siegeszug des Journalismus und des Massenmediums Zeitung habe das Buch verdorben. Im Gegenteil: Gute Tageszeitungen – Lessing schreibt seit 1922 regelmäßig für das Prager Tagblatt – garantieren eine lebendige und anregende Lektüre. Die Kalamitäten mit dem Buch liegen im Medium selbst begründet, beginnend mit dem Buchdruck, der im großen und ganzen nur Elend über die Menschheit gebracht habe: Buchdruck, das ist neben dem Schießpulver die »teuflischste Erfindung des Menschengeistes. […] Die Waffen der Fäuste wie der Gehirne sind eine schwere Last geworden.«3
Daß Schießpulver und Buchdruck in einem Atemzug genannt werden, ist keine neue Assoziation, sie reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Damals haben einige Humanisten beide Erfindungen mit viel Stolz und mangelnder Sachkenntnis auf das Konto der deutschen Nation verbucht.4 Die Trias von Buchdruck, Schießpulver und Kompaß steht dann am Beginn der neuzeitlichen Wissenschaft und Fortschrittsgläubigkeit, zumindest für Francis Bacon, der diesen Erfindungen den größten Einfluß auf die Menschheitsentwicklung zuschreibt und in diesem Zusammenhang den berühmten Satz formuliert, der gesündeste und ehrwürdigste Ehrgeiz des Menschen bestehe darin, sich die ganze Natur untertan zu machen.5 200 Jahre später bekümmert sich Bacons Leser Hegel in seiner Geschichtsphilosophie weniger um die Naturbeherrschung, aber er attestiert Buchdruck und Schießpulver gleichermaßen einen »modernen Charakter«. Das Fortschrittsmoment dieser Erfindungen liegt für Hegel darin, daß sie eine Bewegung weg vom Physischen, Lokalen und Besonderen, hin zu einem Allgemeinen weisen, in dem der Geist – mal als »geistiger Mut«, mal als »emanzipatorischer Menschengeist« – sich zu entfalten vermag.6
Wenn Bacon und Hegel Krieg und Wissenschaft bzw. Buchdruck unter dem Gesichtspunkt des Fortschritts und der Machttechnologien zusammendenken, dann tun das, mit entgegengesetzter Bewertung, auch ihre luddistischen Kritiker, die irgendwann zwischen der Nacht des Ersten Weltkriegs und dem Vorabend der nationalsozialistischen Barbarei schreiben. Im berüchtigten Schlußkapitel von Der Untergang des Abendlandes, das der Maschine gewidmet ist, notiert Oswald Spengler, daß die Chinesen so ziemlich alle Erfindungen des Abendlandes – Buchdruck, Schießpulver, Kompaß usw. – auch gemacht haben, aber mit einem entscheidenden Unterschied: »Der Chinese schmeichelt der Natur etwas ab, er vergewaltigt sie nicht. Er empfindet wohl den Vorteil seines Wissens und macht Gebrauch davon, aber er stürzt sich nicht darauf, um es auszubeuten.«7 Man sieht, wie eng nicht-eurozentrische Perspektive und antidemokratische Kulturkritik hier zusammenrücken, um eine suggestive, aber simplizistische Klassifikation anzubieten, die das eigentliche Geschäft des Historikers, nämlich eine kritisch-differenzierende Analyse, von vornherein suspendiert.
Seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, stand Lessing unter einem anhaltenden zivilisatorischen Schock, der ihn zu einer schonungslosen Abrechnung mit der abendländischen Kultur der Neuzeit führte. Wenn man bedenkt, wie rückhaltlos sich die große Mehrheit der deutschen Professoren 1914 in das Heer der Kriegstrunkenen einreihte, wird Lessings Bitterkeit über die politische Blindheit der Kultur nachvollziehbar.8 Das erste Resultat seiner Auseinandersetzung war die 1918 unter dem Titel Europa und Asien in Franz Pfemferts Politischer Aktions-Bibliothek publizierte Streitschrift, die bis 1930 in mehreren erweiterten Neuauflagen zu einer umfangreichen Monographie ausgearbeitet wurde, deren Untertitel – Der Untergang der Erde am Geist – nicht nur gute Assoziationen weckt. Bereits in der ersten Auflage des Buches werden Buchdruck und Schießpulver gemeinsam als Beispiele für eine technisch aufgefaßte Kultur eingeführt, die es auf Können, Leisten und Produzieren absieht und doch nichts anderes im Sinn hat als Ausbeutung, Kapitalakkumulation und Gewalt.9
Man muß Lessings Kritik der abendländischen Leitparadigmen und speziell der Wissenschaften nicht im Detail untersuchen, um zu erkennen, daß für ihn die konsequent ins Inferno des Weltkriegs mündende Geschichte der europäischen Machtkämpfe auch eine geistige Seite aufweist. Sie besteht darin, daß Vernunft und Objektivität, Kausalität und Mechanik, Arbeitsökonomie und Verabsolutierung der Maschine seit den Zeiten eines Galilei, Descartes und Kant zu einer »Abtötung lebendiger Seele« geführt haben. Der individualistische und abstrahierende, mit Logik und zukunftsorientiertem Machtbewußtsein operierende Geist steht im Kontrast zur sinnlichen und anschauenden, mit der Natur im Einklang stehenden Seele. Höhepunkt dieser Entwicklung ist für Lessing die Einsteinsche Relativitätstheorie, die mit ihrer Verabschiedung des absoluten Raums und der absoluten Zeit auch die »Anschauung erlebbaren Lebens« aufgibt. Moderne Physik ist das avancierteste »Kampfes- und Übermächtigungsmittel des europäischen Willens zur Macht, welcher das an sich immer nur Erlebbare kopf- und handfertig zur Bewußtseinswirklichkeit umbaut«.10
Demnach fügt sich die Relativitätstheorie für Lessing mit Taylorismus, Hegels Geschichtsphilosophie, Evolutionstheorie, Marxismus und Kants Vernunftkritik zu einer einheitlichen europäischen Geistesordnung zusammen, die bereits im Kern verfehlt ist, weil sie sich gegen die Natürlichkeit des Lebens richtet; und das durchzieht alle Bereiche und Formen der modernen Kultur. Mechanistisches Weltbild und Rationalität, Buchdruck und Schießpulver, Vernunft und Bewußtsein, Abstraktion und Anschauungsverlust, Technik und Macht, Genußsucht und Unterhaltung, sterile Gelehrsamkeit und Produktivität, das alles wird zusammengezogen zu einer europäischen Mentalität, deren stärkste und damit gefährlichste geistige Waffe das gedruckte Buch darstellt.
Es lassen sich leicht Übereinstimmungen mit konservativen Denkern wie Spengler oder Ludwig Klages – Namen, die Lessing selbst aufruft – aufzeigen, etwa mit Spenglers berühmt gewordener These, wonach es sich bei der Kausalität um ein kontingentes kulturelles Konstrukt und nicht um eine universell gültige Kategorie handle.11 In Lessings schroffen Worten heißt es, daß »die gesamte europäische Wissenschaft […] in der großen Menschheitslüge ›Kausalität‹ verwurzelt bleibt. Wir wollen das Zustandekommen, das Gemachtwerden, die Realgründe der Dinge erforschen und verlieren damit ihr Leben aus dem Auge.«12 Solche Sätze sind nicht wegen ihres kulturalistischen Relativismus, sondern wegen ihres verabsolutierenden Rigorismus schwer zu verdauen.
Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, daß Klages und Spengler sich mit ihrer elitären, antidemokratischen Haltung als probate Gewährsleute für den Untergang der Weimarer Republik erwiesen, während Lessing seinen Kampf gegen Rassismus, Nationalismus und Militarismus 1933 mit dem Leben bezahlen mußte, als Schergen der Nationalsozialisten ihn im tschechischen Exil ermordeten.13 Ein Jahr zuvor indes spielte Lessing mit dem Titel seines Artikels »Untergang des Buches« eindeutig auf Spenglers Hauptwerk an, auch wenn beide den Begriff Untergang auf unterschiedliche Weise benutzten. Während Spengler in seiner morphologischen Geschichtsphilosophie Auf- und Untergang einer Kultur als Eckpunkte eines natürlichen, zwangsläufigen Prozesses versteht, versteht Lessing den Untergang des Buches nicht als Vorgang mit zyklischer Folgerichtigkeit, wohl aber als ein fortschrittliches Ereignis.
Kulturkritik entpuppt sich hier als ein ambivalentes Unternehmen, wenn die Vision vom Verschwinden des Buchdrucks ausgerechnet mit einem euphorischen Verweis auf die Technologien der näheren Zukunft legitimiert wird, die genau jener rationalen Ordnung entstammen, die Lessing eigentlich für das ganze Übel verantwortlich macht. Konkret prognostiziert er – hellsichtig – »redende und tönende Bücher« sowie »Lesefilme«, die traditionelle Bibliotheken überflüssig machen oder sie zumindest in eine palavernde Agora verwandeln. Ist es einmal so weit gekommen, wird sich das Buch von selbst verflüchtigen. Es mag der Luxusdruck übrigbleiben, der ohnehin »wie ein Werk der bildenden Kunst auf Dauer angelegt« ist, doch die Tage des gemeinen und immer billiger werdenden, auf den Konsum zugeschnittenen Buches sind für Lessing gezählt. An jenem nicht mehr allzu fernen Tag werden sich dann auch breite Bildung und Gelehrsamkeit erledigt haben, weil die Menschen »zum Bücherlesen viel zu reich, voll und erfüllt« sind.14
Hinter dem Ende des Buches steht die Vision einer anderen menschlichen Lebensform. An diesem Punkt treffen sich Lessings hochgesteckte Erwartungen mit der frühen Filmtheorie, die sich von der visuellen Kultur eine neue Sichtbarkeit des Menschen verspricht. Für den Filmtheoretiker Béla Balázs ist das Wort erst mit dem Buchdruck »zur Hauptbrücke zwischen Mensch und Mensch geworden« und hat damit zu einer regelrechten Spaltung zwischen Körper und Seele geführt: »Die Kultur der Worte ist eine entmaterialisierte, abstrakte, verintellektualisierte Kultur, die den menschlichen Körper zu einem bloßen biologischen Organismus degradiert hat.«15 Erst mit dem Film wird der menschliche Körper als Ausdrucksorgan wieder in seine Rechte eingesetzt. Buchkritik als Kulturkritik erschöpft sich also keineswegs nur im Gestus der schlechtgelaunten Ablehnung. Marshall McLuhan avant la lettre: Unter dem Eindruck optischer Medien bringen die zwanziger Jahre die visuelle Kultur gegen die herrschende Kultur des Wortes in Stellung, um der Menschheit den Weg in eine üppigere Zukunft zu weisen. Kritik des Status quo und ein optimistischer Blick auf die technologischen Apparaturen reichen sich die Hand.
Um 1930 war der Mikrofilm schon nicht mehr ganz taufrisch, da man sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg Gedanken über neue Speicherformen und Zirkulationsweisen von Büchern gemacht hatte,16 aber nun kam auch noch der Wunsch nach technischen Medien hinzu, welche die Lesegeschwindigkeit erhöhen sollten. So propagierte der amerikanische Journalist Robert Carlton Brown, von dem Lessing vermutlich nichts wußte, ein transportables Lesegerät, das eben diese Effizienzsteigerung ermöglichen und den Buchdruck überflüssig machen sollte. Browns jenseits aller Psychophysiologie operierende Hoffnung bestand darin, die Lesegeschwindigkeit mittels dieses Geräts derart auf Touren zu bringen, daß sich ein ganzer Roman in zehn Minuten bewältigen ließe.17
Solche Rekordphantasien waren maßlos, doch um Schnelligkeit ging es zur gleichen Zeit auch bei einem so bedeutenden Typographen wie Jan Tschichold, wenn er das »Überfliegen eines Textes« für die angemessene moderne Art des Lesens hielt und die Typographie der Tageszeitung als ideal für die »zunehmende Beschleunigung des Lesetempos« ansah.18 Natürlich wollte Tschicholds Neue Typographie das gedruckte Buch nicht abschaffen, sondern mit den avanciertesten technologischen Entwicklungen kompatibel machen. Insofern verfolgte er eine ganz andere Strategie als Brown mit seinen Lesegeräten, aber immerhin hingen beide Protagonisten Optimierungsphantasien an, um die Lesegewohnheiten an das »Tempo der umwälzenden technischen Erfindungen«19 anzupassen. Von dieser Position ist Lessings Ansatz scharf abzugrenzen. Indem er das Heil des gesprochenen oder visualisierten, jedenfalls des papierlosen Buches darin erblickte, daß »der Mensch einst sein ganzes Seelenelement zum Ausdruck bringen« könne, zielte er auf das genaue Gegenteil eines optimierten Turbolesens. Ein und dieselbe technische Vorrichtung, das Lesegerät, wurde somit unter völlig unterschiedlichen anthropologischen Voraussetzungen gepriesen.
Man würde Lessings erlebnisfreundlichen und kritikunfreundlichen Blick in die Zukunft des Lesens vielleicht anders bewerten, wenn er nicht ein Jahr später eines der ersten Opfer der nationalsozialistischen Henker geworden wäre. So bleibt aber doch mit aller Behutsamkeit die Frage zu stellen, ob nicht die Vernunft oder der von Lessing so verachtete Geist mitsamt seinem Leitmedium, dem gedruckten Buch, neben ihrer Machtanfälligkeit auch ein kritisch-distanzierendes Potential entfalten können, das in der vermeintlichen Authentizität des Erlebens wieder kassiert wird. Die Frage, ob es nicht vielleicht einen Vorzug hat, der Illusion einer permanenten Anschauungsfülle, Präsenz und Erlebniswilligkeit die Distanzierungsmöglichkeit in Gestalt von Unverfügbarkeit, Skepsis und Kritik entgegenzusetzen – und zwar systematisch entgegenzusetzen, weil die Abschaffung des Sapere aude in der neueren Geschichte noch nie zu einem glücklichen Ende geführt hat –, konnte Lessing sich nicht mehr vorlegen. Im frühen 21. Jahrhundert, da nicht wenige Zeitgenossen zu der Überzeugung zu gelangen scheinen, daß man sich der Mühe der gründlichen Lektüre eines umfangreicheren Buches am besten gar nicht mehr zu unterziehen braucht, weil dort, bisweilen umständlich, die Ausfaltung der Argumente und die ausführliche Auseinandersetzung mit anderen Autoren in der Regel höheren Zeitaufwand als die Netzlektüre erfordert, sollte man dieser Frage nicht ausweichen.
Technologie hat noch nie ein ideologiefreies Eigenleben geführt, und es sind auch nie beliebig viele Ideologeme, die um eine neue Technologie herum versammelt werden. Dementsprechend lassen sich gewisse Ähnlichkeiten zwischen Browns Pragmatismus und Lessings Phänomenologie der unmittelbaren Erlebnishaftigkeit mit den gegenwärtigen Diskussionen um gedrucktes Buch und Netzlektüre erkennen. Browns Geschwindigkeitsrausch steht für die Ideologie einer visuellen Effizienzsteigerung, Lessings Menschenfreundlichkeit für den Glauben an eine wahre menschliche Natur, die – um der Kritischen Theorie diesen Begriff zu entlehnen – aus den modernen Fesseln der Entfremdung gelöst werden muß, indem das individualistisch-abstrakte Buchstudium zugunsten eines gemeinschaftlichen Bildschirmerlebnisses aufgegeben wird. Die Ähnlichkeiten liegen nun weniger darin, daß sich hier eine Art Vorläufer der Idee des elektronischen Buches versteckt. Wie fast immer gerät das Vorläufer-Modell schnell an seine Grenzen, denn vieles, was heute relevant ist, war es für Lessing nicht. Beispielsweise hatte er ein unproblematisches Verhältnis zur Figur und Rolle des Autors, das man nach den von Roland Barthes und Michel Foucault angestoßenen Debatten nicht mehr ohne weiteres haben kann; und von interaktiven Texten, die mittels der Weisheit der Vielen entstehen und sich permanent verändern, ist bei Lessing auch nicht die Rede.