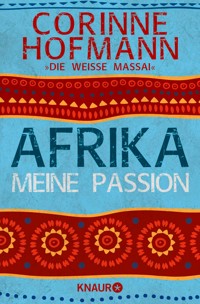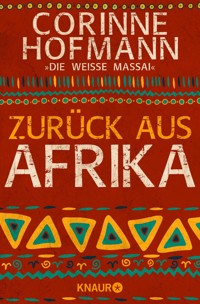
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die »weiße Massai« erzählt, wie es weiterging ... Nach dem Leben in einer fast archaischen Welt muss Corinne Hofmann so manche Fähigkeit neu erlernen, die das Leben in der »Welt der Weißen« erfordert. Doch mit der gleichen Stärke, dem Mut und dem Optimismus, mit denen sie die Herausforderungen in Kenia bewältigte, baut sie für sich und ihre kleine Tochter eine neue Existenz auf. Während dieser Zeit hält sie durch viele Briefe den Kontakt zu ihrer »afrikanischen Familie«. Eines Tages kehrt sie zurück und blickt vom Dach Afrikas, dem Kilimandscharo, in die Weiten des kenianischen Hochlandes ... Von der Autorin des Bestsellers »Die weiße Massai«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Corinne Hofmann
Zurück aus Afrika
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die »weiße Massai« erzählt, wie es weiterging …Nach dem Leben in einer fast archaischen Welt muss Corinne Hofmann so manche Fähigkeit neu erlernen, die das Leben in der »Welt der Weißen« erfordert. Doch mit der gleichen Stärke, dem Mut und dem Optimismus, mit denen sie die Herausforderungen in Kenia bewältigte, baut sie für sich und ihre kleine Tochter eine neue Existenz auf.Während dieser Zeit hält sie durch viele Briefe den Kontakt zu ihrer »afrikanischen Familie«. Eines Tages kehrt sie zurück und blickt vom Dach Afrikas, dem Kilimandscharo, in die Weiten des kenianischen Hochlandes …Von der Autorin des Bestsellers »Die weiße Massai«
Inhaltsübersicht
Vorwort
Ankunft in der »weißen Welt«
Wir leben uns ein
Wieder auf eigenen Füßen
Über die Hürden der Bürokratie
Scheidung von Lketinga
Erinnerungen holen mich ein
Ich will meine Geschichte aufschreiben
Lernen kann man alles
Sensationeller Bucherfolg
Neue Liebe
Zukunftspläne
Aufbruch zum Kilimandscharo
Sehnsucht nach Afrika?
Danksagung
Bildteil
Anzeige
Als im August 1998 mein Buch »Die weiße Massai« erschien, war ich zwar optimistisch, dass die Schilderung meiner afrikanischen Liebesgeschichte auf breites Interesse stoßen würde. Dass es allerdings innerhalb kurzer Zeit auf den Bestsellerlisten landen, in bisher 19 Sprachen übersetzt und verfilmt werden würde, hatte ich auch in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Der Erfolg des Buches und all die Erlebnisse, die damit verbunden waren, entwickelten sich zu einem weiteren großen Abenteuer in meinem Leben.
Damals hatte ich keinesfalls vor, ein zweites Buch zu schreiben. Doch im Laufe der Jahre erhielt ich Tausende von Briefen, Fax-Zuschriften und Mails, in denen mir Leserinnen und Leser auf verschiedenste Weise mitteilten, wie sehr sie von meiner Geschichte beeindruckt waren. Fast immer endeten diese Schreiben mit der Frage, wie es denn meiner kenianischen Familie, meiner Tochter und mir heute ginge.
Versuchte ich zu Beginn noch, jedes dieser Schreiben persönlich zu beantworten, so musste ich eines Tages vor der Flut der Anfragen kapitulieren. Mit jedem neuen Zeichen der Anteilnahme an unserem Schicksal jedoch baute sich in mir zunehmend ein innerer Druck auf, einer Art Verpflichtung nachkommen zu müssen.
All jenen, die mich mit ihrer Anerkennung, ihrem Zuspruch und ihrem Interesse an meiner Lebensgeschichte zum Teil zutiefst berührten, möchte ich dieses Buch widmen.
Lugano, im April 2003
Ankunft in der »weißen Welt«
Wie aus weiter Ferne höre ich eine Stimme: »Hallo … hallo, aufwachen!« Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich öffne die Augen und weiß im ersten Moment nicht, wo ich mich befinde. Als mein Blick auf das Bettchen vor meinen Füßen fällt und ich meine Tochter Napirai entdecke, fällt es mir schlagartig wieder ein: Ich bin im Flugzeug. Die Dame neben mir nimmt ihre Hand von meiner Schulter und meint lachend: »Sie und Ihr Baby haben aber tief geschlafen. Wir landen in Kürze in Zürich und Sie haben alle Mahlzeiten verpasst.«
Ich kann es kaum fassen: Wir haben es geschafft. Wir sind raus aus Kenia. Meine Tochter und ich sind frei!
Sofort erinnere ich mich an die letzten Aufregungen in Nairobi bei der Passkontrolle. Der Mann schaut uns an und fragt: »Is this your child?« Napirai schläft im Kanga auf meinem Rücken und ich antworte: »Yes.« Er blättert in ihrem Kinderausweis und in meinem Pass herum. »Warum wollen Sie mit Ihrer Tochter ausreisen?«, ist die nächste Frage. »Ich möchte meiner Mutter ihre Enkelin zeigen.«
»Warum ist Ihr Mann nicht dabei?« Er müsse arbeiten und Geld verdienen, erkläre ich möglichst gelassen.
Der Mann blickt mich streng an und sagt, er wolle das Gesicht des Kindes besser sehen. Ich solle es aufwecken und mit seinem Namen ansprechen. Jetzt werde ich noch nervöser. Napirai, etwas mehr als fünfzehn Monate alt, erwacht und schaut sich verschlafen um. Der Mann fragt sie ständig nach ihrem Namen. Napirai sagt nichts, stattdessen werden ihre Mundwinkel immer länger und plötzlich weint sie. Ich versuche sie schnell zu beruhigen, weil ich voller Sorge bin, dass noch in letzter Minute alles schief läuft und wir dieses Land nicht verlassen können. Der Mann dreht Napirais deutschen Kinderausweis hin und her und fragt mit strengem Ton: »Warum hat sie bei einem kenianischen Vater einen deutschen Reisepass? Ist das wirklich Ihre Tochter?« Immer mehr Fragen trommeln auf mich ein und ich bin vor Angst in Schweiß gebadet. So ruhig wie möglich erkläre ich, dass mein Mann ein traditioneller Massai sei, keinen Pass bekommen habe und wir in der Kürze nur diesen Reisepass beschaffen konnten. Ich sei aber in drei Wochen zurück und würde mich dann um einen kenianischen Pass bemühen. Dabei schiebe ich ihm nochmals den von meinem Mann unterschriebenen Brief zu und bete leise vor mich hin: »Lieber Gott, lass uns nicht im Stich, lass uns diese paar Meter bis zum Flugzeug kommen!« Hinter uns drängen sich mehrere Touristen und beobachten entnervt die Szene. Der Mann schaut mich noch einmal sehr durchdringend an, schweigt ein paar Sekunden und dann blitzen seine weißen Zähne, als er mit einem breiten Grinsen sagt: »Okay! Gute Reise und bis in drei Wochen. Bringen Sie Ihrem Mann etwas Schönes mit!«
Das alles geht mir durch den Kopf, als ich noch immer sehr müde meine kleine Tochter zu mir hochhebe und ihr die Brust gebe. Meine Gefühle sind nun, kurz vor der Landung, sehr gemischt. Was wird meine Mutter sagen? Werden sie und ihr Mann überhaupt am Flughafen sein? Wie soll alles weitergehen? Wie sage ich ihr, dass dies kein Urlaub ist, sondern dass ich vor meiner einstigen großen Liebe geflohen bin und keine Kraft und keinen Mut mehr habe zurückzugehen? Ich weiß es nicht.
Kopfschüttelnd, wie um diese Gedanken loszuwerden, packe ich alles zusammen. Das Flugzeug setzt zur Landung an und wieder spüre ich diese enorme Erleichterung: Ich habe meine Tochter aus Kenia herausbekommen. Wir haben es geschafft!
Mit Napirai auf dem Rücken laufe ich durch das Flughafengelände und fühle mich in meinem geflickten einfachen Rock, dem kurzärmeligen T-Shirt und den Sandalen am kühlen 6. Oktober 1990 etwas fehl am Platz. Die Menschen, so kommt es mir vor, mustern mich ziemlich befremdet.
Endlich sehe ich meine Mutter und ihren Mann. Freudig gehe ich auf sie zu, merke aber sofort, dass sie beim Anblick meiner mageren Figur erschrecken. Ich bin nur noch Haut und Knochen und wiege bei meinen 1,80 m weniger als 50 Kilo. Ich muss meine Tränen zurückhalten und fühle mich plötzlich unendlich müde und abgekämpft. Meine Mutter nimmt mich gerührt in die Arme. Auch ihre Augen sind feucht. Hanspeter, ihr Mann, begrüßt uns freundlich, doch etwas zurückhaltender, da wir einander noch nicht so gut kennen.
Wir machen uns auf den Heimweg. Sie sind mittlerweile aus dem Berner Oberland ins Zürcherische Wetzikon gezogen. Schon im Auto fragt meine Mutter, wie es denn Lketinga gehe und wie lange ich gedenke, Urlaub zu machen. Mir schnürt es den Hals zu, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, und so antworte ich: »Vielleicht drei bis vier Wochen.«
Ich nehme mir vor, ihr die ganze Tragödie später zu erzählen. Meine Mutter hat ja keine Ahnung, wie schlecht es mir wirklich geht, da ich ihr die Ereignisse in den letzten Monaten nicht schreiben oder mitteilen konnte. Mein Mann kontrollierte alles und ich musste jeden geschriebenen Satz übersetzen. Als wir an der Küste lebten, brachte er manchmal meine Briefe anderen Leuten, die etwas Deutsch konnten, damit sie sie übersetzten. Wenn er nicht einverstanden war, musste ich den Brief ins Feuer werfen. Schon wenn ich nur an zu Hause dachte, sah mich Lketinga misstrauisch an und fragte, als könnte er Gedanken lesen: »Why you are thinking at Switzerland, you stay here in Kenia and you are my wife.« Außerdem wollte ich meine Mutter nicht unnötig belasten, zumal ich ja lange immer noch an unsere gemeinsame Zukunft in Kenia geglaubt hatte.
Zu Hause empfängt uns lautes Hundegebell, das Napirai sehr erschreckt, weil sie das nicht kennt. In Kenia hat man ein eher distanziertes Verhältnis zu Hunden. Das Tier bellt wie verrückt und fletscht die Zähne.
»Er ist keine Fremden gewohnt und schon gar nicht Kinder, doch für die paar Tage wird es schon irgendwie gehen«, erklärt meine Mutter. Wieder spüre ich das beklemmende Gefühl bei dem Gedanken, dass wir hier bleiben müssen, bis alles geregelt ist. Und das kann länger dauern, da ich keine Niederlassungsgenehmigung mehr für die Schweiz besitze und somit nur als Touristin eingereist bin. Ich bin zwar in der Schweiz geboren und aufgewachsen, habe aber wie mein Vater einen deutschen Pass. Nach einem Auslandsaufenthalt, der länger als sechs Monate dauert, verliert man in der Schweiz die Aufenthaltsberechtigung. Ich will gar nicht daran denken, was alles auf uns zukommt.
Mein Gott, ich muss es ihr sagen! Im Moment habe ich aber nicht die Kraft, ihr die Freude zu nehmen und den wahren Grund unseres Besuches zu erklären. Sie ist einfach glücklich, ihre Tochter und die Enkelin endlich wieder zu sehen. Außerdem sind die beiden natürlich nicht eingerichtet für eine plötzliche Rückkehr der erwachsenen Tochter mit einem Kind. Immerhin lebe ich schon seit meinem 18. Geburtstag nicht mehr zu Hause.
Mit Napirai beziehe ich das kleine Gästezimmer und packe unsere wenigen Habseligkeiten aus. Ich besitze lediglich ein paar Kinderkleidchen und etwa 20 Stoffwindeln sowie eine Jeans und einen Pulli für mich. Alles andere habe ich in Kenia gelassen – Lketinga sollte ja glauben, dass ich zurückkomme. Er hätte mich sonst nie und nimmer mit unserer Tochter ausreisen lassen.
Vorsichtig bewege ich mich in dem schönen großen Haus, das mit gepflegten Möbeln, Pflanzen und Teppichen eingerichtet ist. Am meisten aber beeindruckt mich die Toilette, die ich nun an Stelle der stinkenden Plumpsklos benutzen kann. Meine Mutter fragt mich, was ich gerne essen möchte. Mir läuft beim Gedanken an einen saftigen Wurst-Käse-Salat das Wasser im Mund zusammen und so äußere ich meinen Wunsch. Sie ist fast enttäuscht, da sie mir etwas Besonderes kochen wollte. Doch für mich ist dieses Essen nach vier Jahren Busch das Feinste, was ich mir vorstellen kann. Als ich bei den Samburu lebte, hatte ich nie die Gelegenheit, etwas derart Frisches zu essen. Außer Maismehl, manchmal Reis oder noch seltener ungewürztem Fleisch gab es ja nichts. Wie freue ich mich auf diesen Salat mit einem Stückchen frischem Brot!
Napirai ist inzwischen auch ganz neugierig und beobachtet aufmerksam die ihr unbekannten weißen Menschen. In der Zwischenzeit hat sie fast alle Bücherregale ausgeräumt und gräbt in der Pflanzenerde herum. All diese Dinge sind neu für sie.
Endlich gibt es Essen. Allein beim Anblick könnte ich vor Freude fast weinen. Wie viele Male hatte ich nachts von solch einer Mahlzeit geträumt! Jetzt kann ich sie einfach wünschen und nach einer halben Stunde steht sie vor mir.
Meine Mutter will natürlich gleich einen ausführlichen Bericht, wie mir mein neues Leben in Mombasa gefällt und wie mein Souvenirgeschäft am Diani-Beach angelaufen ist. Sie ist so froh, dass ich nach den drei Jahren im tiefsten Busch wieder etwas näher an der Zivilisation lebe. Nur versteht sie nicht, warum ich noch dünner bin als bei meinem letzten Besuch, da ich doch nun mehr Möglichkeiten habe, mich besser zu ernähren. Mich machen diese Fragen völlig fertig und noch trauriger. So gebe ich nur mechanische Antworten, die weit von der Wirklichkeit entfernt sind. Auf Grund ihrer fast naiven Unbekümmertheit wird es für mich noch schwerer, die Wahrheit zu sagen.
Meine Freude über das köstliche Essen hält nicht lange an. Nach einer halben Stunde habe ich höllische Magenkrämpfe und liege zusammengekrümmt auf dem Bett. Natürlich hätte ich mit meiner erst vor einem Jahr eingehandelten Hepatitis kein Fett essen sollen und erst recht keine kalte Kühlschrankkost. Schließlich habe ich jahrelang nur einfachste Gerichte aus dem Kochtopf gegessen. Doch angesichts der Möglichkeit, endlich wieder etwas Besonderes zu bekommen, habe ich einfach nicht mehr daran gedacht. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu übergeben, damit sich mein Magen wieder beruhigt.
Napirai wird von meiner Mutter gebadet, was ihr sehr gefällt. Sie planscht und quietscht vor Vergnügen und bekommt danach zum ersten Mal Pampers-Windeln angezogen. Meine Güte, ist das einfach! Anziehen, voll machen, ausziehen und wegwerfen. Unglaublich toll! Vorbei sind die Zeiten wie die in Nairobi, in denen ich die verkackten Windeln herumschleppen und sie am Abend mit der Hand in kaltem Wasser auswaschen musste, bis mir die Knöchel brannten.
Um acht Uhr bin ich todmüde. In Kenia gingen wir um diese Zeit meistens schlafen, da wir kein elektrisches Licht hatten und es früh dunkel wurde. Ich muss sowieso mit Napirai ins Bett gehen, denn sie ist es nicht gewohnt, allein zu schlafen. In der Manyatta im Hochland schlief sie immer bei mir oder bei der Großmutter und an der Küste zwischen mir und meinem Mann. Das ist für Samburu-Kinder normal. Sie brauchen den Körperkontakt. Im Bett überfallen mich Traurigkeit und auch Zweifel, ob ich das Richtige tue. Leise weinend schlafe ich ein.
Am nächsten Morgen stellt sich die große Frage: Was ziehen wir an? Es ist Oktober und für uns, die wir aus der Wärme Kenias kommen, extrem kalt. Napirai mochte Kleider noch nie und jetzt muss sie sogar Pullover und Jacke anziehen, die meine Mutter besorgt hat. Sie fühlt sich nicht wohl in all den Kleidungsstücken und versucht sie wieder auszuziehen. Doch das geht nicht. Es ist kalt und außerdem läuft man in der Schweiz angezogen herum.
Ein weiteres Problem ist der Hund, denn er scheint uns nicht zu mögen. Er knurrt, bellt und fletscht die Zähne, während er uns sehr genau beobachtet. Napirai hat sich aber schon an ihn gewöhnt und möchte ständig mit ihm spielen. Als Massai-Mädchen kennt sie offenbar keine Furcht. Ich hingegen bin fast hysterisch vor Angst, er könnte Napirai beißen. Während ich in ihm eine echte Gefahr sehe, ist er für meine Mutter und Hanspeter natürlich das liebste Tier und sozusagen Kinderersatz.
Die ersten zwei, drei Tage bin ich nur müde und erschöpft. Ständig denke ich daran, wie es wohl Lketinga gehen mag, so alleine mit dem Shop. Zwar hat er noch William als Hilfe, aber schließlich verstehen sie sich nicht mehr so gut, seit William uns vor einiger Zeit Geld gestohlen hat.
Zur Ablenkung spaziere ich an den folgenden Tagen zu der nahe gelegenen Landwirtschaftsschule und beobachte dort stundenlang die Kühe. Dabei finde ich eine gewisse innere Ruhe und fühle mich mit meiner Schwiegermama nGogo sehr verbunden. Wie wird sie reagieren, wenn sie erfährt, dass sie Napirai und mich nicht mehr sehen wird? Nach Samburu-Sitten würde meine Tochter eigentlich ihr gehören. Diese und ähnliche Gedanken gehen mir durch den Kopf.
Wenn meine Mutter und Hanspeter abends im Fernsehen Nachrichten anschauen, ziehe ich mich meistens mit Napirai in unser Zimmerchen zurück. All die schrecklichen Bilder vom Golfkrieg und dem Elend in der Welt erschüttern mich und ich kann sie kaum ertragen. Über vier Jahre hatte ich keinerlei Berührung mit Fernsehen oder anderen Medien. Ich lebte in einer Welt wie vor tausend Jahren und nun fühle ich mich von all den Nachrichten und Bildern völlig erschlagen. Doch einmal bleibe ich wie gebannt vor dem Fernseher sitzen. Es läuft eine Reportage über den Mauerfall in Deutschland. Ich kann nicht begreifen, was ich da sehe. Tatsächlich habe ich von diesem Ereignis nichts mitbekommen, obwohl es schon vor einem Jahr stattgefunden hat. Ich kann es kaum fassen! Die Mauer war früher bei uns zu Hause ständig ein Thema, da meine Großeltern väterlicherseits im Osten gelebt hatten. So wusste ich schon als Kind, wie verschieden die zwei deutschen Welten waren, da mein Vater viel erzählte, wenn er von einem Besuch aus der DDR zurückkam. Und jetzt sind sie wieder vereint! Alle Welt wusste es, nur bei uns im Busch war diese Nachricht nie angekommen. Angesichts dieser Bilder laufen mir gleich wieder die Tränen herunter. Für meine Mutter und ihren Mann ist es verständlicherweise komisch, wie ich reagiere. Auch die meisten Spielfilme erscheinen mir anders als früher. Oder habe nur ich mich so sehr verändert? Jedenfalls staune ich nicht schlecht über all die Nackt- und Liebesszenen in den heutigen Filmen. In Kenia wird öffentlich nicht einmal geküsst oder auch nur Händchen gehalten, ganz zu schweigen davon, dass bei den Samburu überhaupt nicht geküsst wird. Mir wird allmählich klar, wie puritanisch ich in den vergangenen vier Jahren geworden bin.
Nach ein paar Tagen meint meine Mutter, ich solle mir endlich etwas Neues zum Anziehen kaufen. So mache ich mich auf den Weg, während sie auf Napirai aufpasst. Die vielen Kleider und Waren in den voll gestopften Läden machen mich unsicher. Ich weiß nicht recht, was zu mir passt, und so kaufe ich mir Leggins, die anscheinend gerade in Mode sind, und einen Pulli dazu. Es kommt mir schrecklich teuer vor. Für das gleiche Geld hätte ich in Kenia mindestens drei oder vier Ziegen kaufen können oder eine wunderschöne Kuh.
Zu Hause präsentiere ich das Gekaufte meiner Mutter, die erschrocken feststellt, dass ich in diesen Leggins unmöglich auf die Straße gehen könne. Ich sei viel zu dünn und wirke in dem Aufzug fast krank. Mein kleiner neu gewonnener Stolz über die hübschen Sachen ist dahin und ich fühle mich sehr hässlich. Erschrocken stelle ich fest, dass ich in dieser »weißen« Welt sehr empfindlich geworden bin. In meiner Welt in Kenia unter den Afrikanern war das ganz anders. Da musste ich alles allein machen und organisieren. Immer deutlicher wird mir bewusst, wie sehr ich mich in den Jahren verändert habe. Hier in Europa vergeht die Zeit schnell und vieles ist für mich neu und unbekannt. In Afrika läuft alles noch gemächlich ab und die Tage erscheinen unendlich viel länger. Was ist nur aus der einst so selbstbewussten Geschäftsfrau geworden? Eine abgemagerte Heimatlose mit einem kleinen Kind, die nicht einmal den Mut hat, sich ihrer Mutter anzuvertrauen!
Nach einer Woche jedoch entscheidet das Schicksal für mich. Wir sind gerade beim Abendessen, als das Telefon klingelt. Meine Mutter nimmt den Anruf entgegen und sagt mehrmals nur »Hallo, ja hallo«, dann legt sie auf. Sie meint, es habe sich so angehört, als sei die Verbindung von weit her gekommen, aber niemand habe sich gemeldet. Mit schweißnassen Händen starre ich meine Mutter ungläubig an. Sie lacht und sagt: »Schau nicht so erschrocken! Es wird sicher dein Mann sein, der sich melden möchte. Freu dich doch!«
Mir wird schlecht vor Aufregung und Angst. Natürlich hatte ich die Telefonnummer dort gelassen. Sophia, meine italienische Freundin, hatte mich darum gebeten. Wenn Lketinga im Shop Probleme hätte, wollte sie mich anrufen, da er noch nie in seinem Leben telefoniert hat. Auch ihr hatte ich nichts erzählt. Niemanden hatte ich über meine Fluchtpläne ins Vertrauen gezogen, aus Sorge, es würde schief gehen. Und jetzt das! Wie gebannt starre ich auf das Telefon, doch im Moment bleibt es stumm. Meine Mutter meint, es sei sicher nichts Schlimmes, ich solle doch weiteressen. Der Appetit ist mir jedoch vergangen. Stattdessen überlege ich fieberhaft, wie ich mich am Telefon verhalten soll. Und schon klingelt es wieder. Ich solle hingehen, fordert mich meine Mutter freudig auf. Aber ich kann mich nicht bewegen. Panisch schaue ich zu, wie sie den Hörer abhebt. Nach einem freudigen »Yes« winkt sie mich ans Telefon. Mechanisch gehe ich hin, halte den Hörer ans Ohr und erkenne sogleich Sophias Stimme. »Hallo, Corinne, how are you? I’m here together with your husband Lketinga. Er möchte unbedingt wissen, wie es seiner Frau und seinem Kind geht und wann ihr zurückkommt nach Kenia. Soll ich ihn dir geben?«
»No, wait!«, schreie ich in den Hörer. »Ich möchte erst mit dir sprechen. Sophia, was ich dir jetzt sage, ist sehr schwer für Lketinga, für dich, für mich, für alle. Wir kommen nicht zurück! Ich halte es mit meinem eifersüchtigen Ehemann einfach nicht mehr aus. Du hast es ja zum Teil selbst erlebt. Ich konnte es euch vorher nicht sagen, sonst hätten wir nie mehr ausreisen können.« Hinter mir höre ich Besteck auf den Boden fallen.
»Bitte, bitte, Sophia, erkläre es Lketinga. Ich werde ihm von hier aus mit dem Shop und dem Auto helfen, so gut es geht. Wenn er alles verkauft, ist er ein reicher Mann. Er kann alles haben, auch die Bankkonten, alles außer unserer Tochter Napirai. Ich werde versuchen, mit ihr ein neues Leben aufzubauen.« Sophia ist spürbar erschüttert und fragt, ob ich nicht mit meinem Mann sprechen wolle, doch das Geld sei gleich aufgebraucht. Ich notiere die Telefonnummer und sage ihr, dass ich in zehn Minuten zurückrufen werde, um mit Lketinga zu sprechen. Erschöpft lege ich auf, drehe mich um und sehe meine erstarrte Mutter und Hanspeter an. Im selben Moment schießen mir die Tränen in die Augen und dann heule ich hemmungslos. Noch eine ganze Weile sitze ich neben dem Telefon. Ich fühle mich todunglücklich und gleichzeitig ein wenig erleichtert, weil nun meine Mutter und in diesen Minuten wohl auch Lketinga endlich Bescheid wissen.
Ich höre meine Mutter unsicher fragen: »Ja, wie stellst du dir das denn vor? Ich dachte immer, du seist bis auf ein paar Kleinigkeiten glücklich. Du hast doch erst dein schönes Geschäft mit deinem letzten Geld eröffnet. Außerdem hast du in der Schweiz keine Aufenthaltsgenehmigung mehr!« Jetzt hat auch sie Tränen in den Augen. Sie tut mir aufrichtig Leid. Verzweifelt erinnere ich mich, dass ich bis an mein Lebensende mit meiner großen Liebe eine glückliche Familie bilden und auf keinen Fall meiner Tochter den Vater nehmen wollte. Schließlich ist sie das Kind dieser überwältigenden Liebe. Aber ich habe einfach keine Kraft mehr und weiß, dass ich mich gegen den Tod und für das Leben entscheiden muss. Napirai ist noch nicht einmal zwei Jahre alt und braucht mich. Ich habe zu viel durchgemacht, von den Malaria-Schüben während der Schwangerschaft, der Geburt im Buschhospital und von unserer Isolation während der ansteckenden Hepatitisinfektion ganz zu schweigen. Nein, mein Mädchen gebe ich nicht mehr her. Und ich will leben – für sie! Sie soll später nicht verheiratet werden, nachdem sie kurz zuvor beschnitten wurde. Nein, das will ich ihr ersparen. Der Preis wird ein Aufwachsen ohne ihren Vater in einer weißen Welt sein.
»Kann ich nach Kenia zurückrufen? Lketinga ist sicher ganz verstört«, frage ich meine Mutter, anstatt eine Antwort zu geben, weil ich im Moment sowieso keine habe. Ich muss die Nummer drei Mal anwählen, bevor eine Verbindung zustande kommt. Zuerst höre ich eine afrikanische fremde Stimme, dann wieder Sophia und schließlich kurz darauf Lketinga. »Hallo my wife, why you not come back to me? I’m your husband! I really love you and my baby. I cannot stay without you and Napirai. I don’t want another wife! You are my wife.«
Weinend erkläre ich ihm, dass er mich zu viele Male verletzt habe mit seinem unberechenbaren und krankhaft eifersüchtigen Verhalten. »Zuletzt kam ich mir wie eine Gefangene vor. So kann und will ich nicht leben. Und als du mir dann noch vorgeworfen hast, dass Napirai nicht deine Tochter ist, waren auch meine letzte Liebe und Hoffnung zerstört. Lketinga, ich kann nicht mehr, aber ich helfe dir bei allem, so gut es geht. Ich werde an James schreiben, dass er kommt, um dir zu helfen. Ich werde versuchen, dir alles in einem Brief zu erklären. Es tut mir so Leid.«
Er versteht mich nicht und meint nur verunsichert und halb lachend: »I don’t know what you tell me. My wife, I wait for you and my child. I’m sure you will come back to me.« Dann knackt es in der Verbindung und die Leitung ist tot.
Ich bin wie betäubt, gehe zu meiner Napirai, nehme sie vom Babystuhl und ziehe mich völlig ausgebrannt in unser Zimmer zurück, weil ich für heute keine klaren Gedanken mehr fassen kann. Meine Mutter und auch Hanspeter verstehen das anscheinend und sagen nichts dazu. Napirai spürt, wenn es mir nicht gut geht, und ist dann immer besonders anhänglich. Sie saugt sich wohlig an meiner Brust fest, während sie sie mit einer Hand knetet.
Als Napirai schläft, beginne ich Briefe zu schreiben.
Lieber Lketinga
Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, was ich dir jetzt mitteilen muss: Ich komme nicht mehr zurück nach Kenia.
Inzwischen habe ich viel über uns nachgedacht. Vor mehr als dreieinhalb Jahren habe ich dich so sehr geliebt, dass ich bereit war, mit dir in Barsaloi zu leben. Ich habe dir auch eine Tochter geschenkt. Aber seit dem Tag, an dem du mir vorgeworfen hast, dass dieses Kind nicht von dir ist, habe ich nicht mehr dasselbe für dich empfunden. Auch du hast dies bemerkt.
Nie habe ich jemanden anderen gewollt und habe dich nie belogen. Aber in all diesen Jahren hast du mich nie verstanden, vielleicht auch deshalb, weil ich eine »Mzungu« bin. Meine Welt und deine Welt sind sehr verschieden, doch ich dachte, eines Tages stehen wir zusammen in der gleichen.
Aber jetzt, nach der letzten Chance, die wir in Mombasa hatten, sehe ich ein, dass du nicht glücklich bist und ich erst recht nicht. Wir sind immer noch jung und können so nicht weiterleben. Im Moment wirst du mich nicht verstehen, doch nach einiger Zeit wirst auch du sehen, dass du mit jemandem anderen wieder glücklich wirst. Für dich ist es leicht, eine neue Frau zu finden, die in der gleichen Welt lebt. Aber suche jetzt eine Samburu-Frau, nicht wieder eine Weiße, wir sind zu verschieden. Du wirst eines Tages viele Kinder haben.
Ich habe Napirai mit mir genommen, denn sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Auch weiß ich, dass ich nie mehr Kinder haben werde. Ohne Napirai könnte ich nicht überleben. Sie ist mein Leben! Bitte, bitte, Lketinga, vergib mir. Ich bin nicht länger stark genug, um in Kenia zu leben. Dort war ich immer sehr allein, hatte niemanden, und du hast mich wie eine Verbrecherin behandelt. Du merkst es selber nicht, denn dies ist Afrika. Noch einmal sage ich dir, ich habe nie etwas Unrechtes getan.
Nun musst du überlegen, was du mit dem Shop machen willst. An Sophia schreibe ich ebenfalls, sie kann dir sicherlich helfen. Ich schenke dir das ganze Geschäft. Aber wenn du es verkaufen willst, musst du mit Anil, dem Inder, verhandeln.
Von hier aus will ich dir helfen, so gut ich kann, und will dich nicht fallen lassen. Falls du Probleme hast, sage es Sophia. Die Shopmiete ist bis Mitte Dezember bezahlt, doch wenn du nicht mehr arbeiten willst, musst du unbedingt mit Anil sprechen. Auch den Wagen schenke ich dir. Ich lege dir für ihn ein unterzeichnetes Papier bei. Wenn du den Wagen verkaufen willst, bekommst du mindestens noch 80 000 Kenia-Schillinge, aber du musst jemanden Guten finden, der dir hilft. Danach bist du ein reicher Mann.
Bitte, Lketinga, sei nicht traurig, du wirst eine bessere Frau finden, denn du bist jung und schön. Bei Napirai werde ich dich in guter Erinnerung halten. Bitte versteh mich! Ich würde in Kenia sterben, und ich denke nicht, dass du das willst. Meine Familie denkt nicht schlecht von dir, sie haben dich immer noch gern, doch wir sind zu verschieden.
Viele Grüße von Corinne und Familie
Hallo Sophia!
Gerade eben habe ich deinen und Lketingas Anruf erhalten. Ich bin sehr traurig und nur noch am Weinen. Ich habe dir jetzt gesagt, dass ich nicht mehr zurückkomme. Es ist die Wahrheit. Es war mir klar, noch bevor ich die Schweiz erreicht hatte. Du kennst meinen Mann auch ein bisschen. So sehr habe ich ihn geliebt wie niemanden vorher in meinem Leben! Für ihn war ich bereit, ein richtiges Samburu-Leben zu führen. Dabei wurde ich so oft krank in Barsaloi, doch ich blieb da, weil ich ihn liebte. Vieles hat sich verändert, seit ich Napirai zur Welt brachte. Eines Tages hat er behauptet, dieses Kind sei nicht von ihm. Seit diesem Tag ist meine Liebe zerbrochen. Die Tage sind vergangen mit Höhen und Tiefen, und er hat mich oft schlecht behandelt.
Sophia, ich sage dir bei Gott, ich hatte nie einen anderen Mann, nie! Dennoch musste ich mir dies von morgens bis abends anhören. In Mombasa habe ich meinem Mann und mir noch eine Chance gegeben. Aber so kann ich nicht weiterleben. Er selbst merkt es nicht einmal! Ich habe alles aufgegeben, sogar mein Heimatland. Sicher habe auch ich mich verändert, doch ich denke, das ist unter diesen Umständen normal. Es tut mir sehr Leid für ihn und für mich. Wo ich in Zukunft bleiben kann, weiß ich noch nicht.
Mein größtes Problem ist Lketinga. Er hat nun niemanden mehr für den Shop, den er allein nicht managen kann. Bitte lass mich wissen, ob er ihn behalten will. Ich wäre froh, wenn er damit zurechtkäme, wenn nicht, soll er alles verkaufen. Das Gleiche gilt für den Wagen. Napirai bleibt bei mir. Ich weiß, sie ist so glücklicher. Bitte, Sophia, kümmere dich ein bisschen um Lketinga, er wird nun viele Probleme haben. Leider kann ich ihm nicht viel helfen. Wenn ich nochmals nach Kenia käme, würde er mich nie mehr in die Schweiz zurücklassen.
Sein Bruder James kommt hoffentlich nach Mombasa. Ich werde ihm schreiben. Bitte hilf ihm mit Gesprächen. Mir ist bewusst, auch du hast viele Probleme, und ich hoffe für dich, sie werden sich bald lösen. Ich wünsche dir, dass alles gut wird und du auch wieder eine weiße Freundin findest. Napirai und ich werden euch nie vergessen.
Ich wünsche dir alles Gute und viele Grüße
Corinne
Auch an James, Lketingas jüngeren Bruder, der als Einziger der Familie zur Schule ging und uns so viel geholfen hat, und an den Missionar Pater Giuliano in Barsaloi schreibe ich die traurige Wahrheit.
Am nächsten Morgen hat auch meine Mutter tiefe Ringe unter den Augen. Schon bald sitzen wir am Tisch und ich muss ihr endlich die Wahrheit über mein Leben in Afrika erzählen. Diesmal schone ich sie nicht, da ich nun in der Schweiz vor ihr sitze. Ich schildere ihr mein Leben bei Lketingas Stamm mit allen Licht- und Schattenseiten und erinnere sie daran, dass ich mir in der ersten Zeit sehr wohl vorstellen konnte, mein ganzes Leben bei den Samburu zu verbringen. »Aber nach der Eröffnung des dringend benötigten Lebensmittelshops hat mir seine wachsende Eifersucht mehr und mehr zugesetzt und alles wurde immer schwieriger. Bald hatten sich fast alle Menschen von uns zurückgezogen. Nicht einmal mehr mit dem Missionar durfte ich mich unterhalten und erst recht nicht mit seinem kleineren Bruder James und den anderen Boys. Dabei hatte ich mich immer auf die Unterhaltung mit ihnen so gefreut, wenn endlich Schulferien waren. Lketinga hat Ärger gemacht und zum Schluss musste ein Bursche sogar das Dorf verlassen, sonst wäre etwas Schlimmes passiert. Durch meine ständigen Krankheiten ist auch der Shop nicht mehr gut gelaufen und schließlich sind wir vor ein paar Monaten an die Küste gezogen. Da habe ich wirklich noch an einen Neuanfang geglaubt und habe deshalb auch Marc gebeten, mir das viele Geld für den Souvenirshop zu bringen. Ich erhoffte mir eine positive Wirkung, wenn er sozusagen als ›Ältester‹ mit Lketinga sprechen würde, was für kurze Zeit auch wirklich gefruchtet hat. Lketinga war wieder normaler und zeitweise sehr lieb und fürsorglich. Ab und zu hat er beim Ladenaufbau mitgeholfen und sich auf die Arbeit gefreut. Doch später, als ich mit den Touristen sprechen oder gar mal lachen musste, war die Hölle los. Vor den Touristen hat er mich gefragt, warum ich diese oder jene Person kenne, was gar nicht zutraf. Immer wieder habe ich versucht ihm zu beweisen, dass ich ihn doch liebe und alles auf mich genommen habe nur für uns. Mit der Zeit trank er immer mehr Bier. Zum Teil bekam er es von den ahnungslosen Touristen spendiert, teils zahlte er es mit dem Geld aus der Kasse. William und ich haben wie verrückt gearbeitet und er kam, griff sich ein Bündel Geld und ist mit dem Auto nach Ukunda verschwunden. Ich habe nur noch in Angst gelebt, wie wohl sein Verhalten sein würde, wenn er zurückkam. Zu Hause durfte ich so gut wie nicht mehr unsere spärliche Hütte verlassen und so saß ich dann nur stundenlang auf dem Bett und habe mit Napirai gespielt. Musste ich auf die Toilette, begleitete er mich meistens. Es war so demütigend. Die Streitereien waren auch für Napirai nicht gut.«
Nach all den Klagen erkläre ich meiner Mutter aber auch, dass Lketinga im Grunde genommen und tief im Herzen ein guter Mensch ist. Er hat mir früher in vielen Situationen seine Liebe bewiesen. Doch in Mombasa ist er unglücklich und ich kann nicht mehr zurück in den Busch, weil ich sonst an Malaria sterben würde. Ich habe ihm sogar vorgeschlagen, nach Barsaloi zurückzugehen, dort eine Zweitfrau aus seinem Stamm zu heiraten und mich in Mombasa arbeiten zu lassen, damit wir alle wieder glücklicher würden. »Aber er wollte das plötzlich nicht mehr, obwohl ich damals bei der Heirat damit einverstanden sein musste. Deshalb blieb mir nur die Flucht in die Schweiz«, beende ich meine Erzählung.
Meine Mutter hört sich entsetzt, aber ruhig die Bruchstücke der ganzen Geschichte an und sagt: »Ich wusste zwar von deiner Schwester, die vor kurzem bei euch war, dass nicht alles so rund läuft, aber so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt! Du hast mir ja nur optimistische und zuversichtliche Briefe geschrieben. Ja, und nun haben wir eine völlig neue Situation. Aber wenn ich es mir genau überlege, habe ich meine Tochter wieder zurück und eine süße Enkelin dazu.« Erleichtert fallen wir uns in die Arme. »Also ist es kein so großes Problem, wenn ich mit Napirai noch eine Weile hier wohne und abwarte, wie alles weitergeht?«
»Nein, nur dem Hund müssen wir das noch schmackhaft machen«, meint sie, nun wieder zaghaft lächelnd.
Den Nachmittag verbringen wir damit, meine Afrikazöpfe zu öffnen. Büschelweise fallen mir dabei die Haare aus. Anschließend nehme ich dankbar ein heißes Vollbad und kann es immer noch nicht begreifen, wie schön es ist, in einer vollen Badewanne zu liegen. In Kenia musste ich zum eineinhalb Kilometer entfernten Fluss laufen und konnte mich dort nur spärlich waschen. Später in Mombasa erwärmte ich erst das Wasser auf dem Kohlekocher, schüttete es dann in ein Waschbecken und wusch mich mit den Händen. Hier in der Schweiz gibt es Wasser im Überfluss. Man muss nur den Hahn aufdrehen und hat kaltes oder gar heißes Wasser zur Verfügung. In Afrika habe ich tatsächlich vergessen, wie angenehm ich vorher gelebt hatte. Doch nun wird mir mit jeder Stunde bewusster, wie luxuriös im Grunde genommen unser Leben hier ist, allein durch die einfachsten Dinge wie Wasser, Strom, Kühlschrank und Lebensmittel.
Nein, vor einem solchen Leben brauche ich mich nicht zu fürchten! Ich werde arbeiten, egal was, Hauptsache ich erhalte wieder eine Aufenthaltsgenehmigung! Gleich am nächsten Morgen beschließe ich, mich bei der Gemeinde zu erkundigen. Meine Mutter begleitet mich, da sie eine Frau aus dem Turnverein kennt, die dort arbeitet. So erfahren wir, dass ich schriftlich ein Gesuch für die Wiedererteilung der Niederlassung stellen muss, mit beigefügtem Lebenslauf. Bearbeitet wird es durch die Fremdenpolizei und da heißt es einfach abwarten. Zu Hause erledige ich das Gewünschte sofort und bin zuversichtlich, weil die Angestellten in dem Büro sehr nett waren. Meine Erfahrungen mit den Ämtern in Kenia waren da ganz anderer Art.
In den nächsten Tagen bleibt mir nichts anderes übrig, als lange Spaziergänge mit meiner Tochter zu unternehmen, um nicht ständig an Kenia zu denken. Wenn das Telefon klingelt, habe ich Angst, es könnte wieder Lketinga sein oder jemand anderer aus Kenia mit einer schlechten Nachricht. Mittlerweile müssten alle meine Briefe angekommen sein. Manchmal glaube ich fast körperlich zu spüren, welche Trauer und Aufregung bei den Betroffenen herrscht, vor allem bei meiner lieben Schwiegermama und auch bei Lketinga, da er in der Zwischenzeit wohl sicherlich begriffen hat, dass wir wirklich nicht zurückkommen. Ich kann nur auf die verschiedenen Reaktionen warten. Endlich, am 3. November 1990, erhalte ich den ersten langen Brief von James aus seiner Schule.
Liebe Corinne
Hallo, hier ist James. Wie geht es dir? Ich hoffe, deiner Familie und der lieben Schwester Napirai geht es gut. Ich habe deinen traurigen Brief erhalten, der auch mich sehr traurig machte, weil du in ihm schreibst, dass du nun in der Schweiz bist und nicht wieder in unser Dorf zurückkehren wirst. Alle hier in Barsaloi, die dich kennen, sind sehr unglücklich. Während ich dir schreibe, möchte ich weinen, obwohl ich das alles erst glauben kann, wenn ich es auf dem Gesicht meines Bruders in Mombasa gesehen habe.
Corinne, was ich jetzt von dir höre, habe ich schon in meinem Blut gespürt, als ich sah, wie unmöglich sich mein Bruder dir gegenüber verhalten hat. Doch was soll ich jetzt allen erzählen, die fragen werden, wo unsere liebe Corinne ist und warum sie gegangen ist? Es ist ein Fluch, dass du wegen Lketinga gehen musstest. Er wird in unserer Gegend sehr einsam sein. Alle sind böse auf ihn, weil sie gesehen haben, wie hart du gearbeitet hast. All die Sachen, die du ihm geben willst, werden ihn sehr verwirren. Ich will ihm helfen und alles korrekt erledigen, obwohl ich wenig Einfluss auf ihn habe. Du weißt, dass ich oft mit ihm gestritten habe, weil er so gemein zu dir, seiner Frau, war. Ohne dich ist mein Bruder jetzt eine nutzlose Person in unserer Gemeinschaft, trotz Auto und Shop. Was kann er tun mit diesem großen Shop, wo er doch, wie du weißt, Arbeit hasst? Und was soll er mit einem Auto ohne Fahrerlaubnis? Dass du ihm alles dagelassen hast, zeigt, wie du ihn von Herzen liebst. Aber er ist nicht bei Verstand und kann damit nicht umgehen. Corinne, er ist sehr verwirrt und sicher liebt er dich, aber sein Problem ist, dass er wie eine schlechte Person spricht und nicht bedenkt, was andere über sein Reden denken. Der einzige Rat, den ich ihm geben kann, ist, diesen Reichtum, den du ihm gibst, zu nutzen.
Aber wie kann er den Shop verkaufen, wenn du nicht da bist? Außer du telefonierst mit dem Eigentümer, dem Inder. Ich habe meinem Bruder einen Brief geschrieben und gesagt, er solle mir Geld für die Fahrt nach Mombasa schicken, damit ich bei Schulende am 16. November zu ihm kommen kann. Wenn er mir keines schicken will, gehe ich nach Hause und verkaufe ein paar Ziegen. Dann fahre ich, um zu sehen, was er macht. Ich werde dir im November oder Dezember schreiben und berichten, wie dort alles läuft, und dir auch von zu Hause, vor allem von Mama, erzählen.