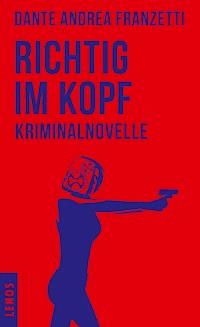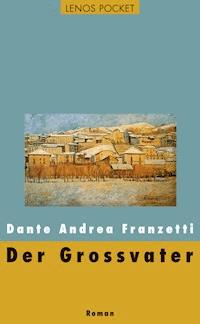17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Lenos Voyage
- Sprache: Deutsch
Rom. Die Ewige Stadt. Einst Zentrum eines Weltreiches, heute noch immer nicht in der Moderne angekommen, eine Stadt zwischen Stillstand und Turbulenz. Das frühere Lebensgefühl - Fellinis »Dolce vita«, Pasolinis tragische Filme, in denen Rom nach etwas roch und schmeckte -, wohin ist es verschwunden? Dante Andrea Franzetti, der einmal in der italienischen Kapitale gelebt hatte und dessen Söhne hier zur Schule gehen, spürt den Widersprüchlichkeiten und Veränderungen nach, die das Rom von heute prägen. Die Stadt ist schneller geworden, das römische Lächeln verbissen, Gelassenheit ist Pünktlichkeit gewichen. Faschisten, Papisten, Renegaten sind hier zu Hause, sonntags brüllt der Fußball aus einer Million Fernseher. Den Armen eines Kraken gleich, frisst sich die Stadt in die Landschaft hinein. Ehemals periphere Viertel, in denen die Halbwelt verkehrte, gelten plötzlich als jung und hip: Gentrifizierung auch hier. Per Straßenbahn und Bus erschließt sich der Autor manch denkwürdigen Ort: so den Cimitero acattolico, wo August von Goethe begraben liegt, oder die Katakomben an der Via Appia. Franzetti zeichnet das Bild eines so farblosen wie bunten, gleichermaßen abstoßenden wie anziehenden Rom - Stadtliteratur der besonderen Art, melancholisch, verträumt, oft aber auch temporeich und von großer Komik, etwa wenn der Autor mit dem längst verstorbenen Lyriker Vincenzo Cardarelli im Caffè Strega an der Via Veneto über Anita Ekberg plaudert. Für das Buch wurde Dante Andrea Franzetti 2013 mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor
Dante Andrea Franzetti, geboren 1959 in Zürich, ist Autor, Publizist und Dozent. Er veröffentlichte mehrere Romane und Erzählungen und wurde u.a. mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis (1994) und dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank (2013) ausgezeichnet. Franzetti war zeitweilig Reporter und Italienkorrespondent verschiedener Zeitungen und lebt heute in Zürich und Rom.
Im Lenos Verlag erschienen Der Grossvater und Roger Rightwing köppelt das feingeistige Tischgespräch sowie Das Bein ohne Mann, das er zusammen mit Pic schrieb.
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert von der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart, bei der sich der Autor freundlich bedankt.
E-Book-Ausgabe 2013
Copyright © 2012 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich
Coverfoto: Bernard Lafond
www.lenos.ch
ISBN EPUB-E-Book 978 3 85787 539 7
Inhalt
I. Gotham City
II. Das Netz
III. Die tag- und die nachthelle Seite des Pigneto
IV. Hinter vatikanischen Mauern
V. Stets Ihr treu dankbarer Sohn
VI. La dolce vita
VII. Io ci credo
VIII. Das vortreffliche Talent des Dottor Flaiano
IX. Störung der Totenruhe
X. Letzte Grüsse aus Rom
Personenregister
I. Gotham City
Es sind die Lähmungen und Turbulenzen, die schweisstriefende Langsamkeit (die Warterei auf das Tram 19 zum Giardino dei Gerani, wenn man zum Pigneto muss; und wenn eine 19 an die Piazza Buenos Aires heranrasselt, endlich, teilt sie dir mit: corsa limitata, gekürzte Fahrt; sie fährt nur bis Porta Maggiore), und dann die Autos mit Blaulicht, die Krankenwagen, die Bluttransporte, die Limousinen der Politiker, die tutend auf der Busspur an allen Rotlichtern vorbeirasen; das Heulen, das losgeht, kaum berührt ein Passant ein Auto; die falschen Alarme an Toren und Geschäftseingängen, dieser kreischende Singsang in der höchsten Tonlage, der selbst die Hunde erschreckt; das scheppernde Surren der Motorroller; das Krachen und Dröhnen der Müllabfuhr in der Nacht; das Fernsehprogramm, die gebrüllten Nachrichten, bereits morgens um acht.
Und dann, manchmal, die verdächtige Stille in einem Hinterhof; oder gerade hier, in der Via Montecuccoli, einer Sackgasse im Pigneto (so ruhig wie mein Zimmer in Zürich, Personalhaus der Psychiatrischen Universitätsklinik, im Grünen, am Rande der Stadt).
Wenn dich diese Stille in Rom überfällt – es kann auch in einer Kirche sein, in einem Park, doch genügend weit weg von der Strasse –, nickst du ein.
Du solltest hier wach sein.
Du bist nicht wach. Du bist nie wach genug.
Bald erschreckt dich das nächste Tuten, Schrillen, Piepsen, Knallen und treibt deinen Puls in die Höhe.
Und dann: Wenn du irgendwo anstehst und sich der Puls beruhigt, beginnst du wieder beinahe einzuschlafen. Und wenn du eine 19 findest, die tatsächlich bis zum Pigneto fährt, und darin einen Sitzplatz entdeckst, nickst du erneut ein.
Dieses Wechselbad von Geschwindigkeit und Entschleunigung, Alarm und torpore, drückender Schwüle und torkelndem Gehen auf dem aufgeweichten Asphalt, Kampf um den Stehplatz in der Strassenbahn, Gehetze irgendwohin, um pünktlich zu sein (kein Taxi da), und du setzt dich verschwitzt und ermattet auf die Spanische Treppe, fächelst dir Wind zu mit der Zeitung, für die deine Augen längst zu müde sind, und schliesslich erscheinen die anderen mit eineinhalb Stunden Verspätung: »Der Verkehr!«
Man gewöhnt sich die Pünktlichkeit ab in Rom. Heute gibt es den Mobilfunk, man wird über jede Kreuzung informiert, die der Kollege bereits hinter sich gelassen hat.
Räche dich nie an den Unpünktlichen! Sie warten gelassen und empfangen dich nie mit einem deutschen Gesicht.
Das war 1979, zu einer Zeit, als es keine Mobiltelefone gab, es sollten sich vier Gruppen aus verschiedenen Vierteln der Stadt an der Piazza Venezia »ungefähr um acht Uhr« treffen. Als die Letzten um halb zwölf ankamen, waren die Ersten bereits wieder gegangen. Man sass noch eine Weile vor der »Schreibmaschine« herum, und schliesslich löste sich die Gruppe auf. Zum Abendessen war es nicht gekommen, doch das fiel nur mir auf, dem einzigen Nordstaatler. Es hatten sich alle gut unterhalten.
Heute gibt es die Business-Lunches, zu denen man pünktlich erscheinen muss; Fussballspiele beginnen auf die Minute, Theatervorstellungen und Kinofilme auch, nur in die Messe kann man sich noch zur Halbzeit hineinschleichen.
Ohne ihr Zutun hat sich die Stadt für die Römer nochmals beschleunigt, die Gangart, das Piepsen und Trillern der Handys, die pfeilschnellen Motorroller auf dem Weg zur Arbeit oder zum Ruderclub und die flimmernden Werbebotschaften an jeder Ecke, die in die Augen schiessen und in die Ohren krachen. Musik und Lärm in voller Lautstärke.
Sie gehen schneller als früher, vor allem wenn sie aus einem Zug oder dem Bus steigen. Ihr Radius ist grösser, lange Beine sind gefragt und wachsen nach, doch auch die Hindernisse haben zugenommen: Verkehr, Baustellen, Laub und Äste auf den Strassen, Löcher im Asphalt.
*
Zum ersten Mal bin ich in einer Pension, in der ich durchschlafen kann: etwas weiter draussen, wo einst die Peripherie war, die sich das Zentrum, das sich nach aussen frisst, nach und nach einverleibt.
Gotham City.
Doch ist es anders in Städten vergleichbarer Grösse?
Es sind die vielen Langwierigkeiten und die Turbulenzen, diese kalten und warmen Duschen, dieses Hab-Acht! und Ruhen!, die Wechselbäder und das Wechselgeschrei, die die Römer zermürben.
Und aufladen.
Sie fressen (wundere ich mich) all die negative Energie in sich hinein, verdauen sie und pfeifen sie in einer ruhigen Stunde aus sich heraus. Arien oder Schlager, Volkslieder oder Jazzmotive, Kinder- und Wiegenlieder, Roma capoccia, man hört hier, wenn auch immer seltener, noch jemanden auf dem Gehsteig singen.
Wenn sie zur Bar schlendern; wenn sie mit den grossen Scheibenwischern die Fenster ihrer Geschäfte putzen; wenn sie Plättchen legen oder Wände anmalen; wenn sie auf einer Parkbank sitzen oder auf einer Leiter stehen; wenn sie mit Einkaufstüten aus dem Supermarkt kommen oder in der Werkstatt einen Ölwechsel vornehmen; auch Priester, wenn sie nach der Messe aus der Kirche treten und sie ein heller, windiger Frühlingstag erwartet: Sie singen, pfeifen, trällern vor sich hin.
In den Aussenquartieren eher.
Etwas leiser als der übrige Lärm der Stadt, aber insistent und widerspenstig, hört man diese Melodien vor allem an Sonntagen, wenn gleichzeitig aus einer Million Fernseher der Fussball in die Strassen brüllt.
*
Als ich dieses Buch zu schreiben begann – aber habe ich es nicht schon immer geschrieben? seit ich mit fünfzehn Jahren zum ersten Mal hier war, Filetto Stroganoff bei Pantaleone an der Via Merulana, und danach noch Dutzende Male, abgesehen von der Zeit, als ich hier durchgehend gelebt und gearbeitet habe und mir deshalb zur Stadt nichts einfallen wollte? –, als ich mit den Notizen begann, lebten meine zwei Kinder, Luca und Nicolò, schon seit drei Jahren hier, und ich war wohl zum siebenten Mal für längere Zeit zu Besuch. Einen Herbstmonat habe ich der Bar Ayres gewidmet, an der Piazza Buenos Aires – in einem besseren Viertel –, bis ich einen Gesang auf diese Bar schrieb, den ich hier irgendwo einfügen will. Heute, ein Jahr später, ist dort nichts mehr, wie ich es im Jahr 2008 angetroffen habe: Marcello, der Kellner, ist verschwunden; nur der Kalabrese, der Nazi, hat im Lokal nebenan, einem Luxusrestaurant, als Kassier überlebt, ausgerechnet er, der den Zigeunern die Haut abziehen will. Obwohl er zur selben Mannschaft wie meine Kinder hält, zu Milan, haben auch sie den Kalabresen nie gemocht, ganz instinktiv. Er hat eine Herrscherstimme, er spricht nicht, er gellt, er schreit, manchmal brüllt er. Alles ist eine Frage von Leben und Tod: ein falsches Zuspiel auf dem Rasen; ein Typ, der geht, ohne zu bezahlen; zu leicht bekleidete Frauen, Nutten natürlich; stinkende Bettler, denen er nachkreischt, obwohl sie bezahlt haben: »Wenn du dich mal duschst, tust du uns einen Gefallen.«
Der Kalabrese macht meinen Kindern Angst, obwohl Luca schon fünfzehn ist, und sie haben Grund, Angst zu haben: Jeder Mensch, der bei Sinnen ist, erschreckt vor diesem drohenden Sergeanten, von dem man annehmen muss, dass er es bei Gelegenheit ernst meint.
In Rom kriechen die Faschisten hervor.
*
Vier Moleskine-Notizbücher liegen gestapelt vor mir, und ich weiss natürlich nicht, wo ich beginnen soll. Dabei geht es darin nur um drei Quartiere: Salario-Trieste im Norden (wo meine Kinder leben), also die Gegend bei der Piazza Buenos Aires und dem Viale Regina Margherita, Vorposten des schwarzen Luxusquartiers Parioli; das Viertel Pigneto, ein kleiner Spickel südöstlich der Salaria, in der Nähe des Verano, des grössten Friedhofs der Stadt, Monument des Zerfalls und der städtischen Gleichgültigkeit; und das abgezirkelte Viertel bei der Porta Cavalleggeri, das ich »Hinter den vatikanischen Mauern« nenne, aus der Zeit, da ich in Rom etwas weiter weg von der Familie sein wollte, und später, als ich für einige Zeitungen hier war, zur Beerdigung Johannes Pauls II., des polnischen Papstes, und zur Weihe des deutschen Inquisitionskardinals Ratzinger, Benedikts XVI.
Nachdem ich lange im Viertel gewohnt hatte, in dem meine Kinder leben (und dort mit ihnen die Niederlage der S.S. Lazio, zu Hause!, gegen ihren Milan erlebt hatte: 1 : 5!), spürte ich ein Bedürfnis nach Veränderung. Zudem gab es zum Pigneto Presseberichte über Schlägereien, versiffte Gassen, Drogenhandel und lästige Transvestiten – doch wenn einer ein paar Wochen im Pigneto lebt, erfährt er vom Wilden Westen, den sich selbst die Linkspresse ausmalt, überhaupt nichts. Kein Vergleich zur Reeperbahn oder zu Zürichs Langstrasse, zu gewissen Vierteln in Frankfurt und zum Gürtel in Wien. (Nur die vielen Hunde im Pigneto sind auffällig.)
Aber ich habe mir, von Mal zu Mal und solange ich hier nähere und entferntere Verwandte und Freunde habe, vorgenommen, die Stadt zu erfahren und auszukosten, in der ich lebe, zeitweilig gewiss, senza fissa dimora, ohne festen Wohnsitz.
Denn damals, als ich einen festen Wohnsitz hatte, an der Via Fratelli Ruspoli, Piazza Ungheria, da hatte mir Rom nichts zu sagen.
Ich hatte zu schreiben (für eine Zeitung), und natürlich hatte ich einiges erfahren, einiges erlebt, aber kaum etwas empfunden.
Dafür wird man nicht bezahlt von der Zeitung.
II. Das Netz
Die Bus- und die Tramlinien: an der Piazza Fiume den 80-Express zur Regina Margherita, zum Internetcafé, die 63 zur Via del Corso, die 3 zum Kolosseum und nach Trastevere, alle anderen zur Stazione Termini.
Man muss das Verkehrsnetz beherrschen, will man in einer Stadt leben. In Rom habe ich ein Dutzend Mal begonnen, in den Verkehrsadern zu schwimmen, je von einem anderen Punkt aus.
Pensionen, Zimmer, allerlei Unterkünfte, doch immer zwischen der Piazza Fiume und der Gegend um die Piazza Buenos Aires, anfangs auch etwas weiter nördlich, Richtung Villa Borghese und Villa Ada.
Von dort aus spannt sich das Netz.
Sobald eine Stadt mehr als eine Million Einwohner zählt, also grösser als Boston oder Stockholm ist– überschaubare Plätze–, wird sie unfassbar, verweigert sie sich dem Gesamtbild.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!