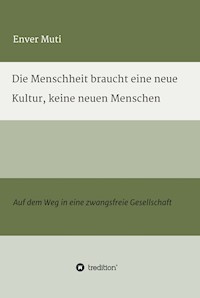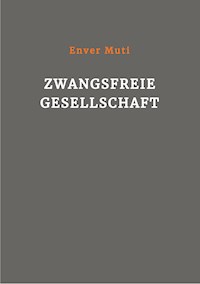
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Ängste bestimmen unser Schicksal. Sie bestimmen, wie wir leben, miteinander umgehen und welche Gesellschaft wir kulturell formen. Unsere Kultur ist eine von Angst getriebene. Sie wird durch Zwang aufrechterhalten und tradiert. Durch Täuschung zwingt sie uns zu Symptombehandlungen und hält uns von tatsächlichen Problemlösungen fern. Eine radikale Wende ist längst fällig. Aber wo genau die Reise hingehen soll, ist nicht klar. Denn unsere Angstkultur verhindert auch eine Kommunikation über Alternativen. Der vorliegende Text setzt sich mit unserer Angstkultur auseinander und skizziert eine Orientierung in eine mögliche Zukunft der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Enver Muti
Zwangsfreie Gesellschaft
©2022 Enver Muti
ISBN Softcover: 978-3-347-52782-9
ISBN Hardcover: 978-3-347-52783-6
ISBN E-Book: 978-3-347-52784-3
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Vorwort
Die Menschheit braucht eine neue Kultur, keine neuen Menschen.
Alles Übel geht von Angst aus
Bewusstsein steuert Angstgefühle
Stärke ist das wirksamste Mittel der Angstkompensation
Gleichgewicht ist der optimale Zustand des Überlebens
Es kommt auf das Glauben an
Konkurrenzkultur torpediert Gleichgewicht
Bedürfnisse werden durch Leistung befriedigt
Kulturelle Routinen entlasten, verhindern aber Weiterlernen
Angstkultur ist die dominante Kultur der Menschheit
Angstkultur lebt von Zwang
Gesellschaft ist kein Selbstzweck
Täuschung legitimiert Zwang
Narrative verschleiern Täuschung
Angstkultur führt zur Fehlerwiederholung
Die einzige Alternative zur Zwangskultur ist die zwangsfreie Gesellschaft
Nur der freie Wille kann den Zwang aufheben
Zwangsfreie Gesellschaft verhindert Entfremdung von der Natur
Der kategorische Imperativ ist eine Grenzziehung
Gleichgewicht macht die Begrenzung der Bedürfnisse notwendig
Alle Veränderungen beginnen mit Veränderungen der Entscheidungen
Corona-Narrativ, Demokratie, Zwang
Ein dringlicher Appell an den Menschen
Was führt uns aus der Krise, Wissenschaftlichkeit oder Spiritualität? Oder eine Kultur der Freiheit?
Zwangsfreie Gesellschaft
Vorwort
Die kulturelle Evolution des Menschen hat bislang alles Mögliche hervorgebracht, aber keine Gesellschaft im Gleichgewicht. Die Gesellschaft, die der Mensch geschaffen hat, befindet sich in einer mehr oder weniger ständigen Schieflage, die mit Täuschung und Zwang gehalten, verwaltet und von Generation zu Generation weitergereicht wird.
Allen bisherigen Gesellschafts-Narrativen, die diese Schieflage überwinden wollen, gelingt es nicht, egal wie man es auch dreht und wendet, ihr Versprechen einzulösen, weil sie selbst Produkte dieser Schieflage sind und nie zu Ende gedacht werden, weder in Bezug auf die Ursachen noch darauf, was das Durchdeklinieren von Notwendigkeiten einer Gesellschaft im Gleichgewicht betrifft.
Die hier formulierten Überlegungen führen logisch weiter und kommen unverblümt zu dem Schluss, dass wir mit den bisherigen Denkroutinen radikal brechen und unser Zusammenleben von Grund auf neu denken müssen. Sie beschreiben eine logisch wahrscheinlichste Hauptursache des gesellschaftlichen Ungleichgewichts und skizieren das prinzipielle Fundament einer Gesellschaft im Gleichgewicht.
Diese Überlegungen sind Ergebnisse aus einem langen Beobachtungs- und Reflexionsprozess. In schriftlicher Form vorgelegt und veröffentlicht wurden sie erst im Jahr 2021 bei verschiedenen Anlässen. In diesem Band liegen sie nunmehr zusammengestellt vor.
Enver Muti, März 2022
Die Menschheit braucht eine neue Kultur, keine neuen Menschen.
Auf dem Weg in eine zwangsfreie Gesellschaft
Juli 2021
Alles Übel geht von Angst aus
Unsere Probleme haben allerlei Ursachen. Aber eine scheint bei allen Problemen zu wirken und ist verdächtig, Generalursache, sozusagen die Ur-Ursache zu sein: Es ist unser Umgang mit Angst, dem Gefühl, bedroht oder gefährdet zu sein. Alles, was wir als Problem beschreiben, hat im Kern etwas mit Angst zu tun, welche wir in uns und in der Beziehung zu unserer Umwelt erleben oder erfahren. Alle Problembeschreibungen sind deshalb zugleich implizite Angstbeschreibungen, und alle Lösungen zugleich implizite Angstkompensationen.
Was treibt diese Hauptursache an? Was ist das Motiv?
Wie alle Lebewesen haben wir einen Drang zum Überleben, also zum Erhalt des Lebens, zu unserer Reproduktion. Dieser Drang ist das Grundmotiv aller Angst, z.B. vor dem Tod, Schmerz, Scheitern usw. Für dieses Grundmotiv gilt die Leitunterscheidung Sicherheit/Gefahr. Wir erleben Angst, wenn wir Gefahr wahrnehmen, Gefahr für unser Dasein in jeglicher Hinsicht und in jeglicher Intensität.
Was ist Angst?
Angst ist ein Gefühl. Ein Gefühl ist ein Erleben des Bewusstseins auf Grund psychischer, physischer und sonstiger Zustände in uns und der Beziehung zu unserer Umwelt. Gefühle helfen uns, uns im Leben zu orientieren.
Gefühle sind nur durch Wahrnehmungen möglich, z.B. durch Sinneswahrnehmungen oder Reflexionen. Denn nur dann, wenn Signale wahrgenommen werden, welche durch innere oder äußere Zustände ausgelöst werden, kann etwas entsprechend empfunden bzw. gefühlt und als Gefühl beschrieben werden. Gefühle sind nicht angeboren. Sie kommen und gehen mit Wahrnehmungen. Regungen oder Reaktionen von Babys im Mutterleib oder Neugeborenen sind Instinkte. Menschen wie Tiere werden schon mit Instinkten (Schutzmechanismen) geboren, und ihre Instinkte werden vom Motiv des Selbsterhalts angetrieben, auch wenn sie manchmal eine Ersterfahrung benötigen, um getriggert zu werden. Aber sie laufen unreflektiert ab. An deren Auf- und Abtauchen ist das Bewusstsein nicht beteiligt.
Gefühle wie z.B. Angst hingegen werden durch unsere Wahrnehmungen, Erfahrungen und Vorstellungen ausgelöst und sind für unser Bewusstsein grundsätzlich unentbehrlich. Denn sie veranlassen es zur Anpassung und liefern damit ihren Beitrag zum Überleben. Wir können in unseren Vorstellungen Angst entwickeln, dosieren und eliminieren. Dies verdanken wir unserer Fähigkeit, zu reflektieren und Folgen unserer Handlungen abzuschätzen und Erkenntnisse/Erfahrungen zu verwerten. Wir können uns z.B. eine Zukunft, ein anderes Leben vorstellen. Ängste sind Produkte unserer Reflexionen über unsere Erlebnisse und Erfahrungen (inkl. Instinkterfahrungen).
Bewusstsein steuert Angstgefühle
D.h. wir können unsere Ängste selbst beeinflussen?
Dadurch, dass Angstgefühle nur auf Grund von Operationen des Bewusstseins entstehen und wir unsere Gedanken und Vorstellungen steuern können, ist es möglich, unsere Angstgefühle nicht nur zu beeinflussen, sondern auch nach Belieben zu steuern.
Wenn wir Angst wahrnehmen, kann dies für unser Überleben nützlich oder aber auch schädlich sein. Was davon hier und jetzt der Fall und welches Maß das richtige ist, entscheidet nur das Bewusstsein. Es gibt sonst nicht so etwas wie einen Autokorrekturmechanismus oder eine Instanz, die das richtige Maß des Erlebens laufend einstellen könnte. Zum Erleben von Angst braucht man keine konkrete, unmittelbare Gefahr, wobei Unmittelbarkeit die direkte Beteiligung des Wahrnehmenden (direktes Erleben oder Erfahren) beschreibt, d.h. ohne eine vermittelnde Wahrnehmung/Beobachtung zwischen dem Wahrnehmungsgegenstand und dem wahrnehmenden Bewusstsein. Auch wenn keine konkrete, unmittelbare Gefahr droht, können Vorstellungen von angsterzeugenden Zuständen bestehen. Man kann sich Zustände vorstellen, vor denen man mehr oder weniger Angst bzw. keine Angst hat.
Dabei hat das Bewusstsein eine doppelte Aufgabe zu bewältigen; es muss das Angstgefühl wahrnehmen und erkennen, was Angst auslöst. Und es muss gleichzeitig dieses Gefühl so steuern, dass kein Schaden für den eigenen Selbsterhalt eintritt. Dies ist eine dauerhafte Aufgabe, bei der das Bewusstsein immer wieder neu entscheiden bzw. nachjustieren muss, um ein Gleichgewicht von Sicherheit und Gefahr (= Frieden) zu gewährleisten. Es ist gleichzeitig eine belastende Aufgabe, weil das Stressen des Bewusstseins mit dem Angstempfinden einhergeht und das Bewusstsein alle weiteren Entscheidungen schon unter Angstgefühl, also unter Stress treffen muss.
Wie wird das Bewusstsein mit dieser Aufgabe fertig?
Durch Entscheidungen unter den jeweiligen kognitiven und zeitlichen Gegebenheiten und durch Mobilisierung verfügbarer Ressourcen (materielle und immaterielle Kapazitäten und Fähigkeiten).
Dieser Prozess findet nicht zufällig oder beliebig statt, sondern unterliegt wie jede andere Steuerung einem Ziel/Zweck oder Motiv. Bei der Angststeuerung ist es der Selbsterhalt, d.h. die Sicherstellung des eigenen Fortbestehens.
Das Bewusstsein, das selbst unter Angst operiert, kann dieses Ziel erreichen nur durch Reduktion bzw. Eliminierung der Angst, durch Kontrolle von Angstgefühlen. Genau dies ist aber nicht per se garantiert und muss vom Bewusstsein unter den jeweiligen Bedingungen immer wieder geleistet werden. Dazu bedarf es der Steuerung der Angstwahrnehmungen.
Mithilfe von Angststeuerung können Zustände, die das Bewusstsein als gefährlich einstuft, wahrgenommen oder konstruiert und kommuniziert werden. Durch Beobachtung/
Reflexion erkennen wir Zustände, die Gefühle auslösen. Durch Zustände werden Gefühle für das Bewusstsein beobachtbar, differenzierbar oder berechenbar. Gefühle sind Produkte oder Bilder von Zuständen. Wenn wir Gefühle beschreiben, beschreiben wir Zustände.
Angstgefühle aber signalisieren Alarmzustände, die nicht nur die physische Anpassungsfähigkeit blockieren, Entspannung verhindern und Verletzbarkeiten offenlegen, sondern auch das Bewusstsein stressen und es dazu verleiten, unzweckmäßige Entscheidungen zu treffen. Im Alarmzustand herrscht vielmehr das Bedürfnis, sich so schnell wie möglich festzulegen. Relevante Zusammenhänge werden ignoriert, unsere Wahrnehmung ist fokussiert und verkürzt. Wir verlieren den Gesamtkontext aus den Augen und sehen nur einzelne Bäume, aber nicht mehr den Wald.
Im Alarmzustand reguliert sich das Bewusstsein auf das instinktiv ‚Nötigste‘ herunter, und wir sind auf eigene Sicherheit konzentriert und denken z.B. nicht mehr daran, dass wir uns füreinander brauchen und Solidarität die entscheidende Sicherheitsmaßnahme sein kann. Gefühle für Empathie und Fairness sind kaum noch vorhanden. Wenn wir Gefahr wahrnehmen, stellen wir uns nicht mehr hintan und sind nicht länger bereit, anderen gegenüber Höflichkeiten zu erweisen. Unsere Bereitschaft zu teilen und zu helfen, andere Positionen nachzuvollziehen, schwindet. Wir sind nur noch darauf aus, eigene Überlebenschancen zu erhöhen, ohne dabei auf das zum Überleben tatsächlich notwendige Maß zu achten. Grenzen werden nicht mehr beachtet, Maßlosigkeit wird zum Standardmaß. Das wird dem Bewusstsein jedoch zum Verhängnis.
Wo liegt das Problem, wenn Bewusstsein Angst steuern kann?
Grundsätzlich ist das Bewusstsein bestrebt, ein Gleichgewicht der Gefühle von Gefahr und Sicherheit herzustellen und zu bewahren, weil nur dieses Gleichgewicht einen optimalen Zustand des Überlebens darstellt. Seine Entscheidungen orientieren sich deshalb an diesem Gleichgewicht. Maßlosigkeit, Weglassen von relevanten Optionen oder Verdrängen bzw. Auslassen von Fragen, Unverhältnismäßigkeiten z.B. können aber zu Störfaktoren werden, die ein Ungleichgewicht verursachen. Bei Ungleichgewicht verliert das Bewusstsein die Kontrolle und lässt sich von Gefühlen treiben. Je dominanter die Gefühle werden, desto verheerender kann das Ergebnis ausfallen. Das ist ein ganz wesentliches Handicap der Angststeuerung.
Und dieses Handicap lässt den Ausgang der Angststeuerung wiederum offen?
Ja. In einem Alarmzustand finden Entscheidungsprozesse (Reduktion von Komplexität) unter Zeitknappheit statt. Zeitknappheit ist eine gedankliche Wahrnehmung des Bewusstseins und löst Stress aus. Während das Bewusstsein unter erhöhtem Stress gegen knappe Zeit operiert, wächst gleichzeitig sein Bedürfnis nach Entlastung. Um den eigenen Totalausfall zu verhindern, schärft das Bewusstsein seine Wahrnehmung für Optionen, die Entlastung bieten und ihm den Reflexionsaufwand unter knapper Zeit ersparen. Das ist grundsätzlich sinnvoll, weil Bewusstseine alleine nicht überleben können und auf Erfahrungen anderer angewiesen sind. Wenn man selbst keine Lösung findet, greift man darauf zurück, was sonst als Lösung wahrgenommen und kommuniziert wird. Und dies ist der Fall, wenn das Bewusstsein dringend Entlastung braucht, welche z.B. eine mehrheitlich getragene Option wirksam liefern kann, weil Mehrheit Stärke suggeriert. Eine Entlastung bedeutet allerdings nicht gleich eine Lösung oder den Erhalt des Gleichgewichts. Man muss sehen, wohin eine Entlastung führt.
Stärke ist das wirksamste Mittel der Angstkompensation
Nun gibt es viele Entlastungsangebote. Woran orientiert sich das Bewusstsein in einem Alarmzustand bei der Wahl einer Entlastung?
Im Gleichgewichtszustand bereitet das Bewusstsein seine Entscheidungen durch Vergleich und Abwägen vor. Im Alarmzustand fällt dieser Prozess weitestgehend aus. Was noch funktioniert, ist die Grundorientierung nach Stärke.
Stärke wird zum Handlungskompass, nach dem das Bewusstsein seine Entscheidung bzw. Wahl trifft. Es sucht geradezu instinktiv oder reflexartig nach Stärke. Bei drohender Gefahr ist es ein Vorteil, dass man gegen starke Antagonisten noch stärkere Protagonisten an seiner Seite hat. Stärke wird zum Meistgesuchten. Je mehr Stärke desto besser, je besser desto noch besser! Weil das Abwägen und die Reflexion durch Angst lahmgelegt oder deaktiviert sind, spielen Verhältnismäßigkeiten bei unseren Entscheidungen auch keine Rolle mehr. Dabei ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit für das Gleichgewicht entscheidend.
Was ist unter Stärke zu verstehen?
Stärke bezeichnet zunächst Wirksamkeit in physischer, psychischer, mentaler und sonstiger Hinsicht. Aus einer Zielperspektive betrachtet, drückt sie zudem Überlegenheit, Macht aus. Wir brauchen Stärke, um der Gefahr überlegen zu sein, die wir wahrnehmen („Herr der Lage sein“). Wir kompensieren deshalb unsere Ängste durch Entwicklung und Fortbildung von Stärke. Das hat nicht nur Vorteile.
Da wir unter Gefahr immer Überlegenheit anstreben, entwickeln wir gleichzeitig auch Angst davor, sie zu verlieren. Während Stärke also Angst kompensiert, ruft sie gleichzeitig Verlustängste hervor. Es entsteht eine Spirale der Angst, die sich nur durch ein krasses Ereignis jenseits des Gewöhnlichen unterbrechen lässt, wie z.B. durch plötzliches Aufwachen aus einem Albtraum. Die Angst wird beendet, indem das Schlafen beendet wird und das Bewusstsein wieder das Kommando übernimmt. Solange jedoch die Angstspirale weiterwirkt, ist eine Überkompensation von Angst unvermeidbar.
Warum eine Überkompensation?
Weil wir erleben und erfahren, dass Stärke bei der Erhöhung unserer Überlebenschancen tatsächlich auch hilft, wird sie vom Bewusstsein positiv konnotiert und als eine bewährte Option für Angstkompensation abrufbereit gehalten. Ihr Fehlen ist Grund für Angst. Wann immer wir denken, dass wir nicht die nötige Stärke bzw. Überlegenheit gegenüber Gefahren oder Problemen haben, mit denen wir konfrontiert sind, spüren wir Angst. Weil wir dies durch eigene Erfahrungen wissen und gleichzeitig fähig sind, uns die Zukunft vorzustellen, streben wir Stärke dauerhaft und auf Vorrat an. Unser Leben ist durch und durch danach organisiert.
Alles, was wir tun, tun wir nach Vorstellungen von der Zukunft. Was kommt hiernach? Womit muss ich rechnen? Wie stärke ich mich gegen Gefahren oder Probleme der Zukunft? Und wir finden oder erfinden Gegenmittel und treffen permanent Vorsorge. Wir versuchen z.B. uns zu bilden, uns materielle Sicherheiten aufzubauen, gegen drohende Gefahren Waffen bereitzuhalten. Wir entwickeln vorausschauend Stärke. Das tun wir, weil wir damit unsere Ängste kompensieren, um das Gleichgewicht zu erhalten und die Gefühle im Griff zu halten. Wir wissen aus Erfahrung, was passiert und welches Gefühl uns dabei überkommt, wenn unser Gleichgewichtssinn gestört ist und wir unser Gleichgewicht verlieren. Es kommt auf das Gleichgewicht an.
Gleichgewicht ist der optimale Zustand des Überlebens
Gleichgewicht ist die optimale Wirksamkeit von Kräften und damit der optimale Zustand des Überlebens. Gesundheit z.B. kann man als einen optimalen Zustand bezeichnen. Krankheit dagegen ist ein Ausdruck von Ungleichgewicht, welches kranke Zustände widerspiegelt. Es gibt unterschiedlich große und wirksame Ungleichgewichte oder kranke Zustände. Die Unterschiedlichkeit liegt in unserer Wahrnehmung, genauso wie die Unterschiedlichkeit darin, wie wir Gefahr wahrnehmen und Maßnahmen ergreifen.
Gleichgewicht ist ein Begriff der Wahrnehmung. Unser Bewusstsein entscheidet, was wir wahrnehmen und als Gleichgewicht betrachten und wie wir Kräfteverhältnisse einordnen, was wir für stark oder schwach halten. Das Bewusstsein hat dabei ein Ziel oder Motiv. In der Natur dagegen finden Veränderungen von Kräfteverhältnissen nur sinnentleert statt. Wenn Natur kompensiert, löst sie kein Problem, macht dafür keinen Plan und steuert nicht, sie lässt einfach nur geschehen. Es geschieht unter Gegebenheiten, d.h. unter Beschränkungen, aber ohne jede Zielgerichtetheit. Da ist nichts Zukunft Bezogenes bei. Wir aber haben Gefühle und ein permanent zu befriedigendes Bedürfnis nach Orientierung in einer Welt voller Komplexität, angetrieben durch den Reproduktionsdrang. Im Unterschied zur Natur wollen wir Zustände überwinden, die wir als Problem wahrnehmen.
Wenn Stärke hilft, ein Gleichgewicht zu erhalten, warum ist gleichzeitig zu befürchten, dass sie Ungleichheiten generieren kann? Kommt es nicht darauf an, was wir unter Stärke verstehen?
Unter optimalen Bedingungen, also im Gleichgewichtszustand hat Stärke keine erhöhte Relevanz für das Bewusstsein, da Wirksamkeiten optimal verteilt sind. Die Unterscheidung stark/schwach oder überlegen/unterlegen spielt nur dann eine Rolle, wenn neu justiert werden muss. Aber optimale Entscheidungen fußen auf optimalen Bedingungen, und das Bewusstsein ist in der Lage, durch Abwägen und Vergleich zwischen Optionen eine optimale Entscheidung vorzubereiten.
Im Alarmzustand fehlt diese Vorbereitung und wird durch eine Art instinktiver Reaktion ersetzt, weil wir emotionalen Stress und Zeitknappheit erleben, wenn wir Gefahr wahrnehmen. Man hat z.B. Angst vor einem Wespenstich und befindet sich mit einer Wespe im selben Raum. Nun schlägt man die Wespe an der Wand mit einem dicken Wälzer platt, statt ihr zu ermöglichen, aus dem Raum herauszufliegen. Und die Wand wird schmutzig oder das Buch wird beschädigt, weil die Angst vor dem Wespenstich zuvor ein Abwägen unmöglich gemacht hat. Das von Gefühlen, also von Angst getriebene Bewusstsein trifft aus dem Bedürfnis nach Überlegenheit heraus eine Entscheidung und setzt in diesem Fall Kanonen gegen Spatzen ein.
Verhältnismäßigkeit ist aber nur ein Resultat des Abwägens. Ohne das Abwägen ist die Verhältnismäßigkeit und damit das Gleichgewicht nicht garantiert. So kann eine Lösung des Problems selbst zum Problem werden. Deshalb kommt es genau darauf an, wie einzelne Bewusstseine Stärke als notwendig betrachten. Stark ist, was Gleichgewicht erzeugt oder erhält. Schwach ist, was Ungleichgewicht verursacht. Größere Wirksamkeit kann, muss aber nicht zum Gleichgewicht führen. Entscheidend ist die optimale Ziel-Mittel-Relation unter gegebenen Bedingungen. Diese Relation wird bestimmt durch Wahrnehmungen, Reflexionen und Entscheidungen des Bewusstseins.
Es kommt auf das Glauben an
Wonach entscheidet das Bewusstsein?
Nach seinem Glauben. Alle Entscheidungen des Bewusstseins basieren auf Glauben. Schon die Wahrnehmung selbst ist eine Entscheidung auf Basis des Glaubens. Wenn wir etwas wahrnehmen, tun wir nichts anderes, als dass wir, aus welchen Gründen auch immer, glauben, etwas wahrzunehmen. Das Bewusstsein hat keine andere Wahl als seine Entscheidungen auf Glauben zu stützen. Was es annimmt, ist schon eine Entscheidung.
Glauben bedeutet, etwas für wahrscheinlich halten. Man kann etwas unterschiedlich für wahrscheinlich halten; z.B. für wahrscheinlicher, sehr wahrscheinlich, absolut wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich, kaum wahrscheinlich, unwahrscheinlich. All das ist Glauben.
Glauben ist eine zeitbezogene Festlegung unter gegebenen Umständen und getragen von dem Gefühl des Vertrauens. Es reduziert Unsicherheit/Komplexität und schafft weiteres Vertrauen, und wir werden handlungsfähig, weil wir vertrauen oder uns trauen. Je nachdem, wie wir glauben, fühlen wir uns sicher oder weniger sicher. Diese Festlegung ist erforderlich, um uns orientieren und handeln zu können. Sie ist eine Entscheidung.
Aber wie kommt unser Bewusstsein zu einem Glauben?
Natürlich durch direkte oder indirekte Erfahrungen und Beobachtungen. Das sind Ergebnisse aus den Operationen des Bewusstseins. Unsere Sinne sind zwar notwendige Bedingungen zum Beobachten/Wahrnehmen, aber dass wir z.B. sehen, bedeutet nicht, dass wir beobachten. Zum Beobachten bedarf es des Prozessierens des Bewusstseins, z.B. durch Rückgriff auf bestehende Verknüpfungen, direkte oder indirekte Erfahrungen, Beobachtungen, durch Bildung und Weiterbildung von Zusammenhängen und durch Schlussfolgerungen und nicht zuletzt durch Intuition. Jedes Bewusstsein entwickelt nur so sein Glauben und operiert dabei geschlossen, für sich alleine. Es gibt keinen für alle passenden Glaubensspender, z.B. so etwas wie eine letzte Instanz. Alles Glauben ist Entscheidung einzelner Bewusstseine.
Wäre da Wissen keine Alternative zum Glauben?
Nein. Denn so wie wir wissen, glauben wir, so wie wir glauben, wissen wir. Wissen und Glauben verhalten sich zueinander wie Meer und Wasser. Ohne Glauben gibt es kein Wissen. Dass wir etwas wissen, setzt voraus, dass wir glauben, etwas zu wissen.
Wissen bezeichnet ein bewährtes Glauben, auf das das Bewusstsein zurückgreifen kann, wenn es es für nötig hält, und basiert wie Glauben auch, auf direkten und/oder indirekten Erfahrungen/Reflexionen, Wahrnehmungen, Beobachtungen, Schlussfolgerungen und schließlich Entscheidungen.
Wissen beschreibt höhere Glaubwürdigkeit. Es suggeriert zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter bestimmten Umständen eine wahrscheinlichere Sicherheit. Wir sind uns z.B. absolut sicher, weil wir wissen, wenn wir einen Ball in die Luft werfen, dass er wieder herunterfällt. Diese Sicherheit ist am höchsten, wenn sich das Wissen darüber mit direkten Erfahrungen deckt. Aber unabhängig davon, ob direkte oder indirekte Erfahrungen Wissen generieren, bleibt es wie beim Glauben auch, eine Entscheidung der einzelnen Bewusstseine. Dies gilt auch für ein durch Wissen vermitteltes Sicherheitsempfinden.