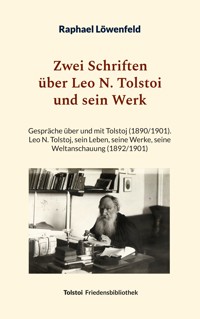
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tolstoi-Friedensbibliothek D
- Sprache: Deutsch
Ohne Literaturvermittler und Übersetzer, die aus dem Judentum (bzw. jüdischen Familien) kamen, hätte es einen Großteil der vor dem Ersten Weltkrieg erschienenen Tolstoi-Editionen für eine deutschsprachige Leserschaft überhaupt nicht gegeben. Als herausragender Akteur ist an erster Stelle der aus Posen stammende Slawist, Übersetzer, Publizist und Theaterdirektor Raphael Löwenfeld (1854-1910) zu nennen. Löwenfeld hat Leo N. Tolstoi zweimal (1890 und 1898) in Russland aufgesucht und auf solider Grundlage zwei frühe Darstellungen über den Dichter verfasst, die als wegweisende Pionierwerke gelten und in dem hier vorgelegten Band ungekürzt - jeweils nach der letzten Auflage - dargeboten werden: "Gespräche über und mit Tolstoj" (1890/1901) und "Leo N. Tolstoj, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung" (1892/1901). Der Verfasser hat zu Anfang des 20. Jahrhunderts die maßgebliche deutsche Ausgabe "Sämtlicher Werke" Tolstois im Verlag von Eugen Diederichs herausgegeben und einen Riesenanteil der Übersetzungen aus dem Russischen ab 1890 selbst besorgt. Seine Berliner Theaterarbeit für ein breites Publikum war u.a. auch von Idealen des berühmten Russen inspiriert. Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe D, Band 1 (Signatur TFb_D001) Herausgegeben von Peter Bürger, Editionsmitarbeit: Bodo Bischof, Ingrid von Heiseler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
G
ESPRÄCHE ÜBER UND MIT
T
OLSTOJ
(Dritte vermehrte Auflage, 1901)
Von Raphael Löwenfeld
Vorwort
Auf der Fahrt (1890)
In Moskau
In Jasnaja Poljana
Schluß
Mein zweite Fahrt (Juli 1898)
L
EO
N. T
OLSTOJ
,
SEIN
L
EBEN
,
SEINE
W
ERKE
,
SEINE
W
ELTANSCHAUUNG
(Zweite Auflage, 1901)
Von Raphael Löwenfeld
Vorwort
1. Jugendjahre
2. Erstlinge
3. Der Kaukasus
4. Sewastópol
5. Petersburg
6. Hier und dort
7. Tolstoj und Turgenjew
8. Volkswohlfahrt und Volksbildung
9. Pädagogische Theorien
10. Poetische Probleme
11. Eheglück
12. Auf der Höhe
Anhang
Ü
BER DEN
V
ERFASSER
Raphael Löwenfeld (1854-1910) als Vermittler von Tolstois Schrifttum im deutschsprachigen Raum
Nachruf auf den Theater-Direktor in der Allgemeinen Zeitung des Judentums (1911)
Ü
BERSICHT
zu den Bänden Tolstoi-Friedensbibliothek
Gespräche
über und mit Tolstoj
1890 ǀ 1901
Leo N. Tolstoi (1828-1910)
im sechsten Lebensjahrzehnt
commons.wikimedia.org
Gespräche über und mit Tolstoj
Dritte vermehrte Auflage ǀ 19011
Raphael Löwenfeld
VORWORT
Leo Tolstojs Kreutzersonate hatte in Deutschland Millionen Leser gefunden; sie war der Stoff der Unterhaltung in dem Kreise aller geistig Angeregten und der Gegenstand der Besprechung in allen Zeitungen und Zeitschriften.
Ein seltsamer Mann, der dieses Buch geschrieben hat! Diese kühne Herausforderung der ganzen Kulturwelt, diese unvergleichliche Kraft der Darstellung!
Nur wenige kannten ihn in Westeuropa. Von seinen Werken waren nur einzelne vielverbreitet, etwa „Eheglück“, das schon Paul Heyse in den „Novellenschatz des Auslands“ aufgenommen hatte, und Anna Karenina, das in der verkürzten und verstümmelten Form der ersten deutschen Übersetzung, von unseren Frauen begierig gelesen wurde.
Und über die Persönlichkeit des Dichters wußte man gar nichts.
Ich hatte mich damals schon lange mit Leo Tolstoj beschäftigt. Seitdem ich die „Bekenntnisse“ kennen gelernt hatte, war mir die eindrucksvolle Gestalt dieses Wahrheitssuchers nahe getreten. Ich las nun planvoll alle Werke Tolstojs in ihrer Urgestalt. Immer mächtiger zog es mich in den Bann des Dichters, dessen Geschöpfe, gleich ihm selber, ein rastloses Ringen der Seele erfüllte. Ich suchte nach Aufschlüssen über sein äußeres Leben, sein Werden und Schaffen.
Niemand hatte je auch nur in flüchtigen Zügen seine eigentümliche Entwicklung geschildert, obwohl der Dichtername Leo Tolstoj schon seit Jahrzehnten in Rußland unter den besten genannt wurde und die geaichten Ordnungsmänner bereits anfingen über die Lebensweise des Grafen, der sich wie ein Bauer gebärdete, die liebenswürdigsten Gerüchte auszustreuen.
Es lockte mich das Leben dieses Mannes, wie es war und wie es geworden war, zu schildern.
Ich ging gleich zu der ersten Quelle, zu ihm und seiner Familie auf sein Landgut im mittleren Rußland.
So entstanden die feuilletonistischen Skizzen: Meine erste Fahrt nach Jasnaja Poljana.
Sie erschienen zuerst 1890 in einer Wochenschrift (Zeitgeist), später als besonderes Büchlein und wurden viel gelesen. Die Teilnahme für den Verfasser der Kreuzersonate verschaffte auch ihnen eine große Zahl von Freunden.
Auf dieses bescheidene Büchlein und die darauffolgende biographische Arbeit stützen sich fast alle neueren Veröffentlichungen über die Person Tolstojs. Nur ein Aufsatz Zagoskins über des Dichters Studienjahre und Sergejenkos Schilderungen „Wie Tolstoj lebt und arbeitet“ (deutsch von Stümcke) beruhen auf selbständiger Forschung oder Erfahrung, kurios ist, daß unsre Zeitungen immer wieder als neu mitteilen, was ich vor nun zehn Jahren in aller Anspruchslosigkeit erzählt habe.
Diese ersten Skizzen erscheinen hier wieder in völlig unveränderter Form. Sie sind aber durch neue ergänzt, die „Meine zweite Fahrt nach Jasnaja Poljana“ im Juli 1898 – unmittelbar vor Tolstojs siebzigstem Geburtstage – schildern. Auch diese werden hier ganz in der Form wiederholt, in der sie damals eine große Tageszeitung zu Tolstojs 70. Geburtstage veröffentlicht hat.
Möge mein Büchlein heute, wo die Schar der Verehrer Tolstojs in stetem Wachsen ist, in seiner erweiterten Gestalt, auch einen weiteren Kreis von Freunden finden.
Berlin, Mai 1901
Raphael Löwenfeld.
1 Textquelle ǀ Raphael LÖWENFELD: Gespräche über und mit Tolstoj. Dritte vermehrte Auflage. Mit Porträt der Gräfin. Leipzig: Eugen Diederichs Leipzig 1901. [170 Seiten] [Die Erstauflage als Buch erschien 1891 bei Richard Wilhelmi].
AUF DER FAHRT
Wir befanden uns im Schnellzuge zwischen Breslau und der russischen Grenze. Ich war an einer kleineren Station von einem Wagen in den anderen gestiegen. Der Dampf zweifelhafter Cigarren hatte mich vertrieben, und ich suchte mir ein Plätzchen in der Nichtraucher-Abteilung der zweiten Klasse. Welche Enttäuschung! Ich öffne die Thür in dem Augenblick, da der Zug sich in Bewegung setzen will, und springe erschrocken zurück. Das ganze Coupé eine Rauchwolke. Aber es hilft nichts, ich muß hinein.
Das Unangenehme des Rauches wurde glücklicherweise durch den Duft gemildert, den eine türkische Cigarette der feinsten Sorte ausströmte. Es war aber schwer, durch den Dampf hindurch den Raucher zu sehen. Erst als sich eine Stimme fragend an mich wandte: „Ist es gestattet?“ erkannte ich eine Dame. Sie war bis hierher ganz allein gereist und hatte sich, der strengen preußischen Vorschrift nicht achtend, über das Gebot des Nichtrauchens hinweggesetzt. Sie legte zwar die Cigarette aus dem Munde, versuchte aber sofort sich die Erlaubnis mit einer zweiten Frage zu erkaufen. „Sie rauchen vielleicht auch? Wir Russen nehmen häufig nur darum im Nichtraucherwagen Platz, weil man hier viel ungestörter rauchen kann.“
Nein, gnädige Frau, antwortete ich, ich rauche nicht. Ich bin hier hineingekommen, um ungestört zu lesen, aber das darf Sie nicht hindern …
Sie lesen russisch, wie ich sehe.
Ja, ich habe einige Kenntnis der Sprache und beschäftigte mich gegenwärtig mit einem der hervorragendsten Dichter Ihres Landes.
O, es ist nicht schwer, zu errathen, mit wem. Mit wem beschäftigt sich denn jetzt das Ausland? Nur mit Einem. Turgenjew war vor Jahren der gelesenste Russe, Dostojewskij wird bei Ihnen bewundert, aber er beschäftigt die Geister nicht mehr. Es giebt nur Einen, das ist Leo Tolstoj. Auch bei uns hat er Freund und Feind, und obwohl seine neueren Werke verboten sind, besitzt sie doch Jedermann, der einen Groschen für ein lithographirtes Exemplar übrig hat. Ich habe da auch in meinem Koffer ein Exemplar der Kreutzersonate. Merkwürdig! Es ist im Ausland gedruckt und geht in so vielen Exemplaren über die Grenze, daß man das Verbot der Regierung nicht begreift.
Sie haben das Buch gelesen?
Ja, es hat mich weniger in Erstaunen gesetzt als Ihre Landsleute. Ich bin vor sechs Wochen über Berlin in ein böhmisches Bad gereist. Wo ich eine Zeitung in die Hand nahm, war die Rede von diesem Buch. Ich las Gutes und Schlechtes, Falsches und Richtiges durcheinander. Was mir am meisten auffiel, war, daß die Kritiker, die über die Kreutzersonate schrieben, von den vorangegangenen Werken unseres Dichters nur geringe Kenntnis zu haben schienen. Das Revolutionäre dieses Buches hat sie mehr beschäftigt als die vollendete Kunstschönheit seiner „Anna Karenina“, seines „Eheglücks“ und seines gewaltigen Epos „Krieg und Frieden“.
Sie können Recht haben, gnädige Frau. Man ist etwas spät auf Tolstoj aufmerksam geworden, gerade etwa um die Zeit, da man in Rußland aufhörte, den Dichter zu bewundern und anfing sich mit dem sittlichen Reformator zu beschäftigen. Aber ganz so ohne Kenntniß seiner großen Schöpfungen sind wir nicht. Was ich da in der Hand habe, ist sein „Krieg und Frieden“. Ich lese es russisch und habe in meinem Koffer eine deutsche Übertragung, theils um mir manchmal weiter zu helfen, teils auch, um den Wert der deutschen Übersetzung festzustellen.
Das werden Sie kaum über die Grenze bringen. Die Censur ist jetzt doppelt streng bei Allem, was den Namen Tolstoj trägt.
Es fehlten nur noch wenige Minuten bis zu dem Grenzort, an welchem die Koffer der Reisenden untersucht werden. Die Hochöfen links und rechts vom Bahngeleise lenkten unsere Aufmerksamkeit ab. Die Unterhaltung war unterbrochen, und ehe wir sie wieder aufnahmen, waren wir bereits in Sosnowice.
Die Dame hatte leider Recht behalten. Einer der Packknechte, der meinen Koffer von oben bis unten durchwühlte, obwohl ich ihm wiederholte, daß er außer den Büchern nichts Verdächtiges enthalte, zog nun auf’s Geratewohl zugreifend, ein paar Bände hervor und ging damit, ohne ein Wörtchen zu sagen, auf einen Gendarmen los, der träg auf einer Bank des Bahnsteiges saß. Der Gendarm entpuppte sich als der Vertreter der russischen Censur.
Wohin reisen Sie?
Nach Moskau.
Gut! Sie werden diese Bücher in Moskau auf der Zensur wiederfinden.
Diese Bücher? Sie haben ja noch gar nicht hineingeblickt, Sie wissen ja noch gar nicht, ob es verbotene sind. Ganz Rußland liest seit Jahrzehnten dieses Buch in abertausend Exemplaren.
Aber es ist ja ein deutsches Buch.
Gewiß, es ist die Übersetzung von „Krieg und Frieden“ des Grafen Tolstoj.
Der Name traf ihn wie ein Schlag. Er erhob sich, würdigte mich kaum noch eines Blickes und gab die Bücher an einen zweiten Beamten weiter. Es half nichts, daß ich ihn zu überzeugen suchte, daß es sich um ein gänzlich harmloses Werk des Dichters handle, daß kein Mensch in Rußland, der Zar selbst keinen Anstoß daran nehmen könnte … es nützte Alles nichts. Ich war um meine Reiselektüre gekommen und hatte die Aussicht, meine kurz gemessene Zeit in Moskau in der Censurabtheilung verbringen zu müssen. Kurz entschlossen übergab ich die Bücher einem der Spediteure, die am Grenzort zahlreich vertreten sind, damit er sie mir unter meiner Adresse nach Berlin sende, und fügte mich in mein Schicksal.
Ich habe wiederholt die russische Grenze überschritten. In so empörender Gestalt war mir die Censur noch nie gegenüber getreten. Ich hatte immer die Liebenswürdigkeit und Zuvorkommenheit der russischen Beamten bewundert. Können sie auch das herrschende Gesetz, besonders in Zeiten, wo es so streng gehandhabt wird, wie jetzt, und in Bezug auf Personen, die eine so hervorragende Stellung einnehmen, wie Leo Tolstoj, schwer umgehen, so suchen sie doch seine Strenge durch ihre höfliche Art zu mildern. Ich war auch noch nie einem so rohen, ungebildeten Beamten begegnet, dem ein Urteil über das Erlaubte oder Unerlaubte von Büchern anvertraut gewesen wäre. Ein Mann, der nicht einmal einen in deutschen Buchstaben geschriebenen Namen lesen konnte, vertrat hier ein Amt, zu dem, wie man glauben sollte, nicht bloß eine gewöhnliche, sondern eine höhere Bildung erforderlich ist. Ich hatte einen Vorgeschmack von dem bekommen, was Leo Tolstoj als Vorkämpfer für geistige Freiheit bedeutet.
Meine Reisegefährtin hatte inzwischen ihr Abendbrod verzehrt und in freundlicher Weise auch für mich gesorgt. Es waren trotz des langen Aufenthaltes nur noch wenige Minuten bis zum Abgang des Zuges. Ich mußte mich beeilen, um noch rechtzeitig einen Platz zu finden.
Am andern Morgen waren wir in Warschau. Die Dame gab mir, ehe der Zug hielt, ihre Visitenkarte und eine Empfehlung nach Moskau.
Diesen Herrn müssen Sie unbedingt besuchen. Wenn Sie Tolstoj so ernst beschäftigt, wie Sie mir vorhin erzählt haben, haben Sie in ihm den besten Führer. Er ist nicht bloß ein Verehrer des Dichters, sondern ein Freund Tolstojs und ein inniger Anhänger seiner socialen Anschauungen. Wenn Sie ihn zufällig in Moskau treffen – denn es muß ein glücklicher Zufall sein, wenn Sie jetzt Jemanden in der Stadt finden – so haben Sie, wenn ich so sagen darf, das Vorzimmer zu Tolstojs Hause betreten.
Ich dankte ihr herzlich, nahm Abschied und beeilte mich, den Anschluß an die Terespoler Bahn zu erreichen.
Es ist geradezu erstaunlich, wie der Geist Tolstojs, wo man sich auch in Rußland bewegen möge, uns in Allem entgegentritt. Wir hatten 33 Stunden Reise vor uns. Im Zuge waren nur wenig Passagiere, und fast jeder der Fahrgäste hatte seine eigene kleine Abtheilung in dem prächtigen Wagen. Als uns aber, nach drei Stunden etwa, das Bedürfnis der Unterhaltung in dem gemeinschaftlichen kleinen Flur zusammenführte, war der Gegenstand des Gespräches wiederum – Tolstoj. Fast alle Passagiere waren aus dem Auslande gekommen und hatten sich dort reichlich mit den Büchern versehen, die man im Inlande nicht bekommen kann; und unwillkürlich befand ich mich heute mit einem Herrn in einem ähnlichen Gespräch, wie ich es gestern mit der Dame geführt hatte. Ich sah wohl, daß es der Mühe wert war, Ansichten und Thatsachen, die im Laufe des Gespräches geäußert wurden, aufzuzeichnen; und war auch nicht Alles, was ich hörte, neu oder durch Originalität überraschend, so erfuhr ich doch Manches, was mir für meine späteren Pläne von Wert war.
Wir hatten schon eine Nacht hinter uns und einen lebhaften Disput über Tolstojs Bildungsgang.
Wäre der Graf nicht immer auf seinem Gute gewesen, nahm einer der Mitreisenden das Wort, hätte er häufiger im Westen gelebt und die geistige Bewegung Europas mit größerem inneren Antheil mitgemacht, er wäre unmöglich zu den asketischen Anschauungen gekommen, die er in seinen religiös philosophischen Büchern in ein System gebracht hat. Aber mit wem verkehrt der Graf? Die Gesellschaft flieht er, sein Umgang mit Schriftstellern ist gering. Die Wenigen, die bei ihm verkehren, vergöttern ihn und sehen mit kritikloser Bewunderung zu ihm wie zu einem Messias auf …
Aber muß man denn in persönlicher Berührung mit den Kreisen des geistigen Fortschritts sein? erwiderte ein Anderer. Kann man nicht heute mit und in der Welt leben, ohne daß man seine vier Wände verläßt? Ich komme nur alle Jahre auf vier bis sechs Wochen einmal hinaus und bin doch stets in Verbindung mit Allem, was hier und dort vorgeht. Der Graf hat ausgedehnte Kenntnisse, er kennt die poetische und philosophische Literatur aller Länder, er liest das Bedeutendste in den Sprachen, in denen es ursprünglich geschrieben ist, ja er arbeitet noch als Greis an seiner Fortbildung; denn ich weiß es aus dem Munde eines seiner besten Freunde, daß er noch vor wenigen Jahren das Griechische erlernt hat, das ihm vorher vollkommen fremd gewesen, und er hat es in der merkwürdig kurzen Zeit von sechs Monaten erlernt.
Meine Neugier ließ mich nach dem Namen des erwähnten Freundes fragen, und ich war ebenso erfreut wie erstaunt, als ich den Namen Wolganow hörte, denselben Namen, der auf der Empfehlung meiner Reisegefährtin von gestern notirt war.
Ist Herr Wolganow ein junger Mann?
Ein Vierziger etwa.
Schriftsteller?
Nein, Kaufmann. Er war bisher ein selbständiger Bankier und ist jetzt in einer der größten Fabriken Moskaus oberster Leiter, ein Mann von vortrefflicher Bildung und ausgezeichnetem Charakter, aber ein so blinder Anhänger Tolstojs, daß man wohl sagen könnte, er denke nur mit Tolstojs Hirne und empfinde mit dessen Herzen.
Ich habe da eine Empfehlung an ihn. Glauben Sie, daß er mir Eintritt bei dem Grafen verschaffen wird? Es ist mein sehnlichster Wunsch, Tolstoj kennen zu lernen.
Tolstoj empfängt Jedermann. Sie bedürfen kaum einer Einführung, und da Sie bereits mit ihm in Briefwechsel gestanden haben, sind Sie ihm ja nicht mehr fremd. Darum aber möchte ich Ihnen nicht abraten, von dieser Empfehlung Gebrauch zu machen. Sie werden in Wolganow einen Mann kennen lernen, dessen Bekanntschaft Ihnen große Freude bereiten wird, und in seiner Person werden Sie den ungeheuren Einfluß Tolstojs am besten erkennen. Er ist übrigens täglich in der Stadt zu sprechen. Seine Familie wohnt unweit Moskaus auf dem Lande, und Sie werden sie jedenfalls auch kennen lernen.
Tolstoj hat nicht bloß das Griechische in vorgerücktem Alter erlernt, bemerkte ein junger Mann von jüdischem Gesichtsausdruck, der in der benachbarten Abtheilung saß und bisher an unserem Gespräch nicht teilgenommen hatte, sondern auch das Hebräische. Ich kenne seinen Lehrer persönlich, es ist der Rabbiner der Moskauer Gemeinde, Herr Minor.
Ein alter Mann?
Ein alter Mann, antwortete der Gefragte höflich. Sie treffen ihn jeden Sonntag in der Stadt. Er hat seine Sommerwohnung in Ssokolniki oder ein Stückchen darüber hinaus. Jedenfalls wird er sich freuen, wenn Sie ihn besuchen. Er wird Ihnen auch gewiß Manches sagen können, was Andere nicht wissen.
Ich hatte gar nicht gehofft, noch ehe ich das Ziel meiner Reise erreicht, so gute Beziehungen zu finden. Den ganzen Werth der flüchtigen Notizen meiner fünfzigstündigen Reise aber lernte ich erst in Moskau und in Jasnaja Poljana selber schätzen.
IN MOSKAU
Wenige Stunden nach meiner Ankunft besuchte ich Herrn Wolganow. Ich fand ihn in der großen Schreibstube seiner Fabrik vor seinen Geschäftsbüchern. Rings herum stand eine große Anzahl Pulte, und an allen wurde fleißig gearbeitet. Man brauchte nur in das Zimmer oder richtiger in den Saal einzutreten, um sich sofort davon zu überzeugen, daß man es in Herrn Wolganow mit einem Manne des praktischen Lebens zu thun hat. Er empfing mich mit großer Freundlichkeit und bat mich, an seinem kleinen Tische, der ein wenig abseits von der langen Pultreihe stand, Platz zu nehmen. Ein Diener reichte ihm und mir ein Glas Thee, und nach wenigen Minuten waren wir in der lebhaftesten Unterhaltung.
Mein Freund X. hat mir Ihren Besuch schon angekündigt. Er erzählte mir mit freudigem Erstaunen, daß er gestern einem deutschen Schriftsteller begegnet sei, der Mitteilungen aus Tolstojs Leben wünsche. Ich bin meinem Freunde dankbar, daß er Sie an mich gewiesen hat. Ich bin seit sieben Jahren auf’s Innigste mit dem Grafen befreundet. Es giebt eigentlich nur noch einen von den Jüngeren unter seinen aufrichtigen Anhängern, der ihn länger kennt als ich, und der vielleicht auch seinem Herzen näher steht. Sagen Sie mir nur, was Sie wünschen, ich bin in Allem zu Ihren Diensten.
Hauptsächlich liegt mir daran, meine Arbeit – ich zog dabei aus einer kleinen Mappe eine ziemlich umfangreiche Handschrift hervor – in allen Teilen, die sich aus Thatsachen aus dem Leben des Dichters beziehen, nachprüfen zu lassen. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn der Graf selbst mir meine Angaben bestätigte und, was noch wichtiger ist, ergänzte. Denn der Bestätigung werden sie kaum bedürfen; sie sind aus den zuverlässigsten Quellen und nach genauester Sichtung zusammengestellt. Was ich niedergeschrieben habe, halte ich unbedingt für richtig, aber es ist sehr wenig, es hat Lücken, die unter allen Umständen ausgefüllt werden müssen. Ich weiß z. B. von den Auslandsreisen des Grafen, denen ich eine große Bedeutung für die Entwickelung seiner Anschauungen zuschreibe, so gut wie gar nichts. Die russischen Quellen schweigen. Es macht den Eindruck, als hätte Niemand von dem Grafen selbst etwas Zuverlässiges erfahren, was über die nacktesten Angaben von Geburt, Schulbesuch, Heirat u. dgl. hinausgeht.
Gewiß! antwortete Wolganow. Der Graf ist sehr zurückhaltend. Mehr als das. Es wird Ihnen bekannt sein, da Sie sich mit seinen Werken und mit den Schriften über ihn beschäftigt haben, daß er seine ganze Vergangenheit gering schätzt, daß er die dichterischen Erzeugnisse seiner jüngeren Jahre gänzlich verwirft als die Früchte eines eitlen Ehrgeizes, einer unsittlichen Selbstbespiegelung und eines dünkelhaften Besserwissens.
Ich habe wohl so etwas hie und da gelesen, aber ich hielt es für übertrieben, wenn nicht für ganz erfunden.
Es ist durchaus so. Ich weiß es aus seinem eigenen Munde, ich habe oft und viel mit ihm darüber gesprochen und – hat er nicht Recht?
Diese Wendung überraschte mich. Wolganow machte auf mich den Eindruck eines Mannes von vielseitigster Bildung. Er spricht, obwohl er wenig in Deutschland gewesen ist, unsere Sprache vortrefflich und beherrscht auch das Französische in dem Grade, daß er auf einem Archäologen- oder Anthropologen-Kongreß (ich weiß das nicht mehr genau) die Gäste aus dem Westen in französischer Sprache begrüßt hat. Auch in unserer Unterhaltung bezog er sich häufig mit vertrautester Kenntnis auf Dichter und Denker des Westens, die er in der Originalsprache liest und anführt. Ich hatte daher den Eindruck, mit einem Manne zu sprechen, dessen Anschauungen mit den unsrigen verwandt sein mußten. Ich erkannte bald, daß ich mich in dieser Beziehung geirrt hatte, und daß Wolganow, wenn man so sagen darf, nur ein Spiegelbild Tolstojs bot. Er wußte wie sein Meister die Bildung Europas mit den Anschauungen des russischen Sektirers einträchtig zu verbinden.
Ich sehe die Welt ganz wie Tolstoj an, fuhr er fort. Das Schaffen mit künstlerischen Zwecken steht ohne Zweifel weit hinter den sittlichen Bestrebungen zurück. Erst jetzt erfüllt Tolstojs Riesengeist seine eigentliche Mission. In einem Lande, wo so viel Fäulnis ist, wo höheres Streben so selten ist, wo es keine Ideale giebt, wo die höhere Gesellschaft in ihrer Scheinbildung den gemeinsten Trieben huldigt, und wo die gedrückte untere Schicht kaum von dem Leben des Tiers entfernt ist, brauchen wir die sittliche Kraft eines Volkspredigers und Reformators.
Sie können sich gar nicht vorstellen, sagte er mit einem raschen Gedankensprunge, was Tolstoj für mein Leben bedeutet. Seit ich ihn kennen gelernt, ist er, wenn ich so sagen darf, immer mit mir, in allen Fragen des Lebens giebt er mir seinen Rat, in Stunden einer stärkeren Seelenregung ist es mir, als stünde er leibhaftig vor mir und sagte mir, was ich zu thun habe, und ich habe die Zuversicht, immer gut gehandelt zu haben, wenn ich seiner Eingebung folge.
Ich sah, daß ich es mit einem Schwärmer zu thun hatte, der zwar nicht ungeprüft auf die Worte des Meisters schwört, der aber jetzt von seiner Vollkommenheit so durchdrungen war, daß es einen Widerspruch nicht gab. Ich war auch in die Gedankenwelt Tolstojs nicht tief genug eingeweiht, um mit gleichen Kräften eine Discussion auszunehmen mit einem Manne wie Wolganow, den in der Welt nichts mehr zu beschäftigen schien als Tolstoj.
Wir kamen wie von selbst auch auf die „Kreutzersonate“. Wolganow bekennt sich ganz und gar zu den asketischen Ansichten dieses Werkes.
Wie unglücklich muß die Gattin des Dichters bei dem Erscheinen dieser Erzählung gewesen sein!
Das haben mir schon viele gesagt, antwortete Wolganow. Man erzählt auch, die Kaiserin soll, nachdem sie das Buch gelesen, ausgerufen haben: „Die Frau dieses Mannes muß sehr unglücklich gewesen sein!“ Aber das ist ein großer Irrtum. Die Gräfin ist eine sehr kluge, eine sehr tüchtige Frau. Es hat sie schmerzlich berührt, daß der Dichter nach einem so langen Zusammenleben – sie sind 28 Jahre verheirathet – ein Buch über die Ehe in dieser Auffassung geschrieben hat. Sie hat sich aber bei ihrer hohen Bildung bald gesagt, daß kein feinfühliger Leser aus dem Werke Schlüsse auf das Eheleben des Dichters ziehen würde. Ein großer Dichter weiß eben auch fremde Erfahrung zu gestalten.
Tolstojs Ansichten von der Ehe haben sich sehr oft verändert, wie ja überhaupt die Lebensanschauung, die er jetzt predigt, die Frucht des letzten Jahrzehnts ist. Sie wisse aus seinen Werken, wie er stets ein Suchender war. Jetzt hat er gefunden. Ich habe seine Anschauungen sehr oft gegen Angriffe zu vertheidigen, ich meine nicht die Angriffe frivoler Menschen, die für das ernste Streben eines Leo Tolstoj gar kein Verständnis haben, ich meine gewichtige Einwürfe gegen seine Lehren. Die Frivolität hat vor etwa sieben Jahren das Gerücht verbreitet, Leo Tolstoj sei verrückt geworden; und wie es in Rußland eben ist, die Einen glaubten es, weil ihnen die Fähigkeit zu prüfen fehlt, die Anderen trugen es weiter, weil es eine interessante Neuigkeit war, noch Andere machten daraus eine gefährliche Waffe. Man hatte wohl beobachtet, wie Tolstojs kirchen- und regierungsfeindliche Lehren immer mehr an Anhängern gewannen. Konnte es etwas Bequemeres geben, als das Gerücht von seiner Verrücktheit geflissentlich weiter zu bringen? … Heute glaubt es kein Mensch mehr, denn es giebt zu viele, die den Mann persönlich gesprochen haben und mit dem tiefsten Eindruck von seiner sittlichen Größe und der Überzeugung von seiner vollkommenen Geistesklarheit zurückgekommen sind.
Heute also muß man ihm ernst gegenübertreten, wenn man die Wirkung seiner Lehren abschwächen will. Natürlich ist es da immer das Einfachste, die mangelnde Folgerichtigkeit hervorzuheben. Ich hatte erst vor wenigen Tagen einen Strauß mit einem Freunde. Wir gingen an Tolstojs Hause vorüber. An jedem Hause in Moskau, Sie werden das bemerkt haben, – wenn Sie andere russische Städte kennen, werden Sie wissen, daß die Einrichtung überall besteht, – an jedem Hause ist der Name des Besitzers angeschrieben, und so steht auch an Leo Nikolajewitschs Hause: Eigenthum des Grafen L. N. Tolstoj. – Der Graf aber erkennt ja ein Eigenthum nicht an, meinte mein Freund, wie verträgt sich das? – Seltsame Frage! Als ob der Graf die Macht hätte, gegen eine allgemeine Einrichtung anzukämpfen.–Warum verschenkt er das Haus nicht? Vor Jahren hieß es doch, daß er all sein Vermögen verschenkt habe, eben damals, als man ihn allgemein für verrückt hielt. – Auch diese Frage ist unrichtig. Der Graf erkennt in der That kein Eigenthum an, aber darf er darum, was er besitzt, verschenken? Soll er, da er doch nicht Allen geben kann, A beschenken und B nicht? Nach seiner Meinung würde daraus schon Sünde entstehen. Genug, daß er sein Vermögen nicht genießt. Daß seine Familie es nützt, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Wäre es nicht ein viel größeres Unrecht, wenn er Frau und Kinder zu seinen Anschauungen zwänge? Zu überzeugen sucht er sie, Gewalt verpönt er in allen Lebensbeziehungen. Wenn aber Jemand in sein Haus hineinzöge und sich’s dort bequem machte, er würde nichts dazu sagen. Mehr, fügte Wolganow, seine Rede wieder an mich wendend, hinzu, mehr kann ein Christ nicht.
Wir waren mit diesen Worten dahin gekommen, woher Tolstojs Anschauungen ihren Ausgang nehmen. Tolstojs Christentum ist, um es mit einem Worte zu sagen, ein unkirchliches. Ihm ist das Evangelium der Ausfluß der höchsten Weisheit und höchsten Sittlichkeit. Die reine Lehre Christi ist aber im Laufe der Jahrhunderte durch Herrschsucht und Habsucht entstellt worden. Da man (ich will hier den Grundgedanken der Tolstojschen Geschichtsbetrachtung in möglichst kurzer Form ausdrücken), da man in seinen Handlungen das sittliche Maß Christi verworfen hatte, schuf man einen neuen Maßstab, mit dem man sie messen konnte, ohne daß sie in ihrer ganzen Niedrigkeit erschienen.
Kennen Sie denn Tolstojs Erklärung des Evangeliums?
Ich besitze seine „kurze Erläuterung“.
Dann haben Sie keine Vorstellung von der gewaltigen Gedankenarbeit und der Originalität der Auffassung, die in der Tolstojschen Evangelienforschung verborgen ist. Sehen Sie – er zog dabei den Schubkasten seines Tisches auf – dies ist der Kommentar zum Evangelium. Die Arbeit ist in wenigen Exemplaren verbreitet, sie ist sehr umfangreich, und eine Abschrift kostet an 60 Rubel. Gedruckt darf sie nicht werden, und so sind nur Wenige im Besitze des Werkes. Ich will es Ihnen gern leihen, ich kann Ihnen auch eine Abschrift herstellen lassen. Ich thue das nur für sehr Wenige, aber ich sehe, wie wertvoll die Kenntnis dieses Werkes für Sie sein muß, so daß sie unentbehrlich für Ihre Arbeit ist.
Aber nun muß ich Sie für heute um Entschuldigung bitten. Ich stehe von 5 Uhr an zu Ihrer Verfügung. Morgen ist glücklicherweise ein Feiertag. Ich schließe meine Arbeitszeit um 1 Uhr ab, und wir können dann den ganzen Tag zusammen sein, Kommen Sie, bitte morgen hierher. Wir wollen um Eins ein echt russisches Frühstück einnehmen, dann begleiten Sie mich in meine Sommerwohnung, ich werde Sie meiner Frau anmelden. Wir plaudern dann weiter über den Gegenstand, der Sie beschäftigt, und der mir, wie Sie sehen, Herzenssache ist. Leben Sie wohl!
_____
Ich benutzte den Nachmittag, um Herrn Minor auszusuchen. Ich traf ihn leider nicht in seiner Stadtwohnung und mußte mich entschließen, nach Bogorodsk zu fahren. Die Verbindung nach diesem ländlichen Vorort ist eine bequeme, eine Pferdebahn mit ungemein billigen Preisen bringt uns in etwa 1 ½ Stunden an’s Ziel.
Ich klingelte an der Thür eines bescheidenen Landhäuschens. Eine alte, würdige Dame trat mir entgegen, und ich fragte sie in russischer Sprache, ob ich die Ehre haben könnte, Herrn Minor zu sprechen. Ich hätte eine Bitte an ihn, die mir sehr wichtig wäre, ich sei zu einem ganz bestimmten Zwecke von Berlin nach Moskau gekommen, und er könne mir mit einer Unterhaltung von einer halben Stunde vielleicht sehr nützlich sein.
Sie sind aus Berlin? sagte sie mit einem gewissen besonderen Interesse. Mein Sohn ist gegenwärtig dort, er ist als Vertreter der Moskauer Universität hingefahren. Mein Sohn ist Docent der Psychiatrie und wird wahrscheinlich auch in Berlin auf dem medizinischen Congreß einen Vortrag halten. Sie können auch deutsch mit mir sprechen, wenn Ihnen das bequemer ist, – und ohne meine Antwort abzuwarten, setzte sie ihre Unterhaltung in deutscher Sprache fort. Ich saß etwa zehn Minuten mit ihr auf der Veranda, das übliche Glas Thee stand bereits vor mir, und ich sprach ihm auch zu, denn es ist nicht höflich, ein angebotenes Glas Thee zurückzuweisen, als Herr Minor in der Thür erschien. Er pflegte um diese Zeit sein Mittagsschläfchen zu halten und hatte aus Zuvorkommenheit für einen so weit hergereisten Gast seine Ruhe abgekürzt: ein hochgewachsener alter Herr mit etwas wirrem, grauem Haar und Bart, mit einem klugen Auge, mit gutem Wissen und klarem Denken. Ich trug ihm meinen Wunsch vor.
O gewiß, man hat Ihnen die Wahrheit gesagt. Vor fünf oder sechs Jahren, ich kann es Ihnen nicht mehr genau sagen, kam Graf Tolstoj zu mir. Er bat, ich möchte ihm Jemanden empfehlen, der ihm hebräischen Unterricht gebe. Der Gedanke, hebräisch zu lernen, war ihm teils durch seine Bibelstudien, teils durch einen äußeren Anlaß gekommen. Der Schriftsteller Ssorkin, ein getaufter Jude, hatte sich unmittelbar nach den großen Judenverfolgungen (1881) an hervorragende russische Schriftsteller gewandt, sie sollten in der Not ihre Stimme zu Gunsten der Juden erheben. Turgenjew und Tolstoj waren die gewichtigsten, die damals in Rußland sprechen konnten. Turgenjew sagte zu. Es widerstrebte seinem Wesen aber, in einer Abhandlung die Judenfrage zu beleuchten, er wollte durch eine Erzählung wirken. Er kam nicht mehr dazu, sein Versprechen einzulösen. Tolstoj hielt mit seiner Antwort zurück; er wollte die Judenfrage, wie er sagte, „aus den Quellen“ studiren. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, fügte Minor hinzu, wie irrig diese ganze Anschauung ist. Die heutige Judenfrage hat nichts mit dem Studium der Sprache der Bibel zu thun. Kaum daß man das Wesen der heutigen Juden in irgend einen Zusammenhang mit dem Volke von Palästina bringen kann. Aber Tolstoj blieb dabei, und er ging mit großem Fleiß an die Arbeit. Ich mochte ihm nicht den ersten besten nennen und unternahm es selbst, sein Lehrer zu sein. Ich unterrichtete ihn nach der Methode der östlichen Juden. Er liest also das Hebräische nicht nach spanischer Art, sondern wie wir russischen Juden. (Ich will zur Erklärung hier einfügen, daß die Juden in Europa in zwei große Gruppen zerfallen, in die sogenannten spanischen und die sogenannten polnischen Juden. Die spanischen lesen das Hebräische, wie die christlichen Gelehrten, die es von ihnen übernommen haben, die polnischen, zu denen auch die Gesamtheit der deutschen Juden gehört, haben eine andere Aussprache.)
Tolstoj begriff außerordentlich schnell. Er las aber nur, was auf seinem Wege lag. Was ihn nicht interessirte, übersprang er. Wir begannen mit dem ersten Worte der Bibel und fuhren in dieser sprunghaften Weise bis zu Jesaias fort. Hier brach der Unterricht ab. Die Vorhersagung des Messias dieses Propheten genügte ihm. Mit der Grammatik der Sprache beschäftigte er sich nur insoweit, als sie ihm unentbehrlich schien. Er habe Griechisch ebenso in kürzester Zeit gelernt und sei vollkommen im Stande, das neue Testament in der Ursprache zu lesen.
Er kennt auch den Talmud. In seinem stürmischen Wahrheitsdrange befragte er mich stets über die Sittlichkeitsanschauungen des Talmud, über die Auslegung der biblischen Legenden durch die Talmudisten, und schließlich schöpfte er aus dem russisch geschriebenen Buch ‚Die Weltanschauung der Talmudisten‘ (mirosozremie talmudistow), das von der Petersburger „Gesellschaft zur Hebung der Bildung unter den Juden“ herausgegeben ist.
Wir arbeiteten etwa eine halbe Stunde wie Lehrer und Schüler. Einmal in der Woche fuhr ich zu dem Grafen, einmal kam er zu mir. War die halbe Stunde um, so war der Unterricht mehr eine Unterhaltung. Ich antwortete ihm auf alle Fragen, die ihn beschäftigten. Eines Tages kamen wir auch auf seine Auffassung von der Erhaltung der Welt durch die Liebe. Davon, meinte er, stehe nicht ein Wort in der Bibel. Ich verwies ihn aus die Psalmstelle 89,3, „olam chessed jiboneh“, die ich ihm „die Welt besteht durch die Liebe“ übersetzte. Er war sehr erstaunt über diese Auffassung der bekannten Stelle.
Minor stimmt, was wohl kaum gesagt zu werden braucht, mit den Anschauungen Tolstojs in keinem Punkte überein. Aber er ist ein Bewunderer des Dichters und erkennt den ernsten Wahrheitsdrang seines großen Schülers freudig an.
_____
Wie verabredet, ging ich am folgenden Tage pünktlich um 1 Uhr zu Herrn Wolganow. Die Geschäftstätigkeit hatte bereits aufgehört. Der Tag des heiligen Ilija (Elias) wurde gefeiert. Wolganow hatte einen Gast, einen jungen Mann von etwa 23 Jahren. Sein blasses Aussehen gab dem Gesichte etwas Ernstes, ja Asketisches. Wassilij Petrowitsch Diamantow, so wurde er mir vorgestellt, war einer der treuesten Anhänger Tolstojs. Seiner Anhänglichkeit an den Meister verdankt er die Freundschaft Wolganows, der sich seiner väterlich annimmt. Diamantow hat eine Abhandlung über die Kreutzersonate geschrieben, die sich besonders gegen eine scharfe, wie er sagte, persönliche Kritik Michailowskijs in den „Russkija Wjedomowsti“ richtet. Michailowskij hatte über den Begriff „natürlich“ gespottet. Es heißt in der „Kreutzersonate“: Sie nennen es natürlich. Natürlich ist Essen. Und Essen ist eine Lust, ist angenehm, es erheischt keine Überwindung der Scham. Hier aber ist Widerwillen, Scham und Schmerz zu überwinden. Nein, es ist nicht natürlich. Und ein unverdorbenes Mädchen widerstrebt dem immer, wie ich mich überzeugt habe.
An diese Stelle knüpft Michailowskij einen heftigen Angriff gegen den Dichter. Diamantow beleuchtet nun den Begriff. „Natürlich ist Alles, was keiner Seite des menschlichen Lebens widerspricht, oder kürzer gesagt, was mit dem Gesammtwesen des Menschen in Einklang steht.“ Tolstoj hat den Aufsatz des jungen Schriftstellers gelesen und sich anerkennend darüber ausgesprochen. Aber gedruckt durfte die Abhandlung nicht werden.
Es ist kaum zu glauben! Die „Kreutzersonate“ wird wie ein öffentliches Geheimnis behandelt. Jedermann liest sie in einer Abschrift oder in einer Lithographie, man verleiht sie gegen eine bestimmte Entschädigung, man giebt sie in Freundeskreisen von Hand zu Hand, man kritisiert und bekämpft sie in öffentlichen Blättern wie ein dem ganzen Lande bekanntes Buch – nur den Dichter selbst und seine Vertheidiger läßt man nicht sprechen. Und dabei wird kein Unterschied gemacht zwischen sachlicher Beurteilung und persönlicher Beschimpfung. Was muß sich Leo Tolstoj von dem elendesten Schreiber nicht Alles sagen lassen, ohne ein Wort zu seiner Vertheidigung drucken zu dürfen! Die Regierung vergißt, daß diese Art der Unterdrückung neuer Ideen nur ihre Anhängerschaft vermehrt und die Treue zu dem Meister vertieft. –
Wir gingen nun gemeinsam in das Traktir Jerogow, wo wir bei einem echt russischen Frühstück, bei Bliny (eine Art Fischcotelette), Soljanka (eine Fischsuppe mit allerlei Gemüsezuthat) und Beeren-Kwas unsere Unterhaltung fortsetzten.
Wir sprachen von dem Einfluß, den Tolstojs gesellschaftlichsittliche Anschauungen auf die Lebensgestaltung seiner Anhänger üben. Ich erfuhr hier von einem Manne, der die genaueste Kenntnis davon hatte, Dinge, die in Westeuropa gänzlich unbekannt sind. Tolstoj lehrt, wie wir wissen, die Aufhebung des persönlichen Eigentums und die gemeinsame körperliche Arbeit auf dem Lande. Das Stadtleben ist für ihn der Ursprung alles Unglücks, aller Unsittlichkeit. Aber die Voraussetzung des menschlichen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens ist die Liebe, die Liebe im Sinne Christi. Wenn eine Anzahl von Menschen nur aus wirtschaftlichen Gründen zusammentreten, um ihr Leben auf kommunistischer Grundlage einzurichten, würden sie bald wieder in Feindschaft auseinander gehen. Das Aufgeben persönlicher Wünsche, die Unterdrückung persönlicher Leidenschaften ist die erste Voraussetzung der „christlichen Gemeinschaft“. Dies etwa würde Tolstoj auch dem Invastigating-Club entgegen halten, der sich (wie die Zeitungen berichten) jüngst in Iowa unter dem Einfluß des Bellamy’schen „Rückblickes“ gebildet hat.
Und wie in Rußland jeder neue Gedanke mit übereilter Hast in die That umgesetzt wird, so geschah es auch hier. Eine so große Anzahl christlicher Gemeinschaften (christjanskija obščiny) besteht seit einer Reihe von Jahren, alle von den Jüngern Tolstojs begründet.
Diese Art Kommunismus ist in Rußland nicht neu. Unter den Sektirern werden verwandte Ideen seit Jahrzehnten gepredigt, und die nahe Verwandtschaft der Tolstojschen Anschauungen mit den Lehren der russischen Sektirer sind für jeden Eingeweihten eine klare Thatsache. Ja, man könnte behaupten, Tolstoj habe nur vermöge seiner ungemein großen Bildung und getrieben von seiner Liebe zum Volke und dem Drange nach Wahrheit die unter den Bauern lebenden religiösen Ideen zu einer einheitlichen Lehre gestaltet, die in gleichem Grade das körperliche wie das seelische Wohl des Menschen umfaßt. Und so ist auch die christliche Gemeinschaft nichts Neues. Sie hat nur jetzt erst, könnte man sagen, ihre theoretische Begründung gefunden, durch den Begriff der Liebe eine neue Grundlage erhalten.
Die christliche Gemeinschaft vereinigt eine Auswahl freiwillig zusammentretender Menschen, Männer und Frauen, zu gemeinsamer Arbeit und gemeinsamem, bescheidenem Lebensgenuß. In diesen Gemeinschaften herrscht im Allgemeinen auch die Ehe, und die Reinheit der Beziehungen zwischen Mann und Frau soll außerordentlich sein. Das Geld ist aus dem inneren Verkehr der Mitglieder verbannt, nach außen ist es eine Notwendigkeit. Man kauft für das Geld, das man als gemeinsamen Besitz betrachtet, Alles das, was man selber in der christlichen Gemeinschaft nicht erzielen kann, also Thee, Zucker u. dgl. An das Erworbene aber haben mit gänzlicher Aufhebung des persönlichen Eigentums Alle ein gleiches Recht. Tritt zu den Begründern der Gemeinschaft ein neuer Mensch hinzu, so wird er ohne Weiteres aufgenommen. Er braucht nichts mitzubringen, als den guten Willen zur Arbeit und zum friedlichen Verkehr, und so ziehen denn auch von einer Gemeinschaft zur anderen Mitglieder herüber und hinüber und beanspruchen die Aufnahme am anderen Orte wie ein natürliches Recht. – Was uns bei diesen Verhältnissen so durchaus fremdartig erscheint, ist dem Russen eigentlich nur die Fortbildung einer zwar nie systematisch erfaßten, aber immer in ihm lebendigen Auffassung. Wer in ein russisches Haus tritt, ist kaum ein Gast; er gehört sofort zur Familie. „Er wohnt mit uns“, ist der Ausdruck, den der Russe von einem ihm Nahestehenden gebraucht, der ohne weitere Förmlichkeiten in sein Haus kommt und ebenso ohne Förmlichkeiten aufgenommen und wie ein Zugehöriger behandelt wird, freilich nicht, ohne den Begriff des persönlichen Eigentums festzuhalten.
Heute giebt es eine ganze Anzahl solcher christlichen Gemeinschaften. Ein Herr Sibirjakow hat im Gouvernement Ssamara eine solche Gemeinschaft begründet, ein Herr Jeropkin an der Ostküste des Schwarzen Meeres eine zweite. Die älteste nach Tolstojschen Lehren eingerichtete christliche Gemeinschaft ist die von Aljochin im Gouvernement Smolensk. Sie ist vor vier Jahren entstanden und umfaßt 120 bis 130 Desjatinen. Im Gouvernement Twer hat vor drei Jahren ein Philologe, früher Lehrer eines weiblichen Gymnasiums, Herr Nowosjólow, eine christliche Gemeinschaft begründet. Ein Bruder des genannten Aljochin lebt mit seinen Genossen in der Nähe von Charkow. In demselben Gouvernement lebt Fürst Chiljkow in kommunistischer Weise, nachdem er sein nach Millionen zählendes Vermögen für allgemeine Zwecke geopfert hat. Zwölf Werst von Jasnaja Poljana, dem Gute des Grafen Tolstoj, entfernt, ist des Herrn Bulygin christliche Gemeinschaft. Ein Herr Feinermann* hat mit seinem Genossen Butkjewitsch im Gouvernement Cherson eine Anzahl meist jüdischer Communisten vereinigt. [*Isaak Borissowitsch Feinermann, 1863-1925 – Lehrer, Journalist; Pseudonym: Teneremo.] Die religiöse Grundlage ihres Zusammenlebens ist eine schwache, und darum (so meinte Wolganow) hat sie sich auch nicht halten können. Die eifrigsten Jünger Tolstojs sind Birjukow, der vor einem Jahre in der Nähe von Kostroma, und Tschertkow, der im Gouvernement Woronesch eine christliche Gemeinschaft begründet hat.
Tschertkow ist auch der Mittelpunkt der Vereinigung „Poßrjednik“ (der Vermittler), die – mit dem Sitz in Petersburg – zum Zweck der Verbreitung guter volkstümlicher Schriften zu- sammengetreten ist. Der größte Teil der Schriften des „Poßrjednik“ ist von Leo Tolstoj verfaßt, aber auch andere hervorragende Schriftsteller des Landes, wie Rjemirowitsch-Dantschenko, Ljeskow, Eitel, Erlenwein, Gololobow und Frau Chmielew nehmen Teil an dieser bedeutsamen Unternehmung. Naturgemäß findet die Hauptarbeit in den beiden Residenzen des Landes statt. In Petersburg wird die redaktionelle Arbeit, in Moskau durch den Buchhändler Ssytin die geschäftliche besorgt. Der Poßrjednik hat zum ersten Male in Rußland von der sogenannten Colportage Gebrauch gemacht. Die Bücherverkäufer, die früher im Lande umherzogen, waren nichts als andere Hausirer auch, die ihre schlechte Waare zu möglichst hohem Preise ausboten. Die Korobejniki, welche das Geschäftshaus Ssytin ausschickt, stehen in dauerndem Dienste der Gesellschaft Poßrjednik, haben Credit und brauchen auf diese Weise den Käufer nicht zu überteuern. Der Poßrjednik hat schon außerordentlich viel Gutes gestiftet. Die Regierung oder genauer gesagt die Kirche sieht ihn mit scheelen Augen an, denn die Religiosität und Sittlichkeit der Volksschriften des Poß-rjednik sind nicht die der herrschenden Geistlichkeit. Tschertkow nimmt auch als Schriftsteller an den Arbeiten des Poßrjednik Theil.
Auch Birjukow ist Schriftsteller. Er steht von allen Anhängern dem Meister am nächsten. Er hat sich ganz und gar in die Gedankenwelt Tolstojs hineingelebt und betrachtet nun die Entwickelungsgeschichte der Menschheit von dem neugewonnenen Standpunkt aus. Er ist gegenwärtig mit einem Buch beschäftigt, das er „Wjesna čelowečestwa ili Nowaja Žizn“ (der Frühling der Menschheit oder Neues Leben) benennt. Die erste Periode des Menschheitslebens nennt er die Zeit der Gewalt. Da gab es kein Gesetz, kein Recht, keine sittlichen Vorstellungen. Auf diese erste Zeit folgte die Periode der Gerechtigkeit, die ihren höchsten Ausdruck in der mosaischen Gesetzgebung gefunden hat. Zahn um Zahn ist die Formel für die äußerste Gerechtigkeitsforderung. Sie wurde abgelöst durch die Periode der Liebe, die Christus im Herbst der Menschheit gesäet hat. Dann kamen Schneestürme und Wolkenzüge, und die Saat ging nicht auf. Allmälig brachen die ersten zitternden Sonnenstrahlen durch den Nebel und riefen die Keime aus dem Boden hervor. Solche Sonnenstrahlen waren die bulgarischen Bogomilen, die provencalischen Waldenser, Wycliffe und Luther. Durch die Wärme, welche diese Sonnenstrahlen erzeugten, ist die Saat Christi endlich aufgegangen. Der sie zu ihrer vollen Blüte brachte, ist Leo Tolstoj.
Verwandt mit den christlichen Gemeinschaften ist auch die eigenartige Schöpfung der „biblischen Vereinigung“ in Jelisawetgrad. Sie besteht nur aus Juden, die communistisch zusammenleben. In religiöser Beziehung herrscht vollkommene Duldsamkeit. Es giebt unter ihnen Gesetzestreue, es giebt auch solche, die den neuen Anschauungen ihres Lehrers und Meisters Tolstoj anhangen. –
Nach dem Frühstück, durch welches mir mein liebenswürdiger, schnell gewonnener Freund eine Anschauung von den Delicatessen der russischen Küche zu geben wünschte, stiegen wir in die Pferdebahn, um seine Sommerwohnung in Ssokolniki aufzusuchen.
Das Wetter war schön, und wir benutzten das Verdeck. Neben uns saß eine Anzahl Mushiks, und Herr Wolganow machte sich ein besonderes Vergnügen daraus, die Leute zu religiösem Disput herauszufordern. Der russische Bauer ist dazu immer aufgelegt; Fragen der Sittlichkeit, selbstverständlich in den Grenzen seiner bescheidenen Bildung, beschäftigen ihn immer, aber er hat einen guten Verstand und das, was wir mit einem vortrefflichen deutschen Worte „Mutterwitz“ nennen. Ist er besonders begabt, so wagt er sich auch in einen Streit mit Gelehrten und Gebildeten. Sein Streben, eine Richtschnur für das sittliche Leben zu gewinnen, ist geradezu einzig. Es giebt Beispiele dafür, daß Männer über sechzig Jahre ihre gesammten Lebensanschauungen ändern, weil sie glauben, jetzt erst die Wahrheit gefunden zu haben; und sie sind nicht selten. Wie sehr erinnert das an den großen Dichter, der mit 55 Jahren zu einer geschlossenen neuen Weltanschauung gekommen ist und von dieser Stunde an aus eine an großartigen Schöpfungen reiche Vergangenheit, auf sein ganzes Lebenswerk geringschätzig zurückblickt!
Wolganow erzählte mir von einem Manne seiner Bekanntschaft, einem Fabrikanten, einem echten Typus des Moskauer Kaufmannsstandes, wie man ihn in Lejkins Schilderungen trifft, der in einem Alter von 60 Jahren seine ganze Vergangenheit abschwor, um ein neues Leben zu beginnen. Er war streng kirchengläubig. Ein Zufall führte ihn zum Zweifel, und aus eigenem Antriebe las er, der bis dahin keinen Buchstaben gekannt hatte, das neue Testament. Er brauchte einen Anhalt, und man riet ihm, zu Tolstoj zu fahren. Er fuhr hin und kam als getreuer Anhänger und Vorkämpfer zurück. Wo sich eine Gelegenheit bietet, fordert er die Leute zu religiösen Disputen heraus, rein aus dem Streben nach Wahrheit. Einst traf er in einem Waggon dritter Klasse mit einem Lehrer zusammen. Er hörte, wie die Leute ihn mit Ehrerbietung ansprachen, und es reizte ihn, den Mann herauszufordern. Wie könnt Ihr Euch Lehrer und Priester nennen, Ihr und die Geistlichen? Heißt es nicht im Testament: „Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn Einer ist euer Meister, Christus, ihr aber seid alle Brüder. Und soll Niemand Vater heißen auf Erden, denn Einer ist euer Vater, der im Himmel ist, und ihr sollt euch nicht lassen Meister nennen, denn Einer ist euer Meister, Christus.“ Der Disput wurde immer lebhafter. Alles im Wagen nahm Partei, die Meisten für den spitzfindigen Bauern, und als er eben wieder in längerer scharfsinniger Gegenrede den armen Lehrer in die Enge getrieben hatte, erscholl es von allen Seiten: Bravo, Bravo, Iwan Petrowitsch! Es war kein Zweifel mehr, auf welcher Seite der Sieg war – Iwan Petrowitsch aber zog sich bescheiden in seine Ecke zurück, und als der Lehrer den Wagen verlassen wollte, bat I. P. ihn um Verzeihung, wenn er ihn etwa gekränkt haben sollte.
Iwan Petrowitsch ist heute so weit, daß er die Taufe durch den Geistlichen verwirft. Als die Ceremonie an seinem Enkelchen vollzogen werden sollte, stand er schmollend bei Seite, und es bedurfte großer Überredung, um ihn versöhnlich zu stimmen. Der Disput mit dem Geistlichen konnte nicht ausbleiben, denn der Priester versuchte, den Mann von der Göttlichkeit der Taufe zu überzeugen und sie aus vielen dunklen Stellen des neuen Testaments zu erklären. Diese Stellen ließen sich nicht so im Handumdrehen widerlegen, und es ließe sich viel darüber sagen. – Mit den dunklen Stellen und dem Vielsagen, meinte Iwan Petrowitsch, ist es ein schlimmes Ding; man wird nie damit fertig. Sehen Sie, wir sitzen hier vor einem Tisch, auf dem ein weißes Tuch liegt. Man kann über das weiße Tischtuch viel reden, man kann auch mit wenigen Worten schnell einig sein. Sagen Sie, das Tischtuch ist weiß, und ich sage auch, es ist weiß, so brauchen wir nicht ein Wort mehr zu reden. Sagen Sie aber „schwarz“, dann kommen wir unser Lebtag mit Reden nicht zu Ende.
Solche Männer wie Iwan Petrowitsch, und es giebt ihrer, wie schon oben gesagt, viele, wenden sich häufig mit ausführlichen Zuschriften an Leo Tolstoj. Man spricht allgemein von dem Einfluß, den Sjutajew, ein ungebildeter Sektirer, und Bondarew, ein greiser Bauer, der in Sibirien lebt, aus Tolstojs Anschauungen gehabt haben sollen. Ich habe selbst eine große Epistel „über die Taufe und das Abendmahl“ gelesen, die ein Molokanin an Tolstoj geschickt hat. Sie zeugt von einer erstaunlichen Kenntnis der Bibel, des alten wie des neuen Testaments, und von einer seltenen Klarheit und Schärfe des Geistes.
Da ist es denn kein Wunder, daß der Mushik mit scharfem Ohr hinhorcht, wenn von Leo Tolstoj und seinen Lehren gesprochen wird. Wir beschäftigten uns gerade mit der Frage, wie Tolstoj über die Fortdauer der Seele denke, und Wolganow zog ein Buch aus der Rocktasche, in welchem die Anschauungen der Kirchenväter zusammengestellt waren. Wir lasen eine Stelle aus Tatian. Der Gedankengehalt dieser Stelle war ungefähr folgender: „Ich weiß nicht, was ich war, ehe ich leibliches Leben annahm, und so weiß ich nicht, was ich sein werde, wenn dieses Leibes Leben endet. Ich werde also sein, was ich war.“ Offenbar war dem Bauern zu unserer Linken die Frage zu schwierig. Er bereitete sich immer von Neuem vor, in unser Gespräch einzugreifen, aber er mußte wohl seine Schwäche erkennen und ließ davon ab. Aber seine Aufmerksamkeit war unaufhörlich in Anspruch genommen.
Dies ist der wunderbar aufnahmefähige Boden für die Saat Leo Tolstojs. – –
Inzwischen waren wir nach einer Fahrt von fünfviertel Stunden und einem Spaziergang von fünfzehn Minuten vor dem Sommerhäuschen Wolganows angelangt. Auf der offenen Veranda spielten die kleinen Kinder der Familie. Ein riesiger Ssamowar brodelte aus dem Tische, und die Frau des Hauses schenkte ein Glas um das andere für ihre zehn Sprößlinge ein. Wenige Minuten, und wir saßen um den Tisch herum und setzten unser Gespräch mit derselben Lebhaftigkeit fort.
Frau Wolganow ist eine vollkommene Gegnerin Tolstojs, d. h. Tolstojs, des sittlichen Reformators, den Dichter erkennt sie an und liebt ihn. Sie ist mit seinen Werken auf’s Allergenaueste vertraut und ergänzte in manchen Punkten meine Arbeiten, von welchen ich ihr dies und das vorlesen durfte. Sie befindet sich also auch im Widerspruch mit den Anschauungen ihres Gatten. Dieses Moskauer Ehepaar ist ein merkwürdiges Wiederspiel der Gutsherrschaft von Jasnaja Poljana. Hier wie dort ist der Mann ein Russe mit der weitesten europäischen Bildung und doch ganz und gar mit den nationalen Eigentümlichkeiten seiner Umgebung; hier wie dort die Frau mütterlicherseits von deutscher Abstammung, eine liebenswürdige Bereinigung der freien Natur der Russin mit den klaren, besonnenen Anschauungen der deutschen Frau. Frau Wolganow ist mit Allem, was die Person und die Wirksamkeit Tolstojs betrifft, bekannt, aber sie fühlt sich der Wandlung, die er in dem letzten Jahrzehnt durchgemacht hat, fremd. Sie ist religiös, aber jeder Askese abhold, sie liest, was er jetzt schreibt, aber es bleibt ohne Einwirkung. In ihrem Hause befinden sich Abschriften von allen Werken Tolstojs und unzählige Briefe von seiner Hand, teils solche, die er an Wolganow selbst geschrieben, teils Abschriften der Episteln an Andere. Diese Briefe sind durchaus verschieden von dem, was wir so zu nennen pflegen. Kaum daß Persönliches darin berührt wird! Es ist ein schriftlicher Gedankenaustausch über religiös-sittliche Fragen in dem Stil des neuen Testaments. An die Vorlesung dieser Briefe knüpften sich so manche Mittheilungen, die mir von dem höchsten Interesse waren.
Wolganow erzählte von zwei jungen Damen, die sich gegenwärtig mit nichts Anderem beschäftigen als mit dem Abschreiben Tolstojscher Werke. Die eine von ihnen war Lehrerin an einer Mädchenschule. Sie sagte sich, von der Lektüre Tolstojscher Werke ergriffen, immer mehr und mehr von der Kirche los und unterließ es, beim Gebet das Kreuz zu schlagen. Das mußte der Leiterin der Anstalt auffallen. Sie rügte das Verhalten der Lehrerin während der Andacht und ermahnte sie zur Besserung. Das Beispiel für die Kinder, die ihr anvertraut waren, schien ihr gefährlich. Aber die junge Lehrerin hielt an ihrer Überzeugung fest. Sie bekam ihren Abschied und war brodlos. Da zog sie sich denn mit ihrer Schwester an die ferne Küste des Schwarzen Meeres zurück, suchte sich in der Nähe von Poti eine Bauernhütte und lebt hier ein bescheidenes Leben, Tag um Tag mit der Vervielfältigung der Werke Tolstojs beschäftigt. Und auch solche Beispiele sind nicht vereinzelt.
Daher kommt es auch, daß von den ungedruckten Werken so unzählige Abschriften im Umlauf sind, daß fast alle Gebildeten sie kennen. Nur von Tolstojs Briefen aus jüngeren Jahren giebt es keine Vervielfältigung. Sie sind, wie sich aus dem Entwickelungsgange des Dichters ergiebt, ganz anderer Art. Es sind eben gewöhnliche Briefe. Für Jemanden, der sich mit dem Leben Tolstojs beschäftigt, wären sie ein unentbehrliches Material, aber sie sind unzugänglich. Die Gräfin hat sie mit außerordentlicher Sorgfalt von allen Bekannten eingefordert und, zu einer Sammlung vereinigt, dem Rumjanzew-Museum in Moskau übergeben. Sie werden aber Niemandem gezeigt, denn sie gelten als Privateigentum. Es war nur eine Vorsicht, welche die treue Gattin veranlaßte, die Briefe aus ihrem Hause fortzugeben. Es kam häufig vor, daß das Haus ganz allein war; sie konnten leicht gestohlen oder durch Feuer vernichtet werden. In der Bibliothek genießen sie den Schutz der leitenden Beamten. Tolstojs Handschrift ist kaum zu lesen, er schreibt schnell und mit vielen Verschnörkelungen. Darum sind auch die Gräfin und die zweite Tochter des Hauses, Mascha, beflissen, Alles, was aus seiner Feder hervorgeht, abzuschreiben und in dieser deutlicheren Übertragung aufzubewahren. Tolstoj antwortet Jedem, der sich an ihn wendet, – in religiösen Fragen meist eigenhändig.
Ist jeder Russe schon leicht zugänglich, so ist es Tolstoj im höchsten Grade. Er lebt jetzt fast ganz zurückgezogen auf seinem Gute. Früher verbrachte er den Winter häufig in Moskau und nahm an dem gesellschaftlichen Leben regen Antheil. Natürlich erfreute er sich großer Aufmerksamkeit, die in den meisten Fällen die Folge der Verehrung, in manchen wohl auch die Folge bloßer Neugier war. Eine Dame der Moskauer Gesellschaft, die junge Tochter eines weit bekannten Professors der Medicin, benutzte einmal ein gesellschaftliches Zusammentreffen, um dem Dichter ihr Entzücken über die wunderbare Schilderung des weltlichen Lebens in „Anna Karenina“ auszudrücken. Sie hob besonders die Beschreibung des Balles und des Wettrennens hervor. Sie habe gar nicht gewußt, daß es so herrliche Dinge gebe. Welche Freude, daran teilzunehmen, ehe man sie aus eigener Anschauung kennen gelernt habe! Tolstoj, damals schon der sittliche Asket, war von der Begeisterung der jungen Dame sehr betroffen, er empfand sie als eine schlechte Wirkung seiner Werke und wurde nur noch mehr in der Geringschätzung seiner dichterischen Schöpfungen bestärkt … Sie galten ihm nur als der Ausfluß eitler Selbstbespiegelung. Die Werke eines Schriftstellers, meinte er, sollten darum erst 30 Jahre nach seinem Tode veröffentlicht werden. Wenn keine persönlichen Rücksichten den schaffenden Geist beengen, wenn die Sucht nach Ruhm, der Wunsch, einem bestimmten Publikum zu gefallen, das Bedürfnis, öffentlich gelobt zu werden, nicht vorhanden ist, dann nur wird die dichterische Schöpfung der vollkommene Ausdruck der Überzeugung sein. – –
Wolganow hatte bereits dem Grafen meinen Besuch angemeldet, und wir erwarteten stündlich seine Antwort. Nicht als ob der Graf ein Freund gesellschaftlicher Formen wäre – aber wir konnten nicht wissen, ob er sich von seiner Krankheit schon erholt hatte und empfangsfähig war. Am anderen morgen erhielten wir die Nachricht, daß Tolstoj mich erwartete.
IN JASNAJA POLJANA
Montag, den 23. August / 4. September, Nachmittags 3 Uhr, reiste ich nach Tula. Ich befolgte den Rat Wolganows, als ich mir ein Billet dritter Klasse löste. Sie werden sicher interessante Dinge erleben, rief er mir noch in dem Augenblick des Abschieds zu.
Angenehm ist eine solche Reise in einem russischen Wagen dritter Klasse für einen Westeuropäer nicht, aber die Spannung führte mich leicht über manche Unbehaglichkeit hinweg, und der Weg ist nicht weit. Denn sieben Stunden Reise bedeutet eben in Rußland nicht viel. Es waren nur wenige Bauern im Wagen, wie überhaupt die untere Volksklasse nicht vertreten zu sein schien. Schon daran, daß die meisten Insassen Bücher herauszogen, und nicht bloß in russischer Sprache geschriebene, erkannte ich, daß sie den gebildeten Klassen angehörten. Mir gegenüber saß ein junger Studirter. Er erzählte von wissenschaftlichen Reisen inn Deutschland und Frankreich und las in deutscher Übersetzung Björnson’s „Capitän Mansara“, ein Beweis, daß sein Aufenthalt im Ausland in ihm auch das Streben entwickelt hat, sich mit den neuesten Erscheinungen fremder Literaturen bekannt zu machen. Rechts von mir, um einige Plätze entfernt, saß eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Aus ihrer Erzählung ging hervor, daß ihr Mann Gerichtsbeamter war. Die beiden bisher einander fremden Personen begannen bald ein lebhaftes Gespräch, dessen Ausgangspunkt Tolstoj oder, um es genauer zu sagen, sein Haß gegen den ärztlichen Stand und die ärztliche Wissenschaft war. Sie behandelten mit allem Ernst und in heftiger Rede und Gegenrede, die von der Fähigkeit, logisch zu denken, zeugten, die Frage, ob die Medizin nütze oder schade. Die Dame vertrat den Nutzen der ärztlichen Wissenschaft, ihr Gegner stand auf dem Standpunkt Tolstojs, und Keiner von Beiden gab nach. Bei uns hätte eine solche Auseinandersetzung, wenn sie überhaupt möglich wäre, sofort eine andere Form angenommen. Die Frage über den Wert der Medizin wäre bei uns nicht schroff mit Ja oder Nein beantwortet worden, wir hätten über die Grenzen ihres Könnens gesprochen und mit dem Zweifel an der Bedeutung der medizinischen Wissenschaft nicht ohne Weiteres einen Zweifel an der Ehrlichkeit ihrer Vertreter verbunden. Hatte ich also auch nicht das getroffen, was mir Wolganow in Aussicht gestellt, einen lebhaften religiösen Disput der Mushiks, so war mir doch ein Ersatz dafür gegeben, der mir in grellster Weise den Unterschied unseres stetigen Denkens und des sprunghaften Vorwärtsstrebens des gebildeten Russen vor die Augen rückte.
Der Zug traf um 10 Uhr in Tula ein. Ich fuhr in den Londoner Hof, der von einer deutschen Wirtin verwaltet wird, und fand ein gutes Unterkommen. Eine alte Dienstmagd machte in meinem Zimmer die Aufwartung. Da ich nie versäumte, nach Beziehungen zu Tolstoj zu forschen, und hier in Tula, 1 ½ Meilen von seinem Gute, mit Recht welche vermuten durfte, unterhielt ich mich auch mit ihr über den Grafen.
O, ich kenne ihn sehr gut, sagte sie. Ich bin neun Jahre bei ihm gewesen. Es war um die Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft, ich war seine Leibeigene. – Mehr aber konnte ich von ihr nicht herausbringen. Sie war so beschränkt, daß sie ihr Alter nicht anzugeben wußte, und auf alle weiteren Fragen erhielt ich immer nur die Antwort: Ein guter Herr, ein sehr guter Herr!
Ich glaubte die Spur weiter verfolgen zu müssen, und fragte die Wirtin, ob sie noch mehr Leute im Hause habe, die aus Jasnaja Poljana stammten. Morgen, meinte sie, kann ich Ihnen den Bruder der Alten kommen lassen. Er war viele Jahre beim Grafen. Im vorigen Jahre war er in meinem Hause, und jetzt ist er beim Gouverneur in Diensten. Wenn Sie morgen noch hier sind, können Sie vielleicht viel von ihm erfahren. Es kommen jetzt viele Herrschaften aus dem Auslande zu dem Grafen Tolstoj. Unlängst erst war eine Schwedin bei ihm, Fräulein Bemisch; sie hat auch bei mir gewohnt.
Ich sagte ihr, daß ich die Absicht habe, sofort am anderen Morgen weiter zu reisen, und daß ich doch wohl von dem früheren Diener des Grafen nicht mehr erfahren würde als von ihm selbst. Mein Weg führe mich unmittelbar nach dem Gute des Grafen. – –
Am anderen Morgen mietete ich einen Iswoschtschik nach Jasnaja Poljana, einen Bengel von etwa 15 Jahren. Er hatte diesen Weg noch nie gemacht. Er kannte Leo Tolstoj nicht einmal dem Namen nach. Ich erzählte ihm, daß der Graf besonders vom Volke geliebt werde, und daß wir ihn möglicherweise auf dem Felde am Pfluge antreffen würde, weil er seinen Acker wie jeder Mushik selbst bestelle. Was er wohl daran für ein Vergnügen finden kann! lautete die kurze Kritik des peitschenführenden Jünglings. –
Jasnaja Poljana ist fünfzehn Werst von Tula entfernt. Vierzehn Werst fährt man auf einer vortrefflichen Kunststraße, dann biegt man rechts ab und hat etwa noch eine Werst Landweg vor sich. Ein schlichter, weiß getünchter Stein in Form einer gestutzten Pyramide bezeichnet die diesseitige Grenze des altadligen Besitzes. Wenige Minuten von dem Grenzstein entfernt liegt Dorf und Gut. Bei der Einfahrt fallen dem Reisenden die Überreste früherer herrschaftlicher Größe auf: zwei runde, eisengedeckte Thürme, welche jetzt das Thor von Jasnaja Poljana bilden; sie sind vom Alter auf die Seite gebeugt und von Moos und Gras überwachsen. Eine dichte, schattige Birkenallee, die einen vernachlässigten Obstgarten durchschneidet, führt zu dem Wohnhaus des Gutsherrn. Künstlich angelegte Teiche und ein Park schließen den bescheidenen Herrensitz ein, der einst der Teil eines stolzeren Ganzen war.
Im vierten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hat ein Brand den herrschaftlichen Palast des Gutes zerstört. Nur zwei zweistöckige Flügel des großen Baues sind stehen geblieben. Der eine bietet den zahllosen Gästen des jetzigen Besitzers Aufenthalt, der andere ist seine und seiner Familie bescheidene Wohnung. Dieser Flügel, das jetzige Herrenhaus, hat in den letzten Jahrzehnten viele Wandlungen durchgemacht. Im Jahre 1862 war Graf Tolstoj genöthigt, den kleinen Bau zu erweitern, denn die wachsende Familie erheischte mehr Raum und Bequemlichkeit. Kunstlos wie der Hauptteil war auch dieser Ausbau. Nur das Bedürfniß entschied, der Schönheitssinn hatte kein Wörtchen mitzureden. Drei Fenster breit nach links wuchs der alte Bau, und noch heute sieht man an der unsymmetrischen Form des Ganzen genau die Grenze zwischen der unscheinbaren Vergangenheit und der Ergänzung der jüngeren Zeit. Ebenso kunstlos und bescheiden ist die Erweiterung nach der rechten Seite, die aus dem Jahre 1888 stammt, ein Holzbau von noch kleinerem Umfang und noch geringerer Schönheit. Im Frühling 1890 ist nun an der linken Seite des Hauses eine große Veranda aufgeführt worden, in den Sommermonaten der Hauptaufenthalt des gräflichen Paares, seiner Familie und seiner zahlreichen Gäste. Die Gräfin begriff gar nicht, wie man bisher ohne diese Veranda hatte auskommen können. Vor dem Hause auf einem grünen Wiesenplatze steht ein großer Rundlauf, an dem die Kleinen mit Lachen ihre Geschicklichkeit zeigen, und da, wo im Anfang des Jahrhunderts der große Mittelbau des alten Schlosses stand, locken Turngeräte jeglicher Art auch die Erwachsenen zur Übung an.
Auf dieser Veranda saß Graf Tolstoj, als ich in meinem kleinen Wagen vorfuhr. Vor ihm stand auf einem einfachen Tisch ein riesiger Ssamowar. Nur noch ein Herr war in seiner Gesellschaft, den ich später als den General von Stachowitsch, den Verwalter der Reichsmarställe, kennen lernte. Der Graf begrüßte mich ohne Förmlichkeiten in freundlichster Weise und hieß mich zu seiner Linken Platz nehmen. Er bot mir Kaffee und Thee an, ich hatte zu wählen. Ich bat um ein Glas Thee.
Sie wollen ein wenig bei uns bleiben, sagte der Graf. Herr Wolganow hat Sie uns angemeldet, und wir haben uns auf Ihren Besuch gefreut. Wir haben viel Besuch von Ausländern, fügte er hinzu – ohne Pose, ohne im Geringsten damit ausdrücken zu wollen, daß diese Gäste als Verehrer zu ihm kommen. Unser Gespräch kam schnell der eigentlichen Ursache meiner Reise näher.
Also Mitteilungen zu meiner Lebensbeschreibung wünschen Sie! Ich stehe solchen Dingen recht gleichgütig gegenüber. Aber meine Frau und meine Kinder werden Ihnen Alles geben, was Sie brauchen. Was haben Sie da in der Tasche? –
Ich zeigte ihm die umfangreiche Handschrift, die ich mitgebracht hatte, um sie an Ort und Stelle zu ergänzen und wenn nötig zu berichtigen.





























