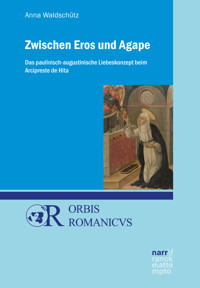
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Orbis Romanicus
- Sprache: Deutsch
Diese Studie behandelt das Libro de Buen Amor im Horizont der christlichen Theologiegeschichte, wobei der Fokus sowohl auf der neutestamentlichen Exegese und der Patristik als auch auf der abendländischen Begriffsgeschichte von Eros und Agape liegt. Es wird dargelegt, wie der Liebesbegriff im autoritativen christlichen Schrifttum selbst polysem und damit zum hermeneutischen Problem wird. So kann das Verhältnis von buen amor und loco amor im Werk des Arcipreste neu bestimmt und über bisherige Deutungen hinausgegangen werden, indem die Herleitung aus einer patristisch-platonischen und dem lateinischen Westen bestens bekannten Tradition neu beleuchtet wird, die sich mit Paulus, Origenes, Dionysius Areopagita und insbesondere mit Augustinus sowie mit deren zahlreichen Nachfolgern bis ins Mittelalter hinein verbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Waldschütz
Zwischen Eros und Agape
Das paulinisch-augustinische Liebeskonzept beim Arcipreste de Hita
Umschlagabbildung: Guidoccio Cozzarelli: Die heilige Katharina von Siena tauscht ihr Herz mit Christus, um 1485, Pinacoteca Nazionale di Siena, Inv.-Nr. 445.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823396062
© 2023 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2365-3094
ISBN 978-3-8233-8606-3 (Print)
ISBN 978-3-8233-0491-3 (ePub)
Inhalt
Für meinen Vater
IForschungsfragen und Herangehensweise
1974 leitete Carmelo Gariano sein Werk El mundo poético de Juan Ruiz mit folgenden Worten ein:
He aquí un nuevo estudio sobre Juan Ruiz…, pese a que hay ya bastantes, y quizá de sobra. Pero eso no quiere decir que queda interrumpido el diálogo interior entre el antiguo vate y el estudioso moderno. Todo diálogo mental es búsqueda, y, por ser tal, puede llegar a ser descubrimiento.1
In dieser Aussage steckt viel Wahrheit. Es gab damals bereits sehr viel Literatur zum Libro de buen amor (LBA) und auch nach 1974 wurde noch mehr dazu geforscht und veröffentlicht, aber die Suche ist noch nicht abgeschlossen und lässt uns immer wieder Neues entdecken.
I.1Forschungsfragen
Diese Dissertation will einen Beitrag zur Forschung leisten, indem folgende Fragen beantwortet werden:
Welchen Liebesbegriff verwendet der Erzpriester?
Diese Frage scheint nicht neu zu sein, schließlich haben sie sich zuvor schon andere Literaturwissenschaftler:innen gestellt. Der Unterschied zwischen ihren Analysen und der vorgelegten Dissertation liegt aber darin, dass hier der Liebesbegriff des Erzpriesters auf seinen christlichen Ursprung hin untersucht und mit den Erzählungen des LBA in Verbindung gebracht wird, sodass sich eine bislang noch nicht erforschte Perspektive ergibt.
Dies stellt uns allerdings schon vor weitere Fragen: Warum verwendet der Arcipreste ausgerechnet den Begriff „amor“ und auch noch „buen amor“? Wie die nächsten Kapitel zeigen werden, könnte die Gottesliebe ganz andere Namen tragen. Gottesliebe wurde vor dem LBA nie als „buen amor“ bezeichnet.1 Warum muss also ein solcher Begriff verwendet werden, v. a. da er ein gewisses Streben2 in sich trägt?
Handelt es sich bei der Definition der Liebe im LBA um den paulinischen Liebesbegriff?
Diese Frage ist für die hier vorgelegte Untersuchung zentral. Bei genauerem Hinsehen scheint der Erzpriester eine stark dualistisch geprägte Auffassung von der rechten Lebensführung zu haben, d. h. er unterscheidet klar zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht, rechter und törichter Liebe. Diese Dichotomie ist auch unter den frühchristlichen Autoren und v. a. bei Paulus zu finden. Geht man einen Schritt weiter, findet man in den Paulusbriefen diverse Regeln und Vorgaben, die auch im LBA auftauchen, sodass nun untersucht werden soll, welcher Zusammenhang zwischen den Paulusbriefen und dem LBA besteht.
Ist die weltliche Liebe im LBA erlaubt?
So heiter und humorvoll der Erzpriester an die Schilderungen seiner Liebesabenteuer herangeht, so deutlich sind auch seine Warnungen vor Verfehlungen und sündhaftem Handeln. Mittels Dialogizität1 führt er uns verschiedene Standpunkte und Anschauungsmöglichkeiten vor, sodass die Antwort auf die Frage, ob weltliche Liebe erlaubt ist, und wenn ja, in welchem Rahmen, zunächst nicht leicht ersichtlich scheint. Die weltliche Liebe ist weder beim Erzpriester noch in der (mittelalterlichen) christlichen Kirche gänzlich als sündhaft zu verteufeln. Schließlich – und auch darauf wird im Verlauf dieser Arbeit näher eingegangen – hat Gott Mann und Frau füreinander geschaffen sowie zur Fruchtbarkeit und gegenseitigen Unterstützung auf Basis von Zuneigung aufgerufen. Es stellt sich daher die Frage, wie der Erzpriester zur weltlichen Liebe an sich steht, und ob es eine ehrbare, vertretbare Variante gibt.
Welche Rolle spielen Don Amor und Doña Venus im LBA?
Die beiden Götter der römischen Mythologie sind im LBA sehr präsent. Das Streitgespräch zwischen dem Erzpriester und Don Amor nimmt verhältnismäßig viel Platz ein.1 Als siegreicher Feldherr zieht der Liebesgott mit Don Carnal nach dem Sieg über die Fastenzeit durch die Lande, was überbordender Beschreibungen nicht entbehrt.2 Doña Venus begegnet den Leser:innen nicht nur als Gesprächspartnerin des Erzpriesters, bevor dieser bzw. sein Alter Ego sich in sein erstes „erfolgreiches“ Liebesabenteuer begibt, sondern sie leitet ihn, der sich als „Kind der Venus“ sieht, in Liebesdingen an.3 V. a. erstaunt aber die Konstellation, in der die beiden Götter gemeinsam auftreten: Anders als in der römischen Mythologie sind sie hier nicht Mutter und Sohn, sondern ein Ehepaar.4 Was der Erzpriester mit dieser Darstellung im Sinn gehabt haben könnte, verdient eine genauere Untersuchung. Welche Rolle die Götter spielen – jeder für sich und beide als Paar – wird hier ebenfalls analysiert. Dabei interessiert v. a., wie sie zur Definition des Liebesbegriffs beitragen.
Außerdem soll ein weiterer Punkt untersucht werden, der die Wissenschaft schon lang beschäftigt: Wer war Juan Ruiz? Da es nach wie vor nur vage Hinweise auf die historische Person Juan Ruiz, Erzpriester von Hita, gibt5, wird hier nicht gänzlich geklärt werden können, wer er war, wo er herkam und was aus ihm wurde. Aber es soll ein Versuch unternommen werden, anhand neuer Informationen mehr über ihn zu erfahren, sodass irgendwann vielleicht das Rätsel um seine Person gelöst werden kann.
I.2Herangehensweise
Vom LBA selbst gibt es verschiedene Ausgaben. Neben den zahlreichen altspanischen gibt es auch die neuspanische Übersetzung1 und – für die deutschen Leser:innen eine hilfreiche Stütze – die zweisprachige Ausgabe, erstellt von Hans Ulrich Gumbrecht2. Für die Zitate in dieser Dissertation wurde die Ausgabe von Jaques Joset aus dem Jahr 19743 gewählt, weil diese sich in der bisherigen Forschung als eine der am besten recherchierten und kommentierten etabliert hat.
Das LBA wurde in der Vergangenheit von zahlreichen Literaturwissenschaftler:innen untersucht. Hierbei standen die unterschiedlichsten Gesichtspunkte im Zentrum der Analysen. Anthony N. Zahareas zum Beispiel konzentrierte sich u. a. auf die Struktur des LBA, die Rolle des Erzählers bzw. Kommentators und die Übernahme bis dahin tradierter Erzähltechniken.4 Joset hat in seinen Kommentaren zum LBA und seiner zweiten Auseinandersetzung mit dem Werk5 wichtige Erläuterungen aufgeführt, die für das Verständnis des komplexen Textes unerlässlich sind. Auch die Äußerungen Leo Spitzers6, Ulrich Leos7 und María Rosa Lida de Malkiels8 dürfen in einer erneuten Untersuchung des LBA nicht vergessen werden. Die bisherigen Ansätze werden hier mit modernen theoretischen Ansätzen und zum Teil kürzlich erschienenen Publikationen zum LBA kombiniert, weitergeführt und, wenn notwendig, kritisch hinterfragt.
Untersucht werden außerdem die im LBA explizit und implizit zitierten Quellen sowie sein theologischer Inhalt. Es geht hier um die teils ironische, teils ernste Verarbeitung und Anwendung paulinischer bzw. christlicher Werte und Lehren. Da diese u. a. auf platonischen Ideen fußen, dürfen Platon und sein Symposion hier nicht fehlen. Des Weiteren werden die im LBA explizit zitierten Werke der Antike herangezogen, u. a. Ovid und natürlich die Bibel.9 Zudem gibt es auch implizit zitierte Werke, die hier ebenfalls berücksichtigt werden müssen, z. B. Plutarch.10 Die Kombination der Werke aus der Antike, der älteren Forschung aus dem 20. Jahrhundert sowie Hintergründe, wie sie z. B. Michel Foucault11 liefert, soll neben der Beantwortung der oben genannten Fragen auch zum Ziel haben, diesen Klassiker der spanischen Literatur in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Besonders hilfreich sind Anders Nygrens Ausführungen zu eros und agape, die – ergänzt durch weitere Standpunkte zu einzelnen Etappen innerhalb der Begriffsgeschichte – einen Einblick in die Entwicklung des christlichen Liebesbegriffs liefern.12 Es gilt zu erläutern, wie platonische Ideen und Werte Einzug in das christliche Gedankengut gefunden haben, wie sie verstanden wurden und wie sie sich v. a. durch Paulus und die Kirchenväter entwickelt haben. So soll gezeigt werden, unter welchen Einflüssen der Erzpriester gestanden haben könnte, als er das LBA verfasste, und wie sich dieser Liebesbegriff bei ihm darstellt. Allerdings sagt uns der Erzpriester ganz deutlich, dass es darum geht, zwischen den Zeilen zu lesen und den „rechten“ Sinn zu verstehen13, wobei es davon abhängt, was die Leser:innen als richtig erachten bzw. was sie suchen – und sie ggf. zum Umdenken zu inspirieren, denn der Erzpriester selbst kennt seine Definition von „richtig“.14
Die Werke eines Gonzalo de Berceo, einer Teresa de Ávila oder San Juan de la Cruz würden sicherlich weitere Vergleichsmöglichkeiten liefern. Dennoch werden diese hier nicht erwähnt, weil es nicht um einen Vergleich mit diesen Werken geht – zumal es immer schwierig zu beurteilen ist, inwieweit ein:e Autor:in des Mittelalters die Werke anderer Autor:innen kannte. Oft lassen sich eklatante Parallelen erkennen, manchmal müssen Ähnlichkeiten mit Mühe herausgefiltert werden. Unterschiede fallen leicht auf, allerdings bleibt dann zuweilen die Frage im Raum stehen, ob es sich um eine absichtlich eingenommene Kontraposition handelt oder ob die Disparität eher zufällig entstanden ist. Darum wurde der Teil, der sich mit Vergleichen zu anderen Werken der Liebeslehre beschäftigt, bewusst kurzgehalten. So werden der Roman de la rose (RR) und De amore (DA) als Beispiele für weitere Darstellungen der weltlichen und geistlichen Liebe herangezogen, in denen Amor und Venus auftauchen und die die Leserschaft, wenn auch zum Teil auf Umwegen, zu unsittlichem Handeln auffordern.
Drei grundlegende Anmerkungen sollen die Lektüre dieser Dissertation erleichtern: Es handelt sich um das absichtliche Umgehen der Bezeichnungen „Autor“ und „Erzähler“, den Gebrauch der Begriffe „Ironie“ und „Humor“ sowie den Ausdruck „Leser:innen“ für das Publikum des Arcipreste.
Die Unterscheidung zwischen „Autor“, „Erzähler“ bzw. „Erzählinstanzen“ kann bei der literaturwissenschaftlichen Analyse eines Werks neue Perspektiven eröffnen. Im LBA erscheint der Erzpriester, der als Autor des LBA bezeichnet wird, einerseits selbst als Erzähler, z. B. wenn er gleich zu Beginn Gott anfleht, er möge ihn aus seinem Gefängnis befreien15. Mit Gérard Genette gesprochen, ist ein Erzähler, der in seiner eigenen Geschichte auftaucht, ein homodiegetischer Erzähler.16 Andererseits gibt sich der Erzpriester in der Endrina- sowie der Garoza-Episode jeweils einen neuen Namen, nämlich Don Melón bzw. Don Polo.17 In beiden Fällen bleibt er aber Ich-Erzähler, also ein intradiegetisch-heterodiegetischer Erzähler18. Im Scholarengesang und in den Blindengesängen sowie dem Klagelied der Kleriker von Talavera müsste man von einem extradiegetisch-heterodiegetischen Erzähler19 sprechen usw. So beinhaltet das gesamte LBA verschiedene Erzählertypen. Die Ausdifferenzierung des jeweils zur Passage passenden Typs wäre zwar möglich, allerdings würde dies vom eigentlichen Thema, der Untersuchung des Liebesbegriffs, ablenken. Daher wird vom „Erzpriester“ bzw. dem „Arcipreste“ gesprochen, ohne auf die jeweilige Unterscheidung nach Genette einzugehen. Lediglich in Kapitel II wird kurz von dieser Vorgehensweise abgewichen, weil das Thema der ggf. biographischen Angaben des Autors im LBA dies notwendig macht.
Der Begriff „Ironie“ wird hier im Sinne der Wortironie (antiphrasis) gebraucht. Wortironie bedeutet nach Uwe Japp, dass ein Sprecher etwas sagt, aber etwas anderes meint und trotzdem – im Gegensatz zur Lüge – verstanden werden will.20 Laut Gerd Althoff und Christel Meier geht diese Definition der Ironie im Gegensatz zur Lüge auf Isidor von Sevilla und Donat zurück.21 Der Erzpriester konfrontiert sein Publikum u. a. mit einer Form der Ironie, wie sie eigentlich erst in der Renaissance zutage tritt: Er vermengt Triviales mit Erhabenem, wie Friedrich Schlegel es bei William Shakespeare gesehen hat.22 Ein Beispiel hierfür findet sich in den Strophen 372-387, die ein Teil der Invektive des Erzpriesters gegen Don Amor sind. Hier wirft der Erzpriester Don Amor vor, er nutze Kirchgänge, um eine Frau zur weltlichen Liebe zu überreden. Psalmenzitate und die Aufzählung von Stundengebeten gemischt mit der Verführungstaktik Don Amors lassen die Ironie hier deutlich werden. Weitere Ironiesignale, derer sich der Erzpriester bedient, sind Unter- und Übertreibung, wie wir sie z. B. in der Garoza-Episode finden23: Zu Beginn dieser Episode beschreibt Trotaconventos Nonnen als durchaus im Überfluss lebende und dem Liebesspiel keineswegs abgeneigte Damen, die ihre Verehrer mit Geschenken, Lebensmitteln aller Art sowie heilenden Kräutern verwöhnen.24 Später wiederum versucht sie, Garoza von ihrem Verehrer zu überzeugen, indem sie ihr aufzeigt, wie elend und entbehrungsreich ein Leben ohne einen Mann an ihrer Seite sei.25
Eng mit der Ironie verbunden, ist der Begriff des „Humors“. Humor wird hier im Sinne des „heitere[n], optimistische[n] Witz[es]“26 sowie als „tolerantes Infragestellen geltender Konventionen“27 gebraucht. Es handelt sich beim Humor, im Gegensatz zur Ironie, nicht um ein Stilmittel, sondern um einen Gemütszustand und eine „variable Schreibweise, die sich verschiedener Techniken des Komischen bedient mit dem Ziel, die Diskrepanz zwischen Eigentlichem und Uneigentlichem auszugleichen“28. Da es sich also um eine Haltung handelt, könnte man sagen, die ironische Schreibweise des Erzpriesters drückt seinen Humor aus.
Man muss davon ausgehen, dass das LBA sowohl (vor)gelesen als auch (in Teilen) als Theaterstück aufgeführt wurde, wie es im Mittelalter üblich war. Um hier aber den Lesefluss nicht unnötig zu stören, wird von den „Leser:innen“ bzw. „Rezipient:innen“ gesprochen, wenn das damalige sowie das heutige Publikum des Erzpriesters gemeint ist.
Zu guter Letzt soll noch ein allgemeiner Hinweis zum Gebrauch des Titels Libro de buen amor gegeben werden: Da es im Spanischen „el libro“ heißt, könnte man im Deutschen von „der Libro de buen amor“ sprechen. Oder man sagt „das Libro de buen amor“ und verwendet dann den deutschen Artikel zu „Buch“. Da zwei der bekanntesten und ältesten deutschsprachigen Forscher:innen über das LBA, Hans Ulrich Gumbrecht und Leo Spitzer, „das Libro de buen amor“ sagen, schließe ich mich dieser Vorgehensweise an.
Nach dieser kurzen Umschreibung des Themas ist es nun an der Zeit, in medias res zu gehen und aufzuzeigen, warum das LBA als ironische, aber doch äußerst ernstgemeinte Interpretation platonischer, paulinischer und augustinischer bzw. patristischer Ideen zu verstehen ist.
IIDie Person des Juan Ruiz und warum ihm Paulus als Vorbild gedient haben könnte
Die Biographie eines Autors, sein Werdegang, seine Erfahrungen, seine Interessen – alle Details, die ihn ausmachen – können Einfluss auf seine Werke nehmen. Auch wenn Juan Ruiz uns nur wenige Hinweise auf sich selbst als Person mitteilt, so erfahren wir doch zwischen den Zeilen einiges, was uns weitere Möglichkeiten eröffnet, das LBA zu interpretieren und zu verstehen. Neben den bereits erforschten Ansätzen und Theorien soll im Folgenden über die „Biographie“ des Autors ein neuer Zugang zum LBA untersucht werden, in der Hoffnung, auf diesem Wege die Facetten des Liebesbegriffs zu erweitern.
II.1„Biographie“ des Juan Ruiz
Der Begriff „Biographie“ steht hier ganz bewusst in Anführungszeichen. Schließlich sind so wenige Details über das Leben des Juan Ruiz bekannt, dass man kaum eine ganze Biographie erstellen könnte. Dennoch wird diese Vokabel hier verwendet, weil nun versucht wird, nähere Einblicke in sein Leben zu gewinnen.
Zunächst soll ein Blick auf die bisherige Forschung die Grundlage dieser Untersuchung bilden. Im Jahr 1965 veröffentlichte Anthony N. Zahareas seine Abhandlung The Art of Juan Ruiz, Archpriest of Hita, in welcher er verschiedene Aspekte des LBA untersuchte, unter anderem Juan Ruizʼ Äußerungen zur weltlichen Liebe, die für diese Dissertation besonders wichtig sind. Es geht ihm aber nicht nur um die Verwendung von Begriffen, sondern er behandelt auch die Frage nach der Identität des Autors bzw. wie es sein kann, dass ein vermeintlicher Geistlicher so deutlich über die weltliche Liebe schreibt. Das Besondere an seinen Ausführungen ist, dass es für ihn nicht nur den Erzähler gibt, sondern er ihn in seinen Doppelrollen als „Erzähler-Liebhaber“ („narrator-lover“1) und „Erzähler-Kommentator“ („narrator-commentator“2) wahrnimmt. Diese Unterscheidung erleichtert die Interpretation des LBA ungemein, indem sie wie eine Art Kompromiss erscheint, die den Erzähler aus zwei Perspektiven zeigt: den Liebenden, der ebenso wie seine Leser:innen den Gesetzen der Natur unterworfen ist und sich seiner Sündhaftigkeit nicht erwehren kann, und den Kommentierenden, der weiß, dass sein Handeln nicht konform mit den christlichen Leitlinien geht und gleichzeitig v. a. auf zum Teil ironische Weise Anleitungen gibt, wie man auf den rechten Weg zurückfinden kann, wenn man sich einmal in die sündige Welt verirrt hat.3 Zahareas gelingt es, die Komplexität wie auch die Komik des LBA auf den Punkt zu bringen: Für die meisten Kritiker:innen ist es der Kontrast zwischen dem Liebenden, der als liebenswürdig, ängstlich und manchmal auch naiv dargestellt wird, und dem Kommentator mit seinen klaren Moralvorstellungen, der sowohl die Vielschichtigkeit als auch die Ironie des LBA ausmacht.4 Zahareas beruft sich u. a. auf María Rosa Lida de Malkiel, wenn er erläutert, dass der Erzpriester die Form des Ich-Erzählers wohl gewählt hat, um Nähe zu den Leser:innen zu schaffen, also um ihnen als Beispiel zu dienen.5 Von einem autobiographischen „Ich“, das auch in überzeichneten Situationen dargestellt wird6, ist demnach eher abzusehen. Spitzer meint, dass der Erzpriester lediglich die Form einer Autobiographie gewählt habe, die Verwendung der 1. Person Singular bedeute aber noch nicht, dass der Erzähler auch wirklich alles erlebt habe, was er schildert.7 Außerdem sagt Spitzer, der Erzpriester folge dem Beispiel der Heiden, die ihre Philosophie in Fabeln versteckten, indem auch er seine Darstellung der rechten Liebe in einem Buch über die törichte Liebe zwischen den Zeilen erläutere.8
Diese Standpunkte dienen der Feststellung, dass wir es mit mehr als einem Autor, einem Erzähler und einem lyrischen Ich zu tun haben. Die Grenzen dieser Begriffe verschwimmen im LBA zu einem Konstrukt, in dem man sich die Frage stellen muss, wer gerade spricht bzw. ob es eine Mischform aus den verschiedenen Rollen gibt. Daher müssen wir also davon ausgehen, dass an der ein oder anderen Stelle doch auch autobiographische Elemente im LBA auftauchen. Die Verbindung aus Dichtung und (eventuell) Biographischem verleiht dem LBA seine besondere Atmosphäre.
Sucht man nach weiteren Hinweisen über den Autor und seine Biographie, stößt man unweigerlich auch auf die Beschreibungen der Kupplerin, die Doña Garoza davon überzeugen sollen, dass es sich lohnt, Don Polo9 zum Geliebten zu nehmen. Die indirekte Selbstbeschreibung des Erzpriesters ist aber wahrscheinlich kein wirklicher Hinweis auf die Person des Autors, ist sie doch eine Auflistung erotischer Merkmale, die noch dazu nicht ein einziges „priesterliches“ Detail erkennen lassen, sodass man wohl davon ausgehen muss, dass der Erzähler nur die sehr konkrete Beschreibung eines für die damalige Zeit besonders attraktiven Mannes dargelegt hat.10
„Don Polo“ ist einer der beiden Namen, die sich der Erzpriester gibt.11 Der erste ist „Don Melón“.12 Warum der Arcipreste ausgerechnet bei den beiden zentralen Episoden jeweils einen anderen Namen wählt, hat zu vielen Diskussionen geführt.13 Zumindest im Fall der Endrina-Episode wissen wir aus sicherer Quelle, dass es sich nicht um eine biographische Begebenheit handelt, schließlich sagt das der Erzpriester selbst in c. 909. Hier erklärt er, er habe die Geschichte von Endrina nur erzählt, um seinen Leser:innen ein Beispiel zu nennen, nicht, weil sie ihm selbst passiert sei. Diese sehr deutliche Aussage lässt keine weiteren Fragen offen. Nun könnte aber noch eine Kleinigkeit bei manchen Leser:innen für Verwirrung bezüglich des Namens- und Personenwechsels gesorgt haben: In den später eingefügten Überschriften14 wird der Protagonist dieser Episode nach wie vor als „Arçipreste“ bezeichnet, z. B. zwischen c. 652 und c. 653 („Aquí dize de cómo fue fablar con Doña Endrina el Arçipreste“) oder c. 870 und c. 871 („De cómo Doña Endrina fue a casa de la vieja e el Arçipreste acabó lo que quiso“). Dass der bzw. ein Kopist hier eventuell mitverantwortlich für die Unklarheiten in der Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler gewesen sein könnte, wurde bisher wohl nicht berücksichtigt. Der Name „Don Polo“, den der Erzpriester in der Garoza-Episode aufbringt, wird in Kapitel V.1.2 näher untersucht.
Jaques Josets Ausführungen aus dem Jahre 1988 liefern weitere, wenn auch nur vage Hinweise auf die Person des Juan Ruiz. Mit Sicherheit kennen wir den Vor- und Zunamen des Autors, welchen Beruf er ausübte und wo er gelebt hat sowie die Jahresangaben 1330 und 1343 aus den Manuskripten Toledo (T) und Salamanca (S).15 Die Erwähnung, dass sich der Autor auf Befehl des Don Gil de Albornoz im Gefängnis befunden habe, entbehrt nach wie vor jeglicher Beweise und wird auch von Joset stark angezweifelt.16 Möglicherweise schrieb er Teile des Werkes, bevor er Erzpriester wurde, z. B. die Endrina-Episode. Joan Corominas und Joset sehen es nämlich durch Erwähnung des Ortes „Fita“ in c. 845a erwiesen, dass sich der Autor hier auf seinen Geburtsort bezieht: Corominas liest aus diesem Vers einen jugendlichen Mut heraus, der ihn annehmen lässt, dass der Autor sich zum Zeitpunkt der Dichtung noch nicht der Kirche und ihren Regeln unterworfen haben könnte17; Joset hingegen glaubt, es handle sich bei der Vorstellung des Verehrers in diesem Vers um einen Fehler in der Pamphilus-Adaption, hält Corominasʼ These aber für durchaus möglich.18 Wiederum andere Forscher:innen behaupten, „Juan Ruiz“ sei lediglich ein Pseudonym19, was weitere Untersuchungen unmöglich machen würde. Allerdings gibt es auch für diese These keine wirklichen Beweise, sodass dieser Vermutung genauso viel bzw. wenig Wahrscheinlichkeit zukommt wie allen Untersuchungen, die die Existenz des Autors namens Juan Ruiz zu beweisen versuchen. Im Jahr 1984 tauchte ein Dokument auf, das auf den ersten Blick eindeutig zu sein schien: Francisco J. Hernández behauptete, im Liber privilegiorium ecclesie Toletane des Madrider Nationalarchivs die Erwähnung eines „Johannes Roderici archipresbiter de Fita“ gefunden zu haben. Es handelt sich bei diesem Schriftstück um ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 1330 und der genannte Johannes Roderici wurde wohl als Zeuge aufgerufen. Hernández versprach zwar, eine ausführlichere Untersuchung zu liefern, diese blieb allerdings aus, sodass auch hier nur spekuliert werden kann, ob es sich bei dem Zeugen um den Autor des LBA handelt.20 Für den Mediävisten und ehemaligen Direktor der Real Academia toledana, Ramón Gonzálvez Ruiz, ist die Nennung dieses Namens im oben genannten Schriftstück bereits ein Beweis für die Existenz des Juan Ruiz, Erzpriester von Hita. Schließlich sei es laut Gonzálvez Ruiz sehr unwahrscheinlich, dass es zwei Erzpriester aus demselben Ort zur selben Zeit mit demselben Namen gegeben habe. Gonzálvez Ruiz erläutert in seinem Aufsatz den Zweck, den das Liber privilegiorum erfüllte. Demnach wurden hier Schiedssprüche festgehalten, die die Vormachtstellung der Kirche demonstrierten. Die Erwähnung des Juan Ruiz, Erzpriester von Hita, als Zeuge in einem derart wichtigen Dokument ist für Gonzálvez Ruiz ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Juan Ruiz sogar als Erzpriester von Hita erkannt werden wollte. Gonzálvez Ruiz beschreibt auch, welche Funktion der Erzpriester von Hita hatte: Damals gehörte Hita zum Erzbistum Toledo, weswegen Juan Ruiz an die toledanische Kirche gebunden war. Er gehörte keinem Orden an, war auch kein Wanderprediger, sondern ein sogenannter weltlicher Kleriker („clérigo secular“), der dem toledanischen Erzbischof unterstand und eine priesterliche Funktion ausübte. Als Historiker und Archivar der Kathedrale von Toledo beschreibt Ramón Gonzálvez Ruiz in dem hier zitierten Artikel die Lebensumstände der Geistlichen im Spanien des 14. Jahrhunderts allgemein. U. a. schildert er, dass weltliche Kleriker nicht an den Zölibat gebunden waren und heiraten durften. Sie profitierten von den Vorteilen, die ein kirchliches Amt bot, ohne dafür alle Pflichten einzugehen. Wer in der klerikalen Hierarchie aufsteigen wollte, musste ab einem gewissen Grad allerdings auf einige weltliche Genüsse verzichten. Des Weiteren beschreibt Gonzálvez Ruiz, welche Rechte und Pflichten das Amt eines Erzpriesters mit sich brachte und wie sich die Kirche um Toledo zu Juan Ruizʼ Zeiten entwickelte. All diese Details zeichnen ein sehr differenziertes Bild von einem Kleriker, der in einer Region, die von jüdischen und muslimischen Einflüssen geprägt war, ein verantwortungsvolles Amt ausgefüllt haben könnte, wobei auch hier betont werden muss, dass Gonzálvez Ruiz lediglich die bisherigen Forschungsergebnisse zur Identität des Autors mit seinen Kenntnissen über die Kirche von Toledo kombiniert, aber keine weiteren konkreten Hinweise auf die Existenz des Autors aufführen kann.21 Emilio Sáez und José Trenchs glaubten, es handelte sich bei dem Autor des LBA um einen gewissen Juan Ruiz (oder Rodríguez) de Cisneros, der ein Bekannter des Don Gil de Albornoz war. Als Sohn des Arias González, eines reichen Mannes aus Palencia, bekleidete er wohl diverse Kirchenämter zwischen 1318 und 1353, allerdings wird an keiner Stelle erwähnt, dass er auch Erzpriester von Hita gewesen sei.22 In den Versen 1733cd des Poema de Alfonso Onceno wird ebenfalls ein „Iohan Rruis, rrico omne de Cisneros“23 erwähnt. Aber auch hier kann nicht mit Sicherheit geklärt werden, ob dieser der Autor des LBA gewesen ist. Joset meint, in c. 326cd des LBA mit dem Ausdruck „el león mazillero“ eine Anspielung auf Alfons X oder Alfons XI zu erkennen24, was ebenfalls ein historiographischer Hinweis wäre und die beiden Personen eventuell in Verbindung bringt.
Der Name „Juan Ruiz“ in dieser oder einer ähnlichen Schreibweise taucht in dieser Zeitspanne öfter auf – bei keinem kann man sicher sein, ob er nun der von den Literaturwissenschaftler:innen gesuchte Autor war oder nicht. Ebenso wenig lässt sich beweisen, ob der von José Filiguera Valverde entdeckte Johannes Roderici (Johan Rodríguez), ein Meistersänger des Klosters Las Huelgas in Burgos, „unser“ Juan Ruiz war.25
Jeder, der sich mit dem LBA beschäftigt, möchte wohl ebenfalls herausfinden, wer Juan Ruiz war. Daher werden bestimmt auch in Zukunft weitere Hinweise über die vermeintliche Existenz seiner Person auftauchen. Z. B. könnte man auch erforschen, ob es sich bei dem Juan, der in der Auflistung der Ordinarii der Diözese der Ciudad Rodrigo aufgeführt wird, um unseren Erzpriester gehandelt haben könnte26, schließlich könnte er dort Ordinarius geworden sein. Außerdem ist es bezeichnend, dass ein gewisser Alfonso de Paradinas im 15. Jahrhundert ebenfalls in Ciudad Rodrigo als Bischof tätig gewesen sein soll.27 Diesen Namen kennen die Leser:innen des LBA als den des Kopisten. Die rein lokale Nähe zwischen dem Kopisten und einem Mann namens Juan aus Rodrigo lassen uns aufmerksam werden. Dennoch erhebt auch diese Beobachtung keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bleibt daher reine Spekulation.
Der Autor beginnt seinen Text mit der Erwähnung einer Gefangenschaft.28 Dieses Gefängnis hat ebenfalls viele Wissenschaftler:innen inspiriert, entsprechende Nachforschungen anzustellen, die leider ohne historisch belegbare Ergebnisse blieben.29 Joset erläutert, dass die Erwähnungen des Gefängnisses in den Versen 1d, 2cd, 3d, 4cd, 5d, 7d, 9cd, c. 10, 1669a, 1671a, 1674e, 1683a und v. a. der Kolophon des Manuskripts S die romantische Legende um die physische Gefangenschaft des Erzpriesters genährt habe, wobei die Angaben zur Dauer der Haft je nach wissenschaftlicher Position zwischen sechs und 30 Jahren variieren.30
Dass hiermit aber auch die Metapher des Liebesgefängnisses gemeint sein könnte, ist ebenfalls eine bekannte und durchaus legitime Position, schließlich war dieses Bild des leidenden Liebenden, der sich in einer aussichtslosen und verzweifelten Situation gefangen sieht, ein beliebter Vergleich in der mittelalterlichen Literatur.31
Nun gäbe es aber auch noch eine weitere Möglichkeit, dieses Gefängnis zu deuten. Es ist unbestritten, dass der Arcipreste gelehrt und v. a. mit biblischen Schriften und Lehren sehr vertraut war. Dass sich der Autor mit den Regeln für die „rechte Liebe“ auseinandersetzt, ist ebenfalls eine unbestreitbare Tatsache. Nun liegt der Verdacht nahe, dass er sich u. a. die Paulusbriefe als Vorlage für die Regeln der guten und der törichten Liebe ausgewählt haben könnte, galten die Schriften des Paulus doch seit jeher als zentrale Texte der christlichen Lehre. So unterrichtet Paulus z. B. in Röm 8,5-8 oder Gal 5,16-23 den Unterschied zwischen geistlicher und fleischlicher Liebe sowie deren Auswirkungen auf den Menschen.
An diesem Punkt lohnt sich ein kurzer Blick auf Teilaspekte der Biographie des Apostels, um die Zusammenhänge zu erläutern, die hinsichtlich der Gefangenschaftsmetapher eine weitere Möglichkeit der Interpretation liefern können, denn es gibt interessante Ähnlichkeiten zwischen dem Erzpriester und dem Apostel Paulus.
II.2Exkurs: Mögliche Parallelen zwischen Paulus und dem Erzpriester
Bei genauerer Betrachtung fallen Ähnlichkeiten zwischen dem Apostel und dem Erzpriester auf. Für Martin Dibelius und Werner G. Kümmel zeichnet sich Paulus unter anderem durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Um seine bzw. Gottes Botschaft zu vermitteln, gleicht er sich seiner jeweiligen Zielgruppe an.1 So heißt es in 1Kor 9,19-22:
Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden – obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin –, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden – obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi –, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.
Sich selbst seinen Leser:innen als einer von ihnen zu präsentieren, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen und sie von der eigenen Meinung zu überzeugen, ist ein Werkzeug, dessen sich auch der Erzpriester bedient. Er stellt sich als Sünder bzw. Gefährdeter dar, um seinem Publikum möglichst nah zu sein, er nennt sich Sünder, erzählt von Liebeskummer und wie schwer es ist, der Versuchung zu widerstehen. So stellt er eine enge Autor-Leser-Verbindung her, vielleicht nach dem Vorbild des Paulus.
Dibelius und Kümmel zufolge prägten drei verschiedene Umstände das Leben des Apostels: Er war zugleich römischer Bürger, hellenistischer Jude und jerusalemischer Schriftgelehrter.2 Einer der Vorteile, die Paulus aus diesem Hintergrund zog, war, dass er als Pharisäer, also besonders gut Gelehrter, die Gegensätze zwischen der jüdischen Welt und der Botschaft Jesu besser verstehen konnte als die Apostel vor ihm. Seine Kenntnisse über das griechische Judentum wiederum gereichten ihm zum Vorteil, da er dadurch sowohl Sprache als auch Denkweisen besser verstand als andere Pharisäer. Laut Dibelius und Kümmel beruht Paulusʼ Erfolg als Prophet des Christentums und Missionar auf diesen beiden Umständen.3 So wie Paulus vom Verfolger zum Verfolgten wurde, also vom „alten“ zum „neuen Weg“ wechselte, verhält es sich vielleicht mit dem Erzpriester: Er scheint zwei Seiten des Lebens zu kennen, nämlich die des Sünders und die des Geistlichen, des Geläuterten, weswegen er es versteht, seinem Publikum die Heilsbotschaft besonders authentisch und mit viel Verständnis für die Fallstricke des Lebens zu vermitteln.
Diese beiden zuletzt genannten Vergleiche zwischen Paulus und dem Erzpriester mögen gewagt klingen, schließlich ist der eine ein Wegbereiter des christlichen Glaubens, der andere ein Autor, der sich dem Thema der Liebe auf fast schon spielerische Art widmet. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass der Erzpriester in seinem gesamten Werk Humor bewiesen hat – warum sollte er dies also nicht auch bei der Wahl seiner Vorbilder bzw. bei dem Selbstvergleich mit ihnen getan haben?
Eine weitere und diesmal weniger gewagte als offensichtliche und für das Christentum typische Gemeinsamkeit zwischen Paulus und dem Erzpriester ist die Dichotomie von Gut und Böse. Diese geht zurück auf den Sündenfall bzw. auf Adams und Evas Vergehen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, in dessen Folge sie u. a. mit der Unterscheidung von Gut und Böse konfrontiert sind.4 Sowohl Paulus als auch der Arcipreste sehen die moralische Welt in Gut und Böse aufgeteilt, dennoch ist der rechte Weg nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Weil dem Erzpriester bewusst war, dass einfache Leser:innen genau hier Verständnisschwierigkeiten haben könnten, geht er auf konkrete Beispiele ein, schildert, wie und wo sich die Sünde versteckt und wie man ihr entgeht, um bei den paulinischen Lehren zu bleiben.
Insgesamt – und das ist eine weitere Gemeinsamkeit – geht es beiden um die Liebe: Paulus erklärt, wie sich die Liebe zwischen Gott und den Menschen ausnimmt, welche Verhaltensregeln unter den Menschen eingehalten werden sollen, um diese liebevolle Verbindung nicht zu gefährden, und erklärt, welche Gefahren einem Christen auf dem Weg zu Gott begegnen. Für Paulus ist die Liebe ein „besserer Weg“ zu Gott als alle Bräuche, die vorher gelebt wurden.5 So bezeichnet er im Hohelied der Liebe die Liebe als sinnstiftend und tragendes Element in der Mensch-Gott-Beziehung, das neben dem Glauben und der Hoffnung alle Zeiten und Zweifel übersteht.6 Die Liebe zu Gott bzw. die rechte Liebe ist auch für den Erzpriester zentrales Thema. Sie ist für ihn ebenfalls essentiell, nur sieht er, wie schwer sie im Alltag manchmal zu finden und auszuleben ist. Auch der Erzpriester erklärt seiner Zielgruppe, wie sie sich zu verhalten hat, nur eben etwas konkreter und an alltäglichen Beispielen, die mit viel Humor und geschickt so formuliert werden, dass man neben der moralischen Lehre auch noch unterhalten wird. So missionieren beide, Paulus und Juan Ruiz, diejenigen, die noch unsicher sind, wie der richtige Weg zu Gott aussieht. In beiden Fällen richten sich die Anweisungen an Personen, die bereits die „richtige“ Richtung eingeschlagen haben, aber noch etwas mehr Anleitung brauchen, d. h. im Falle des Apostels besteht die Zielgruppe aus Gläubigen, die sich bereits (mehr oder weniger) entschieden haben, einen neuen Weg zu gehen7, und auch der Arcipreste spricht wohl christlich orientierte Leser:innen an. Dibelius und Kümmel erläutern, dass Paulus bei der Belehrung seiner neu entstandenen Gemeinden ein Ziel mit vorherigen Missionsgedanken teilt, nämlich Verhaltensregeln zu verbreiten. So halten die Autoren über die von Paulus und seinen Vorgängern missionierten Gemeinden fest, „daß die jungen Christen zwar wissen, daß sie den Willen Gottes tun sollen, aber nicht wissen, welches der Wille Gottes ist“8. Wenn Juan Ruiz mit seiner meist heiteren Erzählweise die Grenzen von guter und törichter Liebe erläutert, scheint es, als verfolge er damit ebenfalls das Ziel, seinem Publikum Orientierungshilfen anzubieten.
Betrachtet man nun all diese Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten zwischen den Schriften des Apostels und dem Arcipreste, liegt der Verdacht nahe, das LBA als eine Art Rezeption der Paulusbriefe zu verstehen. Der Erzpriester widerspricht den paulinischen Lehren an keiner Stelle, er beschreibt sie nur sehr viel humorvoller als der Apostel selbst und ergänzt sie um weitere literarische Quellen, die aber alle letzten Endes der Anleitung zur rechten Liebe dienen.
Zieht man nun in Betracht, dass Ramón Menéndez Pidal das LBA als eine Art Goliardengedicht identifiziert9 und auch Zahreas im LBA v. a. die Äußerung gesellschaftlicher Kritik und Satire als eine der Goliarden verwandten Ausdrucksweise sieht, und die Goliarden sich wiederum – wenn auch auf parodistische Weise – mit den Aposteln verglichen, um in die Welt hinauszuziehen und dort Gottes Wort zu predigen10, könnte man sagen, der Autor des LBA habe sich vielleicht in Anlehnung an den Apostel Paulus als Gefangenen bezeichnet. Es ist bekannt, dass sich der Apostel Paulus tatsächlich in Gefangenschaft befand und einige seiner Briefe dort verfasste. Der Brief an die Philipper beispielsweise enthält Hinweise darauf.11 Auch im Epheserbrief kommt sie zur Sprache, wenn Paulus sich als den „Gefangene[n] Christi Jesu für euch Heiden“12 oder „der Gefangene in dem Herrn“13 bezeichnet. Ebenso heißt es in 2Tim 1,8:
Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes.
Dass es sich bei dem Brief an die Epheser und sowohl dem ersten als auch dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus, die zu den sogenannten Pastoralbriefen gehören, um Pseudepigraphien handelte, ist erst seit dem 19. Jahrhundert bekannt14, daher musste der Autor des LBA noch davon ausgehen, dass diese heute als deuteropaulinische Texte bezeichneten Bibelpassagen15 von Paulus selbst stammten16.
Bei Paulus hat das Gefängnis neben der tatsächlichen Haft die Bedeutung der Bindung an den Glauben. Nicht umsonst bezieht er sich in Eph 4,8 auf Psalm 68,19, wo es heißt: „Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat Menschen Gaben gegeben.“ Der deutsche Text bezeichnet dann zwar auch das Christentum als ein Gefängnis im positiven Sinne; man könnte sagen, Paulus war vom christlichen Glauben gefesselt. Dass diese Gefangenschaftsmetapher für die enge Verbundenheit des Paulus mit seinem Glauben steht, bestätigt auch Ferdinand Staudinger, der in Eph 3,1 im griechischen Originaltext in der grammatikalischen Struktur des Ausdrucks „Gefangener im Herrn“ den Beweis für die „innige Christusverbundenheit des Apostels“17 sieht. Für einen Erzpriester wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn auch er sich dieses Bildes bedienen würde.
II.3Die Gefangenschaftsmetapher – weitere Interpretationsmöglichkeiten
Eine weitere, ganz andere Art der Interpretation wäre folgende: Der metaphorische Gebrauch der Fessel bzw. der Gefangenschaft steht u. a. in der Bibel auch für Gottesferne, wie z. B. in Ps 107,10-161:
Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel,
gefangen in Zwang und Eisen,
weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren
und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten,
sodass er ihr Herz durch Unglück beugte
und sie dalagen und ihnen niemand half,
die dann zum Herrn riefen in ihrer Not
und er half ihnen aus ihren Ängsten
und führte sie aus Finsternis und Dunkel
und zerriss ihre Bande:
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte
und für seine Wunder,
die er an den Menschenkindern tut,
dass er zerbricht eherne Türen
und zerschlägt eiserne Riegel.
Gottesferne und sündhaftes Handeln, das den Menschen an die Welt bindet und damit von der rechten Liebe zu Gott abhält, würden zu den weiteren Lehren des LBA passen, sodass das Gefängnis des Erzpriesters hier als eine Metapher für das unfreiwillige Verhaftetsein in der sündigen Welt gedeutet werden kann. In seinen Gebeten bittet der Erzpriester um Befreiung von Sünden und Versuchungen. Somit müsste man also eigentlich von der Bitte um Befreiung aus dem Sündengefängnis der Welt, nicht vom Eingeschlossensein im Liebesgefängnis oder einer physischen Gefangenschaft sprechen. Diese Idee scheint schlüssig, ist doch das LBA eine ein- und manchmal auch zweideutige Anleitung für das Finden und Leben der rechten Liebe, die sich auf Gott bezieht. Auch die Verse 110ab („Si omne a la muger non la quissiese bien, non ternía tantos presos el amor quantos tien“) könnte sowohl als Anspielung auf das Liebes- als auch auf ein Sündengefängnis hindeuten, das für viele Liebende zum Kerker werden könnte. Auch später im Text findet man das Gefängnis wieder. In einem der das Werk abschließenden Lobgesänge an die Heilige Jungfrau Maria heißt es:
Del mundo salud e vida,
de muerte destrüimiento.
de graçia llena conplida,
de coidados salvamiento:
de aqueste dolor que siento
en presión sin meresçer,
tú me deña estorçer
con el tu defendimiento.2
Hier und in der darauffolgenden Strophe spricht der Arcipreste in seinem Lobgesang an die Heilige Jungfrau von sich selbst als Sünder3 und bittet um Erlösung. Die Nähe der Begriffe „Gefängnis“ („presión“4) und „Sünder“ („pecador“5) lässt vermuten, dass die Theorie des Sündengefängnisses tatsächlich gerechtfertigt sein könnte.6 Vor allem aber die Erwähnung des „gefährlichen Gefängnisses“ („cárcel peligrosa“) in c. 1666 scheint die oben geäußerte Vermutung zusätzlich zu unterstützen. Joset interpretiert diesen Ausdruck als Metapher für das Fegefeuer7, das dem Sünder droht, wenn er sich nicht auf den rechten Weg begibt. An dieser Stelle des LBA bittet der Erzpriester die Heilige Jungfrau mit seinem Ave Maria darum, ihn vor diesem Umstand zu bewahren.8
Da nun die intertextuellen und inhaltlichen Bezüge zwischen dem LBA und biblischen Quellen bereits angesprochen wurden, bleibt zu untersuchen, inwiefern sich die Begriffswahl „buen amor“ und „loco amor“ vielleicht ebenfalls an der Bibel und anderen christlichen Quellen orientiert bzw. warum ausgerechnet „amor“ als Bezeichnung für die Gottesliebe gewählt wurde. Schließlich hätten einem Geistlichen auch andere Begriffe zur Verfügung gestanden, die für die Beschreibung der Gott-Mensch-Beziehung nützlich gewesen wären.
IIIDer Liebesbegriff im Libro de buen amor und im christlichen Kontext
Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der Liebe im LBA sind nach wie vor Gegenstand der Forschung, z. B. beschäftigt sich Michael Rössner mit den unterschiedlichen Übersetzungen des Liebesbegriffs beim Erzpriester und den damit einhergehenden Problemen. Ihm zufolge wird eine eindeutige Übersetzung schon allein deswegen erschwert, weil die neueren Sprachen anders als die Sprachen der Antike nicht zwischen den vier verschiedenen Begriffen für Liebe (eros, agape, amor und caritas) unterscheiden. Die einzig klare Unterscheidung muss laut Rössner aber nicht der Arcipreste treffen:1
Dieses Schwanken zwischen den Polen der reinen Liebe (buen amor) und der Fleischeslust (loco amor) bestimmt die dem Schein nach ambivalente Haltung des Textes, in der der Rezipient selbst über seine Orientierung entscheiden muss.2
Die von Rössner als „scheinbar ambivalente Haltung“ bezeichnete Position wird ebenfalls in den folgenden Kapiteln untersucht. Vorab sei an dieser Stelle festgehalten, dass der Arcipreste eine sehr klare Meinung vertritt, aber auch die Situationen beschreibt, die seinen Rezipient:innen bei der eigenen Positionierung den Blick auf die rechte Liebe versperren könnten. Rössner geht noch weiter, indem er sagt, das LBA handle nicht mehr von der Frage, wie man sich zwischen den möglichen Liebesvarianten entscheidet, sondern es hält fest, dass man sich zu entscheiden hat. Bereits in der Passage im LBA über die Griechen und Römer, die einen Disput über die richtige Deutung der Zeichen führen, demonstriert Juan Ruiz, so Rössner, wie schwierig richtige Interpretationen zu finden sind, v. a. wenn man von unterschiedlichen Bildungsniveaus ausgeht. Der Erzpriester hilft hier den Rezipient:innen, sich in den verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten zurechtzufinden.3
Laut Zahareas handelt das LBA von dem Konflikt zwischen dem Ideal der göttlichen Liebe und der Realität, in der die weltliche Liebe herrscht. Die religiöse Perspektive ist für Zahareas nur eine von vielen Möglichkeiten, Liebe an sich zu definieren. Der Erzpriester scheint sich nicht zu entscheiden, auf welcher Seite er steht: auf der religiösen, die als einzig wahre Liebe die zu Gott gelten lässt, oder auf der weltlichen, in der der Mensch seinen natürlichen Bedürfnissen nachgibt.4
Insgesamt wirkt das LBA unter diesem Gesichtspunkt offen für die Interpretation eines jeden Lesers bzw. einer jeden Leserin. Oder, um das Buch selbst sprechen zu lassen:
De todos los instrumentos yo, libro, só pariente:
bien o mal, qual puntares, tal diré çiertamente;
qual tú dezir quisieres, ý faz punto, ý tente;
si me puntar sopieres sienpre me avras en miente.5
Wer das LBA als eine Anleitung zum sündigen Leben lesen will, findet hier die richtigen Hinweise dazu; wer sich von den Abenteuern des Erzpriesters abgeschreckt fühlt, erkennt wahrscheinlich den richtigen Weg zu Gottes Liebe; und wer der Meinung ist, dass es eine Grauzone zwischen der göttlichen Liebe und der fleischlichen, weltlichen Liebe gibt, der findet im Buch des Erzpriesters eine Art Trost und die Bestätigung, dass er mit dieser Einstellung nicht alleine ist. Somit erweisen sich die einleitenden Sätze des Erzpriesters als wahr: Man muss das LBA zu interpretieren wissen und spielt ganz unbewusst als Leser:in die Hauptrolle, indem man selbst versteht, was man verstehen will.6 Keine der drei oben genannten Interpretationen ist dann falsch, sondern entspricht einfach der eigenen Einstellung, was wiederum für Rössners These spricht. Dennoch erläutert der Arcipreste in aller Deutlichkeit, wo er steht. Er plädiert für die Gottesliebe und appelliert an seine Leser:innen, sich dieser Ansicht anzuschließen.7
Aber woher kommen die diversen Facetten des Liebesbegriffs, auf die der Erzpriester sich in seinem Werk bezieht? Ein Überblick über die Quellen und Liebeskonzeptionen der damaligen Zeit, auf die im LBA Bezug genommen werden, soll diese Frage beantworten. Hierzu zählen u. a. natürlich biblische Texte ebenso wie einige Werke Platons, Ovids und Plutarchs, dessen Dialog über die Liebe bisher wohl noch nicht mit dem LBA in Verbindung gebracht wurde. V. a. in Kapitel IV.2.1.3 wird dieser Bezug sichtbar werden.
Wenn der Erzpriester seinen Leser:innen empfiehlt, sich der Gottesliebe anzuschließen, rekurriert er auf einen Liebesbegriff, dessen Geschichte weit zurückgeht und für dessen Verständnis seine Entstehungsgeschichte genau untersucht werden muss, was im folgenden Kapitel geschieht.
III.1Theorien und Vorstellungen von Liebe im christlichen Kontext
Hört man die Schlagworte eros und agape, denkt man zwangsläufig an die beiden Pole, zwischen denen sich auch die deutsche Minnedichtung bewegt.1 An dieser Stelle muss aber festgehalten werden, dass es sich beim LBA nicht um ein Werk der Minne handelt. Die Verehrung einer höhergestellten Dame ist zwar ein vergleichbares Motiv, und auch, dass der Erzpriester in c. 153 sagt, er widme sich dem Dienst an den Frauen, erinnert an die für die hohe Minne typische Ausdrucksweise, aber die Damen im LBA sind für ihren Verehrer leichter erreichbar, d. h. es gibt durchaus Kontakt zwischen den Figuren. Dies ist für die hohe Minne untypisch, denn die in der hohen Minne besungene Liebe ist fast immer eine entsagende. Dennoch soll nicht ausgeschlossen werden, dass der Erzpriester durch das ein oder andere Werk vielleicht inspiriert wurde. Außerdem – und auch das ist inzwischen schon deutlich geworden – geht es nicht in erster Linie darum, die Liebe einer Frau zu gewinnen, sondern ein gottgefälliges Leben zu führen. Daher ist der Liebesbegriff, der in der klassischen Minne verwendet wird, für das LBA nicht unbedingt ein Vorbild. Hier muss der philosophische und religiöse Werdegang des Begriffs „Liebe“ v. a. im christlichen Kontext untersucht werden, um ihn auf das LBA anwenden zu können.
Sowohl im Deutschen als auch im Spanischen verwenden wir ein und dasselbe Wort für die ideale Verbindung zwischen dem christlichen Gott und den Menschen sowie für die Verbindung unter den Menschen: „Liebe“ bzw. „amor“. Das scheint zunächst unproblematisch. Aber im Falle des LBA und anderer Werke des Mittelalters wie Andreas Capelanusʼ DA wird u. a. implizit thematisiert, wie (absichtlich) verwirrend die Verwendung desselben Begriffs sein kann, wenn man die unterschiedlichen Nuancen der Liebe beschreibt.
Die christliche Begriffsgeschichte kennt eros als eine dieser Nuancen, jedoch wird seine Entwicklungsgeschichte oft nicht berücksichtigt. Anders Nygren hat seine Entstehung 1930 dargelegt und erläutert nicht nur eros bei Platon, sondern auch, wie sich dieser Begriff unter Aristoteles, Plotin und anderen wegweisenden Philosophen sowie Theologen weiterentwickelt hat. Zudem stellt Nygren dem Erosmotiv auch agape gegenüber. Darauf aufbauend erläutert er, wie diese beiden Motive im frühen Christentum und im Mittelalter verwendet wurden und in das christliche Vokabular Einzug nahmen. Weil Nygrens Ausführungen bedeutende Erkenntnisse für die zentrale Fragestellung dieser Dissertation liefern, sollen sie als wichtigste Schritte in der Entwicklungsgeschichte des Liebesbegriffs hier wiedergegeben werden. Unter weiteren Werken zu diesem Thema fiel die Wahl auf Nygren, weil nur bei ihm die beiden für das LBA zentralen Begriffe so deutlich dargestellt werden, er einen detaillierten Einblick in die einzelnen Stufen der Entwicklung liefert und seine Erläuterungen exakt auf den Zeitraum bezogen sind, die für diese Doktorarbeit wichtig sind. Kurze Vergleiche u. a. mit Heinrich Scholz und seinen Ansichten zu eros und caritas, die Hinweise von Alfons Fürst und Holger Strutwolf zu Origenesʼ Interpretation des Hohelieds, Hannah Arendts Erkenntnisse über den Liebesbegriff bei Augustin sowie Beate R. Suchlas Kommentar zu Pseudo-Dionysius sollen das Bild über die Entstehung des christlichen Liebesbegriffs abrunden.
III.2Eros und agape nach Nygren
Zunächst muss gesagt werden, dass laut Nygren die Begriffe eros und agape zwei völlig unterschiedlichen Welten angehören und ein direkter Vergleich deswegen nicht stattfinden kann bzw. sie sich auch nicht gegenseitig ersetzen können. Dennoch übersetzen wir beide Ausdrücke mit „Liebe“, was zu dem Irrtum führt, es gäbe einen Zusammenhang. Der Begriff eros geht auf Platon zurück, agape auf Paulus.1 Wir sehen also schon allein an den Ursprüngen der Begriffe, dass der eine der Philosophie, der andere der Religion entstammt und somit zwei verwandte, aber nicht deckungsgleiche Richtungen aufgemacht werden. Der Untersuchung soll vorausgeschickt werden, dass es sich nicht um eine wertende Gegenüberstellung handelt. Die beiden Begriffe sind gleichberechtigt und nicht höher oder niedriger in irgendeiner Skala anzusiedeln.2
III.2.1Eros
Für Nygren bekommt der Erosbegriff bei Platon seine klare Form. Er erläutert den Ursprung des eros anhand des Zagreusmythos, der wiederum dem Orphismus zugrunde liegt: Zagreus (Dionysos) sollte auf Geheiß seines Vaters Zeus die Welt beherrschen, wird aber von den Titanen gefangen, die ihn verzehren. Aus Rache verbrennt Zeus daraufhin die Titanen und formt aus ihrer Asche den Menschen. Somit lässt sich die Zerrissenheit des Menschen zwischen seinem göttlichen Anteil, den er durch Dionysos erhielt, und der Grausamkeit der Titanen, aus deren Asche er entstand, erklären. Dieser Orphismus gepaart mit der platonischen Anschauung über das zwiegespaltene Wesen des Menschen ist Grundlage des Erosmotivs. Das Göttliche im Menschen sehnt sich stets nach der Wiedervereinigung mit der göttlichen Heimat, der er entstammt, und der Befreiung der Seele von allem Weltlichen, denn der Leib gilt als das Gefängnis der Seele. Eine klare Grenze zwischen den Göttern und den Menschen gibt es nicht, die Seele ist im Grunde ein göttliches Wesen. So kann der Aufstieg gelingen. Charakteristisch für Platon ist hier der Dualismus zwischen der Sinnen- und der Ideenwelt. Der Mensch bewegt sich zwischen diesen beiden Welten und hat auch zu beiden Kontakt, in der die erste die notwendige Vernunfterkenntnis, die zweite die zufällige Wahrnehmung darstellt. Die Ideenwelt erobert die Sinnenwelt mit Hilfe des dem Menschen innewohnenden eros. Der Mensch muss hier als Werkzeug dienen, denn die Ideen sind keine Mächte und können daher nicht selbstständig in die Sinnenwelt eingreifen.1 Und hier wird nun klar, wie eros wirkt:
Das Verhältnis zwischen den beiden Welten ist durchaus einseitig; es gibt nur eine Bewegungsrichtung: von unten – nach oben. Von der Ideenwelt geht keine helfende Aktion aus, die der niederen Welt entgegenkommt. Die Ideen haben keinen Anteil an den Dingen, sondern die Dinge haben Anteil an den Ideen. Wenn der Mensch in den Dingen die Idee ahnt, wird er von Eros, von der Sehnsucht nach der Welt der reinen Ideen, ergriffen. Eros ist die Umkehr des Menschen von dem Sinnlichen zu dem Übersinnlichen. Eros ist die Tendenz der Menschenseele nach oben. Er ist die reale Kraft, die die Seele in die Richtung der Ideenwelt treibt.2
Eros ist also die Verbindung zwischen der Sinnen- und der Ideenwelt und der Mensch ist mit diesem eros gerüstet, um den Ideen zur Macht zu verhelfen. V. a. im Höhlengleichnis verdeutlicht Platon diese Ansicht, indem er schildert, wie der Philosoph sich aus dem Gefängnis des Irdischen befreit und somit die Wahrheit erkennt, statt die Schatten an der Wand seiner Höhle für die einzige Wahrheit zu halten.3
Im Phaidros erläutert Platon, dass die Seele in ihrem präexistenten Dasein das Gute, das Wahre gesehen hat und nun dorthin zurückstrebt, weil sie sich bewusst oder unbewusst daran erinnert. Dieses Streben nach dem Anteil am göttlichen Leben ist eros. Die Seele sieht in der Schönheit der weltlichen Dinge Abbilder des Göttlichen. Das Schöne in der Welt ruft also eros wach, aber die Aufmerksamkeit des Menschen soll in dieser Welt nicht hängen bleiben, sondern die Seele soll aufsteigen.4 In welchen Stadien sie sich erhebt, erklärt Platon im Symposion mit dem Bild der Himmelsleiter, die man erklimmen muss, um das Schöne zu sehen.5 Nygren fasst die drei wesentlichen Punkte des Erosmotivs bei Platon wie folgt zusammen: 1) Eros ist begehrende Liebe, d. h. sie strebt nach dem, was ihr fehlt, und das wiederum ist der glückliche Zustand, in dem sich die Seele einst befunden hat; 2) Eros ist der Weg des Menschen zum Göttlichen – und dies ist auch die einzige Richtung. Die Götter selbst müssen nichts begehren, daher ist eros nur dem Menschen eigen und eine Art Weltflucht; 3) Eros ist egozentrisch, denn alles kreist um den Menschen und seine Seele bzw. um die Frage, wie sie den ersehnten Zustand erreichen kann.6
Hilfreich sind hierbei auch die Erläuterungen, die Heinrich Scholz bietet: Der platonische Begriff der Liebe, eros, bezeichnet demnach ein Streben nach dem Schönen in der Welt und einer damit verbundenen Selbsterhöhung, da man versucht, z. B. einer verehrten und damit hochgeschätzten Person ähnlich zu sein. Die Fähigkeit, das Schöne zu sehen, ist allerdings nur Männern vorbehalten; ebenso können auch nur Männer bzw. Jünglinge oder Knaben Schönheit verkörpern.7
Basierend auf diesen Anschauungen entwickelt Aristoteles seine eigene Definition des Erosmotivs. Aristoteles, so Nygren, erweitert das platonische Erosmotiv um seine kosmische Bedeutung, nach der alles im Kosmos nach oben strebt, d. h. für Aristoteles ist das gesamte Universum von eros geprägt.8
Dieses hellenistische Erosmotiv von Platon und Aristoteles war also den Urchristen bereits bekannt, als sie ihre eigene Definition von Liebe, Gottes Liebe und Liebe unter den Menschen entwickelten. Nygren fragt zunächst, ob man vom Erosmotiv als einem Wegbereiter oder einem Konkurrenten für das christliche Agapemotiv sprechen kann, und beantwortet die Frage unmissverständlich: Er sieht eros als konkurrierendes Motiv gegenüber agape.9
III.2.2Agape
Nachdem im Alten Testament die Gemeinschaft von Gott und den Menschen durch die Befolgung des Gesetzes determiniert ist, d. h. Gott sich den Gerechten zuwendet, erfährt diese Verbindung eine neue Wendung im Neuen Testament, in dem Jesus Christus sagt, Gott wende sich nicht an die Gerechten, sondern an die Sünder (Mk 2,17). Dass es nicht mehr notwendig ist, sich durch die Einhaltung der Gesetze für Gottes Liebe zu qualifizieren, sondern Gott sich dem Menschen spontan und bedingungslos – oder wie Nygren sagt, „unmotiviert“1 – zuwendet, ist eine grundlegende Botschaft des Christentums. Somit wird aus einer Rechtsgemeinschaft eine Liebesgemeinschaft. Diese bedingungslose Liebe Gottes wird agape genannt. Nur Gott allein ist zu einer solchen Liebe fähig, weil sein ganzes Wesen Liebe ist. Der Mensch aber ist zu einer Liebe wie dieser nicht in der Lage, schließlich ist er im Gegensatz zu Gott nicht perfekt. Agape schafft eine Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, sie ist also schöpferisch und wertschaffend.2





























